
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CROCU
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
1800, Joseon (Korea): Die verwaiste sechzehnjährige Seol ist bei der Polizei angestellt und soll einen angesehenen jungen Inspektor bei der Untersuchung des politisch brisanten Mordes an einer Adeligen unterstützen. Während sie immer tiefer in die Geheimnisse der toten Frau eindringen, entwickelt Seol allmählich eine Freundschaft mit dem Inspektor. Ihre Loyalität wird auf die Probe gestellt, als er zum Hauptverdächtigen wird und Seol vielleicht die Einzige ist, die herausfinden kann, was in der Mordnacht wirklich passiert ist. Doch in einem Land, in dem Schweigen und Gehorsam über alles gehen, kann Neugier tödlich sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Eomma und Abba – danke,dass ihr mir den Mut und die Freiheit gegeben habt, meine Leidenschaft fürs Schreiben auszuleben.
Inhalt
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
NACHWORT DER AUTORIN
DANKSAGUNGEN
1
In der Hauptstadt war es totenstill.
Normalerweise herrschte morgens auf der staubigen Straße vor dem Changdeok-Palast reges Treiben: Frauen drängelten sich um Fischstände; Bauern karrten Obst und Gemüse; man traf auf Gelehrte in Seidengewändern und Mönche mit Gebetsperlen um den Hals. Und natürlich wuselte immer eine Schar Kinder umher – mit sonnenverbrannten, in der schwülen Hitze glänzenden Gesichtern –, die entlang der Straße Fangen spielten. Heute jedoch nicht.
»Meint Ihr, an den Gerüchten ist was dran, Wachtmeister Kyŏn?« Laut prasselte der Regen auf die schwarzen Dachziegel. Ich zog mir den Satgat tiefer ins Gesicht, sodass die Tropfen von der Strohspitze aus über die breite Krempe abperlten. »Von wegen, der König sei ermordet worden?«
Die Polizisten stapften weiter, unter ihren Stiefeln schmatzte der Schlamm.
Wachtmeister Kyŏn, der das Schlusslicht bildete und der Jüngste von ihnen war, warf mir einen grimmigen Schulterblick zu. »Hütet Eure Zunge. Hier in der Hauptstadt geht es anders zu als bei Euch auf dem Land.«
Damit spielte er auf die Präfektur Inchon an. Vor ein paar Monaten hatte ich mein Zuhause dort verlassen, um mich in der Hauptstadt zur Damo ausbilden zu lassen – einer Dienerin der Polizei, sozusagen Mädchen für alles.
»Aber, äh, eines kann ich Euch verraten.« Wachtmeister Kyŏn besah sich die graue Umgebung und zog den Stoffgürtel um sein schwarzes Gewand enger. »Als König Chŏngjo starb, kam vom Berg Samgaksan her ein schreckliches Wehklagen, und dann bündelten sich die Sonnenstrahlen und versprühten Funken!«
»Ein Omen?«, flüsterte ich.
»Ein schlechtes. Die alte Ordnung gibt es nicht mehr, und die neue wird von einem Strom aus Blut eingeläutet werden.«
Der König war tot. Nun würde sich unser Leben grundlegend ändern. Das hatte ich erfahren, als ich den Polizisten Reiswein eingeschenkt und dabei ihren Ausführungen über Politik und Verrat gelauscht hatte, die mich oft ganz aufgekratzt zurückließen. Obwohl wir gerade auf Geheiß des Inspektors unterwegs zu einem Tatort waren, konnte ich an nichts anderes denken.
»Da Ihr neu seid, lasst mich Euch etwas über die Hauptstadt erzählen: Hier ist jeder nur auf Macht aus; entweder will man sie an sich reißen oder festigen. Aber was geht das eine Damo an? Für eine Frau quatscht Ihr sowieso zu viel.« Er schnalzte mit der Zunge und scheuchte mich weg.
Ich ärgerte mich ein wenig und ich hielt mich im Schatten hinter ihm. Er hatte natürlich recht – auch wenn ich mich noch nicht als Frau bezeichnet hätte. Ich war schließlich erst sechzehn. Trotzdem wusste ich bereits, dass Geschwätzigkeit zu den sieben Sünden der Frauen gehörte. Für einen Mann war das sogar ein anerkannter Scheidungsgrund.
An meinem unersättlichen Wissensdurst war meine Schwester schuld. Für eine Bedienstete war sie ungewöhnlich belesen und in buddhistischen wie konfuzianischen Lehren bewandert – auch wenn sie stets versucht hatte, das vor mir und den Dorfbewohnern geheim zu halten. Oft hatte ich an ihren langen Ärmeln gezupft und sie darum gebeten, mir mehr darüber zu erzählen, aber sie hatte sich jedes Mal losgerissen und gesagt: »Es ist besser, wenn du nichts von alledem weißt. Falle nicht auf, sei nicht so neugierig, dann wird dir ein langes Leben vergönnt sein, Seol.« Ich hatte ihr das stets verübelt; jetzt allerdings begriff ich, was sie damit gemeint hatte. In letzter Zeit brockte ich mir mit meinem Wissensdurst nichts als Ärger ein.
»Ihr da.«
Ich hob den Kopf. Inspektor Han stand ganz in der Nähe. Er beobachtete mich unter der breiten Krempe seines schwarzen Polizeihutes. Die mit Perlen geschmückte Hutschnur unter seinem Kinn schaukelte in den nassen Böen. Gleich hinter ihm warteten seine Männer, die vor uns am Schauplatz angekommen sein mussten: zwei Wachtmeister, der Gehilfe des Leichenbeschauers, ein Gerichtsschreiber und der Polizeizeichner. Während ich zum Inspektor eilte, blieben die sechs Polizisten, mit denen ich hergekommen war, in Hörreichweite und unterhielten sich leise:
»Wurde von einem Wachmann entdeckt.«
»Wann?«
»Er war gerade am Südtor auf Patrouille, und am Ende seiner Schicht lag sie einfach da.«
Ich faltete die Hände und verbeugte mich vor Inspektor Han – tiefer, als nötig gewesen wäre. Er war einer der wenigen, die es würdig waren, meinen Scheitel zu sehen. Er erinnerte mich an den kräftigen, getupften Leoparden aus meinem Heimatdorf – ein blitzschneller, muskelbepackter Jäger, der klettern und springen konnte wie kaum ein anderer und so lautlos durchs Gras glitt, dass dabei kaum ein Halm zitterte.
»Ihr habt nach mir geschickt, Inspektor.«
»Seht sie Euch an.«
Er zeigte auf die Tote, die ein paar Schritte entfernt lag. Ich trat in den gewaltigen Schatten der Stadtmauer Hanyangs, der Hauptstadt Joseons. Sie war so hoch, dass die Berge dahinter verschwanden, und so dick, dass ein Eindringling tausend Jahre gebraucht hätte, um sich durch die massiven Steinblöcke zu kämpfen. Die Welt dort draußen war gefährlich, doch in der Festung war es offenbar nicht viel sicherer.
Beim Anblick der jungen Frau drehte sich mir der Magen um. Die Arme und Beine von sich gestreckt, lag sie mit dem Gesicht nach unten im Regen, völlig durchweicht. Ihrer Kleidung zufolge musste sie eine Adelige sein: Sie trug ein langes Kleid, dazu eine Jacke aus seidiger Ramiefaser. Ärmel und Kragen waren mit prächtigen Blumenmustern bestickt.
»Dreht sie um«, befahl Inspektor Han. »Wir müssen uns noch ihre Wunde ansehen.«
Ich stieg über die Leiche, ging in die Hocke und packte sie an der Schulter. Genau deswegen beschäftigte die Hauptstadtpolizei Dienerinnen wie mich: Ich war sozusagen der verlängerte Arm der Wachtmeister; durch mich untersuchten sie weibliche Opfer und nahmen Verbrecherinnen fest. Männern war es offiziell verboten, Frauen zu berühren, mit denen sie weder verheiratet noch verwandt waren. Eine ungünstige Komplikation, aber so lautete nun einmal das Gesetz des Konfuzius.
Als ich die Tote auf den Rücken drehte, raschelte ihr wallender Rock, und ich zuckte fast zusammen, als ihr langes, nasses Haar an meinem Ärmel kleben blieb. Bloß nicht schreien.
Ich schloss die Augen. In mir stieg Panik hoch. Nie zuvor hatte ich ein Mordopfer angefasst, schließlich arbeitete ich erst seit ein paar Monaten im Revier. Ich holte tief Luft und zupfte mir die durchweichten Leichensträhnen vom Ärmel, dann zwang ich mich, wieder nach unten zu schauen. Ihr weißer Kragen war voller Blutflecken. Über die bleiche Kehle zog sich eine tiefe, ausgefranste Schnittwunde. Ihre Augen waren trüb. Außerdem klaffte mitten im Gesicht statt der Nase ein blutiges Loch, wie bei einem Totenschädel.
»Man hat ihr die Kehle durchgeschnitten«, stellte Inspektor Han fest. Dann deutete er auf den Zieranhänger mit Quaste, der am Rock des Opfers befestigt war. »Ihr Norigae wurde nicht entwendet; auch die Schmucknadel steckt noch im Haar. Das hier war kein Raubüberfall. Und was ist das da unter der linken Schulter?«
Ich hob sie an. Ein kleines, blutverschmiertes Ziermesser mit Silbergriff …
Erneut wandte ich mich dem Norigae zu. Auf den zweiten Blick fiel mir die zugehörige Hülle auf, die mit einem Zierknoten am Norigae festgebunden war: ein Paedo – oder genauer gesagt nur die Scheide. Meine Hände bewegten sich wie von selbst; ich nahm die Mordwaffe und steckte sie in die mit türkisen Edelsteinen besetzte Hülle.
»Das Messer hat ihr gehört«, flüsterte der Inspektor erstaunt. »Gebt das dem Schreiber.«
Ich tat wie geheißen, verblüfft darüber, dass die Frau mit ihrem eigenen Messer ermordet worden war.
»Und jetzt sucht nach der Kennmarke.«
»Neh.« Ich tastete die Leiche ab, vergrub meine Hand in ihrem Rock und holte schließlich eine gelbe Marke aus Pappelholz hervor. Bei den eingravierten Schriftzeichen handelte es sich vermutlich um den Namen der Trägerin, ihren Geburts- und Wohnort sowie ihren Stand in der Gesellschaft. Sicher war ich mir dessen aber nicht, denn für mich waren Buchstaben nur bedeutungsloses Gekrakel. Hier handelte es sich wahrscheinlich um Hanja – klassische chinesische Schriftzeichen –, die offizielle Schrift des Königreichs. Was hätte es sonst sein sollen? Unsere landeseigene Schrift, Hangul, wies mehr Kreise und gerade Linien auf.
Der Inspektor hielt die Hand auf. Als ich ihm die Marke übergab, sah ich zu ihm hoch, neugierig, wie er wohl auf den Namen reagieren würde, der dort geschrieben stand. Mein Blick blieb an seinem Kinn hängen, denn Vorgesetzten durfte man nicht in die Augen schauen. Ich wusste nicht einmal, welche Farbe sie hatten.
»Fräulein O, Tochter des Kabinettsministers O. Zarte neunzehn Jahre alt.«
Ein Raunen ging durch die Polizisten. »Wie traurig, so jung zu sterben«, sagte einer. »Ich wette, ein Gegenspieler ihres Vaters hat sie auf dem Gewissen. Als Mitglied der Südfraktion hat man einfach zu viele Feinde …«
Während sie weiterspekulierten, schleppte ich die Leiche zu den Wachtmeistern Kyŏn und Goh, die schon mit einer hölzernen Bahre auf mich warteten. Nur mir, der Damo, war es gestattet, Frauenleichen anzufassen.
Ich biss die Zähne zusammen und verdrängte das Stechen in meiner Brust. In den letzten paar Tagen wurden ungewöhnlich viele Tote ins Revier gebracht, meistens Bauern und Bedienstete. Die Polizisten behandelten sie so beiläufig wie geschlachtetes Vieh. Aber das hier war etwas anderes: Das Blut einer Adeligen schockierte alle.
Ich zog noch einmal kräftig, und der ekelhaft-süßliche Gestank des Todes stieg mir in die Nase. Er hätte mich nicht überraschen sollen; schließlich hatte ich zuvor schon Vögel und Hasen mit dem Bogen erlegt, und ich hatte geholfen, sie zu rupfen und abzubalgen. Hier glaubte ich jedoch zu gleichen Teilen Schimmel und verwestes Tier zu riechen. Mit einem letzten Ruck wuchtete ich die Frau auf die Bahre und wich vor dem schrecklichen Gestank zurück.
»Oberwachtmeister Shim, nehmt Kyŏn mit und befragt die Wachen.« Laut schallte Inspektor Hans Stimme über das Prasseln des Regens hinweg. »Alle anderen nehmen sich zuerst die Gastwirtschaften, dann die Häuser vor. Es muss Zeugen geben …« Er hielt inne, dann rief er: »Ihr da.«
Ich richtete mich auf, und der Schlamm triefte von meinen Knien. »Meint Ihr mich?«
Als Inspektor Han auf sein Pferd stieg, warf er mir einen kurzen Blick zu. »Ja, Euch meine ich. Mir nach.«
Ich hastete neben ihm her; die donnernden Hufe bespritzten mir Rock und Ärmel mit noch mehr Schlamm. Die Bürger mussten das Getrappel gehört haben, denn sie hatten sich bereits auf den Boden geworfen und drückten ihre Stirn in den Dreck. So gehörte es sich: Inspektor Han war schließlich nicht nur ein einfacher Aristokrat, sondern außerdem ein Militärbeamter des fünften Ranges. So weit stiegen nur die wenigsten Adeligen auf. Vor einem Mann wie ihm wagte niemand, aufrecht zu bleiben.
Aber vor mir?
Ich war schon als Dienerin geboren und gehörte folglich den Palchŏn an, den »acht niedersten Gesellschaftsgruppen«. Zu unserem Stand gehörten Mönche, Schamanen, Clowns, Fleischer und dergleichen. Auf die eine oder andere Art galten wir alle als unrein.
Trotzdem stellte ich mir vor, die Menschen fielen vor mir auf die Knie.
Meine große Schwester hatte mich oft dafür geschimpft, dass ich mich wie eine chinesische Kaiserin aufführte. Als Kind hatte ich immer lautstark nach Aufmerksamkeit verlangt und war der festen Überzeugung gewesen, mehr zu verdienen: mehr Liebe, mehr Anerkennung, eine freundlichere Behandlung. Wie kam ich als Dienerin nur dazu, so zu denken?
Dabei hätte mich ein solches Leben doch lehren sollen, wie grausam die Welt war – und dass ich eben nichts Besseres verdiente. Noch ehe ich laufen gelernt hatte, war ich dem Tod begegnet. Mein Vater war angeblich verhungert, und obwohl ich das nur aus Erzählungen wusste, träumte ich oft, ich würde seine Rippen zählen. Jahre später hatte sich meine Mutter von einer Kippe gestürzt und war an der felsigen Küste zerschellt. Mit sieben dann hatte ich das junge Fräulein Euna aus dem Hause Nam kalt und steif unter einer Seidendecke vorgefunden. Ich hatte sie stets als Spielkameradin betrachtet, obwohl ich für ihre Familie eigentlich als Magd gearbeitet hatte. Trotzdem hatte ich dieses »Getue einer chinesischen Kaiserin« einfach nicht ablegen können – zumindest bis vor drei Monaten.
Da hatte mich ein Streifenpolizist bei meinem Fluchtversuch aus dem Revier erwischt. Mit Händen und Füßen und unter großem Geschrei hatte ich mich gewehrt, hatte verzweifelt versucht, ihm zu entkommen. An jenem Tag – dem vierten meiner Ausbildung – hatte mich nämlich die Nachricht erreicht, dass sich der Gesundheitszustand meiner Schwester rapide verschlechtert hatte, was mich unter Druck gesetzt hatte, mein Versprechen an sie einzuhalten. Es war schrecklich naiv von mir gewesen, zu glauben, ich könnte entkommen. Die Polizei hatte mir eine gehörige Lektion erteilt. Mit einem heißen Eisen hatten sie mir ein Hanja-Schriftzeichen auf die linke Wange gebrannt: bi. Dienerin. Eine Strafe aus grauer Vorzeit.
Ich fasste mir an die entsprechende Stelle. Wo die Wunde verheilt war, fühlte sich die Haut jetzt dick und rau an.
Während ich Inspektor Han folgte, erinnerte ich mich wieder an den Schmerz von damals – das Gefühl, sterben zu wollen, nicht zu wissen, wie ich diese Demütigung ertragen soll. Mein Todeswunsch war jedoch schnell verflogen. Solange ich eine Aufgabe hatte – den Wunsch meiner Schwester zu erfüllen –, hatte mein Leben einen Sinn.
Bleib in Hanyang, hatte sie mich angefleht. Finde das Grab deines Bruders Inho.
Von seinem Tod waren wir beide überzeugt, denn er hatte mir beim Grab unserer Mutter geschworen, dass er mir schreiben würde, ganz egal, wohin im Königreich es mich verschlagen würde. Und ich hatte ihm geglaubt. Ich kannte ihn. Mein Bruder hielt immer Wort. Doch inzwischen waren zwölf Jahre ohne einen einzigen Brief von ihm vergangen. Er musste also gestorben sein.
Um mir bei der Suche nach ihm zu helfen, hatte mir meine Schwester am Tag, an dem ich zur Hauptstadt aufgebrochen war, eine Zeichnung von ihm mitgegeben. Sie war so krakelig und ausgebleicht, dass ich mich inzwischen nur noch verzerrt an ihn erinnerte. Dennoch verließ ich das Revier nie ohne sie, verwahrte sie immer sicher in meiner Uniform. Ich hatte versprochen, meinen großen Bruder zu finden. Und wie er hielt auch ich stets Wort.
Die Erinnerung verblasste nach und nach; zu abgelenkt war ich vom Labyrinth, das sich durch das Zentrum der Hauptstadt zog – den schmutzigen Straßen und Gässchen zwischen den wilden Ansammlungen aus einfachen Hütten, zusammengeschustert aus Stroh und Holz. Die Passanten, an denen wir vorbeikamen, wichen angsterfüllt zurück. Als wir den nördlichen Bezirk erreichten, wo die hochrangigen Beamten lebten, veränderte sich die Atmosphäre schlagartig. Er befand sich zwischen dem Changdeok-Palast im Osten und dem Gyeongbok-Palast im Westen. Hier waren wir nicht länger von Hoffnungslosigkeit umgeben, sondern von strukturierten Steinmauern und den dunklen Ziegeldächern der benachbarten Villen. Der Regen hatte nachgelassen, und vor dem aufklarenden Himmel zeichneten sich die acht Berggipfel, die Hanyang umringten, wie scharfe Zähne ab.
»Anhalten«, befahl Inspektor Han, als wir vor dem Tor einer ummauerten Villa ankamen. »Wie war noch einmal Ihr Name?«
»Seol, Inspektor«, flüsterte ich.
Es folgte eine Pause, dann: »Na?«
Ich eilte los, band die Zügel an einem Pfosten fest und klopfte an das schwere Holztor. In der nachfolgenden Stille fragte ich mich, wie der Inspektor meinen Namen vergessen haben konnte. War ich denn so nichtssagend? Ich strich mir die Uniform und das rabenschwarze Haar glatt. In der schimmernden Pfütze unter mir spiegelte sich ein schmales Gesicht mit einem breiten Mund und Augen, die ich gern als blütenblattförmig beschreibe. Nicht etwa »Winzäugelchen«, wie meine Schwester sie oft zu nennen pflegte. Wegen meiner eng geschnürten Brust und meinem Körperbau – zu groß, zu schlaksig – wirkte ich eher wie ein Junge im Rock als eine Frau. An mir gab es offenbar wirklich nichts Besonderes. Der Pförtner streckte den Kopf aus dem Torspalt und musterte mich von Kopf bis Fuß; dann fiel sein Blick auf Inspektor Han. Augenblicklich senkte er demütig den Kopf. »Inspektor!«
»Ich bin hier, um mit Herrn O zu sprechen.«
»E… Er hat die Hauptstadt vor einem Monat verlassen.«
»Und wer ist sonst noch zu Hause?«
»Seine Frau, Hausmutter Kim. Aber Ihr müsst ein andermal wiederkommen. Sie ist krank.«
»Es geht um eine äußerst dringliche Angelegenheit.«
Der Pförtner zögerte und rang die Hände, dann machte er schließlich Platz und ließ uns ein. Die Magd, die uns führte, wirkte ebenfalls nervös. Immer weiter folgten wir ihr, hinein in die angespannte Stille, über den Hof bis zum Gästepavillon – einem länglichen Hanok, dessen Längsseite von vierzehn papierbespannten Holzschiebetüren durchbrochen war. Schwere Balken trugen das Ziegeldach, dessen Grate zu den vier Ecken hin ausliefen, geschwungen wie die Barthaare eines Drachens. Ein paar Schritte daneben befand sich ein Tor, hinter dem aller Wahrscheinlichkeit nach ein weiterer Hof lag. Villen wie diese verfügten normalerweise über fünf Bereiche, die durch Steinmauern abgeteilt und nur über schmale Durchgänge miteinander verbunden waren.
Inspektor Han blieb stehen, und ich lief beinahe in ihn hinein. »Befragt Fräulein Os Zofe und erstattet mir über alles Bericht.«
»Ja, Inspektor.« Ich schob die Krempe meines Strohhuts hoch und sah ihm nach, bis sein mitternachtsblaues Gewand verschwunden war. Kurz darauf kam eine Bedienstete mit einem Eimer Wasser vorbei.
»Entschuldigung.« Ich eilte zu ihr hinüber. »Wo finde ich Fräulein Os Zofe?«
Hastig wandte sie mir den Kopf zu und öffnete den Mund. Statt artikuliert zu antworten, gab sie jedoch nur ein leises »Hmm« von sich. Ich interpretierte es so, dass ich ihr folgen sollte. Während sie voraus und ich hintendrein trippelte, schwappte das Wasser unablässig auf den feuchten Boden. Schließlich setzte sie den Eimer unter dem Dachvorsprung ab und führte mich durch das Tor hinter dem Pavillon in den innersten Hof. Dieser Ort war allein Frauen vorbehalten. Männern war der Zugang strikt untersagt; nur die engsten männlichen Familienangehörigen waren von dem Verbot ausgenommen. Die Luft hier fühlte sich ganz anders an: Schwerer kam sie mir vor, erfüllt von einer heiligen Ruhe.
Die Magd zupfte an meinem Ärmel und zeigte auf ein Mädchen mit geflochtenem Haar, das im Freien auf und ab tigerte. Der Regen hatte aufgehört.
»Das ist sie?«
Die Frau nickte.
»Danke.« Ich wandte mich der Zofe zu. Unsere Blicke trafen sich. Mir fiel gleich auf, wie blass sie war; an ihren Schläfen klebten ein paar feuchte Strähnen. Vielleicht war sie krank … oder sie hatte Angst.
Auch sie musterte mich von oben bis unten, begutachtete aufmerksam meine Uniform: die hellgraue Baeja über dem dunkelgrauen Kleid, den Stoffgürtel, den blauen Kragen und die dazu passenden Ärmelaufschläge. Dann blieb ihr Blick am Brandmal auf meiner Wange hängen. »Du bist eine Damo.«
Mit hochrotem Kopf schob ich die Haare über die Narbe. »Ja.«
»Was willst du?«
»Ich komme mit schlechten Nachrichten …« Ich grübelte, wie ich es ihr schonend beibringen konnte – aber es gab einfach keinen zartfühlenden Weg, ihr mitzuteilen, dass jemand ihrer Herrin die Kehle durchgeschnitten hatte. »Deine Herrin ist tot.«
Ich erwartete, dass sie gleich loszittern und in Tränen ausbrechen würde, doch je genauer ich sie beobachtete, desto weniger wurde ich aus ihr schlau. Ich konnte nicht sagen, ob sie traurig war, zu erschüttert, um Gefühle zu zeigen, oder ob sie ihre Emotionen schlichtweg gut verbarg.
»Tot«, wiederholte sie ausdruckslos.
»Tut mir leid.« Ich erzählte ihr, was ich über die Todesumstände wusste, dann schwieg ich kurz und überlegte, wie ich am besten fortfuhr. »Und da du ihre Zofe warst … ist dir bestimmt keine Angelegenheit deiner Herrin entgangen. Sag mir: Wann hat sie das Haus zuletzt verlassen?«
»Das weiß ich nicht. Ich bin früh aufgestanden, um nachzusehen, ob sie gut geschlafen hat, aber ich konnte sie nirgends finden – also habe ich Alarm geschlagen.«
»Verstehe … Hatte sie Feinde?«
Sie schwieg ein wenig zu lange. »Ich habe die Regeln gebrochen.«
Ich befragte sie eigentlich nur, weil Inspektor Han es mir aufgetragen hatte, aber jetzt goss sie Öl ins Feuer meiner Neugier – und Neugier war meine große Schwäche. »Die Regeln?«
»Die Regeln, die allen Bediensteten eingebläut werden.«
Die kannte ich nur allzu gut. Ich habe einen Mund, aber darf nicht sprechen; Ohren, aber darf nicht zuhören; Augen, aber darf nicht hinsehen.
»Hast du etwas gehört oder gesehen?«
»Gesehen. Etwas, das ich nicht hätte sehen sollen.«
»Und was?«
Ihre Antwort ließ lange auf sich warten. Sie starrte eine Weile vor sich hin und schob sich nachdenklich eine Strähne hinters Ohr. »Eines Nachts habe ich gedankenlos die Tür zum Zimmer meiner Herrin aufgeschoben und einen Blick hineingeworfen … und da war ein Fremder. In der Dunkelheit konnte ich ihn nicht genau erkennen – nur dass er ein Mann war. Da ist er aufgesprungen und aus der Hintertür geflüchtet. Der Vorfall war mir so peinlich, dass ich weggerannt bin.«
»Wann war das?«
»Vor einer Woche. Außerdem gab es einen Brief.«
Meine Gedanken rasten. »Du kannst lesen?«
»Meine Herrin hat es mir beigebracht.«
»Und du wolltest es lernen?« Nur die wenigsten Bediensteten waren bereit, etwas zu lernen, selbst wenn sich ihnen die Gelegenheit dazu bot. Denn was nützte es schon, Lesen und Schreiben zu können, wenn man nie dazu kam, sein Wissen anzuwenden?
Ich beobachtete, wie sie ihr Kinn hochreckte, und sagte halb zu mir selbst: »Du willst nicht dienen.«
»Ich war mit meiner Anstellung zufrieden, aber meine Herrin …« Wieder zögerte sie.
»Erzähl es mir ruhig.«
»Meine Herrin hat gesagt: ›Ich glaube nicht daran, dass man als Diener geboren wird. Ich sehe in Euch eine Schwester.‹« Ihre Lippen zitterten kaum merklich und sie sah mir in die Augen. »Warum reden wir überhaupt darüber? Ihr seid doch nur hergekommen, um ihrem Tod auf den Grund zu gehen.«
Ich räusperte mich. In mir brannte noch immer die Neugier. Eine Zofe, die lesen und schreiben konnte, war unerhört – ja ein Skandal sogar. »Und was steht in diesem Brief?«
»Er war kurz. Ich erinnere mich noch gut daran.«
Ich wartete. »Also … was steht darin?«
Sie sah mir unentwegt in die Augen, als wandte sie ihre ganze Willenskraft auf, um nicht wegzuschauen. Dann rezitierte sie mit fester Stimme, als hätte sie es schon unzählige Male getan: »Darin stand: ›Liebste, meine Treue ist so unerschütterlich wie Stein und meine Liebe zu dir nach wie vor unbeirrbar. Zweifle nie daran. Warte auf mich heute Nacht, zur Stunde der Ratte, an unserem üblichen Treffpunkt.‹ Dieser Brief wurde ihr gestern früh zugestellt, vor …«
»… ihrem Tod«, beendete ich den Satz, als das Schweigen anhielt.
»Genau.« Sie streckte den Rücken durch. »Wenn es sonst nichts mehr gibt, wäre ich jetzt bitte lieber allein.«
»Natürlich.« Doch ich konnte mir die Frage nicht verkneifen. »Wie heißt du?«
»Soyi«, antwortete sie und sah mich lange an. Ihre Augen glichen zwei schwarzen Tümpeln, und ich hatte das Gefühl, unter der stillen Oberfläche lauerte etwas. Beim Hinsehen wurde mir unwohl zumute.
»Danke, Soyi.« Ich wandte mich gerade zum Gehen um, aber sie rührte sich nicht vom Fleck – als wäre noch nicht alles geklärt. Ich drehte mich noch einmal zu ihr und fragte: »Und wo ist dieser Brief?«
Diesmal sah sie nicht mich an, sondern den regennassen Boden. »Am Ende folgte noch eine Bitte: ›Verbrenne diese Nachricht.‹«
Die Wolken hingen tief über der nassen Straße. Ich folgte Inspektor Han durch den Schlamm und erstattete ihm Bericht über mein Gespräch mit Soyi. Genauer gesagt sprach ich nicht mit ihm, sondern mit seinen Schultern. Wie uralte Felsformationen wölbten sie sich unter der blauen Seide. Er war erst siebenundzwanzig, wirkte aber viel älter und weiser.
»Und am Ende hat sie mir von einem Brief erzählt, der an Fräulein O adressiert war. Ein Brief von ihrem Liebhaber.« Ich rezitierte ihn Wort für Wort. Als ich fertig war, fügte ich noch hinzu: »Ich habe Zofe Soyi gefragt, wie es kommt, dass sie lesen kann. Sie hat gesagt, Fräulein O habe es ihr beigebracht. Dann haben sich unsere Wege getrennt.«
»Es stimmt, was man sich erzählt: Ihr habt wirklich ein gutes Gedächtnis«, sagte Inspektor Han. »Ihr werdet in Zukunft öfter dabei helfen, Informationen von Frauen einzuholen.«
»Selbstverständlich, Inspektor«, erwiderte ich und konnte meine Aufregung kaum verbergen. Dass ich einem Mann wie ihm von Nutzen sein konnte! »Woran erkennt Ihr, dass jemand nicht die ganze Wahrheit sagt?«
»Warum interessiert Euch das?«
»Ich bin nur neugierig.«
»Neugierig.«
Nur dieses knappe Wort, weiter sagte er nichts. Sein Schweigen hielt an, und allmählich bildete sich in meinem Magen ein unangenehmer Knoten. Sprich nicht ungefragt mit deinem Vorgesetzten, Seol. Wie schwer kann das sein?, hatte mich meine Schwester oft ermahnt. In ihrer Gegenwart war ich ähnlich angespannt gewesen; da war diese schwere Stille, angereichert mit allerhand unausgesprochenen Gedanken.
Als wir vor dem Hauptstadtrevier ankamen, fiel die Anspannung endlich von mir ab. Als ich das respekteinflößende Gebäude mit dem kunstvoll verzierten Pagodentor, den rot bemalten Holzsäulen und den Ziegeldächern zum ersten Mal erblickt hatte, hatte ich es mit dem Palast verwechselt.
»Wenn Ihr lügt, Damo Seol, wie fühlt Ihr Euch da?«, fragte Inspektor Han plötzlich.
Ich brauchte einen Moment, bis mir klar wurde, dass er die Frage nicht rhetorisch meinte. »Sehr nervös, Inspektor.« Genau wie jetzt.
»Angst ist eine starke Emotion. Man kann sie leicht erkennen: an der Art zu sprechen, der Röte der Wangen, den Handgesten.«
Ich dachte an die Augen von Zofe Soyi, diese schwarzen, undurchsichtigen Tümpel. Eine letzte Frage wagte ich noch. »Und was ist mit den Augen, Inspektor?«
»Manchmal schauen Lügner weg. Hat ein Mensch etwas zu verbergen, kann er Blicken oft nicht lange standhalten.«
»Und wenn jemand einen ungewöhnlich intensiv anstarrt?«
Er schwang das Bein über den Sattel und kam – für einen Mann von seiner Größe und Statur – erstaunlich leise auf dem Boden auf. »Es gibt eine besondere Art von Lügner, die einem beim Lügen geradewegs in die Augen schaut. So jemand weiß, wie man manipuliert, wie man die Fäden zieht.«
Ehe ich noch etwas sagen konnte, übergab er die Zügel einem Diener und schritt ins Revier. Ich hingegen blieb davor stehen und sank in mich zusammen; automatisch zog ich Kopf und Schultern ein und faltete die Hände im Schoß. Wann immer ich die unsichtbare Warnung über dem Tor spürte, wurde ich ganz klein: Nimm dich in Acht. Verärgere niemanden. Gehorche stets.
Vorsichtig durchquerte ich das Tor. Im Hof dahinter herrschte reges Treiben. Ein junger Bediensteter mit verdrecktem Gesicht schob einen Wagen mit quietschenden Holzrädern vor sich her; ein paar Mägde trugen Tabletts mit kunstvoll arrangierten Beilagen an ihm vorbei; dann tauchten zwei Männer auf – die Wachtmeister Goh und Kyŏn –, die eine Holzbahre mit einer Leiche transportierten, verborgen unter einer Strohdecke.
»Inspektor Han! Ihr seid zurück!«, rief Kyŏn affektiert.
»Was gibt’s?«
»Der Kommandant verlangt, dass wir Fräulein O in den Untersuchungsraum bringen.«
»Na, dann los.« Inspektor Han blickte über seine Schulter. »Damo Seol, geht ihnen zur Hand.«
Ich starrte die Bahre an, die leblosen grauen Fingerkuppen, die unter dem Stroh hervorlugten. Bleibt mir fern damit, wollte ich am liebsten sagen, doch vor Inspektor Han verkniff ich mir das. Als mir wieder der Todesgeruch in die Nase stieg, rang ich unter seinem erwartungsvollen Blick kurz die Hände, dann zwang ich mich vorwärts – und sei es auch nur, um meine Ergebenheit zu demonstrieren.
Ich folgte den Polizisten in den zugigen Raum. Es roch nach Essig und Verwesung. Auf einem Ständer lag ein aufgeschlagenes Buch, in dem eine anatomische Illustration zu sehen war. Daneben stand ein Tisch voller Werkzeuge: ein Messer, ein Lineal, eine Schüssel, eine Näh- und eine Stecknadel, letztere aus Silber. Mein Blick verweilte auf der Silbernadel. Das letzte Mal, als ich hier gewesen war, hatten sie gerade eine Leiche hereingebracht – zusammen mit Zeugen, die behaupteten, der Mann hätte Gift getrunken. Ich hatte dem Gehilfen des Leichenbeschauers dabei zugesehen, wie er die Nadel zuerst in den Mund und dann in den Anus des Toten eingeführt hatte. Im Falle einer Vergiftung färbte sich die Nadel schwarz.
»He, Damo!«, rief Kyŏn. »Hebt die Leiche auf den Tisch. Der Kopf muss nach Süden, die Füße nach Norden zeigen.«
Als ich die starre Tote anhob, schauderte es mich. Ich hatte schon Menschen getragen, meine Freundin zum Beispiel, wenn ich sie beim Spielen Huckepack genommen hatte, aber ihr Gewicht hatte sich anders angefühlt. Lebendig. Eine Leiche hingegen war nur ein Stück Fleisch. Der Tod wog schwerer. Als ich die Tote endlich auf den Holztisch gehievt hatte, trat ich zurück und wartete ab, bis sich mein Magen wieder beruhigt hatte.
»Gewöhnt Euch besser dran.«
Ich blickte über meine Schulter und stellte fest, dass ich nun mit Wachtmeister Kyŏn allein war. Der andere Wachtmeister war verschwunden. »Neh? An was soll ich mich gewöhnen, Herr?« Ich redete ihn in aller Förmlichkeit an, als wäre er ein hochrangiger Militärbeamter und kein einfacher Wachtmeister – der außerdem kaum zwei Jahre älter war als ich.
»Diese Woche habt Ihr eine Menge Leichen gesehen.« Er nahm das Buch vom Ständer und blätterte durch die Seiten voller Kalligrafie und anatomischer Abbildungen. Bei einer Illustration, die Organe zeigte, hielt er inne. »Kommandant Yi hat die meisten Leichen woandershin schaffen lassen, um die Autopsien zu umgehen. Die verbliebenen wurden in den umliegenden Hügeln beerdigt und die Mörder freigesprochen oder nur milde bestraft. Wisst Ihr, warum?«
Das war keine Fangfrage. Ich war stets aufmerksam, beobachtete alles aus den Augenwinkeln. »Weil die Opfer alle aus den untersten Gesellschaftsschichten stammten.«
Er klappte das Buch zu. Die Staubwolke, die daraus emporwirbelte, tanzte durch einen bläulich-grauen Lichtstrahl. »Kommt näher, dann verrate ich Euch ein Geheimnis.« Zögerlich ging ich ein paar Schritte auf ihn zu, und weil er größer war, musste ich den Hals etwas strecken, als er mir zuflüsterte: »Das waren alles Katholiken.«
Meine Nackenhärchen sträubten sich. »Katholiken …« Ich sprach so leise wie er; das Wort allein klang schon ketzerisch. Die Toten waren also Anhänger der westlichen Lehren gewesen – jener streng verbotenen Lehren. Für so etwas konnte man zum Tode verurteilt werden.
»Weil die Opfer alle Katholiken waren, haben sie niemanden aus dem Revier gekümmert. Der Mord an Fräulein O hingegen …« Wachtmeister Kyŏn schüttelte den Kopf und lachte freudlos auf. »Ihr werdet feststellen, dass dieser Fall Inspektor Han ganz und gar nicht kaltlässt.«
Ich wandte mich Fräulein O zu, deren glasiger Blick an die Decke gerichtet war, und betrachtete das klaffende Loch in ihrem Gesicht. Jemand hatte sie in aller Öffentlichkeit ermordet, obwohl die Patrouille ganz in der Nähe gewesen sein musste. Und trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, hatte sich der Täter noch die Zeit genommen, der Toten die Nase abzuschneiden. Ich trat einen Schritt zurück.
Ich hatte gehofft, Fräulein O wäre das erste und letzte Mordopfer, das ich anfassen müsste. Doch nach allem, was Kyŏn gesagt hatte … Bei den Göttern, erwarteten mich etwa noch mehr?
2
Am nächsten Tag sollte ich im Auftrag eines Schreibers einen Brief zustellen. Ich nahm einen längeren Umweg und fand dabei, wonach ich gesucht hatte. Es hing noch immer an der Lehmmauer des Gasthofs: das Fahndungsplakat des Priesters Zhou Wenmo. Das Strohdach tauchte sein hageres Gesicht in Schatten, und die Augenwinkel wirkten etwas schlaff.
Vor zwei Monaten noch hatte das Porträt einen Mann mit deutlich kleineren Ohren und einem rundlicheren Gesicht gezeigt. Sein Äußeres glich dem zitternden Spiegelbild in einer Pfütze: Es veränderte sich stetig. Niemand wusste, wie er wirklich aussah, und die Zeichner, die ihn porträtierten, waren auf Gerüchte angewiesen.
Nur die Form seiner Augen blieb immer gleich. Es waren die traurigsten Augen, die ich je gesehen hatte.
Ich konnte seinem Blick nicht lange standhalten, ohne dass sich mir die toten Katholiken aufdrängten. Seit dem Tod des Königs musste ich mit ansehen, wie der Tod sich ausbreitete, immer weiter ins Revier vorstieß. Kommandant Yi schien das nicht zu schockieren – er hatte offenbar mit den Morden gerechnet.
Ein Geschwisterpaar, das vom eigenen Vater in eine Lagerhütte gesperrt worden und dort verhungert war. Ein Bediensteter, von seinem Herrn in ein nasses Grab befördert. Ein vermisst gemeldetes Mädchen, das man zuletzt beim Wasserholen am Brunnen gesehen und später leblos unter einem Dornbusch aufgefunden hatte – von der eigenen Tante ermordet. Dann hatte man sieben verbrannte Leichen angekarrt, geborgen aus einer niedergebrannten Hütte, in der sie vorher auf Anweisung einer Adeligen eingesperrt worden waren.
»Jemanden umzubringen ist in diesem Königreich eine schwerwiegende Angelegenheit«, hatte Kommandant Yi gesagt, als er die Mörderin im Revier verhört hatte. »Auch wenn Eure Bediensteten katholische Rebellen waren, allein die Tatsache, dass sie Untertanen Eures Königs sind, hätte Euch davon abhalten sollen, ihnen leichtfertig ein Leid zuzufügen.« Für ein letztes Berufungsverfahren war der Fall dem Justizministerium übergeben worden, doch ich hatte gehört, dass das Urteil längst feststand: Die Ermordung der katholischen Rebellen trug essenziell zum Wohl des Königreichs bei.
Was an dieser katholischen Lehre versetzte die Menschen nur so in Angst und Schrecken, dass sie ihre eigenen Bediensteten, ihre eigenen Kinder umbrachten?
Nachdem ich den Brief des Schreibers an ein Regierungsbüro in der Yukjo-Straße übergeben hatte, das ganz in der Nähe des Gyeongbok-Palastes lag, eilte ich zurück zum Revier, um den Hauptpavillon zu fegen, wie es die Obermagd aufgetragen hatte. Ich holte den Besen, hielt jedoch auf dem Rückweg an und versteckte mich vor der Tür zum Untersuchungsraum. Schon seit gestern wollte ich unbedingt mehr über die Todesumstände von Fräulein O in Erfahrung bringen, doch aufgrund von Polizeiprotokollen und der staatlich vorgeschriebenen Trauerzeit um den König war die Untersuchung auf heute vertagt worden.
Aus dem Raum erklangen ernste Stimmen. Sobald die Luft rein war, schlich ich näher heran und spähte durch den Schiebetürspalt.
Ich sollte nicht hier sein, dachte ich noch, aber die Neugier nagelte mich an Ort und Stelle fest, ebenso wie die brennende Frage: Stand Fräulein Os Tod mit den anderen Morden in Verbindung? Hatte die westliche Ketzerei auch sie das Leben gekostet?
»Der Scheitel und die linke Kopfseite sehen normal aus«, stellte Damo Hyeyeon laut fest. Die Männer, zu denen sie sprach, standen mit dem Rücken zu ihr. Sie beschrieb ihnen, was sie sah – anders durften sie ein weibliches nacktes Opfer nicht untersuchen. »Rechts am Hinterkopf ist eine bohnenförmige Narbe …«
Hyeyeon beschrieb jede noch so banale Kleinigkeit, und die Männer vertrauten voll und ganz auf ihre Beobachtungen. Anders als ich waren Hyeyeon und die anderen Damos hochgebildet und verfügten über umfangreiche medizinische Kenntnisse. Bei der strengen Palastschwestern-Ausbildung waren ihre Noten zu schlecht gewesen, darum hatte man sie zu Damos degradiert. In dieser niederen Position mussten sie nun ausharren, bis sie die medizinische Prüfung bestanden.
Das war in der Tat eine harte Strafe für ein paar schlechte Noten.
Falls Hyeyeon diesen Umstand aber je als ungerecht empfunden hatte, ließ sie es sich nie auch nur im Geringsten anmerken. Nicht einmal, als Kyŏn zu ihr gesagt hatte: »Ein hübsches Gesicht, wären da nicht die Segelfliegerohren«, war sie wütend geworden. Schon mit achtzehn verfügte sie über die Anmut und Reife der hoch angesehenen Palastschwestern, die der Königin dienten.
»Eine Schnittwunde an der Kehle; nichts weist darauf hin, dass der Täter gezögert hat.« Sie sprach immer mit einer solchen Seelenruhe. »Die Nase wurde mit einer Klinge abgeschnitten.« Mit dem Lineal vermaß sie die Wunden und hielt Tiefe, Länge und Breite der Schnitte in Ch’on und P’un fest.
»Die Messerwunde ist tief, wahrscheinlich ist sie daran gestorben«, murmelte der Gehilfe des Leichenbeschauers.
»Dem Zustand des Opfers und anderen Faktoren wie Regen und der Spätsommerhitze zufolge«, erklärte Hyeyeon, »wurde Fräulein O vermutlich um Mitternacht herum ermordet. Am Morgen muss sie also schon einige Stunden tot gewesen sein.«
»Hmm. Dann hätte sich der Mord innerhalb der Ausgangssperre ereignet«, schlussfolgerte der Gehilfe. Damit meinte er die Zeitspanne zwischen elf Uhr nachts und Sonnenaufgang. »Und trotz der Patrouille in der Nähe hat sich der Mörder die Zeit genommen, ihr noch die Nase abzuschneiden. Warum, glaubt Ihr, hat er das getan, Herr?«
Er wandte sich an den Hühnen mit dem breitkrempigen Polizeihut, dessen Augenpartie darunter im Schatten lag. Zu erkennen war nur die lange violette Narbe, die durch den roten entzündeten Ausschlag an seiner Wange senkrecht nach unten verlief. Das war Kommandant Yi.
»Der Mörder hat mit Sicherheit einen tiefen Groll gegen sein Opfer gehegt. Zeigt mir, was sie in der Hand hatte.«
Ich runzelte die Stirn. Was? Sie hatte etwas in der Hand gehabt? Ich erinnerte mich zwar noch an ihre geballte Faust, hatte sie mir aber nicht genauer angesehen.
Ein Schreiber brachte Kommandant Yi ein Holztablett. Darauf lag eine zusammengerollte Schnur, ungefähr so lang wie ein Arm. Während er sie in Augenschein nahm, verrenkte ich mir draußen den Hals, um einen besseren Blick darauf zu erhaschen.
»Wie man sieht, war die Schnur verknotet«, sagte Kommandant Yi. »Inspektor Han vermutet, das war eine Halskette. Vielleicht hat sie der Mörder abgerissen. Ich habe ein paar Beamten aufgetragen, die Gegend nach dem zugehörigen Anhänger abzusuchen, falls es denn einen gibt.«
Unruhe machte sich in mir breit. Am liebsten wäre ich direkt losgerannt, um nach dem Anhänger zu suchen, mit dem man vielleicht den Mörder identifizieren konnte – aber ehe die Neugier mit mir durchging, versprenkelte Hyeyeon Essig und Geläger auf der Toten. Als ich sah, wie die Haut darauf reagierte, klappte mir die Kinnlade herunter: Die Substanz machte alle Verletzungen besser sichtbar; überall kamen violette, gelbe und rote Flecken zum Vorschein. Ich klammerte mich am Türrahmen fest.
»Über ihren Lippen ist ein blauer Fleck in Form einer Hand«, stellte Hyeyeon fest.
»Jemand hat ihr den Mund zugehalten«, folgerte Kommandant Yi.
Vom ersten Tag im Revier an war mein Leben seltsam geworden. Nie wusste ich, wohin ich eigentlich wollte und wo ich letztlich landen würde, und oft streunte ich ziellos durch die Stadt. Jeder endende Tag glich einem ungelösten Fall. Mein Leben war wie ein Knoten, den ich nicht aufbekam – doch immerhin ließ meine Frustration etwas nach, während ich Hyeyeon dabei zusah, wie sie der Leiche ihre Geheimnisse entlockte. Jeder blaue Fleck, jeder Schnitt erzählte eine Geschichte. Fügte man diese Beweisscherben zusammen, kehrte bestimmt der Alltag zurück.
Ich spitzte die Ohren und versuchte, dem gedämpften Gespräch zu folgen. Dann machte sich Hyeyeon daran, den Intimbereich der Toten zu untersuchen, und mir schoss die Röte ins Gesicht. Als sie verkündete: »Sie ist keine Jungfrau mehr«, drehte ich mich weg – und stand plötzlich direkt vor Inspektor Han.
»Was treibt Ihr hier?«
Meine Ohren brannten. »Ich wollte b… bloß gucken. Ich war neugierig, Herr.«
»Neugier scheint bei Euch Dauerzustand zu sein. Wann seid Ihr nicht neugierig?«
Ich zögerte mit meiner Antwort. »Das weiß ich nicht, Herr, ist bisher noch nie vorgekommen.«
Seine Mundwinkel zuckten leicht nach oben. »Sagt mir, Damo: Nach allem, was Ihr gesehen habt – wie kam es Eurer Meinung nach zu diesem Mord?«
»Ich … weiß es nicht, Herr.«
Er nickte. Dann, nach einer kurzen Pause: »Für Mord gibt es normalerweise drei Motive: Leidenschaft, Gier oder Rache. Rache ist von diesen dreien am häufigsten.«
»Das wusste ich nicht«, gestand ich leise.
»Nein, woher auch? Ich wäre nicht überrascht, wenn sie von ihrer Familie oder ihrem Liebhaber umgebracht worden wäre. Aber ich arbeite auch schon so lange im Revier, dass mich kaum mehr etwas überrascht.« Mit einem müden Seufzer zeigte Inspektor Han auf die Tür. »Sagt ihnen, dass ich hier bin, und dann geht.«
Ich informierte Hyeyeon darüber, dass der Inspektor da war, und sie breitete fürs Erste eine Strohdecke über den Leichnam. Sobald er hineingegangen war, lief ich zurück zum Hauptpavillon, nach wie vor mit hochrotem Kopf. Dort fegte ich den weitläufigen Fußboden, und beim repetitiven Zischen des Besens wanderten meine Gedanken wieder zurück zu Fräulein O. Wenn sie keine Jungfrau mehr war, dann musste sie tatsächlich einen Liebhaber gehabt haben. Und vielleicht, dachte ich, wusste dieser Liebhaber mit einem Dolch umzugehen.
Ich pausierte, hielt mich mit beiden Händen am Bambusgriff des Besens fest und stützte mein Kinn darauf ab. Die Nebelschwaden, hinter denen sich die Morgensonne versteckte, waberten durch das offene Tor in den Hof und überzogen die riesigen Holzsäulen und die kalten grauen Steine mit schimmernden Tautropfen. Fast schien es, als stünde das Polizeirevier tief unten auf dem Grund des tosenden Meeres, und zwischen mir und der Welt erstreckte sich ein grenzenloser Raum.
Ich fragte mich, ob so die Unterwelt aussah, in der nun Fräulein O, mein Vater, meine Mutter und mein Bruder ein neues Zuhause gefunden hatten …
»Beeilt Euch! Schneller!«
Die fernen Stimmen rissen mich aus meinen Gedanken. Im Nebel nahm ich verschwommene Silhouetten wahr, die allmählich größer wurden und klare Formen annahmen. Es waren zwei Polizisten, die mit wallenden schwarzen Gewändern durch das Haupttor ins Revier schritten. »Ihr da!«, rief einer. »Wo steckt Inspektor Han?«
»Im Untersuchungsraum.«
Sie eilten an mir vorbei und verschwanden im südlichen Hof.
Offenbar war eine Anzeige eingegangen. Vielleicht war noch eine andere liederliche Dame wie Fräulein O aufgeschlitzt worden, damit die Familienehre gewahrt blieb. Diese Art von Verbrechen kam recht häufig vor, wie ich später erfuhr. Hier in der Hauptstadt war Ehre das höchste Gut; den Adeligen hier war sie noch wichtiger als das Leben selbst. Ich hatte einmal von einem bizarren Fall gehört, in dem sich eine Frau mit der Axt in die Schulter gehackt hatte, nur weil ein fremder Mann sie dort berührt hatte.
Meine Gedanken schweiften umher, während ich mal hier, mal da fegte, auch wenn ich genau genommen einfach nur den Besen hinter mir herzog und große Flächen außer Acht ließ. Der Hausarbeit ging ich selten wirklich motiviert nach – und dem Fegen am wenigsten. Ich hatte Wichtigeres zu tun, als Staubflusen nachzujagen.
Wichtigeres? Ich konnte fast den Rüffel der Obermagd hören. Zum Beispiel, Damo Seol?
Oft mieden wir Damos die Hausarbeit oder führten sie nur halbherzig aus. Einmal hatte die Obermagd Aejung losgeschickt, um Tee zu kochen – wenig später hatte sie die Damo dann im Hof vor der Küche bei einem Nickerchen erwischt, mit einem aufgeschlagenen Medizinbuch im Schoß. Zur Strafe hatte sie Aejung die Waden ausgepeitscht. So verfuhr sie mit jeder Damo, die sich vor ihren Pflichten drückte. Am meisten fürchteten wir jedoch den Zorn der Polizisten.
Als der Boden halbwegs sauber aussah, sodass ich mir keinen Ärger einhandeln würde, schleifte ich den Besen durch den Hof zur Abstellkammer. Plötzlich aber hörte ich hinter mir hastige Schritte und hielt inne.
Es war Wachtmeister Kyŏn. »Was steht Ihr da herum und dreht Däumchen?«
»Mir wurde aufgetragen zu fegen, Herr …«
Er warf mir ein aufgewickeltes Seil zu, das aus fünf Strängen geflochten war. Damit nahm man Verbrecher fest. »Wir brauchen eine Frau. Ihr kommt mit uns mit.«
»Wohin?«
Er antwortete so leise, dass ich ihn kaum verstand. »Zum Berg, zum Inwangsan.«
Schlagartig fühlte sich mein Mund staubtrocken an. Ich leckte mir über die spröden Lippen. Erst jetzt fielen mir sein Bogen und der volle Köcher auf. Vor dem Inwangsan fürchtete ich mich schon, seit ich als Kind zum ersten Mal davon gehört hatte. Dort lebten nämlich die weißen Tiger.
Immer wieder tippte ich mit dem Finger gegen den Besengriff, um die aufkommende Panik im Zaum zu halten. »Was gibt es denn auf dem Inwangsan?«
Er hätte mich dafür zurechtweisen können, unaufgefordert gesprochen zu haben. Stattdessen sagte er nur: »Zofe Soyi ist geflohen.«
Als wir am Nachmittag losritten, herrschte dichter Nebel, aber Inspektor Han hatte einen ausgeprägten Orientierungssinn und führte die zwanzig Polizisten und mich sicher durch Hanyang. Die fünftägige Trauerzeit, die der Königshof verhängt hatte, endete heute. Nun hatten die Geschäfte wieder offen, die Marktschreier priesen in den Ständen ihre Waren an, und Frauen und Männer strömten durch die Straßen.
Bei all dem Trubel hätte mir die Hauptstadt endlich nicht mehr wie eine Geisterstadt vorkommen sollen, doch der Tod lag noch immer schwer in der Luft. Überall um uns herum nur bleiche, ernste Gesichter. Alle waren noch immer in Weiß gekleidet, die traditionelle Trauerfarbe. Der König war tot. Fast schien es, als habe die Winterkälte die Hauptstadt bereits in ihre tödlichen Arme geschlossen. Einzig die Gassenkinder schienen nicht unter diesem Bann zu stehen und wuselten unbekümmert durchs Gedränge.
Wir verließen die Festung durch das Westtor. Die Straße schlängelte sich zunächst durch ein Dorf mit strohgedeckten Hütten und führte dann durch überschwemmtes Grasland. Bis zum Inwangsan war es eigentlich nur ein halbstündiger Ritt, doch ich hatte schon jetzt Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Ich ritt auf einer Ponydame namens Hexe, die für ihre zahlreichen Macken berüchtigt war – ein zähes, störrisches und zänkisches kleines Vieh. Der Anblick ihrer prächtigen, viel schnelleren Kameraden, die vor ihr hergaloppierten, schien in ihr den Wunsch zu wecken, das Gewicht, das sie ausbremste, abzuwerfen – mich. Verzweifelt krallte ich mich an ihr fest und hielt den Blick starr auf die Polizisten gerichtet, voller Angst, sie im Nebel aus den Augen zu verlieren.
Dabei war ich so konzentriert, dass ich kaum etwas von meiner Umgebung mitbekam. In der Ferne zeichneten sich die Berge allmählich deutlicher ab. Die Bäume am Horizont wirkten nicht allzu lange zart: Ehe ich mich’s versah, ragte der Wald hoch und dicht um uns auf. Seine Schatten umfingen uns, als wanderten wir durch eine finstere Albtraumhöhle. Ich kniff mir in die Wangen, damit sie sich röteten, ehe noch jemandem auffiel, wie totenbleich ich war.
»Sucht alles ab. Wenn ihr den Gong hört, kommt gleich hierher zurück«, rief Inspektor Han von der Spitze der Gruppe aus. »Los, teilt euch auf!«
Die Fackelträger ritten voraus und führten uns tiefer in den Wald am Fuße des Bergs. Langsam suchten wir Bäume, klare Bäche, Gebüsch und Dornengestrüpp ab. Überall waberte der Nebel; manchmal brach er aus den zerklüfteten Felsen über uns herein. Mehr als einmal schnappte ich laut nach Luft. Ein Polizist griff erschrocken nach Pfeil und Bogen, doch da lösten sich die Schwaden auch schon wieder auf.
Je länger wir im Wald unterwegs waren, desto weiter schwärmten wir aus, und die Einsamkeit verschluckte mich immer mehr. Meine Fantasie machte aus jedem Geräusch ein Knurren, sei es das Plätschern des Wassers oder das Rauschen des Blutes in meinen Ohren.
Was hatte Zofe Soyi an einen so beängstigenden Ort getrieben? Was hatte sie zu verbergen? Vielleicht fürchtete sie sich einfach mehr vor dem Polizeiverhör als vor Tigern. Zeugen – Unschuldige, die das Pech hatten, mit einem Opfer oder Verdächtigen bekannt zu sein – wurden oft monatelang eingesperrt und im Prozess der Beweisfindung manchmal sogar zu Tode geprügelt.
»Wahrscheinlich hat sie sich in irgendeiner Höhle verkrochen«, mutmaßte Wachtmeister Kyŏn.
Ich ritt näher heran. Als ich ihm zum ersten Mal begegnet war, hatte ich an die legendären königlichen Ermittler aus den Geschichten denken müssen, mit denen ich aufgewachsen war: junge Männer, die vom König verdeckt in entlegene Dörfer entsandt wurden, um dort unfassbare Verbrechen aufzuklären. Das Aussehen dazu hatte er jedenfalls. Das schwarze Haar hatte er sich oben auf dem Kopf zu einem makellosen Knoten gebunden, sodass sein markantes Gesicht gut zur Geltung kam. Er hatte einen ausgeprägten Kiefer und geschwungene, volle Lippen. Dazu kam noch seine sportliche Statur, schlank und muskelbepackt. All das erweckte den Eindruck von Tapferkeit und Ehre.
Inzwischen wusste ich es allerdings besser. Wenn mich Wachtmeister Kyŏn eines gelehrt hatte, dann dass man von der bloßen Körperkraft eines Menschen nicht auf seine Tapferkeit schließen durfte. Da konnten seine Muskeln noch so gestählt sein – Rückgrat hatte er keins. In seinem Herzen war nur Platz für ihn selbst.
Als die Dämmerung das Nebelmeer allmählich dunkelblau färbte, fühlte ich mich an Kyŏns Seite nicht länger sicher, während wir den Hügel hinaufritten. »Es wird spät«, stellte ich fest, in der Hoffnung, er würde die Frage bemerken, die mitschwang: Sollten wir nicht langsam umkehren?
»Habt Ihr die Anweisung des Inspektors nicht gehört? Wir suchen weiter, bis wir den Gong hören.«
Die Stunde der Ratte rückte immer näher. Wenn wir noch länger warteten, schlossen sich die Festungstore, und wir wären ausgesperrt. »Aber wie sollen wir …«
Ein Zweig knackte, viel zu nah für meinen Geschmack. Mit klopfenden Herzen wandte ich mich um. »Habt Ihr das gehört?«, flüsterte ich. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Soyi im Unterholz kauerte, aber vor mein geistiges Auge drängten sich immer wieder Pranken und Reißzähne.
Wachtmeister Kyŏn umklammerte seinen Bogen fester. »Reitet voraus.«
Durch unzählige Baumstämme kamen wir dem Geräusch immer näher. Schließlich umrundeten wir einen großen, moosbewachsenen Stein – und mein Herz beruhigte sich: nur ein Reh. Reglos wie eine Statue beobachtete uns das Tier vom Gebüsch aus.
»Verdammt«, zischte Kyŏn und riss die Zügel herum. »Sie kann nicht weit gekommen sein. Die königlichen Wachen patrouillieren immer um den Berg herum. Sie muss noch in der Nähe sein.«
»Warum ist es dem Inspektor überhaupt so wichtig, Zofe Soyi ausfindig zu machen?«
»Sie ist eine Verdächtige. Zeugen haben gesehen, wie sie die Villa ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie Fräulein O verlassen hat.«
Das erstaunte mich. Ich konnte mir die sanftmütige Soyi kaum mit einem Küchenmesser vorstellen, ganz zu schweigen davon, wie sie damit ihrer toten Herrin die Nase abschnitt.
»Ich werde dieses Miststück finden. Ganz sicher. Während meiner Zeit im Revier habe ich mehr als fünfzig Verbrecher festgenommen. Fast so viele wie Inspektor Han.«
Ich verbiss mir eine Grimasse.
»Was ist denn Euer Ziel im Leben?«, fragte er amüsiert. »Ach, ich weiß schon. Ihr werdet heiraten, Kinder bekommen und weiterhin das tun, was Ihr am besten könnt: Dienen. Eurem Herrn, Eurem Mann, Euren Kindern.« Er tippte sich an die Schläfe. »Ich weiß solche Sachen.«
»Ich möchte nichts von alledem, Herr.«
»Dennoch werdet Ihr dienen. So ist es nun mal, das ist Euer Schicksal.«
Schicksal. Eine Fessel, so hartnäckig wie die Wahrheit. Unveränderlich, unumstößlich. Am Tag meiner Abreise hatte mir meine Schwester gesagt, wie lange mich die Regierung dazu verpflichtet hatte, im Polizeirevier zu dienen, weit weg von Zuhause und Familie. Eine Generation lang, hatte sie geflüstert.
Nahezu mein ganzes Leben.
Mit einundvierzig wäre ich also frei, wenn mir der Tod schon hinterherschlich.
Plötzlich erfüllte ein Sturm aus Flügeln den Himmel; die Vögel ergriffen alle flatternd die Flucht. In der Ferne erklang ein verängstigtes Wiehern. Wachtmeister Kyŏn preschte voran. Ich brauchte eine Weile, bis mir klar wurde, was hier vor sich ging. Ich gab Hexe die Sporen, und wir galoppierten durch das Dickicht über die hervorstehenden Wurzeln hinweg. Zweige schnalzten mir ins Gesicht.
Dann erreichten wir eine Lichtung, und mein Herz setzte einen Schlag aus. Auf der anderen Seite des Bachs stand Inspektor Han, mit blutgetränktem Ärmel, und griff langsam nach dem Schwert an seinem Gürtel. Nur wenige Schritte von ihm entfernt strich ein Tiger umher. Aus seiner schwarz-weiß gestreiften Brust drang ein kehliges Knurren. Seine mächtigen Pranken waren mit scharfen Krallen bewehrt. Die Bestie war so groß wie der Inspektor.
»Nicht bewegen«, sagte er, meinte damit jedoch nicht uns. Hinter dichtem Blattwerk wand sich ein Pferd auf dem Boden und schüttelte den Kopf. Aus der Wunde an seinen Rippen lief ein Strom aus Blut. Und hinter dem Tier kauerte Zofe Soyi.
Ohne den Blick von der Szene abzuwenden, zischte ich Kyŏn zu: »Schießt!«
Der Wachtmeister biss die Zähne zusammen. Offensichtlich ärgerte er sich, dass ein Mädchen es wagte, ihm Anweisungen zu erteilen. Trotzdem zog er einen Pfeil und spannte den Bogen. Mit bebender Eisenspitze nahm er sein Ziel ins Visier. Seine Entschlossenheit bröckelte.
»Lasst mich.« Ich riss ihm die Waffe aus der Hand und ritt hinaus auf die Lichtung, um bessere Sicht auf das Ziel zu haben. Damit zog ich die Aufmerksamkeit des Tigers auf mich. Gut so. Meine Furcht hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht, da durchströmte mich noch ein anderes Gefühl, eine starke Sehnsucht: das Bedürfnis, von Bedeutung zu sein.
Denkt nicht zu viel über Euer Ziel nach, hatte der Mann meiner Schwester mir auf unseren Hasen- und Vogeljagden beigebracht. Zerbrecht Euch den Kopf nicht über das, was sein könnte. Konzentriert Euch nur auf das, was Ihr wollt, und dann schießt.
In einer fließenden Bewegung legte ich an und schoss.
Der Pfeil zischte durch die Luft und traf den Tiger zwischen den Rippen. Sein Brüllen erschreckte mich – mehr noch verängstigte es jedoch Hexe. Sie sprang zur Seite und warf mich dabei fast ab, dann galoppierte sie mit mir in den Wald hinein. Der Tiger stürmte uns hinterher, und sein wütendes Brüllen ging mir durch Mark und Bein. Trotz seiner Verletzung war er beängstigend schnell und holte rasch auf. Ich meinte schon fast zu spüren, wie er seine Reißzähne in meine Schulter schlug.
Ich ließ den Bogen fallen und grub die Fersen in Hexes Rippen. Schneller, na los, schneller! Bitte!
Plötzlich bäumte sich Hexe auf und schleuderte mich durch die Luft. Ich rollte den Abhang hinab, um mich herum ein wilder Wirbel aus Braun und Grün. Etwas zerschnitt mir die Haut. Mein Kopf schlug gegen etwas Hartes, und Schmerz flammte auf. Dann wurde alles dunkel.
Schatten waberten durch meinen Kopf.
Ich saß in einem Boot, das unter dem nächtlichen Himmel über schwarze Wellen glitt. Meine Hände waren frisch gewaschen, und mein ordentlich geflochtenes Haar wurde von einem gelben Stoffband zusammengehalten. Mein Bruder und meine Schwester saßen auf der Holzbank gegenüber.
»Wann sind wir zu Hause?« Ich hatte unendlich viele Fragen. Die Geduld, die mein großer Bruder für mich aufbrachte, hatte die Leute schon immer beeindruckt – die ruhige Art, auf die er seiner vierjährigen Schwester antwortete, nachdem er eingehend über ihre Fragen nachgedacht hatte. Und das in seinem zarten Alter.
»Sobald wir das Meer überquert haben.«
»Warum ist hier so viel Wasser?«
»Weil hier Zehntausende von Flüssen zusammenfließen.«
»Das sind aber viele Flüsse.« Ich blickte hinaus in die endlose Weite und sah nichts als finstere Einsamkeit, durchbrochen nur vom Mond.
»Hör genau hin.« Mein Bruder – mein Orabeoni – lehnte sich über den Bootsrand. »Hörst du das?«
»Was denn?«
»Den Herzschlag im Meer.«
Ich lauschte dem Plätschern der Wellen und beobachtete, wie sich die kleinen Schaumkronen brachen. »Was ist da unten, Orabeoni?«
»Schildkröten, Quallen, Garnelen. Alle möglichen Wesen.«
»Sind die lieb?«
»Ja, sind sie.«
Ich hielt meine Finger in die Wellen, und nach und nach wurde das Land sichtbar, so nah und doch so fern, erleuchtet vom Mond und dem Schein der Laternen. Zuhause kam mir vor wie ein unerreichbares Märchenland. Und als ich mich umwandte, um meinem Bruder genau das zu sagen, war er verschwunden.
Ich wurde von einer Brise geweckt. Erdklümpchen klebten an meinen Wimpern und rieselten mir in die Augen, als ich gen Himmel blinzelte. Es war Nacht. Ich war allein, umgeben von Hunderten uralter Bäume. Mühsam richtete ich mich auf; jeder einzelne Knochen in mir rebellierte. Ein messerscharfer Schmerz zuckte durch meinen Kopf. Ich wartete, bis er nachließ, und sah mich dabei um.
Rechts, links, vorne, hinten. Überall das Gleiche: Felsen, Zweige, raschelnde Blätter.
Ich musste diesem Berg entkommen. Tief hängende Äste und Dornensträucher verfingen sich in meinem Rock, und im Wind schienen die schwankenden Schatten der Bäume nach mir zu greifen. Wie eine Ameise krabbelte ich verzweifelt den Hang hinab: winzig, unbedeutend und verloren in einer Welt der Riesen.
Weiter unten gelangte ich an einen Bach. Ich watete durch das eiskalte Wasser, stieg über gebrochenen Granit und versuchte, meinen Rocksaum trocken zu halten. Dann rutschte ich aus. Mit Händen und Knien landete ich auf den schleimigen Steinen; um mich herum spritzte das eisige Wasser auf. So blieb ich eine Weile auf allen vieren, zu benommen, um mich zu bewegen, und während mir die Kälte in die Knochen kroch, brach eine tiefe Hilflosigkeit über mich herein.
War alles, was ich von mir glaubte – dass ich etwas bedeutete –, nur Einbildung?
Du hast jetzt keine Zeit, zu schmollen. Beweg dich, Seol. Das konnte ich gut.
Ich zog meine Sandalen aus und hüpfte barfuß von Stein zu Stein, aber durch die Tränen, die mir in den Augen brannten, konnte ich kaum klar sehen. Ich sprang zu weit, rutschte an der glatten Steinkante ab und lag wieder im Bach. Die Strömung riss mir die Schuhe aus der Hand. »Nein!«, schrie ich, als sie auf den schwarzen Wellen davonschwammen. Die Sandalen, die meine Schwester für mich geflochten hatte. Das einzige Erinnerungsstück, das mir noch an sie geblieben war.
Na los.
Als ich endlich wieder auf dem Trockenen stand, waren meine Lippen blau, und ich klapperte mit den Zähnen. Wieder tauchte ich zwischen den Bäumen ab. Zweige und Steine piksten mir in die nackten Füße, und die Kälte setzte mir zu. Ich brauchte ein Feuer. Ich dachte an die anderen Bediensteten, die ich damals dabei beobachtet hatte, wie sie mit Steinen Funken erzeugten, aber das hatte ich nie gelernt. Und immer hatte ich den Tiger im Hinterkopf. Der Wind, der durch das Astwerk strich, verwandelte sich in seinen Atem; im Rascheln des Laubs meinte ich das Scharren seiner Krallen zu hören; aus dem Flussbett drang sein Knurren.
Der ganze Berg war ein Tiger, und er hatte Hunger.
So kämpfte ich mich voran, ohne zu wissen, wie spät es war oder in welche Richtung ich lief. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, erblickte ich endlich Licht – Fackelflackern, um genau zu sein. Ich blieb stehen und duckte mich, als die Leute hinter den Bäumen an mir vorbeizogen. Sie hatten einen Ochsen im Schlepptau, der einen Wagen voller Holzkisten zog. Die Fackelträger waren schnell unterwegs. Sie waren zu fünft: Vier hochgewachsene, magere Männer in schmutziger Baumwollkleidung gingen zu Fuß, und in ihrer Mitte ritt ein feiner Herr in Seidengewand und hohem schwarzen Hut. Unter seinem Kinn baumelte eine Schnur mit edlen Perlen, die ihn als Adeligen auswies.
Alle Männer waren mit Knüppeln und Schwertern bewaffnet. Vermutlich Leibwachen … oder Banditen.
Vorsichtig richtete ich mich auf und wollte loslaufen, da aber knackte ein Zweig unter mir. Mit angehaltenem Atem beobachtete ich, wie ein Mann in meine Richtung blickte und den anderen ein schnelles Handzeichen gab. Ohne Vorwarnung rannte ein anderer auf mich zu, den ich nicht bemerkt hatte, und packte mich am Arm. Er grub seine rauen Finger so fest in meine Haut, als wollte er mir den Knochen brechen. Dann zerrte er mich zur Gruppe. Ich konnte kaum laufen. Als er mich losließ, warf ich mich gleich vor dem Reiter in den Dreck. »Gnade, Herr!«
Der feine Herr stieg vom Pferd. Da ich den Kopf unten hielt, sah ich nur seine Lederstiefel neben meiner Hand.
»Steht auf.«
Die Stimme ließ mich aufblicken. Im Sternenlicht sah ich ein längliches Gesicht mit markantem Kiefer und hohen Wangenknochen. Eine Frau!


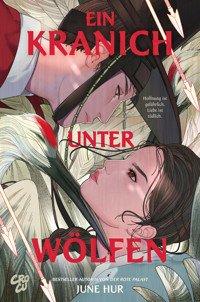
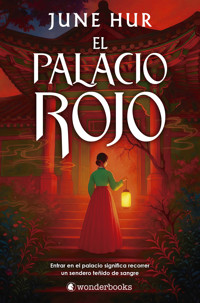













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











