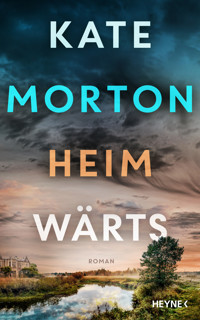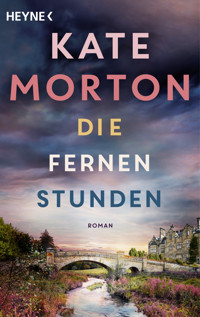9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cornwall 1933: Die sechzehnjährige Alice Edevane fiebert dem prachtvollen Mittsommernachtfest auf dem herrlichen Landgut ihrer Familie entgegen. Noch ahnt niemand, dass die Ereignisse dieser Nacht die Familie auseinanderreißen werden.
Siebzig Jahre später stößt die Polizistin Sadie auf ein verfallenes Haus am See. Und sie erfährt, dass damals ein Kind verschwunden sein soll. Die Suche nach Antworten führt Sadie tief in die Vergangenheit der Familie Edevane, zu einer verbotenen Liebe und tiefer Schuld.
Inklusive ausführliches Bonusmaterial Kate Morton über Cornwall
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 936
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Cornwall 1933: Das Landhaus der Familie Edevane ist geschmückt und bereit für das langersehnte Mittsommernachtsfest. Alice Edevane, sechzehn Jahre alt und angehende Schriftstellerin, ist besonders aufgeregt. Sie hofft, den Mann wiederzusehen, für den sie tiefe Gefühle hegt – und den sie nicht haben kann. Doch als die Uhr Mitternacht schlägt und ein Feuerwerk den Nachthimmel erhellt, ist die Idylle auf dem Anwesen zerstört.
Siebzig Jahre später stößt die Polizistin Sadie beim Joggen im Wald auf ein verlassenes Haus an einem verwunschenen See. Vorsichtig kämpft sie sich durch den verwilderten Garten und späht durch die Fenster. Auf dem verstaubten Tisch steht noch Geschirr, und es sieht so aus, als hätten die Bewohner vor vielen Jahren ihr Zuhause fluchtartig verlassen. Sadie ahnt, dass in diesem Haus etwas Schreckliches passiert sein muss. Eine packende Spurensuche beginnt, die für Sadie ungeahnte Folgen hat …
»Ein großartiger Gesellschaftsroman!« Bunte
Zur Autorin
Kate Morton, geboren 1976, wuchs im australischen Queensland auf, studierte Theaterwissenschaften in London und Englische Literatur in Brisbane. Ihre Romane verkauften sich weltweit in 32 Sprachen und 38 Ländern insgesamt über sieben Millionen Mal. Auch in Deutschland eroberte sie ein Millionenpublikum, alle ihre Romane sind SPIEGEL-Bestseller. Kate Morton lebt mit ihrer Familie in Brisbane, Australien.
Kate Morton
Das Seehaus
Roman
Aus dem Englischen von
Charlotte Breuer und Norbert Möllemann
Von Kate Morton sind im Diana Verlag erschienen:
Das geheime Spiel – Der verborgene Garten – Die fernen Stunden Die verlorenen Spuren – Das Seehaus – Die Tochter des Uhrmachers
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Diana Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 2015 by Kate Morton
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel The Lake House bei Allen & Unwin, Australia
Redaktion: Claudia Krader
Covergestaltung: t.mutzenbach design, München
Covermotive: Shutterstock.com (bogumil; Lukasz Pajor; ZoranKrstic; Mistervlad; J Walters)
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-13999-5V004
www.diana-verlag.de
1
Cornwall, August 1933
Es regnete heftig, und der Saum ihres Kleides war schlammverschmiert. Sie würde es später verstecken müssen. Niemand durfte erfahren, dass sie draußen gewesen war.
Wolken verdeckten den Mond, so viel Glück hatte sie gar nicht verdient. So schnell sie konnte, bewegte sie sich durch die finstere Nacht. Das Loch hatte sie schon am Nachmittag gegraben, aber erst im Schutz der Dunkelheit konnte sie beenden, was sie angefangen hatte. Der Regen tüpfelte das Wasser des Forellenbachs, trommelte erbarmungslos auf die Erde am Ufer. Etwas brach durch das Farndickicht, doch sie zuckte nicht zusammen, blieb nicht stehen. Sie war ihr Leben lang im Wald herumgelaufen, sie kannte den Weg auswendig.
Als es passiert war, hatte sie es gestehen wollen, und anfangs hätte sie es vielleicht sogar getan. Aber sie hatte die Gelegenheit verpasst, und jetzt war es zu spät. Zu viel war geschehen – Suchtrupps, Polizisten, Zeitungsartikel, in denen um Informationen gefleht wurde. Es gab niemanden, dem sie sich anvertrauen konnte, keine Möglichkeit, es wiedergutzumachen, keine Hoffnung auf Vergebung. Nun blieb ihr nur noch, die Beweise zu vergraben.
Sie erreichte die Stelle, die sie ausgewählt hatte. Der Beutel mit der Metallkiste war überraschend schwer. Erleichtert stellte sie ihn ab. Auf Knien entfernte sie die Tarnschicht aus Farnwedeln und Zweigen. Der Geruch nach feuchter Erde, Moos, Pilzen und Fäulnis war überwältigend. Ihr Vater hatte ihr einmal erzählt, dass Generationen von Menschen in diesem Wald gelebt hatten und tief in der schweren Erde begraben lagen. Die Vorstellung hatte ihn froh gestimmt. Er fand Trost in der Beständigkeit der Natur und glaubte, dass die Dauerhaftigkeit der langen Vergangenheit die Kraft besaß, die Kümmernisse der Gegenwart zu lindern. Vielleicht funktionierte das ja auch in manchen Fällen, aber nicht in diesem.
Sie ließ den Beutel in das Loch gleiten. Einen kurzen Augenblick lang lugte der Mond hinter einer Wolke hervor. Tränen drohten, als sie die Erde beiseiteschob, doch sie unterdrückte sie. Zu weinen war ein Luxus, den sie sich versagte. Schließlich klopfte sie die Erde fest, zuerst mit den flachen Händen, dann mit den Füßen, bis sie außer Atem war.
So. Es war vollbracht.
Sie dachte, dass sie vielleicht etwas sagen sollte, ehe sie diesen einsamen Ort verließ. Etwas über den Tod der Unschuld, die tiefe Reue, die sie von nun an begleiten würde. Doch sie tat es nicht. Sie schämte sich für den Gedanken.
Mit schnellen Schritten machte sie sich auf den Rückweg, darauf bedacht, das Bootshaus mit seinen Erinnerungen zu meiden. Es dämmerte bereits und nieselte nur noch, als sie das Haus erreichte. Das Wasser des Sees schlug gegen das Ufer, und die Nachtigallen sangen ihr letztes Lied. Die Grasmücken und die Rohrsänger waren schon aufgewacht, und in der Ferne wieherte ein Pferd. Damals wusste sie es nicht, aber diese Geräusche würden sie ihr Leben lang begleiten. Jenseits von diesem Ort und dieser Zeit würden sie in ihre Träume und Albträume eindringen und sie an das erinnern, was sie getan hatte.
2
Cornwall, 23. Juni 1933
Obwohl man den besten Blick auf den See vom Maulbeerzimmer aus hatte, begnügte Alice sich mit dem Badezimmerfenster. Mr. Llewellyn war zwar noch mit seiner Staffelei unten am Ufer, aber er kam oft früh ins Haus, um einen Mittagsschlaf zu halten, und sie wollte ihm nicht begegnen. Der alte Mann war eigentlich harmlos, aber er war exzentrisch und anlehnungsbedürftig, ganz besonders in letzter Zeit. Sie fürchtete, er könnte falsche Schlüsse daraus ziehen, wenn er sie unerwartet in seinem Zimmer antraf. Alice rümpfte die Nase. Sie hatte ihn unglaublich gern gehabt, als sie noch klein war, und er sie auch. Seltsam, dass sie jetzt daran denken musste. An die Geschichten, die er ihr erzählt hatte, an die kleinen Zeichnungen, die er für sie angefertigt und die sie wie Schätze gehütet hatte, an die wundersame Aura, die ihn umgeben hatte. Jedenfalls lag das Badezimmer näher als das Maulbeerzimmer. Da es nur Minuten dauern konnte, bis ihrer Mutter auffiel, dass in den Zimmern im ersten Stock immer noch keine Blumen standen, fehlte Alice die Zeit, die Treppe hochzulaufen. Vorbei an einer Schar Dienstmädchen, die sich mit Poliertüchern im Flur zu schaffen machten, schlüpfte sie durch die Tür.
Wo war er? Alice zog sich der Magen zusammen, die Aufregung schlug in Verzweiflung um. Die Hände an die Scheibe gedrückt, ließ sie ihren Blick schweifen. Weiße und rosa Rosen, deren Blütenblätter glänzten, herrliche Pfirsiche am Spalier entlang der Gartenmauer, der lange See, der im Morgenlicht silbrig schimmerte. Das ganze Anwesen war perfekt herausgeputzt und hergerichtet. Überall herrschte reges Treiben.
Musiker schoben Metallstühle über die für den Abend aufgebaute Bühne, und während die Lieferwagen des Partyservice beim An- und Abfahren den Staub in der Einfahrt aufwirbelten, blähte sich das zur Hälfte errichtete Festzelt im Wind. Der einzige ruhende Pol in all dem Trubel war Großmutter deShiel, die klein und gebeugt auf der gusseisernen Gartenbank vor der Bibliothek saß. Sie schien so versunken in ihren verstaubten Träumen, dass sie gar nicht mitbekam, wie um sie herum viele runde Lampions in die Bäume gehängt wurden …
Alice sog heftig die Luft ein.
Da war er.
Unwillkürlich breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Überbordende Freude erfüllte sie, als sie ihn auf der kleinen Insel in der Mitte des Sees entdeckte, ein riesiges Holzscheit auf der Schulter. Sie hob eine Hand, um ihm zu winken, der Impuls war spontan und unsinnig, denn er schaute gar nicht zum Haus herüber. Und selbst wenn, hätte er nicht zurückgewinkt. Sie wussten beide, dass sie vorsichtig sein mussten.
Sie tastete nach der Strähne, die sich ständig über ihrem Ohr löste, und begann, sie um ihren Finger zu wickeln. Sie mochte es, ihn heimlich zu beobachten. Es gab ihr ein Gefühl von Macht, das Gegenteil von dem, was sie empfand, wenn sie zusammen waren. Wenn sie ihm im Garten Limonade servierte oder wenn es ihr gelang, sich fortzuschleichen, um ihn bei der Arbeit in weitab gelegenen Randbereichen des Guts zu überraschen. Oder wenn er sich nach ihrem Roman erkundigte, nach ihrer Familie, ihrem Leben, und sie ihm Geschichten erzählte, ihn zum Lachen brachte und Mühe hatte, sich nicht in der Tiefe seiner grünen, mit Gold gesprenkelten Augen zu verlieren.
Er beugte sich vor, hielt kurz inne, um das Gewicht auszutarieren, und legte das Holz dann auf den Stapel. Er war stark, das gefiel ihr. Alice wusste selbst nicht so genau, warum, aber tief in ihrem unerforschten Innern war ihr das wichtig. Ihre Wangen glühten. Ihr war, als würde sie erröten.
Alice Edevane war nicht schüchtern. Sie hatte schon andere junge Männer kennengelernt. Nicht viele natürlich. Bis auf die traditionelle Mittsommerparty, die sie jedes Jahr veranstalteten, waren ihre Eltern äußerst reserviert und blieben am liebsten unter sich. Aber es war ihr hin und wieder gelungen, ein paar verstohlene Worte mit den Jungs aus dem Dorf zu wechseln oder mit den Söhnen der Pachtbauern, die sich die Mütze tiefer in die Stirn zogen und den Blick senkten, wenn sie ihren Vätern auf dem Anwesen folgten. Das jedoch – war vollkommen anders. Sie fand es ziemlich überspannt, und es klang dummerweise genauso wie etwas, das ihre große Schwester Deborah sagen würde, aber es stimmte nun einmal.
Benjamin Munro hieß er. Sie sprach die Silben lautlos aus. Benjamin James Munro, sechsundzwanzig Jahre alt, kürzlich aus London hergekommen. Er hatte keine Familie, arbeitete hart, ein Mann, der keine unnötigen Worte machte. In Sussex geboren und als Sohn eines Archäologen im Fernen Osten aufgewachsen. Er mochte grünen Tee, den Duft von Jasmin und heiße, schwüle Tage, die Regen verhießen.
All das hatte nicht er ihr erzählt. Er war keiner dieser Wichtigtuer, die über sich selbst und ihre Taten schwadronierten, als wäre ein Mädchen nichts weiter als ein hübsches Gesicht zwischen zwei willigen Ohren. Aber sie hatte zugehört, ihn beobachtet und sich ein Bild gemacht. Als sich die Gelegenheit bot, war sie ins Lagerhaus geschlichen und hatte im Lohnbuch des Chefgärtners nachgesehen. Alice hatte immer schon eine gute Spürnase besessen, und prompt hatte sie in Mr. Harris’ Buch hinter einer Seite mit Pflanzplänen Benjamin Munros Bewerbungsschreiben gefunden. Das Schreiben war kurz gehalten, in einer Schrift, die ihre Mutter missbilligt hätte. Alice las es, prägte sich die wichtigen Einzelheiten ein. Sie war ganz erregt davon, wie die Worte dem Bild, das sie sich von ihm gemacht hatte, Farbe und Tiefe verliehen, wie eine zwischen Buchseiten gepresste Blume. Wie die Blume, die er ihr vor einem Monat geschenkt hatte. »Schau mal, Alice.« Der grüne Stiel hatte in seiner starken Hand ganz zart gewirkt. »Die erste Gardenie in diesem Jahr.«
Sie lächelte bei der Erinnerung und langte in ihre Rocktasche, um ihr ledergebundenes Notizbuch zu streicheln. Es war eine Angewohnheit aus ihrer Kindheit, mit der sie ihre Mutter zur Verzweiflung brachte.
Sie machte das schon, seit sie zum achten Geburtstag ihr allererstes Notizbuch bekommen hatte. Wie sie dieses kleine, nussbraune Heft geliebt hatte! Ihr Vater hatte es für sie ausgesucht. Auch er führe Tagebuch, erklärte er Alice mit einem Ernst, der sie tief beeindruckte. Unter dem kritischen Blick ihrer Mutter schrieb sie ihren vollen Namen – Alice Cecilia Edevane – ganz langsam auf das Vorsatzblatt und spürte sofort, dass sie von nun an eine wichtige Person war.
Alice’ Mutter mochte es nicht, wenn Alice ständig ihr Tagebuch streichelte. Es erwecke den Eindruck, sie sei verschlagen und führe irgendetwas im Schilde. Eine Beschreibung, gegen die Alice absolut nichts einzuwenden hatte. Das Missfallen ihrer Mutter war nur ein Bonus. Sie hätte ihr Tagebuch auch dann befingert, wenn Eleanor Edevane nicht die Stirn in Falten gelegt hätte. Sie tat es, weil ihr Tagebuch sie daran erinnerte, wer sie war. Außerdem war es ihr engster Vertrauter und daher eine Autorität in Sachen Ben Munro.
Es war jetzt fast ein Jahr her, dass sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Er kam im Spätsommer 1932 nach Loeanneth, während der herrlichen Trockenperiode, nach all der Aufregung um Mittsommer. In der Zeit, in der man nichts anderes mehr tun konnte, als sich der einschläfernden Hitze zu ergeben. Eine himmlische Trägheit lag über dem ganzen Anwesen. Sogar Alice’ Mutter, im achten Monat schwanger und glühend rot, hatte ihre perlenbesetzten Armbänder abgelegt und die Ärmel ihrer Seidenbluse bis zum Ellbogen hochgekrempelt.
An jenem Tag saß Alice faul auf der Schaukel unter der Trauerweide und grübelte über ihr großes Problem nach. Um sie herum die Geräuschkulisse des Familienlebens – das Lachen von Mr. Llewellyn und ihrer Mutter, begleitet vom trägen Rhythmus der eintauchenden Ruder. Clemmie lief auf der Wiese im Kreis, die Arme ausgebreitet wie Flügel, und führte Selbstgespräche. Deborah berichtete Nanny Rose von den neuesten Skandalen in London. Alice war mit sich selbst beschäftigt und hörte nur das leise Summen der Sommerinsekten.
Seit fast einer Stunde schaukelte sie nun schon vor sich hin. Sie hatte nicht einmal bemerkt, dass sie ihren Federhalter hatte sinken lassen und sich ein schwarzer Fleck auf ihrem weißen Baumwollkleid ausbreitete. Da trat er plötzlich aus dem dunklen Wäldchen auf den sonnenbeschienenen Weg. Er hatte eine Leinentasche geschultert, etwas in der Hand, das aussah wie eine Jacke, und ging mit festen, kräftigen Schritten. Das Geräusch brachte sie dazu, langsamer zu schaukeln. Sie reckte den Hals, um an den Weidenzweigen vorbei seinen Weg verfolgen zu können. Das raue Seil der Schaukel kratzte an ihrer Wange.
Eine Laune der Geografie verhinderte, dass jemand zufällig nach Loeanneth kam. Das Anwesen lag in einem engen Tal, umgeben von dichtem Wald voller Dornengestrüpp, so dicht und düster wie in alten Märchen. Und in Albträumen, aber das wusste Alice damals noch nicht. Es war ihr privater Sonnenplatz, seit Generationen die Heimstatt der deShiels, der Stammsitz der Familie ihrer Mutter. Doch plötzlich befand sich dieser Fremde in ihrer Mitte, und mit einem Mal war der Bann des Nachmittags gebrochen.
Alice war von Natur aus neugierig, ihr Leben lang wurde ihr das schon nachgesagt. Sie betrachtete es als eine Art Kompliment. Es war ein Charakterzug, den sie sich irgendwann zunutze zu machen gedachte. Doch an jenem Tag waren es eher die Langeweile und das Bedürfnis nach Ablenkung, was ihr Interesse weckte. Den ganzen Sommer arbeitete sie bereits fieberhaft an einem Roman über Liebe und Leidenschaft, aber seit drei Tagen kam sie einfach nicht voran. Schuld war ihre Heldin Laura, die sich nach mehreren Kapiteln, in denen ihr tiefgründiges Innenleben geschildert wurde, plötzlich weigerte mitzuspielen. Konfrontiert mit der Einführung eines großen, dunkelhaarigen Gentleman, des schneidigen Lord Hallington, hatte Laura sich von einer geistreichen, scharfzüngigen jungen Frau in eine komplette Langweilerin verwandelt.
Nun, dann würde Laura eben warten müssen, dachte Alice, während sie den jungen Mann beobachtete, der auf das Haus zukam. Sie hatte Wichtigeres zu tun.
Ein schmaler Bach durchquerte leise murmelnd das Anwesen, erfreute sich kurz am Sonnenschein, ehe er rasch wieder im dunklen Wald verschwand. Eine steinerne Brücke, das Vermächtnis eines Ururgroßonkels, überspannte den Bach und erlaubte den Zugang nach Loeanneth. Der Fremde blieb vor der Brücke stehen. Langsam drehte er sich in die Richtung um, aus der er gekommen war, dann schien er etwas in seiner Hand zu betrachten. Einen Zettel? Oder war das eine optische Täuschung? So wie er den Kopf schief legte und den Waldrand betrachtete, hatte es den Anschein, als würde er verschiedene Optionen gegeneinander abwägen. Alice kniff die Augen zusammen. Sie war Schriftstellerin, sie kannte sich mit Menschen aus. Sie durchschaute sofort, wenn jemand verletzlich war. Wovon ließ dieser Mann sich verunsichern, und warum? Er drehte sich erneut um, legte eine Hand schützend an die Stirn und blickte den von Disteln gesäumten Weg zum Haus herauf, das hohe Eiben umringten wie treue Wächter. Er rührte sich nicht, schien kaum zu atmen. Dann stellte er seine Tasche ab, legte seine Jacke darauf, rückte seine Hosenträger zurecht und stieß einen tiefen Seufzer aus.
In diesem Augenblick hatte Alice eine ihrer plötzlichen Erkenntnisse. Sie wusste selbst nicht, woher sie kamen, diese Einblicke in die Gedankenwelt anderer, nur dass sie sich unverhofft einstellten, klar und deutlich waren. Manchmal wusste sie bestimmte Dinge einfach. Zum Beispiel: Er war es nicht gewohnt, an einem solchen Ort zu sein. Aber er hatte eine Verabredung mit dem Schicksal, und auch wenn er am liebsten auf dem Absatz kehrtgemacht hätte, ehe er richtig angekommen war, wollte – konnte – er dem Schicksal nicht den Rücken kehren. Es war eine berauschende These, und Alice spürte, wie die Ideen nur so sprudelten. Gespannt umklammerte sie die Seile der Schaukel noch fester, während sie darauf wartete, was der Fremde als Nächstes tun würde.
Wie erwartet nahm er seine Jacke, schlang sich die Tasche über die Schulter und setzte seinen Weg fort. Eine neue Entschlossenheit sprach aus seinen Bewegungen, und allen, die es nicht besser wussten, erschien er wie ein resoluter Mann, der eine unkomplizierte Aufgabe vor sich hatte. Alice gestattete sich ein selbstzufriedenes Lächeln, doch dann traf es sie mit solcher Wucht, dass sie beinahe von der Schaukel gefallen wäre. In dem Augenblick, als sie den Tintenfleck auf ihrem Kleid wahrnahm, wusste sie die Lösung für ihr großes Problem. Plötzlich sah sie es klar und deutlich vor sich. Laura, konfrontiert mit dem faszinierenden Fremden und ebenfalls mit einer besonderen Wahrnehmung begabt, würde die Fassade des Mannes durchschauen, sein schreckliches Geheimnis entdecken, seine schuldbeladene Vergangenheit. In einem stillen Moment, wenn sie Zeit für sich allein hatte, würde sie flüstern …
»Alice?«
Im Badezimmer von Loeanneth erschrak Alice so heftig, dass sie sich die Wange am Fensterrahmen stieß.
»Alice Edevane! Wo bist du?«
Sie fuhr zu der geschlossenen Tür herum. Die süßen Erinnerungen an den vorigen Sommer, an die aufregende Zeit der Verliebtheit, die ersten Tage ihrer Beziehung mit Ben und das berauschende Gefühl, Schreibstoff im Überfluss zu haben, zerbröckelten um sie herum. Der bronzene Türknauf wackelte kaum merklich im Rhythmus der sich schnell nähernden Schritte. Alice hielt die Luft an.
Ihre Mutter war seit einer Woche ein einziges Nervenbündel. Typisch. Sie war keine geborene Gastgeberin, aber die Mittsommerparty gehörte zu den Traditionen der Familie deShiel. Sie wurde außerdem Alice’ Großvater Henri zu Ehren abgehalten, den ihre Mutter sehr verehrt hatte. Es war jedes Jahr ein Theater, aber diesmal war es besonders schlimm.
»Ich weiß, dass du hier bist, Alice. Deborah hat dich gerade gesehen.«
Deborah: große Schwester, großes Vorbild, Hauptfeindin. Alice knirschte mit den Zähnen. Als wäre es nicht genug, die berühmte und gefeierte Eleanor Edevane zur Mutter zu haben, hatte das Pech ihr eine ältere Schwester beschert, die fast genauso perfekt war. Schön, klug, verlobt mit dem begehrtesten Junggesellen der Saison … Gott sei Dank gab es noch Clementine, ihre jüngere Schwester, die ein derart seltsames Geschöpf war, dass sogar Alice im Vergleich halbwegs normal wirkte.
Während ihre Mutter mit Edwina im Schlepptau den Flur entlanggestürmt kam, öffnete Alice das Fenster und hielt ihr Gesicht in die warme Brise, die nach frisch gemähtem Gras und Meersalz duftete. Edwina war die Einzige, die Alice’ Mutter in diesem Zustand ertragen konnte, und die war ein Golden Retriever, also zählte das eigentlich nicht. Selbst ihr armer Vater war bereits vor Stunden auf den Dachboden geflüchtet, wo er es zweifellos genoss, mit seinem großen Werk über die Naturkunde allein zu sein. Das Problem war, dass Eleanor Edevane eine Perfektionistin war und jedes Detail der Mittsommerparty ihren hohen Ansprüchen genügen musste. Insgeheim wurmte es Alice, dass sie den Erwartungen ihrer Mutter so ganz und gar nicht entsprach – auch wenn sie das seit Jahren unter dem Mantel der Gleichgültigkeit zu verbergen versuchte. Sie hatte sich im Spiegel betrachtet und war schier verzweifelt über ihren zu hoch aufgeschossenen Körper, ihr ungefälliges, mausbraunes Haar und die Tatsache, dass sie die Gesellschaft fiktiver Personen Menschen aus Fleisch und Blut vorzog.
Doch das war vorbei. Alice lächelte, als Ben ein weiteres Scheit auf den Stapel wuchtete, der sich allmählich zur Größe eines Scheiterhaufens auftürmte. Sie mochte vielleicht nicht so charmant sein wie Deborah und nicht unsterblich wie ihre Mutter, die die Heldin eines beliebten Kinderbuchs war, aber das spielte keine Rolle. Sie war eben anders. »Du bist eine Geschichtenerzählerin, Alice Edevane«, sagte Ben an einem Spätnachmittag zu ihr, als sie am Bachufer gesessen hatten und die Tauben zum Schlafen heimgekehrt waren. »Ich habe noch nie jemanden mit einem derart ausgeprägten Einfallsreichtum kennengelernt.« Seine Stimme klang sanft, und sein Blick war intensiv. In jenem Moment sah Alice sich mit seinen Augen, und was sie sah, hatte ihr gefallen.
Die Stimme ihrer Mutter flog an der Badezimmertür vorbei, irgendetwas über Blumen, die in den Zimmern fehlten, und verschwand dann um die Ecke. »Ja, liebste Mutter«, murmelte Alice voller köstlicher Herablassung. »Kein Grund, aus der Hose zu springen.« Der Gedanke an Eleanor Edevanes Unterhose hatte etwas herrlich Frevlerisches, und Alice musste die Lippen zusammenpressen, um nicht laut loszulachen.
Nach einem letzten Blick in Richtung See schlüpfte sie aus dem Bad und schlich auf Zehenspitzen in ihr Zimmer, um ihre kostbare Mappe unter der Matratze hervorzuziehen. Darauf bedacht, in ihrer Hast nicht auf einer abgetretenen Stelle des Beluchi-Läufers auszurutschen, den ihr Urgroßvater Horace von seiner Abenteuerreise in den Nahen Osten mitgebracht hatte, flitzte Alice die Treppe hinunter. Dort schnappte sie sich einen Korb vom Tisch in der Eingangshalle und rannte in den neuen Tag hinaus.
Das Wetter war wirklich perfekt. Alice summte vor sich hin, als sie über den Weg aus Steinplatten lief. Der Korb war schon halb voll, dabei war sie noch nicht einmal in der Nähe der Wiesen gewesen. Dort wuchsen die schönsten Wildblumen, außergewöhnliche, überraschende, nicht die üblichen zahmen, protzigen, aber Alice hatte den richtigen Zeitpunkt abgepasst. Den ganzen Vormittag über war sie ihrer Mutter aus dem Weg gegangen und hatte darauf gewartet, dass Mr. Harris Mittagspause machte, damit sie Ben allein erwischte.
Als sie sich das letzte Mal gesehen hatten, sagte er ihr, er habe etwas für sie. Sie hatte gelacht. Daraufhin setzte er dieses schiefe Lächeln auf, bei dem sie jedes Mal weiche Knie bekam, und fragte: »Was gibt’s da zu lachen?« Alice hatte sich zu voller Größe aufgerichtet und geantwortet, sie habe zufällig auch etwas für ihn.
Hinter der dicksten Eibe am Ende des Wegs, die wie alle anderen Bäume für das Fest kunstvoll beschnitten worden war, blieb sie stehen. Im Schutz der dichten Zweige riskierte sie einen Blick. Ben war noch auf der Insel, und Mr. Harris half seinem Sohn Adam, am gegenüberliegenden Seeufer bereitliegende Hölzer auf ein Boot zu laden, die zur Insel gebracht werden sollten. Der arme Adam. Alice sah, wie er sich hinterm Ohr kratzte. Er war einmal der Stolz der ganzen Familie gewesen, wie Mrs. Stevenson behauptete, stark, lebenslustig und gescheit. Aber während der Dritten Flandernschlacht 1917 hatte er einen Granatsplitter in den Kopf bekommen, seitdem war er geistig behindert. Der Krieg war grausam, sagte die Köchin gern, während sie einen unschuldigen Teigklumpen auf dem Küchentisch mit der Backrolle malträtierte. »So ein lieber, vielversprechender Junge wird einfach verheizt; und jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst.«
Das einzig Gute war laut Mrs. Stevenson, dass Adam selbst von seiner Veränderung gar nichts merkte und eher heiterer wirkte als zuvor. »Das ist nicht normal«, fügte sie jedes Mal hinzu, war sie doch als Schottin von Natur aus pessimistisch. »Es sind genug zurückgekommen, denen das Lachen komplett vergangen ist.« Alice’ Vater hatte darauf bestanden, dem Jungen auf dem Anwesen eine Arbeit zu geben. »Das ist eine Stelle auf Lebenszeit«, hatte Alice ihn mit vor Leidenschaft bebender Stimme zu Mrs. Harris sagen hören. »Das habe ich Ihnen schon einmal gesagt. Adam kann bleiben, solange er das braucht.«
Ganz dicht an ihrem linken Ohr nahm sie ein leises Sirren wahr, einen kaum spürbaren Windhauch, der ihre Wange streichelte. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie eine Libelle. Eine seltene Art, eine Gelbe Keiljungfer. Sie empfand eine altvertraute Erregung. Sie musste an ihren Vater denken, der sich in sein Studierzimmer zurückgezogen hatte, um sich vor seiner überspannten Frau in Sicherheit zu bringen. Wenn Alice sich beeilte, konnte sie die Libelle fangen, sie ihm für seine Sammlung bringen, sich in seiner Freude über das Geschenk sonnen und wieder ein bisschen in seiner Achtung steigen. So wie früher, als sie die Einzige gewesen war, die das düstere Zimmer voller wissenschaftlicher Bücher, weißer Handschuhe und Glasvitrinen betreten durfte, was sie so aufregend fand, dass sie sogar den Anblick der glänzenden silbernen Nadeln ertrug.
Doch natürlich hatte sie jetzt keine Zeit. Allein, dass sie überhaupt darüber nachdachte, war eine gefährliche Ablenkung. Alice runzelte die Stirn. Die Zeit hatte eine merkwürdige Art, sich zu verflüchtigen, wenn man mit den Gedanken woanders war. Sie schaute auf ihre Uhr. Fast zehn nach zwölf. In zwanzig Minuten würde der Chefgärtner sich wie jeden Tag in den Schuppen zurückziehen, um sein Käsesandwich mit sauer Eingelegtem zu essen und die Ergebnisse der Pferderennen zu studieren. Er war ein Mann mit festen Angewohnheiten, und Alice war nicht die Einzige, die das respektierte.
Sie vergaß die Libelle, überquerte eilig den Weg und schlich um den See herum. Dabei vermied sie den Rasen und die Gärtner, die die Flächen um die aufwendige Feuerwerksvorrichtung herum säuberten, und hielt sich, so gut es ging, im Schatten, bis sie den versunkenen Garten erreichte. Dort setzte sie sich auf die sonnengewärmten Stufen des alten Springbrunnens und stellte den Korb neben sich ab. Der perfekte Aussichtspunkt, dachte sie. Die Weißdornhecke vor ihr war dicht genug, dass man sie nicht sehen konnte, und erlaubte ihr dennoch einen guten Blick auf den neuen Anlegesteg.
Während sie darauf wartete, Ben allein zu erwischen, beobachtete sie zwei Saatkrähen, die am meerblauen Himmel herumtollten. Ihr Blick wanderte zum Haus hinüber, wo Männer auf Leitern die Backsteinfassade mit gigantischen Girlanden aus grünem Blattwerk schmückten und zwei Dienstmädchen zarte Papierlampions an dünnen Schnüren anbrachten, die an den Dachrinnen befestigt waren. Die oberen Bleiglasfenster leuchteten in der Sonne, und das gründlich geschrubbte Haus strahlte wie eine mit Juwelen behängte alte Dame, die sich für den jährlichen Opernbesuch herausgeputzt hatte.
Eine Welle tiefer Zuneigung überkam Alice. Seit sie denken konnte, wusste sie, dass das Haus und die Gärten von Loeanneth für sie auf eine ganz andere Weise lebten und atmeten als für ihre Schwestern. Während für Deborah London eine große Verlockung darstellte, war Alice nirgendwo so glücklich und so sehr sie selbst wie hier. Sie liebte es, am Bachufer zu sitzen, die Füße im kühlen Wasser, im Morgengrauen aufzuwachen und dem geschäftigen Treiben der Mauersegler zu lauschen, die über ihrem Fenster ein Nest gebaut hatten, oder mit ihrem Tagebuch unter dem Arm am Seeufer entlangzustapfen.
Im Alter von sieben Jahren hatte sie begriffen, dass sie eines Tages erwachsen sein würde und dass Erwachsene normalerweise nicht im Haus ihrer Eltern wohnten. Ein Abgrund hatte sich vor ihr aufgetan, und von da an hatte sie an allen erdenklichen Stellen ihren Namen eingraviert. In den Fensterrahmen aus hartem Eichenholz im kleinen Wohnzimmer, in den schmalen Fugen zwischen den Fliesen in der Waffenkammer, in der gemusterten Tapete in der Eingangshalle. Als könnte sie, indem sie überall diese winzigen Spuren hinterließ, eine stärkere und dauerhaftere Bindung zu ihrem Elternhaus aufbauen. Als ihre Mutter die kleinen Liebeserklärungen entdeckt hatte, hatte sie ihr für den ganzen Sommer den Nachtisch gestrichen. Die Strafe hätte Alice nichts ausgemacht, wäre sie nicht gleichzeitig des schamlosen Vandalismus bezichtigt worden. »Ich hätte gedacht, dass ausgerechnet du mehr Respekt vor dem Haus hättest«, hatte ihre Mutter wütend gezischt. »Nicht zu fassen, dass meine Tochter zu solchen Schandtaten fähig ist! Wie kannst du nur so einen gedankenlosen Schabernack treiben?« Derart beschimpft zu werden und zu erleben, dass die Zeichen ihrer liebevollen Inbesitznahme als mutwillige Zerstörung gebrandmarkt wurden, hatte sie zutiefst getroffen.
Aber das war im Augenblick völlig egal. Sie streckte die Beine aus, hielt die Zehen nebeneinander und seufzte wohlig. Das alles war Vergangenheit, Schnee von gestern, Kinderkram. Das Sonnenlicht überzog das hellgrüne Blattwerk des Gartens mit einem goldenen Schimmer. Verborgen im Laub einer Weide trällerte eine Mönchsgrasmücke, am Ufer balgten sich zwei Stockenten um eine saftige Schnecke. Das Orchester probte ein Tanzstück, und leise Musik schwebte über dem See. Was hatten sie für ein Glück mit dem Wetter! Wochenlang hatten sie mit bangen Blicken den Himmel im Morgengrauen beobachtet, die Alteingesessenen befragt. Heute war die Sonne strahlend aufgegangen und hatte die letzte Wolke vom Himmel vertrieben. Ein perfekter Mittsommertag. Es war ein warmer Abend mit einer sanften Brise zu erwarten. Die Party würde wie jedes Jahr alle Gäste verzaubern.
Lange bevor sie alt genug war, um zur Party aufzubleiben, hatte Alice den Zauber der Mittsommernacht verspürt. Damals hatte Nanny Bruen sie und ihre beiden Schwestern fein gemacht und nach unten geführt, damit sie den Gästen vorgestellt werden konnten. Am frühen Abend war es noch ruhig zugegangen. Elegant gekleidete Erwachsene waren auf gekünstelte Art darauf bedacht, die Etikette zu wahren, während sie auf die Dunkelheit warteten. Später jedoch, als sie längst hätte schlafen sollen, hatte Alice gewartet, bis Nanny Bruen tief und regelmäßig atmete. Dann war sie ans Kinderzimmerfenster geschlichen und auf einen Stuhl geklettert, um die Szenerie draußen in sich aufzusaugen. Die Lampions, die wie reife Früchte leuchteten. Das lodernde Freudenfeuer, das auf dem mondbeschienenen See zu treiben schien. Diese magische Welt, in der die Dinge und die Menschen beinahe so aussahen, wie Alice sie kannte, aber eben nur beinahe.
Heute Abend würde sie unter ihnen sein, und es würde ein ganz besonderer Abend werden. Alice lächelte, ein wohliger Schauder der Vorfreude überlief sie. Sie warf einen Blick auf ihre Uhr, dann nahm sie die Mappe mit dem kostbaren Inhalt aus ihrem Korb und schlug sie auf. Es handelte sich um ihr Manuskript, um eine von zwei Kopien, die sie sorgfältig auf der alten Remington-Schreibmaschine abgetippt hatte, das Ergebnis eines Jahres harter Arbeit. Der Titel hatte einen kleinen Schönheitsfehler, denn an einer Stelle stand anstelle eines d ein t. Abgesehen davon war es perfekt. Ben würde sich nicht daran stören. Er würde ihr höchstens sagen, es sei viel wichtiger, eine saubere Kopie an Victor Gollancz zu schicken. Sobald das Buch herauskam, würde er eine Erstausgabe bekommen, die sie direkt unter der Widmung für ihn signiert hätte.
Schlaf, Kindlein, schlaf. Alice flüsterte den Titel vor sich hin und genoss die Gänsehaut, die ihr das verursachte. Sie war ungeheuer stolz auf ihre bisher allerbeste Geschichte und machte sich große Hoffnungen, dass sie veröffentlicht werden würde. Es handelte sich um einen richtigen Kriminalroman. Nachdem sie das Vorwort zu Die besten Detektivgeschichten gelesen hatte, hatte sie ihr Heft aufgeschlagen und sich die Regeln notiert, die Mr. Ronald Knox dort aufgestellt hatte. Ihr war klar geworden, dass sie den Fehler begangen hatte, zwei verschiedene Genres zu mischen. Also hatte sie Laura kurzerhand ins Jenseits geschickt und ganz von vorn angefangen. Sie hatte sich ein Landhaus ausgedacht, einen Detektiv und einen Haushalt, in dem jeder verdächtig war. Es war ganz schön knifflig gewesen, es so hinzubekommen, dass der Leser bis zum Schluss den Täter nicht erriet. Bis sie auf die Idee gekommen war, eine Art Resonanzboden einzuführen, sozusagen ihrem Holmes einen Watson zur Seite zu stellen. Und sie hatte ihn gefunden. Sie hatte mehr als das gefunden.
Für B. M., Komplize und Verbündeter.
Sie fuhr mit dem Daumen über die Widmung. Wenn der Roman erst einmal erschienen war, würden alle von ihnen beiden erfahren, aber das störte Alice nicht. Auf der einen Seite konnte sie es kaum abwarten. Wie oft hätte sie es um ein Haar Deborah oder Clemmie erzählt, weil sie so sehr darauf brannte, die Worte laut auszusprechen. Gesprächen mit ihrer Mutter, die längst Verdacht geschöpft hatte, ging sie so gut wie möglich aus dem Weg. Es war besser, wenn sie es erst erfuhren, wenn sie ihr erstes gedrucktes Buch lasen.
Schlaf, Kindlein, schlaf war aus Gesprächen mit Ben entstanden. Ohne ihn hätte es die Geschichte nie gegeben. Indem sie ihre Gedanken aus der Luft gepflückt und in Worten zu Papier gebracht hatte, hatte sie etwas Ungreifbares, eine vage Möglichkeit, Wirklichkeit werden lassen. Sie hatte das Gefühl, wenn sie Ben die Kopie des Manuskripts gab, würde auch das Versprechen, das sie beide unausgesprochen verband, eher Wirklichkeit werden. Versprechen spielten eine wichtige Rolle in der Familie Edevane. Von klein auf hatte Alice’ Mutter ihren Kindern eingebläut: Man sollte niemals ein Versprechen geben, das man nicht zu halten beabsichtigt.
Plötzlich waren auf der anderen Seite der Weißdornhecke Stimmen zu hören, und Alice drückte sich das Manuskript instinktiv an die Brust. Einen Augenblick lang lauschte sie angestrengt, dann lief sie zur Hecke und spähte durch eine winzige, rautenförmige Lücke zwischen den Blättern. Ben war nicht mehr auf der Insel, und das Boot lag wieder am Steg. Alice entdeckte die drei Männer neben dem restlichen Holzstapel. Sie beobachtete, wie Ben aus seiner Feldflasche trank, wobei sein Adamsapfel auf und ab hüpfte. Sie sah sein stoppeliges Kinn, die kleinen Locken, die seinen Kragen berührten, den Schweißfleck, der sich hinten auf seinem Hemd ausgebreitet hatte. Ihr stockte der Atem. Sie liebte seinen Geruch, er war so erdig und natürlich.
Mr. Harris packte sein Werkzeug zusammen und gab ein paar letzte Anweisungen, woraufhin Ben nickte und sich mit dem Anflug eines Lächelns verabschiedete. Auch Alice lächelte, sah das Grübchen in seiner linken Wange, seine kräftigen Schultern, seinen nackten Unterarm, der in der prallen Sonne schimmerte. Plötzlich reckte er sich, ein fernes Geräusch hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Sie folgte seinem Blick, der sich auf etwas in den weiter weg gelegenen, wilden Gärten richtete.
Kaum erkennbar in dem Gestrüpp aus Steppenlilien und Eisenkraut bewegte sich eine kleine Gestalt mit federnden, furchtlosen Schritten auf das Haus zu. Theo. Der Anblick ihres kleinen Bruders ließ Alice noch breiter lächeln. Aber der große, dunkle Schatten, der hinter ihm auftauchte, ließ ihr Lächeln ersterben. Jetzt begriff sie, warum Ben die Stirn runzelte. Sie dachte genauso über Nanny Bruen und konnte sie nicht ausstehen. Wie sollte man jemanden mit despotischen Neigungen mögen? Der Himmel wusste, warum die liebe, nette Nanny Rose entlassen worden war. Sie hatte Theo sehr gemocht, war regelrecht in ihn vernarrt gewesen. Es hatte niemanden gegeben, der sie nicht mochte. Selbst Alice’ Vater, der dafür bekannt war, dass er an keinem ein gutes Haar ließ, hatte hin und wieder mit ihr im Garten geplaudert, während Theo die Enten umherscheuchte.
Aber Alice’ Mutter hatte sich über irgendetwas fürchterlich aufgeregt. Vor zwei Wochen hatte Alice die beiden beobachtet, wie sie sich vor dem Kinderzimmer flüsternd stritten. Es hatte mit Theo zu tun gehabt. Leider stand Alice zu weit weg, um zu verstehen, was gesagt wurde. Am nächsten Tag war Nanny Rose fort gewesen und Nanny Bruen wieder aus der Mottenkiste geholt worden. Alice hatte geglaubt, dass sie die alte Hexe mit den Bartstoppeln und ihrer Flasche Rizinusöl nie wiedersehen würde. Es erfüllte sie sogar mit heimlichem Stolz, als sie zufällig mitbekommen hatte, wie Großmutter deShiel einmal bemerkte, es sei ihre widerspenstige Enkelin Alice gewesen, die der alten Nanny den Rest gegeben habe. Und nun war sie wieder da, garstiger denn je.
Während Alice sich um den Verlust von Nanny Rose grämte, merkte sie, dass sie nicht mehr allein auf ihrer Seite der Hecke war. Hinter ihr knackte ein Zweig, und sie fuhr herum.
»Mr. Llewellyn«, rief sie aus, als sie die gebeugte Gestalt erblickte, eine Staffelei unter einem Arm und unter dem anderen unbeholfen einen großen Zeichenblock. »Gott, haben Sie mich erschreckt.«
»Tut mir leid, Liebes. Ich kann mich wohl nicht mehr so vorsichtig anpirschen. Ich hatte gehofft, wir könnten uns vielleicht ein bisschen unterhalten.«
»Jetzt, Mr. Llewellyn?« Obwohl sie den alten Mann eigentlich mochte, löste sein Ansinnen Unwillen aus. Anscheinend hatte er nicht begriffen, dass die Zeiten vorbei waren, in denen Alice ihm beim Zeichnen Gesellschaft leistete, sich mit ihm im Ruderboot bachabwärts treiben ließ und ihm all ihre kindlichen Geheimnisse anvertraute, während sie gemeinsam nach Elfen Ausschau hielten. Sicher, er war einmal eine wichtige Figur in ihrem Leben gewesen, ein guter Freund, als sie noch klein gewesen war, und ihr Mentor, als sie mit dem Schreiben angefangen hatte. Wie oft war sie zu ihm gelaufen, um ihm die einfältigen Geschichten zu zeigen, die sie in einem Anfall von Inspiration aufgeschrieben hatte, und er hatte sie jedes Mal mit großer Geste gewürdigt. Jetzt, mit sechzehn, hatte sie andere Interessen, andere Geheimnisse, die sie ihm nicht anvertrauen konnte. »Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, wissen Sie.«
Sein Blick wanderte zu der kleinen Lücke in der Hecke, und Alice spürte, wie ihre Wangen zu glühen begannen.
»Ich überwache die Partyvorbereitungen«, sagte sie hastig. Mr. Llewellyn lächelte auf eine Weise, die ihr verriet, dass er ganz genau wusste, wen sie beobachtete und warum. »Und ich pflücke Blumen für meine Mutter«, fügte sie schnell hinzu.
Er warf einen Blick auf ihren Korb, in dem die Blumen in der Mittagshitze welkten.
»Ich muss mich beeilen.«
»Natürlich«, sagte er mit einem Nicken. »Normalerweise würde es mir nicht im Traum einfallen, dich zu stören, während du deiner Mutter so fleißig hilfst. Aber ich muss etwas Wichtiges mit dir bereden.«
»Im Moment habe ich wirklich keine Zeit.«
Mr. Llewellyn wirkte ungewöhnlich enttäuscht, und in diesem Moment erinnerte sich Alice, dass er in letzter Zeit sehr matt wirkte. Nicht unbedingt trübsinnig, aber irgendwie abwesend und traurig. Ihr fiel auf, dass er seine Satinweste schief geknöpft hatte und dass der Schal, den er um den Hals trug, ziemlich schäbig aussah. Mit einem Mal tat er ihr leid. Sie nickte, um Wiedergutmachung bemüht, in Richtung seines Zeichenblocks. »Ein sehr gutes Porträt«, sagte sie. Das meinte sie ernst. Theo hatte er vorher nie gezeichnet, aber unglaublich gut getroffen. Seine runden Bäckchen, die noch an das Babygesicht erinnerten, die vollen Lippen, die großen, vertrauensvollen Augen. Der gute Mr. Llewellyn sah in ihnen allen nur das Beste. »Wollen wir uns vielleicht nach dem Tee treffen?«, fragte sie mit einem aufmunternden Lächeln. »Bevor die Party anfängt?«
Mr. Llewellyn drückte seinen Zeichenblock fester an sich und dachte über Alice’ Vorschlag nach. Schließlich sagte er stirnrunzelnd: »Und wenn wir uns heute Abend beim Freudenfeuer treffen?«
»Heißt das, Sie kommen zur Party?« Das war eine Überraschung. Mr. Llewellyn war alles andere als gesellig und stets darauf bedacht, größere Menschenmengen zu meiden. Vor allem, wenn sich darunter Leute befanden, die ihn unbedingt treffen wollten. Er verehrte Alice’ Mutter, und doch war es ihr nie gelungen, ihn dazu zu überreden, an der Mittsommerparty teilzunehmen. Die Erstausgabe ihrer Mutter von Eleanors magische Tür würde wie jedes Jahr zur Ansicht ausliegen. Die Leute würden darauf brennen, den Autor des Buchs kennenzulernen. Wie jedes Jahr würden sie auf Knien an der Hecke nach der alten steinernen Säule zu suchen, die dort vergraben war. »Schau mal, Simeon, da ist er! Der Messingring von der Karte. Genau, wie es im Buch beschrieben ist.« Dabei ahnten die Leute nicht, dass der Tunnel bereits vor vielen Jahren zum Schutz vor neugierigen Besuchern versiegelt worden war.
Alice hätte gern noch ein bisschen nachgehakt, doch plötzlich hörte sie hinter der Hecke einen Mann herzhaft lachen und einen anderen ausrufen: »Die laufen nicht weg, Adam. Geh mit deinem Dad und sieh zu, dass du was zwischen die Kiemen kriegst! Du brauchst sie nicht alle auf einmal rüberzuschleppen.« Alice erinnerte sich wieder an ihr Vorhaben. »Also gut«, sagte sie. »Heute Abend. Auf der Party.«
»Sagen wir, um halb zwölf in der Laube?«
»Ja, ja.«
»Es ist wichtig, Alice.«
»Halb zwölf«, wiederholte sie ein bisschen ungehalten. »Ich werde da sein.«
Aber er ging nicht, sondern blieb wie angewurzelt stehen und schaute sie ernst und wehmütig an. Es war beinahe, als versuchte er, sich ihre Gesichtszüge einzuprägen.
»Mr. Llewellyn?«
»Erinnerst du dich, wie wir einmal an Clemmies Geburtstag mit dem Boot gefahren sind?«
»Ja«, sagte sie. »Ja, das war ein schöner Tag.« Alice ging zum Brunnen und nahm demonstrativ ihren Korb von der Stufe, ein Wink mit dem Zaunpfahl, den Mr. Llewellyn offenbar verstanden hatte, denn als sie sich umdrehte, war er fort.
Ein großes Bedauern nagte an ihr, und sie stieß einen tiefen Seufzer aus. Wahrscheinlich war es ihre Verliebtheit, die solche Gefühle in ihr auslöste, dachte sie. Eine Art allgemeines Mitgefühl mit allen, denen es nicht wie ihr erging. Der arme alte Mr. Llewellyn. Einst hatte sie ihn für einen Zauberer gehalten. Jetzt sah sie nur den gebeugten, traurigen Mann, der vor seiner Zeit gealtert war, eingeengt von den viktorianischen Kleidungs- und Verhaltensregeln, von denen er sich nicht befreien konnte. Er hatte in seiner Jugend einen Zusammenbruch erlitten. Das war eigentlich ein Geheimnis, aber Alice wusste vieles, was sie nicht wissen sollte. Als es passierte, war ihre Mutter noch ein Kind gewesen und Mr. Llewellyn ein guter Freund von Henri deShiel. Er hatte seinen Beruf in London aufgegeben und Eleanors magische Tür geschrieben.
Was den Zusammenbruch ausgelöst hatte, wusste Alice nicht. Vielleicht sollte sie versuchen, das herauszufinden, dachte sie flüchtig, aber nicht jetzt, nicht heute. Heute wartete die Zukunft auf der anderen Seite der Hecke auf sie. Sie hatte einfach keine Zeit für die Vergangenheit. Ein kurzer Blick durch die Lücke im Laub bestätigte ihr, dass Ben allein war. Er sammelte gerade seine Sachen ein. Gleich würde er durch den Garten zu seiner Unterkunft gehen, um zu Mittag zu essen. Mr. Llewellyn war sofort vergessen. Alice hob das Gesicht in die Sonne und genoss die Wärme auf den Wangen. Es war ein Augenblick vollkommener Glückseligkeit. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand glücklicher war als sie. Dann machte sie sich mit dem Manuskript in der Hand auf den Weg zum Steg, berauscht von dem Bewusstsein, eine junge Frau zu sein, vor der eine schillernde Zukunft lag.
3
Cornwall, 2003
Das Sonnenlicht fiel durch das Laub. Sadie rannte, bis ihre Lunge sie anflehte, stehen zu bleiben. Doch sie rannte nur noch schneller, konzentrierte sich auf das beruhigende, rhythmische Geräusch ihrer Schritte, das schwache Echo, das von der feuchten, bemoosten Erde und dem dichten Unterholz dumpf widerhallte.
Die Hunde waren schon vor einer Weile von dem schmalen Weg verschwunden. Sie glitten, die Schnauze am Boden, wie dunkelbraune Schatten durch das nassglänzende Gestrüpp zu beiden Seiten des Wegs. Vielleicht fühlten sich die Hunde noch erleichterter als sie, dass der Regen endlich aufgehört hatte. Es überraschte Sadie, wie froh sie war, die beiden bei sich zu haben. Anfangs hatte sie sich gegen den Vorschlag ihres Großvaters gesträubt. Aber Bertie hatte ziemlich argwöhnisch reagiert, als sie aus heiterem Himmel bei ihm geklingelt hatte. »Seit wann machst du Urlaub?«, hatte er gefragt und war wie immer stur geblieben. »Du bist mit der Gegend nicht vertraut. Der Wald ist an manchen Stellen sehr dicht, da kann man sich leicht verirren.« Dann fing er damit an, er könne einen der einheimischen jungen Männer bitten, sie zu begleiten. Er bedachte sie mit einem Blick, der ihr sagte, dass er drauf und dran war, Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten wollte. Also hatte Sadie sich lieber darauf eingelassen, die Hunde mitzunehmen.
Sadie joggte immer allein. Das hatte sie schon getan, lange bevor der Fall Bailey ihr um die Ohren geflogen und ihr Leben in London in sich zusammengestürzt war. So gefiel es ihr am besten. Manche joggten, um sich fit zu halten, andere zum Vergnügen. Sadie joggte wie jemand, der seinem eigenen Tod davonlief. Das hatte ein Mann zu ihr gesagt, mit dem sie vor Jahren zusammen gewesen war. Er hatte es ihr vorgehalten, während er zusammengekrümmt mitten im Hampstead Heath stand und nach Luft rang. Sadie hatte mit den Achseln gezuckt und sich gefragt, was daran schlecht sein sollte, und im selben Moment gewusst, dass aus ihnen beiden nichts werden würde.
Ein Windstoß fuhr durch die Zweige und sprühte ihr die Regentropfen der vergangenen Nacht ins Gesicht. Sadie schüttelte den Kopf, ohne das Tempo zu verlangsamen. Am Wegesrand wuchsen Wildrosen, die wie jedes Jahr ihr Glück zwischen Farnen und umgestürzten Bäumen versuchten. Es war gut, dass es so etwas gab, der Beweis dafür, dass die Schönheit und das Gute tatsächlich auf der Welt existierten, wie Gedichte und platte Sprüche behaupteten. In ihrem Beruf konnte man das leicht vergessen.
Am Wochenende hatten die Londoner Zeitungen wieder darüber berichtet. Sadie hatte einem Mann im Hafencafé über die Schulter gesehen, während sie mit Bertie frühstückte. Oder vielmehr, während sie frühstückte und er an einem grünen Smoothie nuckelte, der nach Gras roch. Es war nur ein kurzer Artikel gewesen, eine einzige Spalte auf Seite fünf, aber der Name Maggie Bailey hatte Sadies Blick wie ein Magnet angezogen. Sie hielt mitten im Satz inne und überflog den Artikel gierig. Neues erfuhr sie nicht, was bedeutete, dass sich nichts geändert hatte. Wie auch. Der Fall war abgeschlossen. Derek Maitland hatte als Autor in der Namenszeile gestanden. Kein Wunder, dass er sich an die Geschichte klammerte wie ein Hund an einen Knochen, den man ihm wegnehmen wollte. So war er eben. Vielleicht war das einer der Gründe, warum sie sich für ihn entschieden hatte.
Sadie erschrak, als Ash mit einem Riesensatz vor ihr aus dem Gebüsch sprang und mit fliegenden Ohren und offenem, nass grinsendem Maul vor ihr herrannte. Mit geballten Fäusten und zusammengebissenen Zähnen beschleunigte sie ihr Tempo, um nicht zurückzufallen. Eigentlich sollte sie keine Zeitung lesen. Sie sollte sich eine Auszeit nehmen und abwarten, bis die Lage in London sich beruhigt hatte. Das hatte Donald ihr geraten. Er versuchte nur, sie davor zu bewahren, dass man ihr ihre eigene Dummheit unter die Nase rieb. Das war wirklich nett von ihm, aber dafür war es ein bisschen zu spät.
Alle Zeitungen hatten darüber berichtet, die Fernsehsender ebenso. In den Wochen danach war die Berichterstattung nicht weniger, sondern vielfältiger geworden und reichte von Artikeln über Sadies Kommentare und boshaften Hinweisen auf Differenzen innerhalb der Met bis hin zu Anspielungen auf Vertuschungsmanöver. Kein Wunder, dass Ashford sauer war. Der Superintendent ließ keine Gelegenheit aus, seine Meinung zum Thema Loyalität kundzutun, sich die vom Mittagessen bekleckerte Hose hochzuziehen und den versammelten Detectives eine Standpauke zu halten: »Es gibt nichts Schlimmeres als Nestbeschmutzer, verstanden? Wenn Sie sich über etwas aufregen, regeln Sie das innerhalb des Hauses. Nichts schadet dem Department mehr als Polizisten, die Interna an Außenstehende ausplaudern.« Und er vergaß nie, die verabscheuungswürdigsten unter den Außenseitern zu erwähnen, nämlich die Journalisten, die er voller Verachtung als Blutsauger bezeichnete.
Gott sei Dank wusste Ashford nicht, dass Sadie dieses spezielle Detail ausgeplaudert hatte. Donald hatte sie gedeckt, genauso wie er es bei ihren Fehlern bei der Arbeit getan hatte. »Schließlich sind wir Partner«, hatte er auf seine typische raubeinige Art geknurrt, als sie sich damals unbeholfen bei ihm bedankt hatte. Sie scherzten sonst immer über die kleinen Ausrutscher in ihrem ansonsten tadellosen Verhalten. Doch der Verstoß, den sie sich diesmal geleistet hatte, war etwas anderes. Als Vorgesetzter war Donald verantwortlich für die Handlungsweise der ihm unterstellten Polizisten. Erschien jemand ohne Notizblock zu einer Vernehmung, konnte man das mit einem gutmütigen Frotzeln abtun. Wurde aber ausgeplaudert, dass das Department eine Ermittlung vermasselt hatte, war das eine ganz andere Sache.
Als die Geschichte Schlagzeilen machte, hatte Donald gleich gewusst, dass Sadie die undichte Stelle war. Er lud sie auf ein Bier im Fox and Hounds ein und machte ihr unmissverständlich klar, dass sie aus London verschwinden müsse. Sie solle den gesamten Urlaub nehmen, der ihr zustand, und sich rarmachen, bis sie verarbeitet hatte, was ihr quer im Magen lag. Was auch immer das sein mochte. »Ich meine es ernst, Sparrow«, hatte er gesagt und sich Bierschaum aus dem grauen Schnurrbart gewischt. »Ich weiß nicht, was neuerdings in dich gefahren ist, aber Ashford ist nicht blöd, er wird ein wachsames Auge auf dich haben. Dein Großvater ist doch zurzeit in Cornwall, oder? Zu deinem eigenen Besten, zu unser beider Besten, fahr hin und bleib da, bis du dich wieder gefangen hast.«
Ein umgestürzter Baum versperrte ihr den Weg, und Sadie sprang darüber, wäre aber beinahe mit der Schuhspitze hängen geblieben. Adrenalin schoss ihr bis in die Haarspitzen wie heißer Sirup. Sie machte sich das zunutze und rannte noch schneller. Bleib da, bis du dich wieder gefangen hast. Das war leichter gesagt als getan. Donald mochte den Grund für ihre Zerstreutheit und Unbesonnenheit nicht kennen, aber sie selbst kannte ihn. Sie dachte an den Inhalt des Umschlags, den sie im Nachtschränkchen in Berties Gästezimmer versteckt hatte, an das hübsche Papier, die schnörkelige Handschrift, die schockierende Nachricht. Ihre Probleme hatten genau an dem Abend vor sechs Wochen angefangen, an dem der Brief auf der Fußmatte vor ihrer Londoner Wohnung lag. Anfangs waren es nur gelegentliche Konzentrationsstörungen gewesen, kleine Fehler, die sich leicht ausbügeln ließen, aber dann … Der Fall Bailey, das kleine, mutterlose Mädchen – da war ihr alles um die Ohren geflogen.
Mit einem letzten Energieschub zwang Sadie sich zu einem Sprint bis zu dem schwarzen Baumstumpf, an dem sie immer kehrtmachte. Taumelnd schaffte sie es, den feuchten, schartigen Stumpf mit der ausgestreckten Hand zu berühren, dann beugte sie sich keuchend vornüber, stützte sich mit den Händen auf den Knien ab und versuchte, wieder normal zu atmen. Ihr Zwerchfell hob und senkte sich, sie sah Sternchen. Ihr tat alles weh, und das war gut so. Ash lief umher und schnüffelte am Ende eines moosbedeckten Astes, der an der steilen Böschung aus dem Schlamm ragte. Sadie trank gierig aus ihrer Wasserflasche, dann sprühte sie dem Hund etwas Wasser ins offene Maul. Sie kraulte ihm den Kopf. »Wo ist dein Bruder?«, fragte sie, woraufhin Ash den Kopf schief legte und sie mit seinen klugen Augen anschaute. »Wo ist Ramsay?«
Sadie ließ den Blick über das Gestrüpp wandern. Dicke Farnbüschel sorgten für üppiges Grün. Zarte, noch zusammengerollte Wedel reckten sich zum Licht hin. Es duftete süß nach Geißblatt und regenfeuchter Erde. Sie hatte diesen Geruch seit jeher gemocht, und sie mochte ihn noch mehr, seitdem Bertie ihr erzählt hatte, dass er durch bestimmte Bakterien verursacht wurde. Das war der Beweis dafür, dass unter den richtigen Bedingungen Gutes aus Schlechtem entstehen konnte. Daran zu glauben lag in Sadies persönlichem Interesse.
Der Wald war ziemlich dicht, und während sie Ausschau nach Ramsay hielt, wurde ihr klar, dass Bertie recht hatte. Hier konnte man sich heillos verirren. Sie nicht, sie hatte ja die Hunde als Begleiter, deren Spürnasen den Heimweg finden würden. Aber jemand anders durchaus, ein unschuldiges Mädchen aus einem Märchen zum Beispiel. So ein Mädchen, den Kopf voller romantischer Gedanken, konnte sich leicht zu tief in diesen Wald hineinwagen und nicht wieder hinausfinden.
Sadie kannte nicht viele Märchen, nur die bekanntesten. Das gehörte zu den Erfahrungslücken (Märchen, ein Schulabschluss, Elternliebe), die sie von Gleichaltrigen unterschieden. Selbst im Zimmer der kleinen Bailey, das ziemlich spärlich möbliert war, stand ein Regal voller Bücher, darunter ein viel gelesenes Exemplar von Grimms Märchen. Aber in Sadies Kindheit hatte es kein geflüstertes Es war einmal gegeben. Ihre Mutter hatte es nicht mit Flüstern gehabt, ihr Vater noch weniger. Für die Welt der Fantasie hatten ihre Eltern nur Verachtung übrig.
Als Weltbürgerin besaß Sadie genug Allgemeinbildung, um zu wissen, dass in Märchen Menschen verschwanden. Meistens in dichten, dunklen Wäldern. Auch im wirklichen Leben verschwanden Menschen, Wälder hin oder her. Das wusste Sadie aus Erfahrung. Einige aufgrund eines Missgeschicks, andere aus eigener Entscheidung. Letzteres galt für Menschen, die nicht gefunden werden wollten. Wie zum Beispiel Maggie Bailey.
»Abgehauen«, hatte Donald bereits ganz zu Anfang gesagt, an dem Tag, an dem sie die kleine Caitlyn allein in der Wohnung gefunden hatten. Wochen, bevor sie die Nachricht fanden, die bewies, dass er recht hatte. »Überfordert. Von den Kindern, der finanziellen Not, dem Leben. Wenn ich für jedes Mal ein Pfund bekäme, wo ich das erlebe …«
Sadie hatte sich geweigert, daran zu glauben. Sie verfolgte ihren eigenen Kurs, getragen von fantastischen Mordtheorien, die in Kriminalromane gehörten, beharrte darauf, dass eine Mutter ihr Kind nicht einfach verlassen würde. Sie verlangte, dass sie sämtliche Beweise ein zweites Mal durchgingen, um nach dem entscheidenden Hinweis zu suchen, den sie übersehen hatten.
»Du suchst nach etwas, das du nie finden wirst«, sagte Donald zu ihr. »Manchmal, nicht häufig, sind die Dinge tatsächlich so simpel, wie sie aussehen, Sparrow.«
»So wie du, wolltest du wohl sagen.«
Er lachte. »Werd nicht unverschämt.« Dann fügte er in beinahe väterlichem Ton hinzu, was noch schlimmer war, als wenn er sie angebrüllt hätte: »Das passiert jedem mal. Wenn man lange genug Polizist ist, kommt irgendwann ein Fall, der einem unter die Haut geht. Das bedeutet, dass du ein Mensch bist, aber es bedeutet nicht, dass du recht hast.«
Sadies Atem hatte sich beruhigt, doch Ramsay war nicht wieder aufgetaucht. Sie rief nach ihm und hörte das Echo ihrer Stimme an dunklen, feuchten Orten. Ramsay … Ramsay … Ramsay … Das letzte Echo war so schwach, dass es sich verlor. Er war der zurückhaltendere der beiden Hunde; bei ihm hatte es länger gedauert, sein Vertrauen zu gewinnen. Aus diesem Grund mochte sie ihn ganz besonders, auch wenn es vielleicht ungerecht war. Zutraulichkeit hatte Sadie schon immer argwöhnisch gemacht. Es war ein Wesenszug, der ihr an Nancy Bailey aufgefallen war, Maggies Mutter, zu der sie aufgrund der Gemeinsamkeit eine engere Beziehung aufgebaut hatte. Eine folie à deux nannte sich das. Zwei ansonsten gesunde, vernünftige Frauen, die einander in derselben Wahnvorstellung bestärkten. Inzwischen begriff Sadie, dass diese Beschreibung auf sie und Nancy Bailey zutraf. Sie hatten derselben Illusion nachgehangen und einander davon überzeugt, dass hinter Maggies Verschwinden mehr steckte, als man auf den ersten Blick erkennen konnte.
Es war tatsächlich der reine Wahnsinn gewesen. Zehn Jahre bei der Polizei, fünf Jahre Arbeit als Detective, und alles, was sie jemals gelernt hatte, löste sich in dem Moment in Wohlgefallen auf, als sie das Mädchen allein in der muffigen Wohnung gesehen hatte. Klein und zart, von hinten beleuchtet, sodass ihr zerzaustes blondes Haar wie ein Heiligenschein schimmerte. Große, wachsame Augen, die die beiden Fremden betrachteten, die gerade die Wohnungstür aufgebrochen hatten. Sadie war zu der Kleinen gegangen, hatte ihre Hände genommen und in einer hellen, klaren Stimme, die sie kaum als ihre eigene erkannte, zu ihr gesagt: »Hallo, Liebes. Wer ist das da auf deinem Nachthemd?« Die Verletzlichkeit der Kleinen, ihre Zartheit und ihre Verwirrung trafen Sadie genau an der Stelle, die sie normalerweise tief in ihrem Innern verborgen hielt. Während der folgenden Tage hatte sie die ganze Zeit den geisterhaften Abdruck der kleinen Hände in den ihren gespürt. Wenn sie abends versuchte einzuschlafen, hörte sie die leise Stimme fragen: Mama? Wo ist meine Mama? Sie war wie besessen von dem Drang gewesen, dem kleinen Mädchen seine Mutter wiederzubringen, und Nancy Bailey hatte sich als die perfekte Verbündete erwiesen. Es war verzeihlich, dass Nancy sich an Strohhalme klammerte, und verständlich, dass sie verzweifelt das kaltschnäuzige Verhalten ihrer Tochter entschuldigte. Sie musste die schockierende Tatsache herunterspielen, dass ihre kleine Enkelin im Stich gelassen worden war, um ihre Schuldgefühle zu bekämpfen. »Wenn ich an dem Wochenende nicht mit meinen Freundinnen weggefahren wäre, dann hätte ich sie selbst gefunden.« Doch Sadie hätte es besser wissen müssen. Ihre gesamte berufliche Laufbahn, ihr gesamtes Erwachsenenleben beruhte darauf, dass sie es besser wusste.
»Ramsay«, rief sie noch einmal, diesmal etwas lauter.
Wieder hallte nur Stille zurück, erfüllt vom Rascheln des Laubs und dem entfernten Gurgeln eines Rinnsals in einem Graben. Naturgeräusche, die dazu führten, dass man sich noch verlassener fühlte. Sadie streckte die Arme über dem Kopf aus. Das Bedürfnis, sich bei Nancy zu melden, peinigte sie wie ein riesiges Gewicht, das ihr die Luft abschnürte. Ihre eigene Schmach konnte sie ertragen, aber die Scham, die sie überkam, wenn sie an Nancy dachte, war niederschmetternd. Sie hätte sie so gern um Verzeihung gebeten, ihr erklärt, dass es eine fürchterliche Fehleinschätzung ihrerseits gewesen war. Dass es nie ihre Absicht gewesen war, ihr falsche Hoffnungen zu machen. Donald kannte sie gut. »Noch eins, Sparrow«, waren seine Abschiedsworte gewesen, bevor er sie nach Cornwall geschickt hatte. »Komm ja nicht auf die Idee, die Großmutter zu kontaktieren.«
Noch lauter rief sie: »Ramsay! Wo steckst du?«
Sadie horchte angestrengt. Ein Vogel flog auf, schweres Flügelschlagen in den Baumkronen. Sie hob den Blick. Durch das Gitterwerk der Äste und Zweige sah sie ein Flugzeug, das wie ein weißer Strich den Himmel zerschnitt. Es flog nach Osten, in Richtung London. Sie schaute ihm mit einem seltsamen Gefühl der Entwurzelung nach. Unvorstellbar, dass das Leben, ihr Leben, dort ohne sie weiterging.
Seit sie London verlassen hatte, hatte sie nichts von Donald gehört. Sie rechnete auch eigentlich nicht damit, jedenfalls noch nicht. Es war erst eine Woche her, und er hatte darauf bestanden, dass sie einen ganzen Monat Urlaub nahm. »Aber ich kann doch früher zurückkommen, wenn ich will, oder?«, hatte Sadie den jungen Mann in der Personalabteilung gefragt, dessen verdatterter Blick ihr sagte, dass ihm bisher niemand diese Frage gestellt hatte. »Untersteh dich«, hatte Donald hinterher geknurrt. »Wenn du wieder aufkreuzt, bevor du so weit bist, dann gehe ich sofort zu Ashford. Das meine ich ernst, Sparrow.« Er würde seine Worte wahr machen, das wusste sie. Er stand kurz vor der Pensionierung und würde sich seinen Abschied aus dem Dienst nicht von einer durchgeknallten Untergebenen vermiesen lassen. Schließlich war Sadie nichts anderes übrig geblieben, als klein beizugeben, ihre Sachen zu packen und nach Cornwall zu fahren. Vorher hatte sie Donald Berties Telefonnummer gegeben, weil auf den Handyempfang in der Gegend kein Verlass war, und hoffte, dass er sie vorzeitig zurückbeordern würde.
Zu ihrer Linken war ein leises Knurren zu hören. Sie schaute nach unten. Ash stand stocksteif da und starrte in den Wald. »Was ist los, alter Junge? Ist dir der Geruch des Selbstmitleids zuwider?« Sein Nackenfell sträubte sich, seine Ohren zuckten, doch sein Blick blieb starr geradeaus gerichtet. Dann hörte Sadie es auch, in einiger Entfernung. Ramsay. Ein Bellen, nicht unbedingt ein warnendes Bellen, und doch klang es seltsam.
Seit die Hunde sie adoptiert hatten, entwickelte Sadie zu ihrer eigenen Bestürzung regelrecht mütterliche Gefühle für die beiden. Als Ash erneut ein langes, tiefes Knurren von sich gab, verschloss sie ihre Wasserflasche. »Also los«, sagte sie und klopfte sich auf den Schenkel. »Gehen wir deinen Bruder suchen.«
In London hatten ihre Großeltern nie Hunde gehabt, denn Ruth litt an einer Tierhaarallergie. Aber als Bertie nach Ruths Tod in Rente ging und nach Cornwall zog, wurde er schwach. »Ich komme gut zurecht«, sagte er durch die pfeifende Telefonleitung zu Sadie. »Es gefällt mir hier. Tagsüber bin ich beschäftigt. Nur die Nächte sind sehr still. Ich streite mich schon mit dem Fernseher. Schlimmer noch, ich verliere jedes Mal.«
Es sollte ein Scherz sein, doch Sadie merkte, wie seine Stimme leicht kippte. Ihre Großeltern hatten sich als Teenager ineinander verliebt. Ruths Vater belieferte den Laden von Berties Eltern in Hackney, so hatten sie sich kennengelernt und waren seitdem unzertrennlich gewesen. Sadie hätte ihren Großvater gern getröstet, sie konnte seine Trauer deutlich spüren. Aber Worte waren nie ihre Stärke gewesen. So antwortete sie, er hätte wahrscheinlich bessere Karten, wenn er sich mit einem Labrador streiten würde. Er lachte und sagte, er würde darüber nachdenken. Am nächsten Tag war er zum Tierheim gegangen. Typisch Bertie, kam er nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Hunden nach Hause und brachte zudem einen übellaunigen Kater mit. Nach einer Woche in Cornwall hatte sie den Eindruck, dass die vier eine zufriedene kleine Familie geworden waren, auch wenn der Kater die meiste Zeit hinter dem Sofa verbrachte. Ihr Großvater jedenfalls wirkte so lebenslustig wie seit dem Beginn von Ruths Krankheit nicht mehr. Ein weiterer Grund, warum sie auf keinen Fall ohne die beiden Hunde nach Hause gehen würde.
Ash lief schneller, und Sadie hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Ihr fiel auf, dass die Vegetation sich veränderte. Die Luft wurde frischer. Unter den weniger dicht stehenden Bäumen bekam das Gestrüpp mehr Licht und hatte sich hemmungslos ausgebreitet. Ständig blieb sie mit ihren Shorts an Zweigen hängen. Wäre sie mit mehr Fantasie begabt gewesen, hätte sie geglaubt, dass sie versuchten, sie aufzuhalten.