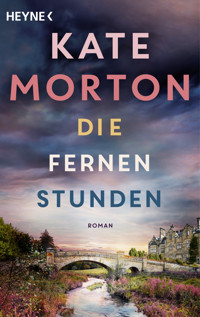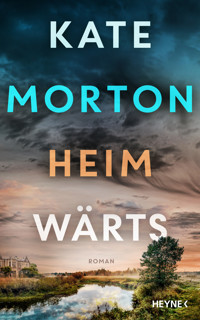Inhaltsverzeichnis
Teil eins
Ein verlorener Brief findet seinen Bestimmungsort
Eine Erinnerung bringt Klarheit
Die Bücher und die Birds
Raymond Blythe in Milderhurst
Verklungene Stimmen eines Gartens
Drei verblühte Schwestern
Hausgeister
Das leere Dachzimmer und die fernen Stunden
Der Modermann, das Familienarchiv und eine verschlossene Tür
Sag, dass du zum Tanz kommst
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil zwei
Das Buch von den nassen Zaubertieren
Ein Striplokal und Pandoras Büchse
Ein Gespräch im Wartezimmer
Endlich wieder zu Hause
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Teil drei
Entführungen und Schuldzuweisungen
Die Handlung wird ziemlich kompliziert
Kapitel 1
Kapitel 2
Die Kleinanzeigen
Eine Einladung und eine Neuauflage
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil vier
Zurück auf Schloss Milderhurst
Ein Fauxpas und ein Coup
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Mrs. Birds Verdacht
Der Abend, an dem er nicht kam
Das Familienarchiv und eine Entdeckung
Ein tiefer Sturz
Die Geschichte von Percy Blythe
Eine Nacht im Schloss
Der Tag danach
Und zum Schluss
Teil fünf
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Epilog
Danksagung
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Leseprobe: Kate Morton, Die Tochter des Uhrmachers
litlove
Orientierungsmarken
Widmung
Hauptteil
Epilog
Inhaltsverzeichnis
Copyright-Seite
Titelseite
Hauptteil
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
The Distant Hours bei Allen & Unwin, Australia
Copyright © Kate Morton 2010
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Diana Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion | Heiko Arntz
Herstellung | Gabriele Kutscha
Satz | Leingärtner, Nabburg
Covergestaltung: t.mutzenbach design
Covermotiv: Shutterstock.com (vanhurck, ZoranKrstic, TEEDA.Y, Natalya Voronova, Dave Head, Pawel Piotr)
ISBN 978-3-641-05277-5V004
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Teil eins
Ein verlorener Brief findet seinen Bestimmungsort – 1992
Eine Erinnerung bringt Klarheit
Die Bücher und die Birds
Raymond Blythe in Milderhurst
Verklungene Stimmen eines Gartens
Drei verblühte Schwestern
Hausgeister
Das leere Dachzimmer und die fernen Stunden
Der Modermann, das Familienarchiv und eine verschlossene Tür
Sag, dass du zum Tanz kommst
Kapitel 1 – 29. Oktober 1941
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Teil zwei
Das Buch von den nassen Zaubertieren – 1992
Ein Striplokal und Pandoras Büchse
Ein Gespräch im Wartezimmer
Endlich wieder zu Hause
Kapitel 1 – London, 4. September 1939
Kapitel 2 – Dorf Milderhurst, 4. September 1939
Kapitel 3 – Schloss Milderhurst, 4. September 1939
Kapitel 4
Teil drei
Entführungen und Schuldzuweisungen – 1992
Die Handlung wird ziemlich kompliziert
Kapitel 1 – Milderhurst, Schlossgarten, 14. September 1939
Kapitel 2
Die Kleinanzeigen – 1992
Eine Einladung und eine Neuauflage
Kapitel 3 – Samstag, 20. April 1940
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil vier
Zurück auf Schloss Milderhurst – 1992
Ein Fauxpas und ein Coup
Kapitel 1 – London, 22. Juni 1941
Kapitel 2
Kapitel 3 – London, 17. Oktober 1941
Kapitel 4 – London, 19. Oktober 1941
Mrs. Birds Verdacht – 1992
Der Abend, an dem er nicht kam
Das Familienarchiv und eine Entdeckung
Ein tiefer Sturz
Die Geschichte von Percy Blythe
Eine Nacht im Schloss
Der Tag danach
Und zum Schluss
Teil fünf
Kapitel 1 – Schloss Milderhurst, 29. Oktober 1941
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Epilog
Danksagung
Für Kim Wilkins, die mich ermutigt hat anzufangen; und Davin Patterson, der bis zum letzten Punkt an meiner Seite war.
Schsch! Hörst du ihn?
Die Bäume hören ihn. Sie wissen als Erste, dass er kommt.
Horch! Im tiefen, dunklen Wald erzittern die Bäume, ihre Blätter rascheln wie Silberfolie, ein verstohlener Wind geistert und schlängelt sich glitzernd durch ihre Kronen und flüstert, dass es bald anfangen wird.
Die Bäume wissen es, denn sie sind alt und haben es schon vielmals erlebt.
Es ist Neumond.
Es ist Neumond, wenn der Modermann kommt. Die Nacht hat sich weiche Lederhandschuhe übergezogen und ein schwarzes Laken über dem Land ausgebreitet, eine List, eine Verkleidung, ein Bann, damit alles in süßem Schlaf schlummert.
Undurchdringliches Dunkel. Doch auch die Dunkelheit hat ihre Nuancen, ihre Konturen. Schau: Der dichte Wald ist ein rauer Pelz, die Felder sind eine Flickendecke, das Wasser im Schlossgraben glänzt wie Sirup.
Und dennoch. Wenn du nicht ganz großes Pech hast, siehst du nicht, dass sich etwas bewegt hat, dort, wo sich nichts regen dürfte. Und du kannst dich glücklich schätzen, denn niemand, der gesehen hat, wie der Modermann sich erhebt, lebt lange genug, um später davon zu berichten.
Da – siehst du? Der stille, schwarze Schlossgraben, der schlammige Schlossgraben liegt nicht mehr spiegelglatt da. Eine Blase hat sich gebildet, wo er am breitesten ist, eine große Blase, ein leichtes Kräuseln rundherum, eine Ahnung …
Aber du hast dich abgewendet! Und das war klug. Ein solcher Anblick ist nichts für deinesgleichen. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit lieber dem Schloss zu, denn auch dort regt sich etwas.
Hoch oben im Turm.
Schau hin, und du wirst es sehen.
Ein kleines Mädchen schlägt seine Decke zurück.
Man hat es Stunden zuvor zu Bett gebracht; im Nebenzimmer schnarcht seine Kinderfrau leise, träumt von Seife und Lilien und hohen Gläsern mit warmer, frischer Milch. Aber irgendetwas hat das Mädchen geweckt. Vorsichtig setzt es sich auf, rutscht über das saubere weiße Laken, stellt die blassen, schmalen Füße auf den Holzboden.
Kein Mond steht am Himmel, den es anschauen oder der ihm Licht spenden könnte, und doch fühlt es sich zum Fenster hingezogen. Das blasige Glas ist kalt; das Mädchen spürt das Flirren der eiskalten Nachtluft, als es auf das halbhohe Bücherregal mit den ausrangierten Kinderbüchern klettert, den Opfern seiner Ungeduld, erwachsen und flügge zu werden. Es zieht das Nachthemd über die blassen Beine und legt das Kinn in die Mulde, die sich zwischen den Knien bildet.
Die Welt ist da draußen, Menschen bewegen sich darin wie Aufziehpuppen.
Ds alles will es sich demnächst mit eigenen Augen ansehen. Zwar sind alle Türen in diesem Schloss mit schweren Schlössern und die Fenster mit Riegeln versehen, aber sie dienen dazu, den dort draußen nicht hereinzulassen, nicht dazu, das Mädchen festzuhalten.
Der dort draußen.
Das Mädchen hat Geschichten über ihn gehört. Er ist eine Geschichte. Er ist eine alte Legende, und die Riegel und Schlösser sind Überreste einer Zeit, als die Menschen noch an solche Dinge glaubten. An Gerüchte über Ungeheuer in Schlossgräben, die auf der Lauer lagen, um Jagd auf schöne Jungfrauen zu machen. Über einen Mann, dem vor langer Zeit ein Unrecht getan wurde und der immer und immer wieder auf Rache sinnt.
Aber das kleine Mädchen – es würde finster dreinblicken, wenn es wüsste, dass man es so bezeichnet – fürchtet sich nicht mehr vor den Ungeheuern und Märchen seiner Kindheit. Es ist unruhig. Es ist ein Kind der modernen Zeit und es ist auch nicht mehr klein und es will endlich fort. Dieses Fenster, diese Burg können ihm nichts mehr bieten, aber vorerst muss es sich damit begnügen, und so schaut es niedergeschlagen hinaus.
Da draußen, in der Ferne, im Tal zwischen den Hügeln, sinkt das Dorf in den Schlaf. Ein dumpf rumpelnder Zug, der letzte an diesem Abend, kündigt seine Ankunft an: ein einsamer Ruf, der unbeantwortet bleibt. Der Bahnhofswärter mit Schirmmütze stolpert heraus, um die Kelle zu heben. Im nahe gelegenen Wald begutachtet ein Wilderer seine frisch erlegte Beute und träumt davon, nach Hause ins Bett zu kommen, während am Dorfrand, in einer Hütte, wo die Farbe von den Wänden abblättert, ein Neugeborenes weint.
Vollkommen gewöhnliche Vorkommnisse in einer Welt, wo alles einen Sinn ergibt. Wo man Dinge sieht, wenn sie da sind, und Dinge, die nicht da sind, allenfalls vermisst. Eine ganz andere Welt als die, in der das Mädchen erwacht ist.
Denn dort unten, ganz nahe bei dem Mädchen, das seinen Blick in die Ferne schweifen lässt, geschieht etwas.
Der Graben hat angefangen zu atmen. Tief, tief unten im Schlamm schlägt das nasse Herz des begrabenen Mannes. Ein leises Geräusch wie das Stöhnen des Windes steigt aus den Tiefen auf und vibriert dicht über der Oberfläche. Das Mädchen hört es, nein, es spürt es, denn die Fundamente des Schlosses sind eins mit dem Schlamm, und das Stöhnen dringt durch die Steine, die Mauern empor, Stockwerk für Stockwerk und unmerklich durch das Bücherregal, auf dem es sitzt. Ein einst heiß geliebtes Buch fällt um, und das Mädchen im Turm erschrickt.
Der Modermann öffnet ein Auge. Verschlagen blickt es hin und her. Denkt er in diesem Augenblick an seine verlorene Familie? An die hübsche, zierliche Frau und die beiden kleinen, wohlgenährten Kinder, die er zurückgelassen hat? Oder gehen seine Gedanken noch weiter zurück, zu den Tagen seiner Kindheit, als er mit seinem Bruder über die Wiesen, durch das hohe Gras lief? Oder denkt er vielleicht an die andere Frau, die ihn vor seinem Tod liebte? An ihre Schmeicheleien und Aufmerksamkeiten, an ihre Weigerung, seine Weigerung hinzunehmen, was den Modermann am Ende alles gekostet hat …
Etwas verändert sich. Das Mädchen spürt es und fröstelt. Legt eine Hand an die eisige Fensterscheibe, wo sie auf dem feuchten Film einen sternförmigen Abdruck hinterlässt. Die Geisterstunde ist angebrochen, auch wenn das Mädchen nicht weiß, dass man sie so nennt. Jetzt ist niemand mehr da, der ihm helfen kann. Der Zug ist fort, der Wilddieb kuschelt sich an seine Frau, und selbst das Neugeborene schläft und hat es aufgegeben, der Welt mitzuteilen, was es weiß.
Im Schloss ist nur das Mädchen am Fenster wach. Die Kinderfrau hat aufgehört zu schnarchen, und sie atmet so leicht, dass man meinen könnte, sie sei erfroren. Auch die Vögel im Wald sind still, sie haben die Köpfchen unter die zitternden Flügel gesteckt und die Augen zu dünnen, grauen Linien geschlossen, um nicht sehen zu müssen, was sich da nähert.
Nur das Mädchen ist wach. Und der Mann, der im Schlamm erwacht ist. Sein Herz pumpt jetzt schneller, denn seine Zeit ist gekommen, und sie ist kurz bemessen. Er bewegt seine Hand-und Fußgelenke und steigt aus seinem schlammigen Bett.
Sieh nicht hin. In Gottes Namen, schau dir nicht an, wie er durch die Oberfläche bricht, wie er aus dem Graben steigt, wie er sich auf dem schwarzen, nassen Ufer aufrichtet, die Arme streckt und Luft holt. Wie er sich erinnert, wie es sich anfühlt zu atmen, zu lieben, zu leiden.
Schau dir lieber die Gewitterwolken an. Selbst in der Dunkelheit kannst du sie kommen sehen. Wütende, wie Fäuste geballte Wolken, die sich übereinanderwälzen und miteinander ringen, bis sie sich direkt über dem Turm vereinen. Bringt der Modermann das Gewitter oder das Gewitter den Modermann? Niemand weiß es.
In seinem Zimmer neigt das Mädchen den Kopf, als die ersten, zögernden Tropfen gegen die Fensterscheibe und seine Hand klatschen. Es war ein schöner Tag, nicht zu heiß, der Abend war kühl. Nichts deutete auf mitternächtlichen Regen hin. Am nächsten Morgen werden die Leute sich über die feuchte Erde wundern, sie werden sich am Kopf kratzen, einander anlächeln und sagen: Das ist ja ein Ding! Und wir sind nicht einmal wach geworden!
Aber sieh nur! Was ist das? Eine unförmige Gestalt klettert an der Turmmauer hoch. Sie klettert schnell und geschickt, wie es eigentlich unmöglich ist. So ein Kunststück kann doch kein Mensch vollbringen!
Die Gestalt erreicht das Fenster des Mädchens. Zwei Augen vor seinen Augen. Das Mädchen sieht sie durch das blasige Glas, durch den Regen, der jetzt in Strömen fällt, sieht ein schlammbedecktes, abscheuliches Geschöpf. Das Mädchen öffnet den Mund, um zu schreien, um Hilfe zu rufen, aber genau in diesem Moment verwandelt sich die Szene.
Er
Teil eins
Ein verlorener Brief findet seinen Bestimmungsort
1992
Es begann mit einem Brief. Ein Brief, der lange verschollen war, der ein halbes Jahrhundert überdauert hatte, heiße Sommer und kalte Winter, in einem vergessenen Postbeutel auf dem dämmrigen Dachboden eines unscheinbaren Hauses in Bermondsey. Ich muss manchmal daran denken, an diesen Postbeutel, an die Hunderte von Liebesbriefen, Lebensmittelrechnungen, Geburtstagskarten, Kinderbriefen an die Eltern, die dort beieinanderlagen, bebten und seufzten, während ihre nie angekommenen Botschaften im Dunkeln flüsterten. Wie sie darauf warteten und warteten, dass jemand sie fand. Denn es heißt, dass ein Brief immer einen Leser sucht, dass Worte, ob es einem gefällt oder nicht, es an sich haben, den Weg ans Licht zu finden, ihre Geheimnisse preiszugeben.
Aber ich werde sentimental – eine Angewohnheit aus der Zeit, als ich mit einer Taschenlampe Romane aus dem neunzehnten Jahrhundert las, während meine Eltern glaubten, ich schliefe. Eigentlich wollte ich sagen: Merkwürdig – hätte Arthur Tyrell an jenem Heiligabend 1941 nicht einen oder zwei Grog zu viel getrunken und wäre er nicht nach Hause gegangen und betrunken eingeschlafen, anstatt die Post auszutragen, hätte der Postbeutel nicht all die Jahre unbemerkt auf seinem Dachboden gelegen, bis Arthur Tyrell fünfzig Jahre später starb und eine seiner Töchter den Beutel fand und bei der Daily Mail anrief, dann wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Für meine Mutter, für mich und vor allem für Juniper Blythe.
In allen Zeitungen und in den Fernsehnachrichten wurde darüber berichtet. Channel 4 hat sogar eine Sondersendung gebracht, in der einige der Empfänger über ihren Brief sprechen sollten, über die Stimme aus der Vergangenheit, die so unerwartet zu ihnen sprach. Da war eine Frau, deren Verlobter damals bei der Royal Air Force gewesen war, und dann dieser Mann mit der Geburtstagskarte von seinem Sohn, der evakuiert worden und eine Woche später von einem Bombensplitter getötet worden war. Es war eine gute Sendung, fand ich – teilweise sehr rührend, mit manchmal kuriosen, manchmal traurigen Geschichten, das Ganze angereichert mit Originalaufnahmen aus dem Krieg. Ein paarmal musste ich sogar weinen, was allerdings nicht viel heißen will, denn ich habe ziemlich nah am Wasser gebaut.
Meine Mutter hat bei der Sendung nicht mitgemacht. Man hatte sie angerufen und gefragt, ob in ihrem Brief etwas stand, was sie gern mitteilen wollte, aber sie hatte Nein gesagt, es habe sich nur um eine ganz gewöhnliche Bestellbestätigung von einem Bekleidungsgeschäft gehandelt, das es längst nicht mehr gebe. Aber das stimmte nicht. Das weiß ich, weil ich zufällig da war, als der Brief kam. Ich habe ihre Reaktion auf den Brief miterlebt, und die war alles andere als gewöhnlich.
Es war an einem Morgen Ende Februar, der Winter machte uns noch ordentlich zu schaffen, die Blumenbeete waren gefroren, und ich war gekommen, um meiner Mutter bei der Zubereitung des Sonntagsmahls zu helfen. Ich mache das hin und wieder, weil meine Eltern sich darüber freuen – obwohl es für gewöhnlich Hühnchen gibt und ich Vegetarierin bin und genau weiß, dass meine Mutter irgendwann im Lauf der Mahlzeit ein sorgenvolles Gesicht aufsetzt, bis sie es nicht mehr aushalten kann und anfängt, mir Vorträge über Proteinmangel und Anämie zu halten.
Ich stand gerade an der Spüle und schälte Kartoffeln, als der Brief durch den Schlitz in der Haustür fiel. Normalerweise kommt sonntags keine Post, und das hätte uns gleich auffallen sollen, aber das tat es nicht. Ich selbst war viel zu sehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich meinen Eltern beibringen sollte, dass Jamie und ich uns getrennt hatten. Seitdem waren schon zwei Monate vergangen, und irgendwann würde ich ihnen reinen Wein einschenken müssen, aber je länger ich es vor mir herschob, desto schwerer fiel es mir. Und ich hatte meine Gründe, warum ich nichts sagte: Meine Eltern waren Jamie gegenüber von Anfang an skeptisch gewesen. Außerdem können sie nicht gut mit Problemen umgehen, und meine Mutter würde sich noch mehr Sorgen machen, wenn sie hörte, dass ich jetzt allein in unserer Wohnung lebte. Aber vor allem fürchtete ich mich vor dem unausweichlichen, peinlichen Gespräch, das auf meine Eröffnung folgen würde. Zu sehen, wie sich im Gesicht meiner Mutter zuerst Verwunderung, dann Entgeisterung und schließlich Resignation spiegeln würde, wenn sie feststellte, dass von ihr als Mutter jetzt irgendeine Art von Trost erwartet würde …
Aber zurück zu dem Brief. Das Geräusch von etwas, das durch den Briefschlitz geschoben wurde und leise zu Boden fiel.
»Edie, kannst du mal nachsehen?«, sagte meine Mutter.
Sie deutete mit einer Kinnbewegung in Richtung Flur und gestikulierte mit der Hand, die sich nicht im Innern des Hühnchens befand.
Ich legte die Kartoffel weg, wischte mir die Hände an einem Geschirrtuch ab und ging die Post holen. Es war nur ein einzelner Brief, der auf der Fußmatte lag: ein offizieller Umschlag der Post, dessen Inhalt als »Nachsendung« deklariert wurde. Ich las meiner Mutter die Aufschrift vor, als ich in die Küche kam.
Sie hatte das Hühnchen fertig gefüllt und war gerade dabei, sich die Hände abzutrocknen. Stirnrunzelnd, eher aus Gewohnheit als aus Besorgnis, nahm sie den Brief entgegen und klaubte ihre Lesebrille von dem Kürbis in der Obstschale. Sie betrachtete den Postaufdruck und begann, den äußeren Umschlag zu öffnen.
Ich hatte mich wieder dem Kartoffelschälen zugewandt, eine Aufgabe, die mir im Moment dringlicher erschien, als meine Mutter beim Öffnen der Post zu beobachten, deswegen habe ich leider ihr Gesicht nicht gesehen, als sie den kleineren Umschlag hervorzog, das dünne Notpapier sah und die alte Briefmarke, als sie den Brief umdrehte und den Absender auf der Rückseite las. Aber seitdem habe ich mir oft vorgestellt, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich, wie ihre Finger zu zittern begannen, sodass es mehrere Minuten dauerte, ehe sie in der Lage war, den Umschlag aufzureißen.
Was ich mir nicht vorzustellen brauche, ist das Geräusch. Das entsetzte, kehlige Keuchen, gefolgt von heiserem Schluchzen, das so plötzlich kam, dass mir das Schälmesser abrutschte und in den Finger schnitt.
»Mum?« Ich ging zu ihr und legte ihr einen Arm um die Schultern, wobei ich darauf achtete, dass kein Blut auf ihr Kleid tropfte. Aber sie sagte nichts. Sie konnte es nicht, erzählte sie mir später, nicht in diesem Augenblick. Sie stand stocksteif da, und Tränen liefen ihr über die Wangen, während sie sich den Umschlag an die Brust drückte, einen seltsamen kleinen Umschlag aus so dünnem Papier, dass ich den gefalteten Brief darin erkennen konnte. Dann, nachdem sie ein paar wirre Anweisungen zu dem Hühnchen, dem Ofen und den Kartoffeln erteilt hatte, ging sie nach oben und verschwand in ihrem Schlafzimmer.
In der Küche wurde es bedrückend still, nachdem meine Mutter fort war, und ich schlich nur noch auf Zehenspitzen herum. Meine Mutter weint nicht leicht, aber dieser Augenblick – ihr Schreck und der Schock, den er bei mir auslöste – kam mir vage bekannt vor, als hätte ich dasselbe schon einmal erlebt.
Nach einer Viertelstunde, in der ich die Kartoffeln zu Ende geschält hatte, die Möglichkeiten durchgegangen war, wer der Absender des Briefs sein könnte, und mich gefragt hatte, wie ich mich verhalten sollte, klopfte ich schließlich an ihre Tür und fragte sie, ob sie eine Tasse Tee wolle. Sie hatte inzwischen die Fassung wiedergewonnen, und wir setzten uns einander gegenüber an den kleinen Resopaltisch in der Küche. Während ich so tat, als würde ich nicht bemerken, dass sie geweint hatte, begann sie zu sprechen.
»Ein Brief«, sagte sie, »von jemandem, den ich vor langer Zeit mal gekannt habe. Als ich zwölf, dreizehn Jahre alt war.«
Ein Bild fiel mir ein, an das ich mich dunkel erinnerte, ein Foto, das auf dem Nachttisch meiner Großmutter gestanden hatte, als sie im Sterben lag. Drei Kinder, das jüngste meine Mutter, ein Mädchen mit kurzem, dunklen Haar, das im Vordergrund auf etwas hockte. Seltsam, ich hatte Gott weiß wie oft am Bett meiner Großmutter gesessen und konnte mich doch nicht an das Gesicht des Mädchens erinnern. Vielleicht interessieren sich Kinder ja erst dann dafür, wer ihre Eltern vor ihrer Geburt waren, wenn etwas passiert, das mit der Vergangenheit zu tun hat. Ich trank meinen Tee und wartete darauf, dass meine Mutter fortfuhr.
»Ich glaube, ich habe dir nicht viel über diese Zeit erzählt, nicht wahr? Über die Zeit im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Es war eine schreckliche Zeit, all die Aufregung und die Zerstörung. Es schien …« Sie seufzte. »Na ja, es schien, als würde die Welt nie wieder normal werden. Als wäre sie aus dem Gleichgewicht geraten und nichts könnte sie wieder ins Lot bringen.« Sie legte ihre Hände um ihre dampfende Tasse und schaute hinein.
»Meine Familie – Mum, Dad, Rita, Ed und ich -, wir wohnten in einem kleinen Reihenhaus in der Barlow Street, im Stadtteil Elephant and Castle, und am Tag nachdem der Krieg ausgebrochen war, wurden wir Kinder in Schulen gesammelt, zum Bahnhof gebracht und in den Zug gesetzt. Das werde ich nie vergessen, wie wir in Reih und Glied zum Bahnhof marschierten, mit Namensschildern und Gasmasken und unseren Taschen, und wie die Mütter, denen es nicht geheuer war, dass wir fortgeschickt wurden, die Straße heruntergerannt kamen und dem Wachmann zuriefen, er solle ihre Kinder freilassen, und wie sie dann den älteren Geschwistern zuriefen, sie sollten auf die jüngeren achtgeben und sie nicht aus den Augen lassen.«
Eine Weile kaute sie auf ihrer Unterlippe, während sie das alles in ihrer Erinnerung noch einmal durchlebte.
»Du hast bestimmt große Angst gehabt«, sagte ich. In unserer Familie berührte man sich nie viel, sonst hätte ich vielleicht ihre Hand genommen.
»Anfangs ja.« Sie blickte auf und schaute mich an, dann nahm sie die Brille ab und rieb sich die Augen. Ohne ihre Brille wirkte sie verletzlich, ungeschützt, wie ein kleines, nachtaktives Tier, das vom Tageslicht verwirrt ist. Ich war froh, als sie die Brille wieder aufsetzte und fortfuhr. »Ich war noch nie von zu Hause weg gewesen, hatte noch nie eine Nacht getrennt von meiner Mutter verbracht. Aber meine älteren Geschwister waren ja bei mir, und als wir im Zug saßen und eine der Lehrerinnen Schokoladenriegel verteilte, wurde die Stimmung gelöster, und wir kamen uns beinahe vor wie auf einer Abenteuerreise. Kannst du dir das vorstellen? Es war Krieg, aber wir sangen Lieder und aßen Birnen aus Dosen und spielten ›Ich sehe was, was du nicht siehst‹. Kinder sind sehr belastbar, manche regelrecht gefühllos.
Irgendwann kamen wir in einer Stadt namens Cranbrook an. Dort wurden wir in kleineren Gruppen auf Busse verteilt. Der Bus, in dem meine Geschwister und ich saßen, brachte uns zu einem Dorf namens Milderhurst, wo wir in Zweierreihen zu einem Haus mit einem großen Saal marschierten. Ein paar Frauen aus dem Dorf erwarteten uns bereits mit einem eingefrorenen Lächeln und mit Listen in der Hand. Wir mussten uns in Reihen aufstellen, während die Leute umherliefen und ihre Wahl trafen.
Die Kleinen gingen schnell weg, vor allem die hübschen. Ich nehme an, die Leute dachten, dass sie mit denen weniger Arbeit haben würden, dass sie nicht so stark den Geruch von London an sich hätten.« Sie lächelte schief. »Die haben ihren Irrtum schnell eingesehen.
Mein Bruder wurde gleich zu Anfang ausgewählt. Er war groß und kräftig für sein Alter, und die Bauern brauchten dringend Helfer. Kurz darauf wurde Rita zusammen mit ihrer Schulfreundin mitgenommen.«
Ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich nahm die Hand meiner Mutter. »Ach, Mum.«
»Schon gut«, sagte sie, zog ihre Hand weg und gab mir einen Klaps auf die Finger. »Ich war nicht die Letzte. Es waren noch andere da. Zum Beispiel ein kleiner Junge mit fürchterlichem Hautausschlag. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber er stand immer noch in dem Saal, als ich ging.
Weißt du, später habe ich noch jahrelang angeschlagenes Obst gekauft, wenn ich es im Geschäft in die Hand genommen hatte. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, es erst von allen Seiten zu prüfen und dann wieder zurückzulegen, wenn ich sah, dass es Stellen hatte.«
»Aber irgendwann wurdest du mitgenommen.«
»Ja, irgendwann wurde ich mitgenommen.« Sie sprach plötzlich ganz leise und nestelte an etwas in ihrem Schoß herum. »Sie kam ziemlich spät. Der Saal war schon fast leer, die meisten Kinder waren fort, und die freiwilligen Helferinnen waren schon dabei, die Teetassen wegzuräumen. Ich hatte angefangen zu weinen, aber so, dass es niemand merkte. Dann plötzlich rauschte sie herein, und der ganze Saal, selbst die Luft wirkte wie verwandelt.«
»Verwandelt?« Ich zog die Nase kraus und dachte an diese Szene in Carrie, wo die Elektrik explodiert.
»Es ist schwer zu erklären. Hast du es schon mal erlebt, dass jemand sofort eine bestimmte Atmosphäre verbreitet, wohin er auch kommt?«
Vielleicht. Ich hob die Schultern. Meine Freundin Sarah ist eine Frau, nach der sich alle umdrehen, wenn sie auftaucht, nicht unbedingt ein atmosphärisches Phänomen, aber dennoch …
»Nein, natürlich kennst du das nicht. Es klingt ja auch albern … Was ich meine, ist, dass sie anders war, so … Ach, ich weiß nicht. Einfach anders. Schön auf eigenartige Weise, langes Haar, große Augen, mit denen sie sich wild umsah. Aber nicht nur das machte sie auffällig. Sie war damals erst siebzehn, im September 1939, aber die anderen Frauen wirkten wie eingeschüchtert.«
»Ehrfurchtsvoll?«
»Ja, ich glaube, so kann man es sagen, ehrfurchtsvoll. Sie waren überrascht, sie zu sehen, und unsicher, wie sie sich verhalten sollten. Irgendwann hat eine der Frauen ihre Sprache wiedergefunden und gefragt, ob sie behilflich sein könne, aber die junge Frau wedelte nur mit ihren langen Fingern und sagte, sie sei gekommen, um ihre Evakuierte abzuholen. Genau das hat sie gesagt – nicht eine Evakuierte, sondern ihre Evakuierte. Ich saß auf dem Boden, und sie ist direkt auf mich zugekommen. ›Wie heißt du?‹, wollte sie wissen, und als ich ihr meinen Namen nannte, hat sie mich angelächelt und gemeint, ich müsste doch bestimmt müde sein nach der langen Fahrt. ›Möchtest du gern mitkommen und bei mir wohnen?‹, fragte sie dann, und ich habe genickt, das nehme ich jedenfalls an, denn daraufhin hat sie sich zu der Frau umgedreht, die vorher so resolut aufgetreten war, der mit der Liste, und hat ihr erklärt, sie würde mich mitnehmen.«
»Wie hieß sie?«
»Blythe«, sagte meine Mutter, einen kaum wahrnehmbaren Schauder unterdrückend. »Juniper Blythe.«
»Und der Brief war von ihr?«
Meine Mutter nickte. »Sie hat mich zu ihrem Auto geführt, einem Luxusgefährt, wie ich es noch nie gesehen hatte, und ist mit mir zu dem Haus gefahren, wo sie zusammen mit ihren beiden älteren Schwestern lebte, Zwillingen. Es ging durch ein schmiedeeisernes Tor über eine gewundene Zufahrt zu einem riesigen, prächtigen Bau, der sich mitten in einem Wald befand. Schloss Milderhurst.«
Es war ein Name wie aus einem Schauerroman, und mich befiel ein leichtes Frösteln bei der Erinnerung an das Schluchzen meiner Mutter, als sie den Namen der Frau auf der Rückseite des Briefs gelesen hatte. Ich hatte schon alle möglichen Geschichten über evakuierte Kinder und merkwürdige Vorfälle gehört, und ich fragte mit tonloser Stimme: »War es unheimlich?«
»Nein, überhaupt nicht. Kein bisschen unheimlich. Ganz im Gegenteil.«
»Aber der Brief – du hast doch …«
»Ich war einfach überrascht, mehr nicht. Eine Erinnerung an eine Zeit, die ich längst vergessen hatte.«
Sie schwieg. Ich dachte darüber nach, wie einschneidend die Evakuierung gewesen war, wie angsteinflößend und verwirrend es für sie als Kind gewesen sein musste, an einen unbekannten Ort geschickt zu werden, wo alles anders war als zu Hause. Meine eigenen Kindheitserinnerungen waren mir noch sehr präsent, der Schrecken, den es bedeutet hatte, wenn man sich vorübergehend in einer fremden Umgebung befand, an die verzweifelten Bindungen, die man notgedrungen einging – an Gebäude, an verständnisvolle Erwachsene, an Freunde -, um die Zeit zu überstehen. Der Gedanke an die Freundschaften brachte mich auf eine Idee: »Bist du nach dem Krieg jemals wieder hingefahren, Mum? Nach Milderhurst?«
Sie blickte erschrocken auf. »Natürlich nicht. Warum hätte ich das tun sollen?«
»Ich weiß nicht. Um zu sehen, was sich verändert hatte, um die Leute wiederzusehen. Deine Freundin zu besuchen.«
»Nein«, erwiderte sie mit Bestimmtheit. »Ich hatte meine eigene Familie hier in London, meine Mutter brauchte mich. Außerdem hatten wir viel zu tun, die Aufräumarbeiten nach dem Krieg … Das Leben ist weitergegangen.« Und damit senkte sich der vertraute Schleier wieder zwischen uns, und ich wusste, dass das Gespräch vorbei war.
Am Ende gab es doch kein festliches Sonntagsmahl. Meine Mutter meinte, ihr sei nicht danach, und fragte, ob es mir etwas ausmachen würde, wenn wir das Hühnchen diesmal ausfallen ließen. Es schien mir lieblos, sie daran zu erinnern, dass ich sowieso kein Fleisch esse und eigentlich nur gekommen war, um meine Tochterpflichten zu erfüllen. Also erklärte ich mich einverstanden und riet ihr, sich ein bisschen hinzulegen. Gute Idee, sagte sie, und während ich meine Sachen zusammenpackte, war sie bereits dabei, zwei Aspirin zu schlucken, und ermahnte mich, meine Mütze aufzusetzen bei dem kalten Wind.
Mein Vater hat die ganze Angelegenheit verschlafen. Er ist älter als meine Mutter und seit einigen Monaten in Rente. Das Rentnerleben bekommt ihm nicht. Während der Woche streift er durchs Haus auf der Suche nach Dingen, die repariert werden müssen, und treibt meine Mutter in den Wahnsinn, und die Sonntage verbringt er in seinem Sessel. Das gottgegebene Recht des Hausherrn, erklärt er jedem, der es hören will.
Ich gab ihm einen Kuss auf die Wange und ging durch die eisige Kälte zur U-Bahn, müde und doch aufgewühlt und ein bisschen niedergeschlagen bei dem Gedanken, allein in die höllisch teure Wohnung zurückzukehren, die ich bis vor Kurzem mit Jamie geteilt hatte. Erst irgendwo zwischen Kensington High Street und Notting Hill Gate fiel mir auf, dass meine Mutter mir gar nicht gesagt hatte, was in dem Brief stand.
Eine Erinnerung bringt Klarheit
Während ich dies niederschreibe, bin ich ein bisschen von mir selbst enttäuscht. Aber hinterher ist man immer klüger, und jetzt, wo ich weiß, was es zu finden gab, frage ich mich natürlich, warum ich mich nicht gleich auf die Suche gemacht habe. Und ich bin nicht ganz dumm. Meine Mutter und ich trafen uns ein paar Tage später zum Tee. Auch diesmal traute ich mich nicht, ihr von den Veränderungen in meinem Leben zu erzählen, aber ich habe sie wenigstens nach dem Inhalt des Briefs gefragt. Sie winkte ab und sagte, es sei nichts von Bedeutung gewesen, nur ein knapper Gruß; dass ihre Reaktion allein der Überraschung geschuldet war. Da wusste ich noch nicht, dass meine Mutter eine gute Lügnerin ist, sonst hätte ich ihre Worte angezweifelt, hätte nachgehakt oder genauer auf ihre Körpersprache geachtet. Aber so etwas macht man halt nicht. Instinktiv neigt man dazu zu glauben, was die Leute einem sagen, vor allem in der Familie, bei Menschen, die man gut kennt, denen man vertraut. Zumindest ging es mir so. Bis dahin jedenfalls.
Und so vergaß ich das alles: Milderhurst und die Evakuierung meiner Mutter und sogar den eigenartigen Umstand, dass sie mir vorher noch nie davon erzählt hatte. Es ließ sich leicht erklären, wie die meisten Dinge, wenn man sich Mühe gibt: Meine Mutter und ich kamen gut miteinander aus, aber wir hatten uns nie sehr nahgestanden und waren nicht unbedingt erpicht darauf, uns vertraulich über die Vergangenheit auszutauschen. Über die Gegenwart übrigens auch nicht. Erst recht nicht über die Zukunft. Anscheinend war die Evakuierung für meine Mutter eine angenehme, aber unbedeutende Erfahrung gewesen, und so gab es keinen Grund, mir davon zu erzählen. Ich erzähle ihr weiß Gott auch nicht alles.
Schwerer zu erklären war das seltsame und zugleich heftige Gefühl, das ihre Reaktion auf den Brief in mir auslöste, die unerklärliche Gewissheit, dass es da eine Erinnerung gab, die ich einfach nicht zu fassen bekam. Etwas, das ich gesehen oder gehört und dann vergessen hatte und das jetzt durch die dunklen Windungen meines Gehirns geisterte, ohne irgendwo zu verharren, sodass ich es hätte benennen können. Und so zerbrach ich mir den Kopf, ob vielleicht vor Jahren, irgendwann einmal ein Brief eingetroffen war, der sie auch zum Weinen gebracht hatte. Aber es war zwecklos, das verschwommene Bild wurde nicht scharf, und schließlich sagte ich mir, dass wahrscheinlich meine Fantasie mit mir durchging, meine blühende Fantasie, von der meine Eltern schon immer gesagt hatten, sie würde mich noch eines Tages in Schwierigkeiten bringen, wenn ich nicht aufpasste.
Zudem drückten mich ganz andere, größere Sorgen. Nämlich die Frage, wo ich wohnen würde, wenn die Miete für die Wohnung fällig werden würde. Die Mietvorauszahlung für sechs Monate war Jamies Abschiedsgeschenk gewesen, eine Art Wiedergutmachung für sein miserables Verhalten. Aber im Juni war Schluss. Ich hatte in den Zeitungen und in den Schaufenstern von Immobilienbüros nach Ein-Zimmer-Apartments gesucht, aber bei meinem bescheidenen Gehalt erwies es sich als äußerst schwierig, etwas zu finden, das halbwegs in der Nähe meines Arbeitsplatzes lag.
Ich arbeite als Lektorin bei Billing & Brown, einer kleinen Verlagsdruckerei in Notting Hill, die Herbert Billing und Michael Brown Ende der Vierzigerjahre gegründet hatten, um ihre eigenen Theaterstücke und Gedichte herauszubringen. Ich glaube, anfangs genoss der Verlag hohes Ansehen, aber seit der Markt zunehmend von den Großverlagen beherrscht wird und das Interesse der Leser an Nischentiteln immer mehr zurückgeht, drucken wir nur noch Sachen, die wir unter uns wohlwollend als »Spezialität des Hauses« oder weniger wohlwollend als »Machwerk« bezeichnen.
Mr. Billing – Herbert – ist mein Chef, und er ist außerdem mein Mentor und mein bester Freund. Ich habe nicht viele Freunde, jedenfalls nicht von der lebenden, atmenden Sorte. Das heißt nicht, dass ich traurig und einsam bin, ich gehöre einfach nicht zu den Menschen, die gern eine Menge Leute um sich haben. Ich kann mich gut mit Worten ausdrücken, allerdings nicht mit gesprochenen, und ich habe schon oft gedacht, wie wunderbar es doch wäre, wenn ich Beziehungen auf dem Papier führen könnte. In gewisser Weise tue ich das sogar, denn ich habe zig Freunde der anderen Sorte, Freunde zwischen Buchdeckeln, auf Hunderten von Seiten, gefüllt mit großartigen Geschichten, die nie ihre Faszination für mich verlieren, die mich an die Hand nehmen und in Welten von abgrundtiefem Schrecken oder überwältigender Freude führen. Faszinierende, verehrungswürdige, treue Wegbegleiter – einige davon voller Weisheit -, die mir aber leider kein Gästezimmer für einen oder zwei Monate anbieten können.
Denn obwohl ich keine Erfahrung mit Trennungen hatte – Jamie war der erste Freund, mit dem ich mir eine Zukunft hatte vorstellen können -, war mir irgendwie klar, dass dies der Moment war, in dem man Freunde um eine Gefälligkeit bat. Weswegen ich mich an Sarah wandte. Wir waren Nachbarskinder und sind zusammen aufgewachsen, und Sarah flüchtete immer zu uns, wenn ihre vier jüngeren Geschwister sich in kleine Monster verwandelten. Es schmeichelte mir, dass ein Mädchen wie Sarah unser biederes Reihenhaus als Zufluchtsort erwählte, und wir blieben beste Freundinnen während der ganzen Schulzeit, bis Sarah mal wieder beim Rauchen hinter den Toiletten erwischt wurde und den Mathematikunterricht gegen eine Ausbildung zur Kosmetikerin eintauschte. Inzwischen arbeitet sie freiberuflich für Zeitschriften und beim Film. Ich freute mich für sie, dass sie solchen Erfolg hatte, aber leider bedeutete das auch, dass sie in der Stunde meiner Not gerade in Hollywood weilte, wo sie Schauspieler in Zombies verwandelte, und ihre Wohnung samt Gästezimmer an einen österreichischen Architekten untervermietet hatte.
Eine Zeit lang war ich sehr beunruhigt und malte mir detailreich ein Leben als Obdachlose aus, bis Mr. Billing – Herbert – mir, wie ein echter Kavalier, das Sofa in seiner kleinen Wohnung über dem Verlag anbot.
»Nach allem, was du für mich getan hast?«, rief er aus, als ich ihn fragte, ob er sich auch ganz sicher sei. »Du hast mich vom Boden aufgelesen! Du hast mich gerettet!«
Er übertrieb. Ich habe ihn nie am Boden liegend vorgefunden, aber ich wusste, was er meinte. Ich war schon seit ein paar Jahren im Verlag und war gerade dabei, mich nach einer etwas anspruchsvolleren Stelle umzusehen, als Mr. Brown starb. Der Tod seines Partners war ein solcher Schicksalsschlag für Mr. Billing, dass ich ihn in dem Moment unmöglich alleinlassen konnte. Er hatte niemanden außer seinem verfressenen, übergewichtigen Hund, und auch wenn er nie darüber gesprochen hat, so wurde mir doch durch das Ausmaß und die Intensität seiner Trauer klar, dass Mr. Brown und er mehr als Geschäftspartner gewesen waren. Er aß nichts mehr, wusch sich nicht mehr und betrank sich, als eingefleischter Abstinenzler, eines Morgens mit Gin.
Mir blieb eigentlich keine Wahl: Ich begann für ihn zu kochen, konfiszierte den Gin, und wenn wir in die roten Zahlen gerieten und ich sein Interesse nicht wecken konnte, übernahm ich es, Klinken zu putzen, um uns Aufträge zu besorgen. Seitdem drucken wir Prospekte für ortsansässige Unternehmen. Als Mr. Billing davon erfuhr, war er so glücklich, dass er meinen Einsatz reichlich überbewertete. Er fing an, mich als seinen Protegé zu bezeichnen und sprach auf einmal wieder voller Zuversicht über die Zukunft von Billing & Brown, darüber, wie er und ich den Verlag zu Ehren von Mr. Brown wieder auf die Beine stellen würden. Seine Augen begannen wieder zu leuchten, und ich schob meine Suche nach einem anderen Job vorerst auf.
Und seitdem sind acht Jahre vergangen. Was Sarah ziemlich amüsiert. Es ist schwierig, jemandem wie Sarah, einer kreativen, klugen Frau, die ausschließlich nach ihren eigenen Bedingungen arbeitet, zu erklären, dass andere Menschen andere Kriterien für ihr Wohlbefinden im Leben haben. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich bewundere, ich verdiene genug Geld, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten (wenn auch nicht in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Notting Hill), ich verbringe meine Tage damit, mit Wörtern und Sätzen zu spielen, und helfe dadurch anderen Leuten, ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen und sich den Traum zu erfüllen, ein gedrucktes Buch zu veröffentlichen. Außerdem ist es nicht so, dass ich keine Aufstiegschancen hätte. Erst im vergangenen Jahr hat Herbert mich zur stellvertretenden Verlagsleiterin befördert – auch wenn wir zwei die einzigen Vollzeitkräfte im Verlag sind. Es gab sogar eine kleine Zeremonie mit allem Drum und Dran. Susan, unsere Teilzeitkraft, hat einen Trockenkuchen gebacken und ist an ihrem freien Tag ins Büro gekommen, und wir haben mit alkoholfreiem Wein angestoßen, den wir aus Teetassen tranken.
Angesichts der drohenden Räumung nahm ich Mr. Billings Angebot an. Es war eine ausgesprochen rührende Geste, vor allem, da seine Wohnung wirklich sehr klein ist, aber es war meine einzige Option. Herbert freute sich riesig. »Wunderbar! Das wird Jess gefallen, sie ist immer ganz aus dem Häuschen, wenn Besuch kommt.«
Und so war ich in jenem Mai gerade dabei, die Wohnung, die ich mit Jamie geteilt hatte, leer zu räumen und die letzte, leere Seite unserer Geschichte umzublättern, um allein eine neue zu beginnen. Ich hatte meine Arbeit, meine Gesundheit und jede Menge Bücher; nun musste ich tapfer den grauen, einsamen Tagen entgegensehen, die sich endlos vor mir erstreckten.
Alles in allem kam ich ganz gut zurecht. Nur hin und wieder gestattete ich es mir, in den Tümpel meiner Gefühlsduselei zu tauchen. Dann suchte ich mir eine stille, dunkle Ecke – wo ich mich besonders gut meiner Fantasie hingeben konnte – und malte mir in allen Einzelheiten die traurigen Tage aus, an denen ich durch unsere Straße schleichen, vor unserem Haus stehen bleiben und zu dem Fenster hochblicken würde, wo ich meine Kräuter gezogen hatte und wo jetzt die Silhouette eines Fremden erscheinen würde. Stellte mir vor, wie ich einen Blick auf die unsichtbare Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu werfen versuchte und den körperlichen Schmerz der Gewissheit spüren würde, dass es keinen Weg zurück gab …
Als Kind war ich eine Träumerin und habe meine arme Mutter damit zur Verzweiflung gebracht. Wenn ich mal wieder durch eine Pfütze stapfte oder wenn sie mich aus dem Rinnstein zerren musste, um mich vor dem 209er-Bus zu retten, sagte sie jedes Mal kopfschüttelnd: »Es ist gefährlich, am helllichten Tag zu träumen!« oder »So passieren Unfälle, Edie! Du musst aufpassen!«
Meine Mutter hatte gut reden, sie war die pragmatischste Frau, die je geboren wurde. Aber was nützten ihre Ermahnungen einem Mädchen, das ganz in seiner eigenen Welt lebte, seit es sich die Frage stellen konnte: »Was wäre, wenn …?« Natürlich hörte ich nicht auf zu träumen, ich lernte nur, es besser zu verbergen. Aber in gewisser Weise behielt sie recht, denn mein Hang, mich in Gedanken ausschließlich mit der trübseligen, freudlosen Nach-Jamie-Zukunft zu beschäftigen, führte dazu, dass ich vollkommen unvorbereitet war auf das, was dann geschah.
Ende Mai rief ein Mann im Verlag an, der sich selbst zum Medium ernannt hatte und ein Manuskript über seine Erfahrungen mit der Geisterwelt in der Romney Marsh veröffentlichen wollte. Wenn ein potenzieller neuer Kunde uns kontaktiert, tun wir, was wir können, um ihn zufriedenzustellen, und so kam es, dass ich in Herberts altem Peugeot nach Essex fuhr, um mich mit dem Mann zu treffen und wenn möglich einen Vertrag mit ihm abzuschließen. Da ich nur selten Auto fahre und volle Autobahnen verabscheue, machte ich mich vor Tagesanbruch auf den Weg, in der Hoffnung, dass ich auf diese Weise unbeschadet aus London herauskommen würde.
Ich war um neun Uhr dort, das Gespräch verlief gut – wir wurden uns einig, es kam zum Vertrag -, und um Mittag war ich schon wieder auf dem Heimweg. Inzwischen herrschte wesentlich mehr Verkehr, dem Herberts Auto, mit dem man nicht schneller als neunzig fahren konnte, ohne zu riskieren, dass man ein Rad verlor, nicht gewachsen war. Obwohl ich, wenn möglich, auf der Kriechspur fuhr, wurde ich ständig angehupt und mit finsteren Blicken bedacht. Es tut der Seele nicht gut, als Ärgernis betrachtet zu werden, vor allem, wenn man keine Wahl hat. Also verließ ich in Ashford die Autobahn und fuhr weiter über Landstraßen und Dörfer. Mit meinem Orientierungssinn ist es nicht weit her, aber im Handschuhfach lag ein Straßenatlas, und ich stellte mich darauf ein, regelmäßig anzuhalten und die Route im Atlas nachzuschlagen.
Nach einer halben Stunde hatte ich mich hoffnungslos verfahren. Ich weiß immer noch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber wahrscheinlich lag es unter anderem daran, dass der Atlas schon ziemlich überholt war. Und daran, dass ich gedankenverloren die Landschaft bewundert hatte – die mit Schlüsselblumen gesprenkelten Felder, die Wildblumen am Straßenrand -, anstatt auf die Straße zu achten. Wie auch immer, ich wusste nicht mehr, wo ich war, und fuhr gerade durch eine schmale, schattige Allee, als ich mir eingestehen musste, dass ich keinen blassen Schimmer hatte, in welche Himmelsrichtung ich überhaupt unterwegs war.
Aber noch machte ich mir keine Sorgen. Früher oder später würde ich auf eine Kreuzung stoßen oder zu einer Sehenswürdigkeit kommen oder den Stand eines Gemüsebauern finden, wo man mir netterweise ein großes, rotes X in meine Karte malen würde. Ich musste am Nachmittag nicht mehr ins Büro, alle Straßen führten schließlich irgendwohin, ich brauchte einfach nur die Augen offenzuhalten.
Und so entdeckte ich es. In einem Gestrüpp aus wild wucherndem Efeu. Es war einer von diesen alten, weiß gestrichenen Wegweisern aus Holz, in die die Ortsnamen geschnitzt sind. Milderhurst, stand darauf, 3 Meilen.
Als ich anhielt und das Schild noch einmal las, sträubten sich mir die Nackenhaare. Eine seltsame Ahnung überkam mich, und die verschwommene Erinnerung, die ich seit Februar, seit dem Eintreffen des Briefs bei meiner Mutter, nicht zu fassen bekam, nahm auf einmal Konturen an. Ich stieg aus wie in Trance und folgte dem Wegweiser. Mir war, als würde ich mich selbst von außen beobachten, ja, als wüsste ich im Voraus, was ich vorfinden würde. Und vielleicht war es auch so.
Denn nach einem knappen Kilometer, genau dort, wo ich es erwartet hatte, stand es. Aus einem dichten Brombeergestrüpp erhob sich ein großes, eisernes Tor, das einmal herrschaftlich gewesen war, dessen Flügel jetzt jedoch schief in den Angeln hingen. Sie lehnten gegeneinander, als würden sie gemeinsam eine schwere Last tragen. An dem kleinen Torhäuschen hing ein verrostetes Schild mit der Aufschrift »Schloss Milderhurst«.
Mein Herz pochte wie wild gegen meine Rippen, als ich die Straße überquerte und auf das Tor zuging. Ich packte mit jeder Hand eine Stange, spürte kaltes, raues, rostiges Eisen an den Handflächen. Langsam beugte ich mich vor und drückte die Stirn an das Tor. Mein Blick folgte dem Schotterweg, der in einem Bogen den Hügel hinauf und über eine Brücke führte, bis er sich in einem dichten Wald verlor.
Alles sah wunderschön und überwuchert und romantisch aus. Aber es war nicht der Anblick, der mir den Atem raubte. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag, die absolute Gewissheit, dass ich schon einmal hier gewesen war. Dass ich schon einmal vor diesem Tor gestanden, zwischen seinen eisernen Stangen hindurchgelugt und die Vögel beobachtet hatte, die wie Fetzen des Nachthimmels über dem dichten Wald umherflatterten.
Einzelheiten gewannen an Schärfe, und es war, als träte ich in einen Traum ein, als wäre ich wieder das Kind von damals. Meine Finger umklammerten die Eisenstangen, irgendwo tief in meinem Körper erkannte ich die Geste wieder. Genau so hatte ich es schon einmal gemacht. Die Haut an meinen Handflächen erinnerte sich. Ich erinnerte mich. Ein sonniger Tag, eine warme Brise spielte mit meinem Kleid, meinem Sonntagskleid, am Rand meines Blickfelds der große Schatten meiner Mutter.
Aus dem Augenwinkel schaute ich zu ihr hinüber und sah, wie sie das Schloss betrachtete, die dunkle, ferne Silhouette am Horizont. Ich hatte Durst, ich schwitzte, ich wollte in dem See planschen, dessen glitzernde Oberfläche ich durch das Tor sehen konnte. Ich wollte mit den Enten und den Reihern und den Libellen, die zwischen dem Schilf am Ufer herumschossen, im Wasser schwimmen.
»Mum«, sagte ich, aber sie antwortete nicht. »Mum?« Sie wandte sich mir zu und schaute mich an, und für einen kurzen Moment schien sie mich nicht zu erkennen. In ihrem Gesicht lag ein Ausdruck, den ich nicht verstand. Sie war eine Fremde, eine Erwachsene, deren Augen Geheimnisse bargen. Heute kann ich diese seltsame Gefühlsmischung mit Worten beschreiben: Reue, Liebe, Trauer, Sehnsucht. Aber damals war ich ratlos. Erst recht, als sie sagte: »Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte nicht herkommen sollen. Es ist zu spät.«
Ich glaube nicht, dass ich etwas darauf erwidert habe. Jedenfalls nicht gleich. Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte, und ehe ich dazu kam, sie zu fragen, packte sie mich an der Hand und zog mich so ruppig, dass mir die Schulter wehtat, von dem Tor weg und über die Straße zu unserem Auto. Vage roch ich ihr Parfüm, das sich mit der warmen Luft, mit den ungewohnten Landgerüchen mischte. Sie ließ den Motor an, und wir fuhren los. Ich beobachtete gerade zwei Spatzen durch das Seitenfenster, als ich es hörte. Es war der kehlige Schluchzer, der gleiche kehlige Schluchzer, den sie ausgestoßen hatte, als der Brief von Juniper Blythe eintraf.
Die Bücher und die Birds
Das Tor zum Schloss war verriegelt und viel zu hoch, um hinüberzuklettern – nicht dass ich es versucht hätte, wenn es niedriger gewesen wäre. Ich bin schon immer ziemlich unsportlich gewesen, und jetzt, nachdem die Erinnerung zurückgekehrt war, hatte ich Pudding in den Knien. Ich fühlte mich sonderbar verloren und hilflos. Ich ging zu meinem Wagen zurück und saß eine Weile da und überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte. Viele Möglichkeiten hatte ich nicht. Ich war viel zu aufgewühlt, um Auto zu fahren, erst recht die lange Strecke bis London, und so ließ ich schließlich den Motor an und fuhr im Schritttempo ins Dorf Milderhurst.
Auf den ersten Blick sah es genauso aus wie all die anderen Dörfer, durch die ich an dem Tag gekommen war: eine einzige Straße mit einem kleinen Rasenplatz am Ende, daneben eine Kirche und gegenüber eine Schule. Als ich vor dem Gemeindehaus parkte, sah ich plötzlich all die müden Londoner Schulkinder vor mir, rußverschmiert nach der endlosen Zugfahrt Richtung Osten. Ein geisterhaftes Bild von meiner Mutter, vor vielen Jahren, lange, bevor sie meine Mutter wurde, wie sie sich mit den anderen Kindern in Reih und Glied aufstellt und auf eine ungewisse Zukunft wartet.
Ich schlenderte die Hauptstraße entlang und versuchte vergeblich, meine aufgescheuchten Gedanken im Zaum zu halten. Also gut, meine Mutter war noch einmal nach Milderhurst zurückgekommen, und ich war bei ihr gewesen. Wir hatten vor dem großen Tor gestanden, und sie war völlig durcheinander gewesen. Ich konnte mich wieder daran erinnern. Es war passiert. Aber mit der einen Antwort, die ich gefunden hatte, waren nur lauter neue Fragen aufgetaucht und schwirrten um meinen Kopf wie Motten ums Licht. Warum waren wir hier gewesen? Warum hatte sie geweint? Was hatte sie gemeint, als sie zu mir gesagt hatte, sie habe einen Fehler gemacht, es sei zu spät? Und warum hatte sie mich vor drei Monaten angelogen, als sie gesagt hatte, der Brief von Juniper Blythe habe keine Bedeutung?
Die Fragen kreisten noch in meinem Kopf, als ich mich unverhofft vor der offenen Tür eines Buchladens wiederfand. Ich glaube, es ist etwas ganz Natürliches, dass man sich in Zeiten großer Verwirrung dem Vertrauten zuwendet. Die hohen Regale und die zahllosen säuberlich aufgereihten Buchrücken übten eine ungemein beruhigende Wirkung auf mich aus. Umgeben von dem Geruch nach Druckerschwärze und Leim, den Staubflöckchen, die im streifigen Sonnenlicht tanzten, der warmen, stillen Luft, konnte ich wieder freier atmen. Ich spürte, wie mein Puls sich beruhigte und meine Gedanken die Flügel anlegten. Es war schummrig in dem Laden, was mir nur recht war. Ich suchte nach meinen Lieblingsautoren wie eine Lehrerin, die ihre Schüler aufruft. Brontë – alle drei anwesend, Dickens – anwesend, Shelley – mehrere hübsche Ausgaben. Ich brauchte sie gar nicht aus dem Regal zu nehmen, um zu wissen, dass sie da waren; sie leicht mit den Fingern zu berühren reichte mir.
Ich ging an den Regalen vorbei, las die Titel auf den Buchrücken, stellte hier und da ein Buch, das an den falschen Platz geraten war, wieder richtig zurück, bis ich in den hinteren Teil des Ladens gelangte, der nicht mit Regalen vollgestellt war. Auf einem Tisch in der Mitte stand ein Schild mit der Aufschrift: »Heimatgeschichten«. Daneben stapelten sich Heimatkundebücher, Bildbände und Bücher von Autoren aus der Gegend. Geschichten von Mordbrennern, Landfahrern, Vagabunden; Die Abenteuer der Schmuggler von Hawkhurst; Eine kleine Geschichte des Hopfenanbaus. In der Mitte, auf einem hölzernen Ständer, entdeckte ich einen Titel, der mir vertraut war: Die wahre Geschichte vom Modermann.
»Ach!«, rief ich, nahm es vom Tisch und drückte es an mich.
»Mögen Sie die Geschichte?« Wie aus dem Nichts war die Verkäuferin aufgetaucht und schüttelte ihr Staubtuch aus.
»Ja«, sagte ich. »Natürlich. Wer mag sie nicht?«
Als ich Die wahre Geschichte vom Modermann zum ersten Mal las, war ich zehn Jahre alt und lag krank im Bett. Ich glaube, ich hatte Mumps – eine von diesen Kinderkrankheiten, die einen für Wochen ans Bett fesseln, und ich muss ziemlich quengelig gewesen sein, denn das mitfühlende Lächeln meiner Mutter war immer verkniffener geworden. Eines Nachmittags, als sie sich eine kurze Atempause auf der High Street gegönnt hatte, kam sie mit frischem Optimismus zurück und drückte mir ein zerlesenes Buch aus der Bücherei in die Hand.
»Vielleicht muntert dich das ein bisschen auf«, sagte sie vorsichtig. »Es ist eigentlich für etwas ältere Kinder, aber du bist ja ein kluges Mädchen, und wenn du dir Mühe gibst, wirst du es schon verstehen. Es ist zwar dicker als die Bücher, die du sonst liest, aber versuch mal, es zu Ende zu lesen.«
Wahrscheinlich habe ich, anstatt ihr zu antworten, nur voller Selbstmitleid gehustet, ahnte ich doch nicht, dass ich kurz davorstand, eine Schwelle in eine Welt zu überschreiten, aus der es kein Zurück geben würde, dass ich etwas in den Händen hielt, dessen bescheidenes Erscheinungsbild seine Macht Lügen strafte. Jeder wahre Leser hat ein Buch, hat einen Moment wie den erlebt, wie ich ihn hier beschreibe, und als meine Mutter mir das Buch aus der Bücherei mitbrachte, war mein entscheidender Moment gekommen. Damals wusste ich es noch nicht, aber nachdem ich tief in die Welt vom Modermann eingetaucht war, konnte die Wirklichkeit nie wieder mit der Welt der Romane konkurrieren. Seitdem bin ich Miss Perry unendlich dankbar, denn als sie diesen Roman über den Tresen schob und meiner gestressten Mutter zuredete, ihn mir zum Lesen zu geben, hatte sie mich entweder mit einem viel älteren Mädchen verwechselt, oder sie hatte tief in meine Seele geschaut und dort ein Vakuum entdeckt, das gefüllt werden musste. Ich gehe von Letzterem aus. Schließlich besteht die eigentliche Aufgabe einer Bibliothekarin darin, ein Buch mit seinem wahren Leser zusammenzubringen.
Ich schlug das vergilbte Buch auf, und vom ersten Absatz an, in dem beschrieben wird, wie der Modermann in dem tiefen, dunklen Schlossgraben aufwacht, von dem furchtbaren Moment an, in dem sein Herz zu schlagen beginnt, ließ es mich nicht mehr los. Mein Herz klopfte, ich bekam eine Gänsehaut, meine Finger zitterten in Erwartung, Seite um Seite umblättern zu dürfen, die schon voller Eselsohren waren von den zahllosen Lesern, die die Reise vor mir angetreten hatten. Ich besuchte prächtige und furchterregende Orte, ohne das mit Papiertaschentüchern übersäte Sofa im Reihenhaus meiner Eltern jemals zu verlassen. Der Modermann hielt mich tagelang gefangen, meine Mutter begann wieder zu lächeln, mein geschwollenes Gesicht sah wieder normal aus, und mein neues Ich war geboren.
Noch einmal fiel mein Blick auf das handgeschriebene Schild – »Heimatgeschichten« -, und ich sagte zu der strahlenden Verkäuferin: »Raymond Blythe war also hier aus der Gegend?«
»Aber ja.« Sie schob sich feine Haarsträhnen hinter die Ohren. »Er hat oben in Schloss Milderhurst gelebt und geschrieben, und er ist auch dort gestorben. Das ist das prächtige Anwesen ein paar Kilometer außerhalb des Dorfs.« Ihre Stimme nahm einen wehmütigen Ton an. »Zumindest war es mal prächtig.«
Raymond Blythe. Schloss Milderhurst. Mein Herz klopfte inzwischen ziemlich heftig. »Hatte er vielleicht eine Tochter?«
»Er hatte sogar drei.«
»Hieß eine davon Juniper?«
»Genau. Das ist die jüngste.«
Ich dachte an meine Mutter, ihre Erinnerung an die Siebzehnjährige, die die Luft elektrisch aufgeladen hatte, als sie den Gemeindesaal betrat, um »ihre Evakuierte« abzuholen; die 1941 einen Brief geschrieben hatte, der meine Mutter hatte in Tränen ausbrechen lassen, als er fünfzig Jahre später eintraf. Plötzlich hatte ich das dringende Bedürfnis, mich irgendwo zu stützen.
»Die wohnen alle drei noch da oben«, fuhr die Verkäuferin fort. »Es muss was mit dem Wasser im Schloss zu tun haben, sagt meine Mutter immer; sie sind jedenfalls noch sehr rüstig. Außer der Jüngsten natürlich.«
»Was ist denn mit der Jüngsten?«
»Demenz. Ich glaube, das liegt in der Familie. Eine traurige Geschichte – sie muss mal eine ausnehmende Schönheit gewesen sein und klug dazu, als Schriftstellerin ein vielversprechendes Talent. Aber dann hat ihr Verlobter sie verlassen, damals im Krieg, und davon hat sie sich nie wieder erholt. Ist verrückt geworden. Sie hat immer darauf gewartet, dass er zu ihr zurückkommt, aber er ist nicht gekommen.«
Ich öffnete den Mund, um zu fragen, was aus dem Verlobten geworden sei, aber sie war in ihrem Element und offenbar nicht bereit, Fragen aus dem Publikum zu beantworten.
»Zum Glück hatte sie ihre beiden Schwestern, die sich um sie kümmern konnten – die zwei gehören einer aussterbenden Rasse an; haben sich früher für alle möglichen wohltätigen Zwecke engagiert -, sonst wäre sie in einer Irrenanstalt gelandet.« Sie warf einen kurzen Blick hinter sich, um sich zu vergewissern, dass wir allein waren, dann beugte sie sich vor. »Als ich klein war, ist Juniper immer durch das Dorf und die Felder gestreift, das weiß ich noch. Sie hat niemanden belästigt, das nicht, ist einfach nur ziellos umhergewandert. Uns Kindern hat sie eine Heidenangst eingejagt. Aber Kinder gruseln sich ja gern, nicht wahr?«
Ich nickte eifrig, und sie fuhr fort: »Sie war wirklich harmlos. Sie hat sich nie in Schwierigkeiten gebracht, aus denen sie nicht wieder allein herauskam. Außerdem braucht jedes ordentliche Dorf seinen Sonderling.« Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. »Jemanden, der den Geistern Gesellschaft leistet. Hier drin können Sie mehr über sie lesen, wenn Sie möchten.« Sie zeigte mir ein Buch mit dem Titel Raymond Blythe in Milderhurst.
»Ich nehme es«, sagte ich und gab ihr zehn Pfund. »Und den Modermann.«
Ich war mit meiner braunen Papiertüte schon fast aus der Tür, als sie mir nachrief: »Wenn Sie das so sehr interessiert, sollten Sie vielleicht eine Besichtigung machen.«
»Im Schloss?« Ich schaute zurück in den schummrigen Laden.
»Am besten, Sie wenden sich an Mrs. Bird. In der ›Home Farm‹, der Pension in der Tenterden Road.«
Ich musste ein paar Kilometer in die Richtung fahren, aus der ich gekommen war, um zu der Pension zu gelangen, einem schindelverkleideten Bauernhaus mit einem großen, üppig blühenden Garten, in dessen hinterem Teil sich weitere Gebäude erahnen ließen. Zwei kleine Gauben ragten aus dem Dach, und um den hohen Backsteinkamin flatterten ein paar weiße Tauben. Die bleiverglasten Fenster standen offen, um die warme Luft hereinzulassen, und die rautenförmigen Scheiben blinzelten in der Nachmittagssonne.
Ich parkte unter einer gewaltigen Esche, deren ausladende Äste einer Seite des Hauses Schatten spendeten, dann stapfte ich durch ein sonnenverwöhntes Blumengewirr: duftender Jasmin, Rittersporn und Glockenblumen, die sich über den Rand des mit Backsteinen gepflasterten Wegs ergossen. Zwei fette weiße Gänse watschelten vorbei, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, als ich aus dem gleißenden Licht in einen schummrigen Raum trat. An den Wänden hingen Schwarz-Weiß-Fotografien vom Schloss und den dazugehörenden Ländereien, alle, laut Bildunterschrift, aufgenommen für die Zeitschrift Country Life im Jahr 1910. An der hinteren Wand erwarteten mich ein Tresen mit einem goldglänzenden Schild, das »Rezeption« verkündete, und eine kleine, füllige Frau in einem königsblauen Leinenkostüm.
»Ah, Sie müssen die junge Frau aus London sein.« Sie blinzelte hinter einer Hornbrille und lächelte, als sie meine Verwirrung bemerkte. »Alice aus dem Buchladen hat angerufen und mir Bescheid gesagt, dass Sie kommen würden. Sie haben sich ja richtig beeilt. Bird meinte, Sie würden mindestens eine Stunde brauchen.«
Ich warf einen Blick auf den gelben Kanarienvogel in dem prunkvollen Käfig, der hinter ihr von der Decke hing.
»Er wollte schon zu Mittag essen, aber ich habe zu ihm gesagt, Sie würden wahrscheinlich genau in dem Moment hier ankommen, wenn ich die Tür zumache und das Schild raushänge.« Sie lachte ein heiseres Raucherlachen, das tief aus ihrer Kehle kam. Ich hatte sie auf Ende fünfzig geschätzt, aber dieses Lachen gehörte einer viel jüngeren, viel durchtriebeneren Frau, als der erste Eindruck vermittelte. »Alice sagt, Sie interessieren sich für das Schloss.«
»Richtig. Ich habe erwähnt, dass ich das Schloss gern besichtigen würde, und da hat sie mich hierhergeschickt. Muss ich mich irgendwo anmelden?«
»Meine Güte, nein. So offiziell ist das alles nicht, ich mache die Führungen selbst.« Ihr stolzgeschwellter Busen bebte im Leinenjackett. »Das heißt, früher.«
»Früher?«