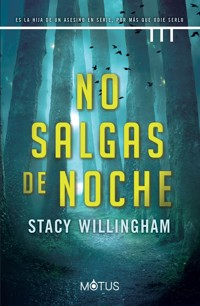9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
In Beaux Bridge, im ländlichen Louisiana, passiert eigentlich nichts. Bis im Sommer 1998 sechs Teenager spurlos verschwinden. Mädchen, die die 12-jährige Chloë aus der Schule kennt. Ihre Leichen werden nicht gefunden. Doch im Schlafzimmer von Chloës Eltern findet man eine Schatulle mit Schmuckstücken der Mädchen. Als ihr Vater, ein liebevoller, bis dahin unbescholtener Mann, die Taten gesteht und als Serienmörder verurteilt wird, zerbrechen Chloës Welt und ihre Familie. Zwanzig Jahre später ist Chloë promovierte Psychologin. Als plötzlich eine ihrer Patientinnen verschwindet, ahnt sie, dass jemand die Taten ihres Vaters imitiert und den 20. Jahrestag der Morde auf seine Weise begehen will. Oder ist der wahre Täter noch immer auf freiem Fuß?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Ähnliche
Stacy Willingham
Das siebte Mädchen
Thriller
Über dieses Buch
Chloe Davis’ Vater ist ein Serienmörder.
Chloe war zwölf, als er verurteilt und ins Gefängnis gesteckt wurde. Sechs Mädchen hat er auf dem Gewissen, ihre Leichen wurden nie gefunden. Der Fall machte Schlagzeilen, die Familie zerbrach.
Seine Verbrechen verfolgen sie noch immer.
Inzwischen ist Chloe eine angesehene Psychologin in Baton Rouge und hat einen liebevollen Verlobten. Doch sie fürchtet, dass ihre heile Welt wieder zusammenstürzen könnte.
Jetzt fällt ein neuer Schatten auf ihr Leben.
Denn wieder wird ein Mädchen vermisst. Und Chloe war die Letzte, die es gesehen hat. Der Jahrestag der Verbrechen ihres Vaters steht unmittelbar bevor, und ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten.
Der Albtraum von damals beginnt erneut.
«Hoch spannend, voller überraschender Wendungen, bedrohlich. ‹Das siebte Mädchen› reißt einen vom Hocker!»
Val McDermid
Vita
Stacy Willingham studierte Journalismus an der University of Georgia, erwarb einen MFA am Savannah College of Art & Design und arbeitete als Werbetexterin und Markenstrategin, bevor sie beschloss, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Ihr Debütroman «Das siebte Mädchen» erscheint in 27 Ländern und wurde sofort ein New York Times-Bestseller. Die Filmrechte erwarb die Produktionsfirma von Oscar-Preisträgerin Emma Stone, die auch die Hauptrolle in der geplanten HBO-Serie spielen wird. Stacy Willingham lebt mit ihrem Mann in Charleston, South Carolina.
Alice Jakubeit übersetzt Romane, Sachbücher und Reportagen aus dem Englischen und Spanischen, u. a. von Alexander McCall Smith, Greer Hendricks & Sarah Pekkanen, Brian McGilloway und Eva García Sáenz.
Für meine Eltern, Kevin und Sue.
Danke für alles.
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, daß er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
– Friedrich Nietzsche
Prolog
Ich dachte, ich wüsste, was Ungeheuer sind.
Als kleines Mädchen stellte ich sie mir als geheimnisvolle Schatten vor, die hinter meinen Kleiderbügeln, unter meinem Bett oder im Wald lauerten. Sie waren etwas, das ich körperlich hinter mir spürte und das immer näher kam, wenn ich im grellen Licht der untergehenden Sonne von der Schule nach Hause ging. Ich hätte dieses Gefühl nicht beschreiben können, aber ich wusste einfach irgendwie, dass sie da waren. Mein Körper spürte sie, er spürte die Gefahr, ebenso wie man ein Kribbeln an der Schulter spürt, kurz bevor jemand einen unverhofft dort berührt, oder man erkennt, dass dieses Gefühl, das sich nicht abschütteln ließ, von einem Paar Augen herrührte, deren Blick sich einem aus dem dichten Unterholz in den Hinterkopf bohrte.
Doch dann dreht man sich um, und die Augen sind fort.
Ich erinnere mich noch, wie der unebene Boden der Schotterstraße, die zu mir nach Hause führt, meinen schmalen Fesseln zu schaffen machte, wenn meine Schritte immer schneller wurden und ich die wabernden Auspuffgase des davonfahrenden Schulbusses hinter mir ließ. Der Sonnenschein, der durch die Äste der Bäume strömte, ließ die Schatten im Wald tanzen, und mein eigener Schatten war so groß wie ein Tier, das gleich seine Beute schlagen wird.
Mehrmals atmete ich tief durch. Zählte bis zehn. Schloss die Augen und kniff sie fest zusammen.
Und dann rannte ich los.
Jeden Tag rannte ich über dieses einsame Stück Straße auf mein Elternhaus in der Ferne zu, doch anstatt näher zu rücken, schien es sich immer weiter zu entfernen. Mit meinen Sneakers wirbelte ich Grasbüschel, Steinchen und Staub in die Luft bei meinem Wettlauf gegen … irgendetwas. Gegen das, was da drin war und mich beobachtete. Wartete. Auf mich. Manchmal stolperte ich über meine Schnürsenkel. Aber irgendwann hastete ich endlich die Treppe unseres Hauses hinauf und stürzte mich in die Geborgenheit der ausgestreckten Arme meines Vaters, der mir zuflüsterte: Ich hab dich, ich bin ja da, sein warmer Atem an meinem Ohr. Dann verwuschelte er mir das Haar. Meine Lunge brannte, so heftig keuchte ich; mein Herz hämmerte im Brustkasten, und in meinem Kopf bildete sich ein einziges Wort: Sicherheit.
Dachte ich jedenfalls.
Das Fürchten zu lernen, sollte eine langsame Entwicklung sein – ein gradueller Prozess vom Nikolaus im örtlichen Einkaufszentrum bis zum Schwarzen Mann unterm Bett; vom für Kinder nicht geeigneten Spielfilm, den die Babysitterin einen sehen lässt, bis zu dem Mann in dem Auto mit den getönten Scheiben, der einen eine Sekunde zu lange anstarrt, während man in der Abenddämmerung auf dem Bürgersteig vorbeigeht, aus dem Augenwinkel beobachtet, wie er einem fast unmerklich hinterherfährt und einem das Herz erst bis zum Hals, dann bis hinter die Augen schlägt. Es ist ein Lernprozess, eine allmähliche Entwicklung von einer wahrgenommenen Bedrohung zur nächsten, und jede neue ist realistischer und gefährlicher als die davor.
Allerdings nicht bei mir. Bei mir war die Angst etwas, das mit einer Wucht über mich hereinbrach, die mein heranwachsender Körper bislang nicht gekannt hatte. Sie war so beklemmend, dass selbst das Atmen schmerzte. Und in dem Augenblick, in dem es geschah, erkannte ich, dass Ungeheuer sich nicht in Wäldern verstecken; sie sind keine Schatten zwischen den Bäumen, kein unsichtbares Etwas, das in dunklen Ecken lauert.
Nein, die wahren Ungeheuer wandeln mitten unter uns.
Ich war zwölf Jahre alt, als diese Schatten allmählich Gestalt annahmen und ein Gesicht bekamen. Sich von einem Gespenst in etwas Konkreteres verwandelten. In etwas Realeres. Und ich allmählich erkannte, dass die Ungeheuer womöglich mitten unter uns lebten.
Insbesondere ein Ungeheuer lernte ich mehr als alle anderen fürchten.
Mai 2019
Kapitel Eins
Mein Hals juckt.
Zuerst kaum merklich. Die Spitze einer Feder, die über meine Speiseröhre streicht, von oben nach unten. Ich schiebe die Zunge nach hinten und versuche, die juckende Stelle zu erreichen.
Es funktioniert nicht.
Hoffentlich werde ich nicht krank. Hatte ich in letzter Zeit Kontakt zu einem Kranken? Zu jemandem mit einer Erkältung?
Da kann man sich eigentlich nie sicher sein. Ich verbringe den ganzen Tag mit anderen Menschen. Keiner von ihnen sah krank aus, aber eine Erkältung kann ansteckend sein, bevor Symptome auftreten.
Erneut versuche ich, die juckende Stelle zu erreichen.
Vielleicht ist es ja Heuschnupfen. Die Belastung mit Ambrosiapollen ist erhöht. Sehr sogar. Eine Acht auf der zehnstufigen Allergieskala. Das Rädchen in meiner Wetter-App war vollständig rot.
Ich trinke einen Schluck Wasser und bewege es eine Weile im Mund, ehe ich es hinunterschlucke.
Auch das hilft nicht. Ich räuspere mich.
«Ja?»
Ich hebe den Blick und sehe meine Klientin an. Steif wie ein Brett sitzt sie vor mir, als ob sie auf meinem großen Ledersessel festgeschnallt wäre. Ihre Hände liegen völlig verkrampft im Schoß. Die glänzenden Narben auf der ansonsten makellosen Haut sind nur schwach sichtbar. Mir fällt ein Armband auf, der Versuch, die hässlichste Narbe – gezackt und dunkelviolett – zu verdecken. Holzperlen mit einem Silberkreuz als Anhänger, es erinnert an einen Rosenkranz.
Ich wende den Blick wieder ihrem Gesicht zu, ihrer Miene, ihren Augen. Keine Tränen, aber es ist noch früh.
«Tut mir leid», sage ich und sehe auf meine Notizen. «Lacey. Ich habe einfach nur so einen Juckreiz im Hals. Bitte erzähl weiter.»
«Oh, okay. Na ja, jedenfalls, wie gesagt … ich werde manchmal einfach so wütend, wissen Sie? Und ich weiß eigentlich nicht, warum, ja? Es ist irgendwie, als würde diese Wut sich einfach immer weiter aufbauen, und dann, ganz plötzlich, muss ich –»
Sie senkt den Blick auf ihre Arme und spreizt die Hände. Überall in den Hautfalten zwischen ihren Fingern hat sie winzige Narben, wie gläserne Haare.
«Es ist befreiend», sagt sie. «Es hilft mir, runterzukommen.»
Ich nicke und versuche, den Juckreiz im Hals zu ignorieren. Er wird stärker. Vielleicht ist es bloß Staub, sage ich mir – es ist staubig hier drin. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Fensterbank, das Bücherregal, die gerahmten Urkunden an der Wand, allesamt mit einer feinen grauen Schicht bedeckt, die im Sonnenlicht glitzert.
Konzentriere dich, Chloe.
Ich sehe wieder das junge Mädchen an.
«Und was glaubst du, woran das liegt, Lacey?»
«Das habe ich doch gesagt. Ich weiß es nicht.»
«Und wenn du eine Vermutung anstellen müsstest?»
Sie seufzt, blickt zur Seite und starrt angelegentlich auf nichts im Besonderen. Sie weicht meinem Blick aus. Bald werden die Tränen fließen.
«Ich meine, wahrscheinlich hat es was mit Dad zu tun», sagt sie schließlich, und ihre Unterlippe bebt ganz leicht. Sie streicht sich das blonde Haar aus der Stirn. «Damit, dass er weggegangen ist und alles.»
«Wann ist dein Vater fortgegangen?»
«Vor zwei Jahren.» Und wie aufs Stichwort tritt eine einzelne Träne aus ihrem Tränenkanal und gleitet ihre sommersprossige Wange hinab. Zornig wischt sie sie fort. «Er hat sich nicht mal verabschiedet. Er hat uns nicht mal erklärt, warum, verdammt noch mal. Er ist einfach abgehauen.»
Ich nicke und mache mir weitere Notizen.
«Könnte man sagen, dass du immer noch ziemlich wütend auf deinen Vater bist, weil er dich einfach so verlassen hat?»
Wieder bebt ihre Lippe.
«Und weil er sich nicht verabschiedet hat, konntest du ihm nicht sagen, wie du dich damit fühlst?»
Sie nickt dem Bücherregal in der Ecke zu, meinem Blick weicht sie immer noch aus.
«Ja», sagt sie, «ich denke, das könnte man so sagen.»
«Bist du sonst noch auf jemanden wütend?»
«Auf Mom, schätze ich. Ich weiß eigentlich nicht, wieso. Ich habe immer gedacht, dass sie ihn vertrieben hat.»
«Okay», sage ich. «Sonst noch jemand?»
Sie zögert und knibbelt mit dem Fingernagel an einer Hautwulst.
«Auf mich selbst», flüstert sie schließlich und macht sich nicht mehr die Mühe, die Tränen fortzuwischen, die sich in ihren Augenwinkeln sammeln. «Weil ich nicht gut genug war, nicht so gut, dass er bleiben wollte.»
«Es ist in Ordnung, wütend zu sein», sage ich. «Wir sind alle wütend. Und jetzt, wo du aussprechen kannst, warum du wütend bist, können wir gemeinsam daran arbeiten, wie du ein bisschen besser damit umgehst. Und zwar so, dass es dir nicht wehtut. Klingt das nach einem Plan?»
«Es ist so bescheuert», murmelt sie.
«Was denn?»
«Alles. Er, das hier. Dass ich hier bin.»
«Was ist bescheuert daran, dass du hier bist, Lacey?»
«Ich sollte nicht hier sein müssen.»
Jetzt schreit sie. Ich lehne mich unauffällig zurück, verschränke die Hände und lasse sie schreien.
«Ja, ich bin wütend! Na und? Mein Dad hat mich verdammt noch mal verlassen. Er hat mich verlassen! Wissen Sie, wie das ist? Wissen Sie, wie das ist, wenn man ein Kind ohne Vater ist? Wenn man in der Schule von allen angestarrt wird? Wenn sie hinter deinem Rücken über dich reden?»
«Ehrlich gesagt, ja. Ich weiß, wie das ist. Das ist kein Spaß.»
Jetzt ist sie still, die Hände in ihrem Schoß zittern. Mit Daumen und Zeigefinger reibt sie über das Kreuz an ihrem Armband. Rauf und runter, rauf und runter.
«Hat Ihr Vater Sie auch verlassen?»
«So ähnlich.»
«Wie alt waren Sie da?»
«Zwölf», sage ich.
Sie nickt. «Ich bin fünfzehn.»
«Mein Bruder war fünfzehn.»
«Dann kapieren Sie’s also?»
Diesmal nicke ich und lächle. Vertrauen herzustellen – das ist der schwierigste Teil.
«Ich kapier’s.» Ich beuge mich vor und stelle auch räumlich Nähe her. Jetzt wendet sie sich mir zu, sieht mich mit tränennassen Augen durchdringend, ja flehend an. «Und wie ich es kapiere.»
Kapitel Zwei
Meine Branche lebt von Klischees – das weiß ich. Aber es gibt einen Grund für diese Klischees.
Sie entsprechen der Wahrheit.
Wenn eine Fünfzehnjährige sich mit der Rasierklinge schneidet, dann hat das wahrscheinlich etwas mit einem Gefühl von Unzulänglichkeit zu tun, mit dem Bedürfnis, körperliche Schmerzen zu spüren, um den seelischen Schmerz zu überdecken. Wenn ein Achtzehnjähriger Schwierigkeiten mit der Aggressionsbewältigung hat, dann hat das garantiert etwas mit einem ungelösten Elternkonflikt zu tun, mit Verlassenheitsgefühlen, mit dem Bedürfnis, sich zu beweisen, stark zu wirken, obwohl er innerlich zerbricht. Wenn eine Zwanzigjährige im ersten Studienjahr sich betrinkt, mit jedem Typen schläft, der ihr einen Wodka Tonic für zwei Dollar ausgibt, und sich dann am nächsten Morgen die Augen ausweint, dann riecht das nach geringem Selbstbewusstsein und einem gesteigerten Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, weil sie zu Hause darum kämpfen musste. Ein innerer Konflikt zwischen der Person, die sie ist, und der Person, die zu sein andere ihrer Meinung nach von ihr erwarten.
Vaterprobleme. Einzelkindsyndrom. Scheidungsfolgen.
Das sind Klischees, aber sie entsprechen der Wahrheit. Und ich darf das sagen, denn ich bin selbst ein Klischee.
Ich sehe auf meine Smartwatch, auf deren Display die Dauer der Aufnahme der heutigen Sitzung blinkt: 1:01:52. Ich sende die Aufnahme an mein Smartphone und beobachte, wie der kleine Timer sich von Grau zu Grün verfärbt, während die Datei hinüber zu meinem Telefon saust und simultan mit meinem Laptop synchronisiert wird. Technologie. Als ich ein junges Mädchen war, nahmen die Ärzte meine Akte zur Hand und blätterten sie Seite für Seite durch, während ich in einem der typischen abgewetzten Ledersessel saß und die Aktenschränke mit den gesammelten Problemen anderer Leute betrachtete. Problemen von Leuten wie mir. Da fühlte ich mich irgendwie gleich weniger allein. Normaler. Diese Aktenschränke aus Metall mit ihren vier Schubladen verkörperten für mich die Möglichkeit, dass ich eines Tages irgendwie meinen Schmerz würde ausdrücken – darüber sprechen, ihn herausschreien, darüber weinen – können, und wenn meine sechzig Minuten dann herum waren, konnten wir die Akte einfach zuklappen und zurück in die Schublade stecken, diese abschließen und den Inhalt bis zum nächsten Mal vergessen.
So, Feierabend.
Ich blicke auf den Desktop meines Computers, wo meine Klienten jetzt nur noch ein Wald aus Icons sind. Einen festen Feierabend gibt es allerdings nicht. Sie finden immer Möglichkeiten, an mich heranzukommen – E-Mail, Social Media –, jedenfalls war das so, bis ich aufgegeben und meine Profile gelöscht habe, weil ich es müde war, die panischen Direktnachrichten zu sichten, die meine Klienten mir schickten, wenn sie an einem Tiefpunkt waren. Ich bin immer im Dienst, allzeit bereit, ein rund um die Uhr geöffneter Laden, dessen Neonschild Open in der Dunkelheit flackert und sein Möglichstes tut, nicht zu erlöschen.
Jetzt erscheint auf dem Laptop die Benachrichtigung, dass die Aufzeichnung angekommen ist. Ich klicke die Datei an und benenne sie: Lacey Deckler, Sitzung 1. Dann blicke ich hoch und mustere mit zusammengekniffenen Augen die staubige Fensterbank. Im grellen Licht der untergehenden Sonne fällt noch stärker ins Auge, wie schmutzig es hier ist. Ich räuspere mich und huste mehrmals, dann beuge ich mich zur Seite, ziehe die unterste Schreibtischschublade auf und sichte meine ganz persönliche Büro-Apotheke. Sie besteht aus diversen Tablettenfläschchen, deren Spektrum von einfachem Ibuprofen bis zu schwieriger auszusprechenden, verschreibungspflichtigen Wirkstoffen reicht: Alprazolam, Chlordiazepoxid, Diazepam. Ich schiebe sie alle beiseite und nehme eine Schachtel Vitamin C heraus, schütte den Inhalt eines Tütchens in mein Wasserglas, rühre mit dem Finger um und trinke einige Schlucke.
Dann schreibe ich eine E-Mail.
Shannon,
schönen Freitag! Hatte gerade eine großartige erste Sitzung mit Lacey Deckler – danke für die Überweisung. Wollte nachfragen betr. Medikation. Wie ich sehe, hast du noch nichts verschrieben. Angesichts unserer heutigen Sitzung glaube ich, dass Prozac in niedriger Dosierung ihr guttun würde – deine Meinung? Bedenken?
Chloe
Ich drücke auf Senden, lehne mich zurück und trinke die nach Mandarinen schmeckende Flüssigkeit aus. Das Präparat hat sich nicht ganz aufgelöst, und der Bodensatz fließt wie Kleister durch meine Kehle, langsam und zäh. Hinterher habe ich lauter orange Körnchen zwischen den Zähnen und auf der Zunge. Nach wenigen Minuten bekomme ich eine Antwort.
Chloe,
wie immer gern geschehen! Einverstanden. Bestell es ruhig für sie.
PS: Wann gehen wir was trinken? Ich will alles wissen zum bevorstehenden GROSSENTAG!
Dr. Shannon Tack
Ich nehme mein Festnetztelefon, rufe in Laceys Apotheke an, derselben CVS-Filiale, in der ich selbst Kundin bin – sehr praktisch –, und lande direkt bei der Voicemail. Ich hinterlasse eine Nachricht.
«Hi. Ja, hier ist Dr. Chloe Davis – C h l o e D a v i s –. Ich möchte ein Medikament für Lacey Deckler bestellen – L a c e y D e c k l e r –, geboren am 16. Januar 2004. Ich habe der Patientin zunächst 10 Milligramm Prozac täglich verschrieben, für acht Wochen. Kein automatisches Folgerezept bitte.»
Ich halte inne und trommle mit den Fingern auf meinem Schreibtisch.
«Außerdem möchte ich ein Medikament für einen weiteren Patienten bestellen, eine Folgeverordnung: Daniel Briggs – D a n i e l B r i g g s –, geboren am 2. Mai 1982. Xanax, 4 Milligramm täglich. Noch einmal, hier spricht Dr. Chloe Davis. Telefon 555-212-4524. Vielen Dank.»
Ich lege auf und lasse den Blick kurz auf dem Telefon ruhen. Dann sehe ich zum Fenster. Die untergehende Sonne taucht meine Mahagonimöbel in ein Orange, das dem Bodensatz in meinem Glas ähnelt. Ich sehe auf die Uhr – halb acht – und klappe gerade meinen Laptop zu, da erwacht das Telefon wieder zum Leben, und ich fahre zusammen. Irritiert starre ich es an – die Praxis ist jetzt geschlossen, zudem ist heute Freitag. Schließlich packe ich weiter meine Sachen zusammen und ignoriere das Klingeln, bis mir klar wird, dass es die Apotheke sein könnte, mit einer Nachfrage zu meiner Bestellung. Ich lasse es ein weiteres Mal klingeln, dann nehme ich ab.
«Dr. Davis», melde ich mich.
«Chloe Davis?»
«Dr. Chloe Davis», korrigiere ich. «Ja, am Apparat. Wie kann ich Ihnen helfen?»
«O Mann, ist nicht leicht, Sie zu fassen zu kriegen.»
Die Stimme gehört einem Mann. Er lacht, aber es klingt irgendwie verärgert.
«Verzeihung, aber sind Sie ein Klient von mir?»
«Nein, aber ich habe den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Den ganzen Tag. Ihre Empfangsdame hat sich geweigert, mich durchzustellen, deshalb dachte ich, ich probiere es mal außerhalb der Praxiszeiten und lande dann vielleicht direkt bei Ihrer Voicemail. Damit, dass Sie abnehmen, habe ich nicht gerechnet.»
Ich runzle die Stirn.
«Nun, dies ist meine Praxis. Ich nehme hier keine Privatanrufe entgegen. Melissa stellt nur meine Klienten durch –» Ich breche ab. Warum erkläre ich eigentlich einem Fremden mich selbst und die Abläufe in meiner Praxis? «Dürfte ich fragen, warum Sie anrufen? Wer sind Sie?», erkundige ich mich in scharfem Ton.
«Mein Name ist Aaron Jansen. Ich bin Reporter bei der New York Times.»
Mir stockt der Atem. Ich huste, es klingt allerdings eher wie ein Würgen.
«Alles in Ordnung bei Ihnen?», fragt er.
«Ja. Ich erhole mich gerade von irgendeiner Halsgeschichte. Tut mir leid – New York Times?»
Sobald die Frage heraus ist, könnte ich mich in den Hintern treten. Ich weiß doch, warum dieser Mann anruft. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet. Oder jedenfalls hatte ich mit etwas in der Art gerechnet. Nicht unbedingt mit der Times, aber doch mit irgend so etwas.
«Sie wissen doch.» Er zögert. «Die Zeitung?»
«Ja, ich weiß, wer Sie sind.»
«Ich schreibe einen Artikel über Ihren Vater und würde mich gern einmal mit Ihnen zusammensetzen. Kann ich Sie zu einem Kaffee einladen?»
«Tut mir leid», sage ich erneut. Warum entschuldige ich mich ständig? Ich atme tief durch und versuche es noch einmal. «Ich habe nichts dazu zu sagen.»
«Chloe», sagt er.
«Dr. Davis.»
«Dr. Davis», wiederholt er und seufzt. «Der Jahrestag steht bevor. Zwanzig Jahre. Das wissen Sie sicher.»
«Natürlich weiß ich das», fahre ich ihn an. «Es ist zwanzig Jahre her, und nichts hat sich geändert. Die Mädchen sind noch immer tot, und mein Vater sitzt noch immer im Gefängnis. Warum sind Sie noch immer daran interessiert?»
Aaron schweigt, und ich weiß, ich habe schon zu viel gesagt. Ich habe diesen kranken Journalistentrieb bereits befriedigt, diesen Drang, bei anderen alte Wunden aufzureißen, kurz bevor sie verheilt gewesen wären. Jetzt hat er garantiert diesen metallischen Geschmack im Mund und will mehr, ein Hai, der vom Blut im Wasser angezogen wird.
«Aber Sie haben sich verändert», sagt er. «Sie und Ihr Bruder. Die Öffentlichkeit würde gern wissen, wie es Ihnen geht – wie Sie damit zurechtkommen.»
Ich verdrehe die Augen.
«Und Ihr Vater», fährt er fort. «Vielleicht hat er sich verändert. Haben Sie mit ihm gesprochen?»
«Ich habe meinem Vater nichts zu sagen. Und Ihnen habe ich auch nichts zu sagen. Bitte rufen Sie nicht mehr hier an.»
Ich lege auf und knalle das Telefon heftiger als beabsichtigt auf die Station. Als ich den Blick senke, sehe ich, dass meine Hände zittern. Um sie zu beschäftigen, streiche ich mir das Haar hinters Ohr und sehe wieder zum Fenster, wo die Farbe des Himmels sich allmählich in ein tiefes Tintenblau verwandelt. Die Sonne sitzt auf dem Horizont wie eine Blase, die gleich platzt.
Schließlich drehe ich mich wieder zum Schreibtisch um, nehme meine Tasche, schiebe den Stuhl zurück und stehe auf. Ich sehe die Schreibtischlampe an, atme tief durch, dann schalte ich sie aus und gehe den ersten zittrigen Schritt in die Dunkelheit hinein.
Kapitel Drei
Über den Tag verteilt wenden wir Frauen unbewusst viele subtile Strategien an, um uns zu schützen. Vor Schatten und unsichtbaren Räubern. Vor abschreckenden Beispielen und modernen Mythen. So subtil sogar, dass es uns selbst kaum bewusst ist.
Wir machen vor Einbruch der Dunkelheit Feierabend. Drücken mit einer Hand die Handtasche an die Brust und halten mit der anderen die Schlüssel wie eine Waffe, während wir zu unserem Auto gehen, das wir strategisch günstig unter einer Straßenlaterne geparkt haben für den Fall, dass wir es doch nicht schaffen, Feierabend zu machen, bevor es dunkel wird. Am Auto angekommen, sehen wir zuerst auf den Rücksitz, bevor wir die Fahrertür entriegeln. Wir halten das Telefon fest in der Hand, den Zeigefinger nur ein Wischen vom Notruf entfernt. Steigen ein. Verriegeln die Türen wieder. Trödeln nicht herum. Fahren zügig los.
Ich verlasse den Parkplatz neben meinem Praxisgebäude und fahre stadtauswärts. Als ich an einer roten Ampel halten muss, werfe ich einen Blick in den Rückspiegel – aus Gewohnheit vermutlich – und zucke zusammen. Ich sehe mitgenommen aus. Es ist schwül draußen, so schwül, dass ein dünner Film meine Haut überzieht und mein normalerweise glattes braunes Haar sich an den Spitzen ein wenig gelockt hat, auf eine Art, wie es nur der Sommer in Louisiana fertigbringt.
Sommer in Louisiana.
Wie emotional aufgeladen diese Worte sind. Ich bin hier aufgewachsen. Nun ja, nicht direkt hier. Nicht in Baton Rouge. Aber in Louisiana. In einer kleinen Stadt namens Breaux Bridge – der Flusskrebshauptstadt der Welt. Auf diese Auszeichnung sind wir aus irgendeinem Grund stolz. Genauso wie Cawker City, Kansas, bestimmt stolz auf sein über zwei Tonnen schweres Garnknäuel ist. So etwas verleiht einem ansonsten unbedeutenden Ort eine oberflächliche Bedeutung.
Breaux Bridge hat außerdem nicht einmal zehntausend Einwohner, was bedeutet, dass jeder jeden kennt. Und insbesondere kennt jeder mich.
Als ich jung war, lebte ich nur für den Sommer. Ich habe so viele Erinnerungen, die mit den Sümpfen verknüpft sind: Alligatoren suchen im Lake Martin und kreischen, wenn ich ihre wachsamen Augen in einem Algenteppich lauern sah. Das Lachen meines Bruders, wenn wir wegrannten und dabei schrien: «See ya later, alligator!» Perücken aus dem Louisianamoos basteln, das in unserem riesigen Garten hing, und danach tagelang die Herbstmilben aus meinem Haar pflücken und klaren Nagellack auf die juckenden roten Quaddeln auf der Haut streichen. Mit einer Drehung den Schwanz eines frisch gekochten Krebses abziehen und den Kopf aussaugen.
Aber die Erinnerungen an den Sommer bringen auch Erinnerungen an Angst mit sich.
Ich war zwölf, als die Mädchen verschwanden. Mädchen, die kaum älter waren als ich. Das war im Juli 1999, und anfangs zeichnete sich nur ein weiterer heißer, schwüler Sommer in Louisiana ab.
Bis er das eines Tages nicht mehr war.
Ich weiß noch, wie ich frühmorgens in die Küche kam und mir den Schlaf aus den Augen rieb. Meine mintgrüne Decke schleifte hinter mir über den Linoleumboden. Mit dieser Decke hatte ich schon als Baby geschlafen. Als ich meine Eltern dicht nebeneinander vor dem Fernseher sitzen und besorgt miteinander flüstern sah, zwirbelte ich den Stoff zwischen den Fingern, ein nervöser Tic von mir; die Kanten der Decke waren schon ganz ausgefranst.
«Was ist denn los?»
Sie drehten sich um und rissen die Augen auf, als sie mich sahen. Dann schalteten sie den Fernseher aus, ehe ich etwas sehen konnte.
Dachten sie jedenfalls.
«Ach, Liebes», sagte mein Vater, kam zu mir und umarmte mich fester als sonst. «Nichts ist los, Liebling.»
Aber es war nicht nichts. Schon da wusste ich, dass es nicht nichts war. Die ungewöhnlich feste Umarmung meines Vaters, die bebende Unterlippe meiner Mutter, als sie sich zum Fenster umdrehte – genauso wie Laceys Lippe heute Nachmittag bebte, als sie sich zwang, sich einzugestehen, was sie längst gewusst hatte. Was sie zu verdrängen, zu leugnen versucht hatte. Ich hatte einen kurzen Blick auf die leuchtend rote Schlagzeile am unteren Bildschirmrand erhascht, und sie hatte sich mir bereits ins Gedächtnis gebrannt, eine Ansammlung von Worten, die das Leben, wie ich es bisher gekannt hatte, für immer verändern sollte.
Mädchen aus Breaux Bridge verschwunden
Wenn man zwölf ist, hat MÄDCHENVERSCHWUNDEN nicht die gleiche unheilvolle Bedeutung, die es hat, wenn man älter ist. Man denkt nicht automatisch an das Allerschlimmste: Entführung, Vergewaltigung, Mord. Ich weiß noch, dass ich dachte: Wo denn verschwunden? Vielleicht hatte sie sich ja verirrt. Das Haus meiner Familie stand auf einem über vier Hektar großen Grundstück; ich hatte mich schon oft verirrt, wenn ich im Sumpf auf Krötenfang ging oder die unerforschten Waldstücke erkundete, meinen Namen in irgendeinen Baumstamm ritzte oder aus moosbewachsenen Stöcken Festungen baute. Einmal war ich sogar in einer kleinen Höhle stecken geblieben, dem Bau irgendeines Tiers, dessen unregelmäßiger Eingang zugleich furchteinflößend und verlockend war. Ich weiß noch, wie mein Bruder mir ein altes Seil um den Knöchel band, während ich flach auf dem Bauch lag und mich dann in die kalte, dunkle Leere hineinwand, zwischen den Lippen eine Schlüsselanhänger-Taschenlampe; wie ich mich ganz verschlingen ließ von der Dunkelheit, immer tiefer hineinkroch – und schließlich blankes Entsetzen, als ich merkte, dass ich feststeckte. Als ich im Fernsehen die Bilder von der Suchmannschaft sah, die dichtes Unterholz durchkämmte und durch die Sümpfe watete, fragte ich mich daher unwillkürlich, was passieren würde, falls ich jemals «verschwinden» würde. Ob die Leute nach mir genauso suchen würden wie jetzt nach diesem Mädchen.
Die taucht schon wieder auf, dachte ich. Und dann ist es ihr bestimmt peinlich, dass man ihretwegen so einen Aufstand gemacht hat.
Doch sie tauchte nicht wieder auf. Und drei Wochen später verschwand ein weiteres Mädchen.
Vier Wochen danach noch eines.
Am Ende des Sommers waren sechs Mädchen verschwunden. Am einen Tag waren sie noch da, und am nächsten – weg. Spurlos verschwunden.
Nun sind sechs verschwundene Mädchen immer sechs zu viel, aber Breaux Bridge ist so klein, dass eine auffällige Lücke im Klassenzimmer entsteht, wenn nur ein Kind die Schule verlässt, oder es merklich stiller in einem Wohnviertel wird, wenn eine einzige Familie wegzieht. Für eine so kleine Stadt waren sechs vermisste Mädchen eine fast unerträgliche Zerreißprobe. Ihre Abwesenheit war unmöglich zu ignorieren; sie war etwas Böses, das am Himmel über uns hing wie ein aufziehendes Unwetter, das man in den Knochen spürt. Man konnte es spüren, schmecken, in den Augen jedes Menschen lesen, dem man begegnete. Tiefes Misstrauen herrschte in unserer sonst so vertrauensseligen Stadt, ein Argwohn, der sich nicht mehr abschütteln ließ. Uns alle beschäftigte dieselbe unausgesprochene Frage.
Wer ist die Nächste?
Ausgangssperren wurden verhängt; Geschäfte und Restaurants schlossen bei Einbruch der Dunkelheit. Wie allen anderen Mädchen in der Stadt war es auch mir verboten, im Dunkeln draußen zu sein. Sogar tagsüber spürte ich das Böse hinter jeder Ecke lauern. Das beklemmende Vorgefühl, dass ich es sein würde – dass ich die Nächste sein würde –, war immer da, immer präsent.
«Dir passiert schon nichts, Chloe. Du hast keinen Grund, dir Sorgen zu machen.»
Ich weiß noch, wie mein Bruder an diesem Morgen seinen Rucksack aufsetzte und sich für das Ferienlager fertig machte; ich weinte wieder, ich hatte Angst, das Haus zu verlassen.
«Sie hat sehr wohl Grund, sich Sorgen zu machen, Cooper. Das ist eine ernste Sache.»
«Chloe ist zu jung. Sie ist erst zwölf. Er mag Teenager, schon vergessen?»
«Cooper, bitte.»
Meine Mutter ging in die Hocke, sah mir in die Augen und strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr.
«Es ist eine ernste Sache, Schatz, aber sei einfach vorsichtig. Sei wachsam.»
«Steig nicht zu Fremden ins Auto», sagte Cooper und seufzte. «Geh nicht allein durch dunkle Gassen. Es ist alles ziemlich logisch, Chlo. Stell dich einfach nicht dumm an.»
«Diese Mädchen haben sich nicht dumm angestellt», fuhr meine Mutter ihn an, leise, aber in scharfem Ton. «Sie hatten Pech. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort.»
Jetzt biege ich auf den Parkplatz der Apotheke ein und halte am Autoschalter. Hinter dem Schiebefenster steht ein Mann und verpackt verschiedene Fläschchen in Papiertüten. Er schiebt das Fenster auf, blickt aber nicht hoch.
«Name?»
«Daniel Briggs.»
Jetzt sieht er mich an: eindeutig kein Daniel. Er tippt etwas auf seiner Computertastatur und fragt dann: «Geburtsdatum?»
«2. Mai 1982.»
Er wendet sich ab und durchsucht den B-Korb. Ich verfolge, wie er eine Papiertüte herauszieht und sich damit wieder zu mir umdreht, und ich umklammere das Steuer, damit er nicht sieht, wie meine Hände zittern. Er hält den Scanner über den Barcode, und ich höre einen Piepton.
«Haben Sie Fragen zu diesem Medikament?»
«Nein.» Ich lächle ihn an. «Alles klar.»
Er reicht mir die Tüte durchs Fenster. Ich nehme sie entgegen und stecke sie tief in meine Handtasche. Dann schließe ich mein Fenster und fahre los, ohne mich auch nur zu verabschieden.
Während ich weiterfahre, scheint meine Handtasche auf dem Beifahrersitz von innen heraus zu strahlen, so intensiv sind mir die Tabletten darin bewusst. Anfangs habe ich darüber gestaunt, wie leicht es war, Rezepte für andere Leute einzulösen; sofern man das Geburtsdatum zum Namen in der Akte kennt, wollen die meisten Apotheker nicht einmal den Führerschein sehen. Und wenn doch, genügen in der Regel einfache Erklärungen.
Ach, Mist, der ist in der anderen Handtasche.
Tatsächlich bin ich seine Verlobte – soll ich Ihnen die Adresse nennen, die in der Akte steht?
Ich biege in mein Wohnviertel ein, den Garden District, und beginne die meilenlange Fahrt die Straße entlang, auf der ich immer mein Orientierungsvermögen verliere, in etwa so wie Taucher, stelle ich mir vor, wenn völlige Dunkelheit sie umgibt, eine Dunkelheit, die so undurchdringlich ist, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sieht.
Jeglicher Orientierungssinn – dahin. Jedes Gefühl von Kontrolle – dahin.
Ohne Häuser, die Licht auf die Straße werfen, oder Scheinwerfer, die die verdrehten Arme der Bäume am Straßenrand beleuchten, hat man auf dieser Straße nach Sonnenuntergang das Gefühl, mitten hinein in eine Tintenpfütze zu fahren, in einem gewaltigen Nichts zu verschwinden, in ein bodenloses Loch zu fallen.
Ich halte den Atem an und drücke das Gaspedal noch ein Stückchen weiter durch.
Endlich spüre ich, dass meine Abzweigung naht. Obwohl hinter mir niemand ist, nur tiefe Schwärze, setze ich den Blinker und biege in unsere Sackgasse ab. Als ich die erste Straßenlaterne passiere, die mir die Straße nach Hause zeigt, atme ich erleichtert aus.
Zuhause.
Auch dieses Wort ist emotional aufgeladen. Ein Zuhause ist nicht nur ein Haus, eine Ansammlung von Ziegelsteinen und Brettern, die von Mörtel und Nägeln zusammengehalten wird. Es ist etwas Emotionaleres. Ein Zuhause bedeutet Sicherheit und Schutz. Es ist der Ort, den man aufsucht, wenn es neun Uhr schlägt und die Sperrstunde beginnt.
Aber was ist, wenn ein Zuhause keine Sicherheit und keinen Schutz mehr bietet?
Was ist, wenn die ausgestreckten Arme, in die man sich auf der Treppe vor dem Haus stürzt, eben die Arme sind, vor denen man davonrennen sollte? Wenn sie demjenigen gehören, der diese armen Mädchen gepackt, ihnen den Hals zugedrückt, ihre Leichen vergraben und sich dann die Hände gewaschen hat?
Was ist, wenn Zuhause der Ort ist, an dem alles begann? Das Epizentrum des Erdbebens, das die Stadt bis ins Mark erschütterte? Das Auge des Hurrikans, der Familien, Menschenleben, dich zerriss? Alles, was du gekannt hattest?
Was dann?
Kapitel Vier
Mein Auto steht mit laufendem Motor in der Einfahrt. Ich ziehe die Apothekentüte aus der Handtasche, reiße sie auf und hole ein oranges Fläschchen heraus, drehe den Deckel ab und gebe eine Tablette in meine Handfläche. Dann knülle ich die Tüte zusammen und schiebe sie zusammen mit dem Fläschchen ins Handschuhfach.
Ich betrachte die Xanax, diese kleine weiße Tablette in meiner Hand, und muss an den Anruf vorhin in meiner Praxis denken: Aaron Jansen. Zwanzig Jahre. Mir wird eng in der Brust, und ich schlucke die Tablette trocken herunter, bevor ich es mir anders überlegen kann. Ich atme auf und schließe die Augen. Schon spüre ich, wie die Beklemmung in meiner Brust sich löst, wie meine Atemwege sich weiten. Mich überkommt dieselbe Ruhe wie immer, wenn meine Zunge eine Tablette berührt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses Gefühl, außer als reine Erleichterung. Die Erleichterung, die einen überkommt, wenn man seinen Kleiderschrank aufreißt und feststellt, dass sich darin nichts als Kleidung verbirgt – der Herzschlag beruhigt sich, und ein euphorischer Schwindel erfasst das Gehirn, weil man erkennt, dass man in Sicherheit ist. Dass sich aus den Schatten nichts auf einen stürzen wird.
Ich öffne die Augen.
Als ich aussteige, liegt etwas Würziges in der Luft. Ich knalle die Tür zu und drücke zweimal auf den Knopf am Schlüssel, der den Wagen verriegelt. Dann hebe ich die Nase zum Himmel und schnüffle, versuche, den Geruch einzuordnen. Meeresfrüchte vielleicht. Irgendetwas Fischiges. Vielleicht grillen die Nachbarn, und kurz bin ich gekränkt darüber, dass sie mich nicht eingeladen haben.
Ich nehme den langen kopfsteingepflasterten Weg zu meiner Haustür in Angriff. Das Haus ragt dunkel vor mir auf. Auf halbem Weg bleibe ich stehen und betrachte es. Damals, als ich es kaufte, vor Jahren, war es genau das. Ein Haus. Eine leere Hülle, der man Leben einhauchen konnte wie einem Luftballon. Es war ein Haus, das bereit war, ein Zuhause zu werden, eifrig und aufgeregt wie ein Kind am ersten Schultag. Doch ich hatte keine Ahnung, wie ich es zu einem Zuhause machen sollte. Das einzige Zuhause, das ich je gekannt hatte, hatte diese Bezeichnung eigentlich nicht verdient – jedenfalls nicht mehr. Nicht im Rückblick. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal durch die Haustür eintrat, die Schlüssel in der Hand. Das Klackern meiner Absätze auf dem Hartholzboden hallte durch die gewaltige Leere, und die Nagellöcher an den kahlen weißen Wänden zeugten von den Bildern, die dort gehangen hatten – ein Beleg dafür, dass es möglich war. Dass man hier Erinnerungen bilden, ein Leben führen konnte. Ich öffnete den kleinen roten Werkzeugkasten, den Cooper mir geschenkt hatte. Er war mit mir durch den Baumarkt gegangen, und ich hatte mit offenem Mund zugesehen, wie er Schraubenschlüssel, Hammer und Zangen hineinfallen ließ wie süße und saure Gummibärchen im Süßwarengeschäft. Ich hatte nichts zum Aufhängen – keine Bilder, keinen Zierrat –, deshalb schlug ich einen einzelnen Nagel ein und hängte den Metallring mit meinem Hausschlüssel daran auf. Ein einzelner Schlüssel, mehr nicht. Es fühlte sich an wie ein Fortschritt.
Jetzt betrachte ich das, was ich seither getan habe, damit es von außen so wirkt, als hätte ich mein Leben im Griff, das Gegenstück zu dem Make-up, mit dem man ein schillerndes Hämatom überdeckt, oder dem Rosenkranz an einem vernarbten Handgelenk. Warum mir so viel an der Anerkennung meiner Nachbarn liegt, die mit der Hundeleine in der Hand an meinem Haus vorbeihuschen, weiß ich wirklich nicht. Da ist die Hollywoodschaukel, die an der Verandadecke befestigt ist, aber an der unberührten buttergelben Pollenschicht darauf erkennt man, dass dort nie jemand sitzt. Dann sind da die Pflanzen, die ich voller Begeisterung gekauft, eingesetzt und dann ignoriert habe, bis alle abgestorben waren; die dünnen braunen Ranken meiner zwei Hängefarne erinnern an die Knöchelchen eines Kleintiers, die ich einmal in der achten Klasse im Biologieunterricht beim Sezieren einer Eule fand. Die kratzige braune Fußmatte, auf der «Willkommen!» steht. Der bronzene Briefkasten in Form eines übergroßen Briefumschlags, zum Verrücktwerden unpraktisch, weil der Schlitz zu schmal für eine Hand ist, ganz zu schweigen davon, dass nicht mehr als die zwei, drei Postkarten von ehemaligen Klassenkameraden hineinpassen, die Immobilienmakler wurden, als die Hoffnungen auf gute Abschlüsse sich nicht so recht erfüllten.
Ich gehe weiter und beschließe in diesem Augenblick, den bescheuerten Briefkasten zu entsorgen und einen normalen zu kaufen, wie ihn alle anderen auch haben. Im selben Augenblick erkenne ich, dass mein Haus tot wirkt. Es ist das einzige in der Siedlung ohne erleuchtete Fenster oder das Flackern eines Fernsehers hinter geschlossenen Jalousien. Das einzige ohne jedes Lebenszeichen im Innern.
Ich gehe näher heran. Das Xanax hüllt meinen Verstand in eine erzwungene Ruhe, dennoch nagt etwas an mir. Irgendetwas stimmt hier nicht. Etwas ist anders. Ich sehe mich im Garten um: klein, aber gepflegt. Ein gemähter Rasen, gesäumt von Sträuchern und einem unbehandelten Holzzaun; die knorrigen Äste einer Eiche ragen über der Garage auf, in der ich mein Auto nicht ein einziges Mal abgestellt habe. Ich blicke zum Haus wenige Schritte vor mir. Hinter einem Vorhang meine ich eine Bewegung zu erkennen, aber ich schüttele den Kopf und zwinge mich, weiterzugehen.
Mach dich nicht lächerlich, Chloe. Sei vernünftig.
Ich drehe schon den Schlüssel im Schloss, da wird mir klar, was da nicht stimmt, was anders ist.
Das Verandalicht ist aus.
Das Verandalicht, das ich immer, immer eingeschaltet lasse – auch wenn ich schlafen gehe; den Lichtstrahl, der deswegen durch die Lücke zwischen den Jalousien auf mein Bett fällt, ignoriere ich –, ist ausgeschaltet. Ich schalte es nie aus. Ich glaube, ich habe den Schalter seit dem ersten Abend nicht mehr angerührt. Deshalb wirkt das Haus so leblos. Ich habe es noch nie so dunkel gesehen, so völlig ohne Licht. Trotz der Straßenlaternen ist es hier draußen dunkel. Jemand könnte sich von hinten an mich heranschleichen, und ich würde es nicht einmal –
«ÜBERRASCHUNG!»
Ich stoße einen Schrei aus und suche hektisch in meiner Handtasche nach dem Pfefferspray. Dann geht das Licht an, und ich starre auf eine Menschenansammlung in meinem Wohnzimmer – dreißig, vielleicht sogar vierzig Leute, die lächelnd meinen Blick erwidern. Das Herz schlägt mir bis zum Hals, ich kann kaum sprechen.
«O mein –», stammle ich und sehe mich um, suche nach einem Grund, einer Erklärung. Aber ich finde nichts.
«O mein Gott.» Gleich darauf wird mir bewusst, dass meine Hand noch in der Tasche steckt und ich das Pfefferspray mit einer Verzweiflung umklammere, die mich erschreckt. Ich lasse es los und spüre unendliche Erleichterung, während ich meine verschwitzte Handfläche am Innenfutter abwische. «Was … was soll das?»
«Wonach sieht es denn aus?», ertönt eine Stimme links von mir. Ich drehe mich um. Die Leute bilden ein Spalier, und ein Mann tritt vor. «Es ist eine Party.»
Der Mann ist Daniel, in einer Dark-washed-Jeans und einem schicken blauen Sakko. Er strahlt mich an. Die blendend weißen Zähne kontrastieren mit seiner gebräunten Haut; das strohblonde Haar hat er sich aus dem Gesicht gestrichen. Mein Herz schlägt wieder langsamer. Unwillkürlich betaste ich meine Wange und spüre, wie sie heiß wird. Daniel reicht mir ein Glas Wein. Verlegen lächelnd nehme ich es mit der anderen Hand entgegen.
«Eine Party für uns», sagt er und umarmt mich kurz. Ich rieche sein Duschgel, sein würziges Deo. «Eine Verlobungsparty.»
«Daniel. Was … was tust du hier?»
«Na ja, ich wohne hier.»
Die Leute lachen schallend, und Daniel drückt lächelnd meine Schulter.
«Du solltest doch auf Dienstreise sein», sage ich. «Ich dachte, du kommst erst morgen zurück.»
«Ach das. Tja, das war gelogen», erwidert er, was noch mehr Gelächter auslöst. «Bist du überrascht?»
Ich lasse den Blick über diesen Pulk von Menschen gleiten, die an ihrem jeweiligen Platz zappeln und mich noch immer erwartungsvoll ansehen, und frage mich, wie laut ich geschrien habe.
«Habe ich etwa nicht überrascht geklungen?»
Ich werfe die Hände in die Luft, und alle lachen. In einer Ecke fängt jemand an zu jubeln, und die anderen stimmen ein. Sie pfeifen und klatschen, während Daniel mich noch einmal in die Arme nimmt und auf den Mund küsst.
«Nehmt euch ein Zimmer!», brüllt jemand, und wieder lachen alle. Dann verteilen sie sich auf die verschiedenen Räume, füllen ihre Gläser auf, plaudern miteinander, laden sich Essen auf Pappteller. Jetzt weiß ich auch, wieso es draußen nach Fisch roch: Old Bay, eine Gewürzmischung für Meeresfrüchte und Fisch. Auf einem Picknicktisch draußen auf der hinteren Veranda erspähe ich einen dampfenden Eimer mit Brühe zum Krebskochen und schäme mich, weil ich mich von der fiktiven Party nebenan ausgeschlossen fühlte.
Daniel sieht mich an und grinst, um nicht laut loszulachen. Ich boxe ihn an die Schulter.
«Du bist unmöglich», sage ich, obwohl ich ebenfalls lächle. «Ich hätte mir vor Schreck fast in die Hose gemacht.»
Jetzt lacht er. Es war dieses raumgreifende, dröhnende Lachen, das mich vor zwölf Monaten anzog und nichts von seiner Wirkung auf mich verloren hat. Ich ziehe ihn wieder an mich und küsse ihn noch einmal, diesmal richtig, jetzt, da die aufmerksamen Blicke unserer Freunde nicht mehr auf uns gerichtet sind. Ich spüre die Wärme seiner Zunge in meinem Mund und genieße es, wie seine Gegenwart mich körperlich beruhigt, mein Herz und meine Atmung verlangsamt, genauso wie das Xanax.
«Du hast mir kaum eine Wahl gelassen», sagt er und trinkt einen Schluck Wein. «Ich musste es so machen.»
«Ach ja? Und warum?»
«Weil du dich weigerst, selbst irgendetwas für dich zu organisieren. Kein Junggesellinnenabschied, keine Brautparty.»
«Ich bin keine Studentin mehr, Daniel. Ich bin zweiunddreißig. Findest du das nicht ein bisschen juvenil?»
Er hebt eine Augenbraue.
«Nein, ich finde das nicht juvenil. Ich finde, das klingt nach Spaß.»
«Tja, weißt du, ich habe eigentlich niemanden, der mir helfen könnte, so etwas zu planen», sage ich, starre in mein Glas und lasse den Wein darin kreisen. «Du weißt doch, Cooper organisiert garantiert keine Brautparty, und meine Mutter –»
«Ich weiß, Chlo. Ich ziehe dich nur ein bisschen auf. Du verdienst eine Party, also habe ich eine Party organisiert. Ganz einfach.»
Mir wird warm ums Herz, und ich drücke seine Hand.
«Danke. Das ist wirklich toll. Ich hätte zwar fast einen Herzinfarkt bekommen …» Er lacht und leert sein Glas. «… aber es bedeutet mir viel. Ich liebe dich.»
«Ich liebe dich auch. Jetzt lass uns aber zu den anderen gehen. Und trink deinen Wein.» Er tippt mit einem Finger an mein unangerührtes Glas. «Entspann dich ein bisschen.»
Ich hebe das Glas an die Lippen und trinke es aus, dann gehe ich ins Wohnzimmer, wo großes Gedränge herrscht. Jemand nimmt mir mein Glas ab und bietet an, es aufzufüllen, während ein anderer Gast mir einen Teller mit Käse und Crackern vor die Nase hält.
«Du musst ja halb verhungert sein. Arbeitest du immer so lange?»
«Natürlich tut sie das. Das ist Chloe!»
«Ist Chardonnay okay, Chlo? Ich glaube, vorher hattest du Pinot, aber mal im Ernst, wo ist da der Unterschied?»
Minuten vergehen, vielleicht auch Stunden. Jedes Mal, wenn ich in ein anderes Zimmer gehe, kommt jemand mit einem Glückwunsch und einem vollen Glas zu mir, und die immer gleichen Fragen sprudeln, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge, schneller hervor als der Wein, obwohl sich in einer Ecke bereits die leeren Flaschen türmen.
«Und? Zählt das als ‹was trinken›?»
Ich drehe mich zu Shannon um, die breit grinsend vor mir steht. Lachend zieht sie mich an sich, umarmt mich und drückt mir wie immer einen herzhaften Kuss auf die Wange. Ich denke an ihre E-Mail von heute Nachmittag.
PS: Wann gehen wir was trinken? Ich will alles wissen zum bevorstehenden GROSSENTAG!
«Du kleine Lügnerin», sage ich und verkneife es mir, die Lippenstiftspuren abzuwischen, die ich auf meiner Wange spüre.
«Schuldig.» Sie lächelt. «Ich musste dafür sorgen, dass du keinen Verdacht schöpfst.»
«Tja, Mission erfüllt. Wie geht’s der Familie?»
«Gut», erwidert Shannon und dreht den Ring an ihrem Finger. «Bill ist in der Küche und schenkt sich nach. Und Riley …»
Sie sucht den Raum ab, lässt den Blick über das Meer der Köpfe wandern, die wie Wellen auf und ab schaukeln. Anscheinend findet sie, was sie gesucht hat, denn sie lächelt und schüttelt den Kopf.
«Riley ist da hinten in der Ecke und telefoniert. Unerhört.»
Ich folge ihrem Blick zu einem jungen Mädchen, das auf einem Stuhl lümmelt und in rasanter Geschwindigkeit auf ihrem Telefon herumtippt. Riley trägt ein kurzes rotes Sommerkleid und weiße Sneakers, ihr Haar ist unscheinbar braun. Sie wirkt unfassbar gelangweilt, und unwillkürlich muss ich lachen.
«Na ja, sie ist fünfzehn», wirft Daniel ein. Ich drehe den Kopf, und da steht er und lächelt. Er kommt zu mir, schlingt den Arm um meine Taille und küsst mich auf die Stirn. Ich staune immer wieder darüber, mit welcher Leichtigkeit er sich bereits laufenden Unterhaltungen anschließt, indem er etwas beisteuert, was so passend ist, als hätte er die ganze Zeit dabeigestanden.
«Wem sagst du das», entgegnet Shannon. «Im Moment hat sie Hausarrest, deshalb haben wir sie mitgeschleift. Sie ist nicht allzu glücklich darüber, dass wir sie zwingen, mit einem Haufen alter Leute abzuhängen.»
Ich lächle und beobachte gebannt, wie das Mädchen sich geistesabwesend eine Locke um den Finger wickelt und auf der Lippe kaut, während sie eine Nachricht auf ihrem Telefon analysiert, die wohl gerade eingetroffen ist.
«Weshalb hat sie denn Hausarrest?»
«Sie wollte nachts abhauen», sagt Shannon und verdreht die Augen. «Wir haben sie erwischt, als sie um Mitternacht aus ihrem Fenster klettern wollte. Sie hat die Nummer mit dem Seil aus Bettlaken abgezogen, wie man es in diesen verflixten Filmen sieht. Zum Glück hat sie sich nicht den Hals gebrochen.»
Ich muss lachen und schlage mir die Hand vor den Mund.
«Als wir uns kennengelernt haben und Bill mir erzählte, er hätte eine zehnjährige Tochter, habe ich mir nicht viel dabei gedacht, das schwöre ich euch», fährt Shannon leise fort und betrachtet ihre Stieftochter. «Ehrlich, ich dachte sogar, ich hätte Schwein gehabt. Ein Kind on demand, mit dem ich mir den Part mit den schmutzigen Windeln und dem Geschrei die ganze Nacht über erspare. Sie war so ein Schatz. Aber sobald sie Teenager sind, ändert sich alles, das ist wirklich erstaunlich. Sie verwandeln sich in Ungeheuer.»
«Das bleibt nicht lange so», sagt Daniel lächelnd. «Eines Tages sind das nur noch ferne Erinnerungen.»
«Himmel, das hoffe ich.» Shannon lacht und trinkt noch einen Schluck Wein. «Er ist wirklich ein Engel, weißt du.»
Die letzte Bemerkung ist nur an mich gerichtet, aber sie deutet dabei auf Daniel und klopft ihm auf die Brust.
«Das Ganze hier zu organisieren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange er gebraucht hat, um alle zur selben Zeit hier zusammenzubekommen.»
«Ja, ich weiß», sage ich. «Ich habe ihn nicht verdient.»
«Gut, dass du nicht eine Woche früher gekündigt hast, hm?»
Sie stupst mich an, und ich lächle. Unsere erste Begegnung ist mir immer noch sehr deutlich in Erinnerung. Es war eines dieser zufälligen Zusammentreffen, die genauso gut nichts hätten bedeuten können. Man stößt im Bus gegen eine Schulter, murmelt eine kurze Entschuldigung und geht seiner Wege. Man leiht sich von einem Mann an der Bar einen Kuli, wenn der eigene leer ist, oder läuft jemandem mit der Brieftasche, die er gerade im Einkaufswagen vergessen hat, zum Auto hinterher. Meistens enden solche Begegnungen mit einem Lächeln und einem Dank, mehr wird daraus nicht.
Aber manchmal wird eben doch etwas daraus. Oder sogar alles.
Daniel und ich sind einander im Baton Rouge General Hospital begegnet. Er kam herein, ich ging hinaus. Vielmehr wankte ich unter dem Gewicht des brechend vollen Umzugskartons hinaus, der den Inhalt meines Büros enthielt. Ich wäre einfach an ihm vorbeigegangen – der Karton verstellte mir die Sicht, und ich hatte den Blick auf meine Füße gesenkt. Ich wäre einfach an ihm vorbeigegangen, wenn ich nicht seine Stimme gehört hätte.
«Brauchen Sie Hilfe?»
«Nein, nein», wehrte ich ab, verlagerte das Hauptgewicht von einem Arm auf den anderen und blieb nicht einmal stehen. Die Automatiktür war nur einen Meter entfernt, nicht einmal, und draußen stand mit laufendem Motor mein Wagen. «Ich habe alles im Griff.»
«Warten Sie, ich helfe Ihnen.»
Ich hörte von hinten Schritte auf mich zukommen und spürte gleich darauf, wie das Gewicht abnahm, als er seine Arme zwischen meine schob.
«Du liebe Güte», ächzte er. «Was haben Sie denn da drin?»
«Hauptsächlich Bücher.» Er nahm mir den Karton ab, und ich strich mir eine Haarsträhne aus der verschwitzten Stirn. In diesem Augenblick sah ich zum ersten Mal sein Gesicht: blondes Haar, blonde Wimpern und Zähne, die das Produkt teurer kieferorthopädischer Behandlungen in seiner Jugend plus vielleicht der einen oder anderen Bleaching-Behandlung waren. Als er sich mein bisheriges Berufsleben auf eine Schulter hievte, zeichnete sich unter seinem hellblauen Hemd ein kräftiger Bizeps ab.
«Gefeuert worden?»
Ich riss den Kopf zu ihm herum und öffnete den Mund, um ihn zu berichtigen, doch da sah er mich ebenfalls an, und seine Augen waren sanft. Sein Blick wurde weich, während er mein Gesicht betrachtete, mich von oben bis unten musterte. Er sah mich an wie eine alte Freundin, schien nach etwas Vertrautem in meinen Zügen zu suchen. Dann verzogen sich seine Lippen zu einem wissenden Grinsen.
«War nur ein Scherz», sagte er und wandte seine Aufmerksamkeit wieder meinem Karton zu. «Sie wirken zu glücklich, um gefeuert worden zu sein. Außerdem, würden Sie dann nicht von zwei Wachmännern herausgeschleift und aufs Pflaster geschleudert werden? Läuft das nicht so?»
Ich lächelte und lachte dann laut auf. Mittlerweile hatten wir mein Auto erreicht, und er stellte den Karton aufs Dach, verschränkte die Arme vor der Brust und wandte sich mir zu.
«Ich habe gekündigt», erklärte ich, und dieser Satz hatte etwas derartig Endgültiges, dass ich beinahe in Tränen ausgebrochen wäre. Die Arbeitsstelle im Baton Rouge General Hospital war meine erste gewesen; meine bisher einzige. Meine Kollegin Shannon war mittlerweile meine engste Freundin. «Heute war mein letzter Tag.»
«Na, dann herzlichen Glückwunsch. Wo geht’s jetzt hin?»
«Ich eröffne eine eigene Praxis. Ich bin Psychologin.»
Er pfiff durch die Zähne und spähte in meinen Karton. Offenbar fiel ihm etwas ins Auge, denn er wandte den Kopf und zog ein Buch heraus.
«Haben Sie’s mit Mord?», fragte er und betrachtete den Einband.
Mir wurde eng um die Brust, und mein Blick zuckte zu meinem Karton, in dem sich, wie mir jetzt wieder einfiel, neben all meinen Psychologielehrbüchern jede Menge Titel über wahre Kriminalfälle befanden: Der Teufel von Chicago, Kaltblütig, Die Bestie von Florenz. Doch im Gegensatz zu den meisten Menschen las ich so etwas nicht zur Unterhaltung, sondern zu Forschungszwecken. Ich las diese Bücher, um zu verstehen, um die Menschen zu analysieren, die das Töten zu ihrem Lebenszweck gemacht haben, und ich verschlang ihre Geschichten beinahe so, als wären sie Klienten von mir, die auf meinem Ledersessel saßen und mir ihre Geheimnisse ins Ohr flüsterten.
«Das könnte man vermutlich so sagen.»
«Nichts für ungut», fügte er hinzu und drehte das Buch so, dass ich den Einband sehen konnte – Mitternacht im Garten von Gut und Böse. Er schlug es auf und blätterte durch die Seiten. «Das ist ein tolles Buch.»
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, und lächelte höflich.
«Jetzt muss ich wirklich los», sagte ich stattdessen, deutete auf meinen Wagen und reichte ihm die Hand. «Danke für Ihre Hilfe.»
«Das Vergnügen war ganz meinerseits, Dr. …»
«Davis», sagte ich. «Chloe Davis.»
«Tja, Dr. Chloe Davis, wenn Sie noch mal Kartons tragen müssen …» Er zog seine Brieftasche aus der Gesäßtasche, entnahm ihr eine Visitenkarte und steckte sie ins aufgeschlagene Buch, klappte es zu und reichte es mir. «Dann wissen Sie, wo Sie mich finden.»
Er lächelte mich an, zwinkerte mir zu und ging zurück ins Gebäude. Als die Automatiktür sich hinter ihm schloss, sah ich auf das Buch in meinen Händen und strich über den glänzenden Einband. Dort, wo seine Visitenkarte steckte, klafften die Seiten ein wenig auseinander. Ich steckte einen Fingernagel hinein und schlug das Buch wieder auf. Während ich seine Karte betrachtete und den Namen darauf las, spürte ich eine mir fremde Regung in der Brust.
Irgendwie wusste ich, dass ich Daniel Briggs nicht zum letzten Mal gesehen hatte.
Kapitel Fünf
Ich entschuldige mich bei Shannon und Daniel und schlüpfe durch die Terrassentür hinaus. Als ich endlich auf der Veranda hinter dem Haus stehe, merke ich, dass sich in meinem Kopf alles dreht – der Wein in meiner Hand ist die vierte Sorte. Meine Ohren dröhnen vom endlosen Small Talk, mein Kopf von der Flasche Wein, die ich mittlerweile intus habe. Draußen ist es immer noch schwül, aber es weht eine erfrischende Brise. Im Haus wird es allmählich stickig, die Körperwärme von vierzig angetrunkenen Menschen heizt die Wände auf.
Nach einer Weile schlendere ich zu dem Picknicktisch, wo haufenweise Flusskrebse, Mais, Würstchen und Kartoffeln auf Zeitungspapier liegen und wundersamerweise noch immer dampfen. Ich stelle mein Glas ab, nehme mir einen Krebs, drehe ihm den Kopf ab und lasse den Saft daraus einfach über mein Handgelenk rinnen.
Dann höre ich etwas hinter mir – Schritte. Eine Stimme ertönt.
«Nicht erschrecken, ich bin’s nur.»
Ich drehe mich um und blicke in die Dunkelheit, bis ich die Gestalt vor mir erkenne, zwischen deren Fingern die kirschrote Spitze einer Zigarette glüht.
«Ich weiß, dass du keine Überraschungen magst.»
«Coop!»
Ich lasse den Krebs auf den Tisch fallen, gehe zu meinem Bruder, lege ihm die Arme um den Hals und atme seinen vertrauten Geruch ein: Nikotin und Minze. Den Seitenhieb auf die Überraschungsparty lasse ich unkommentiert, so perplex bin ich darüber, ihn hier zu sehen.
«Hey, Schwesterchen.»
Ich löse mich von ihm und mustere sein Gesicht. Er sieht älter aus als beim letzten Mal, aber das ist bei Cooper normal. Er scheint innerhalb von Monaten um Jahre zu altern; das Haar an den Schläfen ergraut immer mehr, und die Sorgenfalten auf seiner Stirn scheinen sich täglich tiefer einzugraben. Trotzdem ist Coop einer dieser Männer, die mit zunehmendem Alter immer attraktiver werden. Meine Mitbewohnerin auf dem College nannte ihn distinguiert, als sie entdeckte, dass die Stoppeln an seinem Hals stellenweise grau waren. Aus irgendeinem Grund ist das bei mir hängen geblieben. Es war eigentlich eine ziemlich zutreffende Beschreibung. Er wirkt reif, geschmeidig, nachdenklich, still. Als hätte er in seinen fünfunddreißig Jahren mehr von der Welt gesehen als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Ich löse mich von ihm.
«Ich habe dich drinnen gar nicht gesehen!», sage ich lauter als beabsichtigt.
«Die sind regelrecht über dich hergefallen.» Er lacht, zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette, lässt sie zu Boden fallen und tritt sie aus. «Was ist das für ein Gefühl, wenn einem vierzig Leute auf einmal auf die Pelle rücken?»
Ich zucke die Achseln. «Das beste Training für die Hochzeit, schätze ich.»
Sein Lächeln verliert an Strahlkraft, aber er fängt sich schnell. Wir ignorieren es beide.
«Wo ist Laurel?», frage ich.
Er steckt die Hände in die Taschen und sieht mir über die Schulter; sein Blick wird distanziert. Da weiß ich, was jetzt kommt.
«Sie ist nicht mehr aktuell.»
«Das tut mir leid. Ich mochte sie. Sie schien nett zu sein.»
«Ja.» Er nickt. «Das war sie. Ich mochte sie auch.»
Eine Weile schweigen wir und lauschen dem Stimmengewirr drinnen. Wir verstehen beide, wie kompliziert es ist, nach allem, was wir durchgemacht haben, eine Beziehung aufzubauen; dass es meistens einfach nicht funktioniert.
«Und? Bist du aufgeregt?», fragt er und deutet mit dem Kinn aufs Haus. «Wegen der Hochzeit und so?»
Ich lache. «Und so? Du bist immer so charmant.»
«Du weißt, was ich meine.»
«Klar, weiß ich, was du meinst. Und ja, ich bin aufgeregt. Du solltest ihm eine Chance geben.»
Cooper sieht mich an und kneift die Augen zusammen. Ich schwanke ein bisschen.
«Wovon redest du?», fragt er.
«Von Daniel. Ich weiß, dass du ihn nicht leiden kannst.»
«Wie kommst du denn darauf?»
Jetzt kneife ich die Augen zusammen.
«Müssen wir das wirklich noch mal durchkauen?»
«Ich mag ihn!» Er hebt kapitulierend die Hände. «Was macht er noch gleich?»
«Pharmaberater.»
«Farmberater?», spöttelt er. «Echt jetzt? So kommt er mir gar nicht vor.»
«Pharmazie», sage ich. «Mit ph.»
Cooper lacht, zieht das Zigarettenpäckchen aus der Tasche und steckt sich noch eine zwischen die Lippen. Er bietet mir auch eine an, aber ich schüttele den Kopf.
«Das passt schon eher», sagt er. «So, wie seine Schuhe glänzen, kann er nicht viel Zeit mit Farmern verbringen.»
«Ach, Coop.» Ich verschränke die Arme. «Genau das meine ich.»
«Ich finde bloß, es geht so schnell.» Cooper klappt sein Feuerzeug auf, hält die Flamme an die Zigarette und inhaliert. «Ihr kennt euch jetzt seit – wie lange? Ein paar Monate?»
«Seit einem Jahr. Wir sind seit einem Jahr zusammen.»
«Ihr kennt euch seit einem Jahr.»
«Und?»
«Und wie gut kann man jemanden in einem Jahr kennenlernen? Hast du überhaupt schon seine Familie getroffen?»
«Na ja, nein», gebe ich zu. «Sie stehen sich nicht sehr nahe. Aber komm schon, Coop. Willst du ihn wirklich nach seiner Familie beurteilen? Ausgerechnet du müsstest es doch besser wissen. Familien können zum Kotzen sein.»
Cooper zuckt die Achseln und zieht anstelle einer Antwort noch einmal an seiner Zigarette. Seine Scheinheiligkeit nervt mich. Mein Bruder hatte schon immer die Fähigkeit, ganz beiläufig etwas zu sagen, das mir unter die Haut geht, an mir nagt und mich völlig fertigmacht. Und obendrein tut er noch so, als hätte er es gar nicht darauf angelegt. Als wäre ihm gar nicht klar, wie verletzend seine Worte sind, wie sehr sie schmerzen. Unvermittelt ist mir danach, ihn ebenfalls zu verletzen.
«Schau, es tut mir leid, dass es nicht funktioniert hat mit Laurel, oder auch mit den anderen, wo wir schon dabei sind, aber das gibt dir nicht das Recht, eifersüchtig zu sein», sage ich. «Wenn du dir nur erlauben würdest, dich anderen zu öffnen, anstatt immer so gemein zu sein … du würdest dich wundern, was du alles herausfindest.»
Cooper ist still, und ich weiß, ich bin zu weit gegangen. Das ist der Wein, denke ich. Er macht mich ungewöhnlich direkt. Ungewöhnlich gemein. Cooper zieht heftig an seiner Zigarette und stößt den Rauch aus. Ich seufze.
«Ich hab’s nicht so gemeint.»
«Nein, du hast recht.» Er geht zum Verandageländer, lehnt sich dagegen und kreuzt die Beine. «Das kann ich zugeben. Aber der Mann schmeißt gerade eine Überraschungsparty für dich, Chloe. Du hast Angst vor der Dunkelheit. Scheiße, du hast vor allem Angst.»
Ich klopfe mit dem Finger gegen mein Weinglas.
«Er hat alle Lampen im Haus ausgemacht und die Leute aufgefordert zu schreien, wenn du reinkommst. Er hat dich zu Tode erschreckt. Ich habe gesehen, wie du die Hand in die Tasche gesteckt hast. Ich weiß, was du da gesucht hast.»
Ich schweige. Es ist mir peinlich, dass er das bemerkt hat.
«Wenn er wirklich wüsste, wie verdammt paranoid du bist, meinst du wirklich, er hätte das getan?»
«Er hat es gut gemeint. Das weißt du.»
«Bestimmt, aber darum geht es nicht. Er kennt dich nicht, Chloe. Und du kennst ihn nicht.»
«Doch», fauche ich. «Er kennt mich, Cooper. Er lässt bloß nicht zu, dass ich ständig selbst vor meinem eigenen Schatten erschrecke. Und dafür bin ich dankbar. Das ist nur gesund.»
Cooper seufzt, zieht ein letztes Mal an der Zigarette und schnippt sie übers Geländer.
«Ich sage ja nur, wir sind anders als die, Chloe. Du und ich, wir sind anders. Wir haben heftigen Scheiß durchgemacht.»
Er deutet aufs Haus, und ich drehe mich um und mustere die Leute drinnen. All die Freunde, die zu einer Familie geworden sind, die dort lachen und sich völlig unbekümmert unterhalten – und plötzlich empfinde ich anstelle der Liebe, die mich noch vor wenigen Minuten erfüllt hat, innere Leere. Denn Cooper hat recht. Wir sind anders.
«Weiß er es?», fragt er sanft. Leise.
Ich funkle ihn an. Anstatt ihm zu antworten, kaue ich auf der Innenseite meiner Wange.
«Chloe?»
«Ja», sage ich schließlich. «Ja, natürlich weiß er es, Cooper. Natürlich habe ich es ihm gesagt.»
«Was hast du ihm gesagt?»
«Alles, okay? Er weiß alles.»
Sein Blick zuckt wieder zum Haus, wo die nur gedämpft zu hörende Party ohne uns weitergeht, und wieder schweige ich. Die Innenseite meiner Wange ist schon ganz wund. Ich glaube, ich schmecke Blut.
«Was ist das zwischen euch beiden?», frage ich schließlich mit kraftloser Stimme. «Was ist passiert?»
«Nichts ist passiert. Es ist bloß … ich weiß auch nicht. Weil du so bist, wie du bist und so, und unsere Familie … Ich hoffe einfach, er ist aus den richtigen Gründen bei dir. Mehr will ich gar nicht sagen.»
«Aus den richtigen Gründen?», fahre ich ihn an, lauter, als ratsam ist. «Was soll das denn verdammt noch mal heißen?»
«Chloe, beruhige dich.»
«Nein. Nein, ich beruhige mich nicht. Denn im Prinzip hast du gerade gesagt, dass er mich unmöglich wirklich lieben kann, Cooper. Dass er sich unmöglich wirklich in jemanden verliebt haben kann, der so verkorkst ist wie ich. Wie die angeknackste Chloe.»
«Ach komm, jetzt sei nicht so melodramatisch.»
«Ich bin nicht melodramatisch», fauche ich. «Ich bitte dich