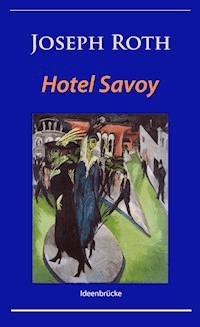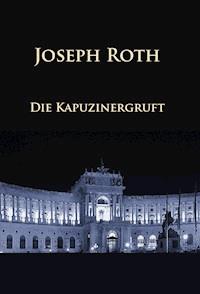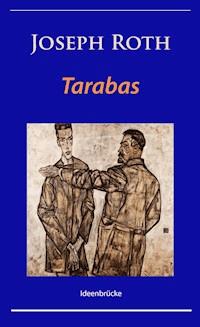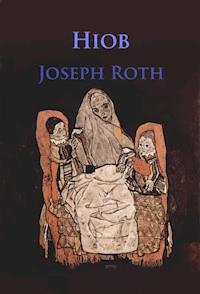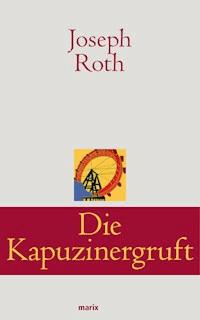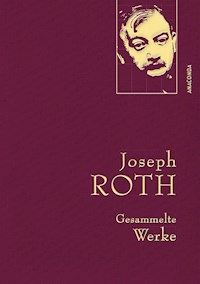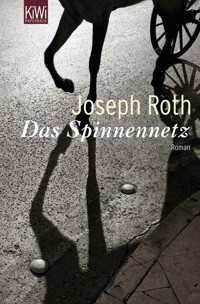
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
»Joseph Roth – einer der besten deutschen Erzähler. Andere hatten im Leben größeren Ruhm. Sein Ruhm wird länger dauern.« Hermann Kesten»Jede Seite, jede Zeile ist wie die Strophe eines Gedichts, gehämmert mit dem genauesten Bewusstsein für Rhythmus und Melodik.« Stefan Zweig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Ähnliche
Joseph Roth
Das Spinnennetz
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Joseph Roth
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
XVI. Kapitel
XVII. Kapitel
XVIII. Kapitel
XIX. Kapitel
XX. Kapitel
XXI. Kapitel
XXII. Kapitel
XXIII. Kapitel
XXIV. Kapitel
XXV. Kapitel
XXVI. Kapitel
XXVII. Kapitel
XXVIII. Kapitel
XXIX. Kapitel
XXX. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
I
Theodor wuchs im Hause seines Vaters heran, des Bahnzollrevisors und gewesenen Wachtmeisters Wilhelm Lohse. Der kleine Theodor war ein blonder, strebsamer und gesitteter Knabe. Er hatte die Bedeutung, die er später erhielt, sehnsüchtig erhofft, aber niemals an sie zu glauben gewagt. Man kann sagen: Er übertraf die Erwartungen, die er niemals auf sich gesetzt hatte.
Der alte Lohse erlebte die Größe seines Sohnes nicht mehr. Dem Bahnzollrevisor war nur vergönnt gewesen, Theodor in der Uniform eines Reserveleutnants zu schauen. Mehr hatte sich der Alte niemals gewünscht. Er starb im vierten Jahre des großen Krieges, und den letzten Augenblick seines Lebens verherrlichte der Gedanke, dass hinter dem Sarge der Leutnant Theodor Lohse schreiten würde.
Ein Jahr später war Theodor nicht mehr Leutnant, sondern Hörer der Rechte und Hauslehrer beim Juwelier Efrussi. Im Hause des Juweliers bekam er jeden Tag weißen Kaffee mit Haut und eine Schinkensemmel und jeden Monat ein Honorar. Es waren die Grundlagen seiner materiellen Existenz. Denn bei der Technischen Nothilfe, zu deren Mitgliedern er zählte, gab es selten Arbeit, und die seltene war hart und mäßig bezahlt. Vom wirtschaftlichen Verband der Reserveoffiziere bezog Theodor einmal wöchentlich Hülsenfrüchte. Diese teilte er mit Mutter und Schwestern, in deren Hause er lebte, geduldet, nicht wohlgelitten, wenig beachtet und, wenn es dennoch geschah, mit Geringschätzung bedacht. Die Mutter kränkelte, die Schwestern gilbten, sie wurden alt und konnten es Theodor nicht verzeihen, dass er nicht seine Pflicht, als Leutnant und zweimal im Heeresbericht genannter Held zu fallen, erfüllt hatte. Ein toter Sohn wäre immer der Stolz der Familie geblieben. Ein abgerüsteter Leutnant und ein Opfer der Revolution war den Frauen lästig. Es lebte Theodor mit den Seinigen wie ein alter Großvater, den man geehrt hätte, wenn er tot gewesen wäre, den man gering schätzt, weil er am Leben bleibt.
Manches Ungemach hätte ihm erspart bleiben können, wenn zwischen ihm und seinem Hause nicht die wortlose Feindschaft wie eine Wand gestanden wäre. Er hätte den Schwestern sagen können, dass er sein Unglück nicht selbst verschuldete; dass er die Revolution verfluchte; dass er einen Hass gegen Sozialisten und Juden nährte; dass er jeden seiner Tage wie ein schmerzendes Joch über gebeugtem Nacken trug und in seiner Zeit sich eingeschlossen wähnte wie in einem sonnenlosen Kerker. Von außen her winkte keine Erlösung, und Flucht war unmöglich. Aber er sagte nichts, immer war er schweigsam gewesen, immer hatte er die unsichtbare Hand vor seinen Lippen gefühlt, immer, als Knabe schon. Nur das auswendig Gelernte, dessen Klang schon fertig und ein dutzend Mal lautlos geformt in seinen Ohren, seiner Kehle lag, konnte er sprechen. Er musste lange lernen, ehe die spröden Worte nachgiebig wurden und sich seinem Gehirn einfügten. Erzählungen lernte er auswendig wie Gedichte, das Bild der gedruckten Sätze stand vor seinem Auge, als sähe er sie im Buch, darüber die Seitenzahl und am Rande die Nase, gekritzelt in müßigen Viertelstunden.
Jede Stunde hatte ein fremdes Gesicht. Alles überraschte ihn. Jedes Ereignis war schrecklich, nur weil es neu war, und verschwunden, ehe er es sich eingeprägt hatte. Aus Furchtsamkeit lernte er Sorgfalt, wurde fleißig, bereitete sich mit hartnäckiger Ruhelosigkeit vor, und wieder und wieder entdeckte er, dass die Vorbereitung noch zu mangelhaft gewesen. Aber er verzehnfachte seinen Eifer, brachte es bis zum zweiten Platz in der Schule. Primus war der Jude Glaser, der leicht und lächelnd, von Büchern und Sorgen unbeschwert, durch die Pausen strich, der in zwanzig Minuten den fehlerlosen lateinischen Aufsatz ablieferte und in dessen Kopfe Vokabeln, Formeln, Ausnahmen und unregelmäßige Verba zu wachsen schienen, ohne mühevoll gezüchtet zu werden.
Der kleine Efrussi war Glaser so ähnlich, dass Theodor Mühe hatte, vor dem Sohn des Juweliers Autorität zu bewahren. Theodor musste eine leise, hartnäckig aufsteigende Zaghaftigkeit unterdrücken, ehe er seinen Schüler zurechtwies. Denn so sicher schrieb der junge Efrussi einen Fehler hin, so selbstbewusst sprach er ihn aus, dass Theodor am Lehrbuch zu zweifeln und seines Schülers Irrtum gelten zu lassen geneigt war. Und immer war es so schon gewesen. Immer hatte Theodor der fremden Macht geglaubt, jeder fremden, die ihm gegenüberstand. In der Armee nur war er glücklich. Was man ihm sagte, musste er glauben, und die andern mussten es, wenn er selbst sprach. Theodor wäre gern sein Leben lang bei der Armee geblieben.
Anders war das Leben in Zivil, grausam, voller Tücke in unbekannten Winkeln. Gab man sich Mühe, sie hatte keine Richtung, Kräfte verschwendete man an Ungewisses, es war ein unaufhörliches Aufbauen von Kartenhäusern, die ein geheimnisvoller Windzug umblies. Kein Sterben nutzte, kein Fleiß erlebte seine Belohnung. Kein Vorgesetzter war, dessen Launen man erkunden, dessen Wünsche man erraten konnte. Alle waren Vorgesetzte, alle Menschen in den Straßen, die Kollegen im Hörsaal, die Mütter sogar und die Schwestern auch.
Alle hatten es leicht, am leichtesten die Glasers und Efrussis: Der wurde Primus und der Juwelier und jener Sohn des reichen Juweliers. Nur in der Armee waren sie nichts geworden, selten Sergeanten. Dort siegte Gerechtigkeit über Schwindel. Denn alles war Schwindel, Glasers Wissen unredlich erworben wie das Geld des Juweliers. Es ging nicht mit rechten Dingen zu, wenn der Soldat Grünbaum einen Urlaub erhielt und wenn Efrussi ein Geschäft machte. Erschwindelt war die Revolution, der Kaiser betrogen, der General genarrt, die Republik ein jüdisches Geschäft. Theodor sah das alles selbst, und die Meinung der anderen verstärkte seine Eindrücke. Kluge Köpfe wie Wilhelm Tiedemann, Professor Koethe, der Dozent Bastelmann, der Physiker Lorranz, der Rassenforscher Mannheim behaupteten und bewiesen die Schädlichkeit der jüdischen Rasse an den Vortragsabenden des Vereines deutscher Rechtshörer und in ihren Büchern, die in der Lesehalle der »Germania« ausgestellt waren.
Oft hatte der Vater Lohse seine Töchter vor dem Verkehr mit jungen Juden in der Tanzstunde gewarnt. Beispiele gibt es, Beispiele! Ihm selbst, dem Bahnzollrevisor Lohse, passierte es mindestens zweimal im Monat, dass ihn Juden aus Posen, welche die schlimmsten sind, zu bestechen versuchten. Im Kriege wurden sie enthoben, für den Kriegsdienst ungeeignet erklärt, saßen sie als Schreiber in den Lazaretten und in den Etappenkommandos.
Im juridischen Seminar meldeten sie sich immer wieder zu Wort und schufen neue Situationen, in denen Theodor sich heimatlos fühlte und zu neuerlichen, unangenehmen, eifervollen, hartnäckigen Arbeiten gedrängt.
Nun hatten sie die Armee vernichtet, nun beherrschten sie den Staat, sie erfanden den Sozialismus, die Vaterlandslosigkeit, die Liebe für den Feind. Es stand in den »Weisen von Zion« – das Buch bekamen alle Mitglieder des Reserveoffiziersverbandes zu den Hülsenfrüchten am Freitag –, dass sie die Weltherrschaft erstrebten. Sie hatten die Polizei in Händen und verfolgten die nationalen Organisationen. Und man musste ihre Söhne unterrichten, von ihnen leben, schlecht leben – wie lebten sie selbst?
Oh, wie herrlich lebten sie! Durch ein graues, silbern schimmerndes Gitter von der gemeinsamen Straße getrennt war das Haus Efrussis und von grünem, weitem Rasen umgeben. Weiß schimmerte der Kies, noch heller die Treppe, die zur Tür führte, Bilder in Goldrahmen hingen im Vestibül, und ein Diener in grün-goldener Livree empfing und verneigte sich. Der Juwelier war hager und groß, immer schwarz gekleidet, in einer hohen, schwarzen Weste, deren Ausschnitt nur ein Stückchen schwarzer, mit einer haselnussgroßen Perle geschmückter Kragenbinde frei ließ.
Theodors Familie bewohnte drei Zimmer in Moabit, und das schönste enthielt zwei wackelige Schränke, als Prunkstück die Kredenz und als einzigen Schmuck jenen silbernen Aufsatz, den Theodor aus dem Schlosse von Amiens gerettet und auf dem Grunde des Koffers geborgen hatte, noch knapp vor der Ankunft des gestrengen Majors Krause, der solche Dinge nicht geschehen ließ.
Nein! Theodor lebte nicht in einer Villa hinter silbrig glänzendem Drahtgitter. Und kein Rang tröstete ihn über die Not seines Lebens. Er war ein Hauslehrer mit gescheiterten Hoffnungen, begrabenem Mut, aber ewig lebendigem, quälendem Ehrgeiz. Frauen, mit einer süßen, lockenden Musik in den wiegenden Hüften, gingen an ihm vorbei, unerreichbar, und er war doch geschaffen, sie zu besitzen. Als Leutnant hätte er sie besessen, alle, auch die junge Frau Efrussi, die zweite Gattin des Juweliers.
Wie ferne war sie, aus jener großen Welt kam sie, in die Theodor beinahe schon gelangt wäre. Sie war eine Dame, jüdisch, aber eine Dame. In der Uniform eines Leutnants hätte er ihr entgegentreten müssen, nicht im Zivil des Hauslehrers. Er hatte einmal, in seiner Leutnantszeit, auf Urlaub in Berlin, ein Abenteuer mit einer Dame. Man konnte schon sagen: Dame; Gattin eines Zigarrenhändlers, der in Flandern stand; seine Fotografie hing im Speisezimmer; violette Unterhöschen trug sie. Es waren die ersten violetten Unterhöschen in Theodors männlichem Dasein.
Was ahnte er jetzt von Damen! Sein waren die kleinen Mädchen für billiges Geld, die hastige Minute kalter Liebe im nächtlichen Dunkel des Hausflurs, in der Nische, umflattert von der Furcht vor dem zufällig heimkehrenden Nachbarn, die Lust, die in der Angst vor dem überraschenden Schritt erlosch, wie die Glut erkaltet, die roh in Flüssigkeit geschleuderte; sein war das barfüßige, einfache Mädel aus dem Norden, das Weib mit den eckigen, harthäutigen Händen, deren Liebkosung rau war, deren Berührung abkühlte, deren Wäsche schmutzig, deren Strümpfe durchschwitzt waren.
Nicht von seiner Welt war sie, die Frau Efrussi. Während er ihre Stimme hörte, fiel ihm ein, dass sie gut sein müsse. Niemand hatte ihm so viel Schönes so einfach und herzlich gesagt. Sie verstehn es vortrefflich, Herr Lohse! Gefällt es Ihnen hier? Fühlen Sie sich wohl bei uns? Oh, wie war sie gut, schön, jung, Theodor hätte sich so eine Schwester gewünscht.
Einmal erschrak er, als sie aus einem Laden trat. Als wäre es plötzlich in ihm hell geworden, erinnerte er sich in diesem Augenblick, dass er auf dem ganzen Wege ihrer gedacht hatte. Es erschreckte ihn die Entdeckung, dass sie in ihm lebte, dass er, wider Willen und ohne es zu wissen, stehen geblieben war, dass er ihre Einladung annahm, mit ihr ins Auto zu steigen, und fast hätte er es vor ihr getan. Manchmal wurde er gegen sie geworfen, ihren Arm berührte er und bat schnell um Verzeihung. Ihre Frage überhörte er. Er musste angestrengt achtgeben, um nicht wieder an sie zu stoßen. Dennoch ereignete es sich. Eifrig bereitete er sich auf den Moment des Aussteigens vor. Aber früher, als er gedacht hatte, hielt der Wagen, und nun war keine Zeit mehr auszusteigen, ihr hilfreich die Hand zu bieten. Er blieb sitzen und ließ sie warten, bis er unten stand, die Schachtel, die er gerade ergreifen wollte, hielt schon der Chauffeur. Aus einer sehr weiten Ferne traf ihr Abschiedswort sein Ohr, aber in unentrinnbarer Nähe lebte ihr Lächeln vor seinen Augen; als lächelte das Spiegelbild einer fern sprechenden Frau.
Niemals erreichte er sie, wie wollte er es? Glühend war sein Wunsch. Aber erloschen der Glaube an seine Kraft zu erobern, da er nicht mehr Leutnant war. Er hätte es erst wieder werden müssen. Er wollte es werden, Leutnant werden oder sonst etwas. Nicht bleiben in der Verborgenheit und nicht mehr geborgen sein, nicht ein bescheidener Ziegelstein im Gefüge einer Mauer, nicht der Letzte der Kameraden, nicht ihr Lauscher und Lacher, wenn sie Anekdoten erzählten und Zoten rissen, nicht mehr einsam unter den vielen, allein mit seiner vergeblichen Sehnsucht, gehört zu werden, und mit der ewigen Enttäuschung des Überhörten, Geduldeten und wegen seiner dankbaren Aufmerksamkeit Beliebten. Oh, glaubten sie, er wäre harmlos und ungefährlich? Sie sollten sehen. Alle sollten es sehen! Bald wird er aus seinem ruhmlosen Winkel treten, ein Sieger, nicht mehr gefangen in der Zeit, nicht mehr unter das Joch seiner Tage gedrückt. Es schmetterten helle Fanfaren irgendwo am Horizont.
Inhaltsverzeichnis
II
Manchmal überfiel ihn sein eigener Stolz wie eine fremde Gewalt, und er fürchtete seine Wünsche, die ihn gefangen hielten. Aber sooft er durch die Straßen ging, hörte er Millionen fremder Stimmen, flimmerten Millionen Buntheiten vor seinen Augen, die Schätze der Welt klangen und leuchteten. Musik wehte aus offenen Fenstern, süßer Duft von schreitenden Frauen, Stolz und Gewalt von sicheren Männern. Sooft er durch das Brandenburger Tor ging, träumte er den alten, verlorenen Traum vom siegreichen Einzug auf schneeweißem Ross, als berittener Hauptmann an der Spitze seiner Kompanie, von Tausenden Frauen beachtet, vielleicht von manchen geküsst, von Fahnen umflattert und Jubel umbraust. Diesen Traum hatte er in sich getragen und liebevoll genährt vom ersten Augenblick seines freiwilligen Eintritts in die Kaserne, durch die Entbehrungen und Lebensnöte des Krieges. Die schmerzende Beschimpfung des Wachtmeisters auf der Exerzierwiese hatte dieser Traum gelindert, den Hunger auf tagelangem Marsch, das brennende Weh in den Knien, den Arrest in dunkler Zelle, das betäubende, qualvolle Weiß der verschneiten Wachtpostennacht, den stechenden Frost in den Zehen.
Der Traum drängte zum Ausbruch wie eine Krankheit, die lange unsichtbar in Gelenken, Nerven, Muskeln lebt und alle Blutgefäße des Körpers erfüllt, der man nicht entrinnen kann, es sei denn, man entrinne sich selbst. Und zufolge jener unbekannten Gewalt, welche Theodor schon oft geholfen hatte und die ihn lehrte, dass der Erfüllung jeder qualvollen Sehnsucht im letzten Moment eine günstige äußere Bedingung auf halbem Wege entgegenkommt, ereignete es sich, dass er den Doktor Trebitsch im Hause Efrussis kennenlernte.
In der ersten Viertelstunde ihrer Bekanntschaft sprach der Doktor Trebitsch unermüdlich, und sein blonder, langer, in sanften, dunkelnden, an den Rändern gelichteten Strähnen herabfließender Bart bewegte sich vor den Augen Theodors in regelmäßigem Auf und Ab und störte die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Leise plätscherten die Worte des Blondbärtigen, eines und das andere blieb eine Weile in Theodor haften und verwehte wieder. Noch nie war er einem Vollbart so nahe gewesen. Plötzlich stöberte ihn der Klang eines Namens aus seiner betäubten Zerstreutheit auf. Es war der Name des Prinzen Heinrich. Und mit dem Instinkt eines Mannes, der zufällig einem Prunkstück aus einer verschütteten Vergangenheit begegnet und es mit rettend hastiger Gebärde an die Brust reißt, rief Theodor: »Ich war Leutnant im Regiment Seiner Hoheit des Prinzen Heinrich!«
»Der Prinz wird sich sehr freuen«, sagte Doktor Trebitsch, und seine Stimme war nicht mehr fern, sondern ganz, ganz nahe.
Der Stolz füllte, wie etwas Körperliches, Theodors Brustkorb, und sein gestärktes Hemd wölbte sich.
Sie fuhren im Auto ins Kasino. Und Theodor saß im Wagen, nicht wie vor einer Woche, als er mit Frau Efrussi fuhr. Nicht mehr fühlte er, gedrückt und dünn, die Ecke zwischen Seitenwand und Rückenpolster. Er breitete sich aus. Sein Körper fühlte durch Paletot, Rock, Weste die sanfte, kühle Nachgiebigkeit des Leders. Die Füße lehnte er gegen den vorderen Sitz. Die Zigarre erfüllte das Coupé mit dem satten Duft einer überflüssigen Behaglichkeit. Theodor öffnete das Fenster und fühlte die schnelle, schießende kalte Märzluft mit der Wollust eines innerlich Durchwärmten.
Man trank Schnaps und Bier, und der Abend im Kasino erinnerte an eine Kaiser-Geburtstagsfeier. Graf Straubwitz von den Kürassieren hielt eine Rede. Man brach in ein dreifaches Hurra aus. Jemand erzählte Anekdoten aus dem Kriege. Theodor war Gast an der Seite des Prinzen. Nicht einen Moment verlor er Seine Hoheit aus den Augen. Er ignorierte seinen Nachbarn zur anderen Seite. Es galt, allezeit auf eine Frage des Prinzen vorbereitet und zur Stelle zu sein. Nicht für die Dauer eines Augenblicks vergaß Theodor, dass er jetzt endlich die Gelegenheit ergreifen konnte, Teile seines Traums zu verwirklichen. War er noch der kleine, unbekannte Hauslehrer eines jüdischen Knaben? Kannte ihn der Prinz nicht? Kannten ihn nicht alle Herren, die hier um den Tisch saßen? Und obwohl der ungewohnte Alkohol allmählich Theodors Sinn für die augenblicklichen, kleinen Wirklichkeiten einschläferte, blieb doch eine große, helle Heiterkeit zurück, und die Sicherheit kehrte ihm so oft wieder, als er sie brauchte, um dem Prinzen eine Serviette, ein Glas, Feuer für die Zigarette zu reichen.