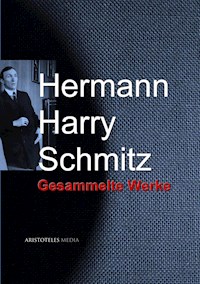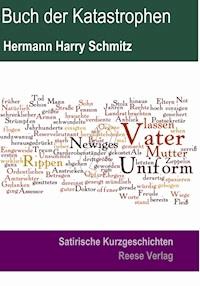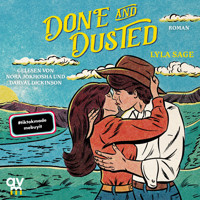Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Grotesken und Katastrophengeschichten über Menschen, Krankheiten und Maschinen. Geschichten, die das Leben schrieb: über Männer, die an Schaltern sitzen, den deutschen Spießer, einen überaus vornehmen Friseur, Aufenthalte im Sanatorium und in der Sommerfrische. Hier ist ein Schriftsteller ("Dandy vom Rhein, Satiriker, Bürgerschreck"), der es mehr als verdient hat, wiederentdeckt zu werden. "Durch die radikal-surreale Gestaltung seiner Grotesken nimmt Hermann Harry Schmitz innerhalb dieses in Deutschland wenig entwickelten Genres eine Sonderstellung ein. In seiner bewusst naiv gewählten Erzählhaltung sucht er als Angriffspunkt für seine Attacken die Welt des Kleinbürgers im Industriezeitalter. Seine Protagonisten mit ihren sinnentleerten Genüssen, ihrem Technikfetischismus, Statusproblemen, aber auch Fluchtbewegungen, wie Reisewut oder falsch verstandenem Naturkult enden zumeist tödlich." (Quelle: Wikipedia) "Hermann Harry Schmitz war zu Lebzeiten so erfolgreich, dass der Kurt-Wolff-Verlag es erst mit den hohen Einnahmen seiner Bücher wagte, einen unbekannten und schwer verständlichen Autor zu verlegen. Sein Name: Franz Kafka." (Quelle: RP) "Hermann Harry Schmitz hätte einen Ehrenplatz unter den wenigen Satirikern Deutschlands verdient" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) "Schmitz war ein höchst skurriler, gescheiter, begnadeter Satiriker um die Jahrhundertwende, und seine Stücke aus dem bürgerlichen Heldenleben gehören zum Komischsten, das ich je gelesen habe..." (Elke Heidenreich) "H.H.Schmitz ist von den hunderten junger schreibfähiger menschen, die ich kenne, einer der wenigen, vielleicht der einzige, der begabung hat und dazu eigenart." (Hanns Heinz Ewers an seinen Verleger)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Die vorzügliche Kaffeemaschine
Das verliehene Buch
Onkel Willibald will baden
Der Säugling
Die Taufe
Der überaus vornehme Friseur
Von Männern, die an Schaltern sitzen
Wie es kompliziert war, bis ich in die Sommerfrische kam
Was mir in der Sommerfrische passierte
Kennen Sie das Land, wo die Zitronen blühen?
Der Blinddarm - ein Fluch!
Im Sanatorium
Über den Autor
Impressum
Hinweise und Rechtliches
E-Books im Reese Verlag:
E-Books Edition Loreart:
Hermann Harry Schmitz
Das entliehene Buch und andere Katastrophen
Die vorzügliche Kaffeemaschine
Jeden Mittag giftete sich der Vater über den Kaffee, den ihm die Mutter nach dem Essen brachte.
Dieses labbrige Gesöff sei kein Kaffee, es sei wohl braun und auch heiß, aber trotzdem kein Kaffee. Er danke auf die Dauer dafür.
Die Mutter verteidigte sich und sagte, sie habe drei Lot hineingegeben und gründlich ziehen lassen. Außerdem sei zu starker Kaffee nicht gesund.
Das war jeden Mittag dieselbe Geschichte.
Tante Rösele Blätterteig, die immer im Wohnzimmer auf einem erhöhten Sitz am Fenster saß und beharrlich graue Socken zweimal rechts und zweimal links strickte, mischte sich regelmäßig in diesen Disput. Warum wolle man nicht auf sie hören und einmal ihr Rezept versuchen: den gemahlenen Kaffee in einen alten Wollstrumpf tun und durch diesen dann das kochende Wasser gießen? Das gebe einen vorzüglichen Kaffee.
Den könne sie von ihm aus eimerweise trinken, schnauzte der Vater die Tante an, er danke dafür. Er habe die Sache aber jetzt endgültig satt. Wenn es noch nicht einmal möglich sei, zu Hause eine anständige Tasse Kaffee zu trinken, pfeife er auf die ganze Haushaltung.
Die Mutter weinte und sagte, sie könne ihm keinen anderen Kaffee vorsetzen. Sie habe getan, was sie tun könne, den besten Kaffee genommen, der in der Stadt zu haben sei, zwei Mark achtzig das Pfund. Dreiviertel Lot habe sie auf eine Tasse genommen. Er liebe sie nicht mehr, er solle es ihr doch gleich ins Gesicht sagen.
Diese leidige Kaffeegeschichte drohte das Eheglück der Eltern ernstlich zu gefährden.
Der Vater war sehr cholerischer Natur. Eines Tages hatte er im Zorn die gefüllte Tasse, dazu noch die feine Tasse mit der Aufschrift „Dem Hausherrn“, gegen die Wand geworfen und geschworen, von nun ab seinen Kaffee im Kaffeehaus zu trinken.
Die Mutter wollte ins Wasser gehen.
Übermorgen war der Geburtstag des Vaters. Das war der rechte Tag zur Ausführung dieses Entschlusses. Dann würde man sie tot aus dem Wasser ziehen und die Leiche dem Vater ins Haus bringen; und er würde jetzt einsehen, was er verloren und wie unrecht er ihr stets getan habe. Zu spät, zu spät, würde er aufstöhnen und sich über sie werfen. Die Tränen liefen ihr über die Backen, als sie sich das alles so vorstellte.
Es sollte anders kommen.
Die Mutter hatte einmal ein Bild gesehen: „Die Lebensmüde“, eine Frau, ganz in Schwarz gekleidet mit einem Spitzentuch um den Kopf, die im Begriff stand, von einer Brücke in den Fluß zu springen.
Ganz in Schwarz, ja, so wollte sie auch sterben, mit einem Spitzentuch um den Kopf. So hatte sie auch im Theater die Rebekka West gesehen. Das gab dem Tod etwas Tragisches. Nun fiel ihr aber auf einmal ein, daß sie kein Spitzentuch hatte. Das war doch zu dumm. Es war eigentlich eine Schande, daß sie kein Spitzentuch besaß. Alle ihre Freundinnen hatten eins. Nichts hatte sie, als den altmodischen Wollschal, wenn sie zum Theater oder Konzert ging. Sie ärgerte sich so darüber, daß sie ganz und gar von ihrer Selbstmordidee abkam.
Dann sprangen ihre Gedanken über zu dem Wollschal; und es fiel ihr ein, daß dieser auch mal wieder gewaschen werden müsse. Ende der Woche würde ohnehin gewaschen, dann könne das gleich mit geschehen. Nur müsse man der Waschfrau recht auf die Finger sehen, daß sie ihn nicht zu heiß wüsche und er einliefe oder verfilze. Gott ja, man hatte so seine liebe Last mit fremden Leuten! Auch die Schlafzimmergardinen hätten es nötig, gewaschen zu werden, fiel ihr noch weiter ein.
So reihte sich eine häusliche Sorge an die andere und entfernte sie immer mehr von ihrem düsteren Vorsatz.
Dann gedachte sie der sechzig Pfund Preiselbeeren, die sie seit einigen Tagen schon im Hause hatte und die unbedingt jetzt eingekocht werden mußten.
Gott ja, Fruchtzucker und praktische Einmachgläser waren noch zu besorgen. Da wollte sie sich aber mal sofort auf die Beine machen.
Schleunigst kleidete sie sich zum Ausgehen an und stürzte, an nichts anderes als an ihre Preiselbeeren denkend, in die Stadt.
Die Einmachgläser hatte sie gekauft. Sie war gerade im Begriff, den Laden zu verlassen, als ihr Blick auf ein großes Plakat fiel, das an einem Gegenstand aus Nickel angebracht war. „Die beste Kaffeemaschine der Welt! In fünf Minuten ein vorzügliches Täßchen Kaffee!“ las sie; und wie ein schwarzes Gespenst tauchte ihre häusliche Tragödie in ihrer ganzen Furchtbarkeit urplötzlich vor ihr auf. Aber gleichzeitig durchzuckte sie auch ein Strahl freudiger Hoffnung angesichts des vielversprechenden Plakats da vor ihr.
„Wir garantieren für diese Kaffeemaschine“, sagte ihr der Ladeninhaber, „es ist das Beste, was zur Zeit auf dem Markt ist. In fünf Minuten haben Sie ein vorzügliches Täßchen Kaffee, gnädige Frau, ohne irgendwelche Mühe. Schauen Sie her, hier dieser Behälter wird mit Spiritus gefüllt, hier hinein kommt der gemahlene Kaffee. Dieser Zylinder ist mit Wasser zu füllen, dann wird hier angezündet, und in wenigen Minuten durchzieht der würzige Duft des Kaffees Ihre Stube. Frau Geheimrat Schnaube hat vergangene Woche zwei dieser Maschinen gekauft, sie ist ganz entzückt davon. Achtundzwanzig Mark ist kein Preis für diese Maschine. Rein Nickel, wird nie gelb.“ Der Mutter erschien diese Kaffeemaschine als Rettungsanker in ihrer häuslichen Misere. Sie würde sie ihrem Gatten zum Geburtstag schenken und ihn mit einer vor seinen Augen hergestellten vorzüglichen Tasse Kaffee versöhnen.
Sie kaufte also diese Wunderkaffeemaschine für achtundzwanzig Mark.
„Beobachten Sie genau die Gebrauchsanweisung“, schärfte man ihr im Laden nochmals ein, „vor allen Dingen geben Sie immer Obacht, daß dieser Hahn hier zu, jenes Ventil stets offen ist. Auch der Ablauf hier muß immer offengehalten werden.“
Es war doch ein Glück, daß sie diese Maschine gefunden hatte. Ihre Absicht, ins Wasser zu gehen, fiel ihr wieder ein. Es wäre doch eigentlich schade um sie gewesen, außerdem - wer hätte dann die Preiselbeeren eingemacht und sich um die Wäsche gekümmert? Schon aus diesen Gründen durfte sie sich als gute Hausfrau in dieser Woche nicht töten. Nun würde ja noch alles gut werden.
Der Geburtstag des Vaters. Die Mutter hatte mit besonderer Sorgfalt den Geburtstagstisch aufgebaut. In der Mitte stand die Kaffeemaschine mit dem Plakat, das sie sich im Laden ausgebeten hatte; auf der einen Seite ein Rodonkuchen, auf der anderen ein Mandelkranz, wie ihn der Vater so gern mochte. Dann zwei Geranientöpfe, eine lange Gesundheitspfeife, ein Paar Plüschpantoffeln, die die Tante mit einem Fuchskopf, dessen Augen aus roten Perlen gemacht waren, bestickt hatte. Weiterhin zwei Pulswärmer, auch eine Arbeit der Tante. Rudi hatte einen Starkasten bebrandmalt, der als Staubtuchbehälter im Hause Verwendung finden sollte. Adele hatte etwas kunstgepunzt: eine echt rindslederne Hausmütze, die zwar nicht sehr bequem war, indessen sehr kleidsam sein sollte. Freilich war sie nicht ganz fertig damit geworden; das hatte sie dem Vater morgens bei der Gratulation weinend gestanden. Der jüngste Bub Erich hatte einen Lampenschirm geklebt: Venedig mit seinen Palästen, deren Fenster ausgeschnitten und mit rotem Seidenpapier beklebt waren.
Der Vater konnte angesichts dieser herrlichen Sachen, Zeichen der Liebe der Seinen - obgleich er wohl den einen oder anderen Gegenstand lieber nicht gehabt hätte - nicht gut anders, als sich freudig überrascht und gerührt stellen.
Sonniger Friede. Mildes Plätschern trauter Familienharmonie.
Jedes Kind bekam einen Kuß, der nach Zigarre schmeckte. Die Mutter bekam auch der Kinder wegen einen Kuß. Das machte sie mutig.
„Jetzt soll Männe aber auch immer sein gutes Täßchen Kaffee bekommen und nicht mehr unzufrieden sein“, hatte sie gesagt und ihren Arm um den Nacken ihres Mannes geschlungen, und so war sie mit ihm durch das Zimmer gegangen. Dem Vater war das ziemlich lästig, er sagte aber nichts um des lieben Friedens willen.
Das Mittagessen war vorbei.
Jetzt kam der große Moment, wo die neue, vorzügliche Kaffeemaschine in Funktion treten sollte.
Die ganze Familie stand um den Tisch herum, nur der Vater saß im Lehnstuhl, dicht vor der Kaffeemaschine.
Er mußte sich die neue Pfeife anzünden, obgleich er viel lieber eine Zigarre geraucht hätte. Man zog ihm die Pulswärmer und die neuen Pantoffeln an. Adele setzte ihm die neue Hausmütze auf, die ihn wie ein Helm kniff. Er ertrug alles wie ein Lamm. Er wollte keinen Mißklang in das Familienidyll hineinbringen.
Er mußte stark an sich halten; denn er war nun einmal sehr cholerischer Natur.
Die Mutter hantierte aufgeregt an der Kaffeemaschine herum. Wie war es doch nur? Hier den Spiritus einfüllen, dort kam der Kaffee hinein und dort das Wasser. Oder war es anders? Wo hatte sie nur die Gebrauchsanweisung?
Die Tante schüttelte den Kopf und nörgelte, weil die Mutter sie nicht mitgenommen hatte, als sie die Maschine kaufte. „Wird schon was Rechtes sein. Dieses neumodische Werk. Ich habe kein Vertrauen zu so was. Hast dir wieder mal etwas anhängen lassen. Es geht nichts über den Wollstrumpf“, brummte sie vor sich hin.
Die Mutter guckte sie wütend an und sagte unwirsch, sie solle doch erst einmal abwarten.
Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts.
Ja und dann mit den Ventilen und Hähnen, wie war das nur damit? Was hatte der Mann im Laden gesagt? Die arme Mutter wurde immer verwirrter, sie stieß die Spiritusflasche um, die sich zur Hälfte auf den Tisch und über die Hose des Vaters ergoß.
Der Vater sog an der Gesundheitspfeife und sagte nichts. Er bekam nur dicke Adern auf der Stirn. Dann nahm die Mutter sich ein Herz. So mußte es sein. Sie goß den Rest des Spiritus in den oberen, das Wasser in den unteren Behälter und gab den gemahlenen Kaffee hinein. Hier mußte angezündet werden, das hatte sie behalten. Das Streichholz machte „Zisch“ und erlosch. Sie verbrauchte eine ganze Schachtel Streichhölzer; es gelang ihr nicht, die Maschine anzuzünden.
Plötzlich stand der ganze Tisch in Flammen. Sie hatte ein glimmendes Streichholz auf den Spiritusfleck auf der Tischdecke fallen lassen.
Der Vater sprang erschreckt auf und stieß sich dabei die Pfeife in den Hals. Er war blau vor Wut, sagte aber noch immer nichts.
„Diese modernen Sachen, ich hab es ja immer gesagt“, murmelte die Tante.
Der Mutter gelang es endlich, die Flammen zu ersticken.
Mit zitternden Händen machte sie sich wieder an der Maschine zu schaffen.
Oder mußte unten angezündet werden?
Der Vater hatte sich wieder im Lehnstuhl aufgebaut. Seine Geduld war beängstigend.
Ja, hier an diesem Hahn mußte gedreht und dann der Spiritus angezündet werden.
Wwubb, wwubb schlug eine blaue Flamme aus der Maschine heraus.
Alles flüchtete vom Tisch weg.
Die Mutter stürzte in die Küche nach einem Eimer Wasser und setzte entschlossen die ganze Maschine unter Wasser.
Die gemütliche Stimmung war so ziemlich zum Teufel.
„Ich habe den Spiritus, glaube ich, in den falschen Behälter getan“, preßte die Mutter bebend hervor; „ich habe das verwechselt. So, jetzt weiß ich es wieder. Das werden wir gleich haben, in fünf Minuten dampft der Kaffee auf dem Tisch.“ Sie versuchte krampfhaft, ihre Sicherheit zu bewahren. Sie nahm die Maschine und ging damit in die Küche.
Der Vater sagte noch immer nichts. Die Augen waren blutig unterlaufen. Er gab dem kleinen Erich einen Tritt, daß er mit dem Lampenschirm auf das Klavier flog. Die kunstgepunzte Mütze schlug er der Adele um den Kopf. Er sagte nichts dabei.
Nach kurzer Zeit kam die Mutter mit der Maschine wieder ins Zimmer. Sie brachte reines Tischzeug mit, und bald sah der Tisch aus, als ob nichts geschehn sei.
Der Vater ließ sich wieder im Lehnstuhl nieder. Die Kinder verkrochen sich hinter die Schränke. In der Maschine summte und brodelte es ganz behaglich. Kaffeeduft erfüllte das Zimmer.
Die Mutter blickte triumphierend um sich.
Der Vater war heute ein Wunder der Selbstbeherrschung. Er war nicht wiederzuerkennen. Es kämpfte zwar noch immer sichtlich in ihm. Er bemühte sich indessen, sogar Interesse für die Kaffeemaschine zu zeigen, und betrachtete sie aus nächster Nähe.
Pfitsch, zischschsch! Ein starker Strahl glühend-heißen Kaffees spritzte plötzlich aus der Maschine hervor, dem Vater mitten ins Gesicht.
Im Nu war sein Kopf eine große Brandblase, die mit dem Vater trotz seines verzweifelten Zappelns wie ein Luftballon an die Decke stieg. Die Mutter kletterte auf einen Stuhl, um den Vater an den Beinen herunterzuziehen. Aber der Stuhl fiel um, und sie schwebte jetzt, die Hände um die Beine des Vaters gekrampft, gleichfalls in der Luft. Laut heulend stürzten die Kinder herbei und klammerten sich an die Beine ihres geliebten Mütterleins, als plötzlich die Kaffeemaschine mit furchtbarem Knall zerplatzte, daß durch die Gewalt der Explosion die Wand des Zimmers nach außen gedrückt wurde. Durch die entstandene Öffnung wurde die ganze aneinanderhängende Familie ins Freie geschleudert.
Heiß trafen die Sonnenstrahlen die Luftballonbrandblase und gaben ihr einen rapiden Auftrieb. Mit außergewöhnlicher Schnelligkeit stieg die ganze Familie in die Luft und war bald den Blicken entschwunden. Nie wieder hat man etwas von ihnen gesehen oder gehört. Das Haus brannte völlig nieder. Im Schutt fand man außer der verbeulten Kaffeemaschine einige verbogene Haarnadeln und Korsettstangen und ein Gebiß: das waren die Überreste der Tante Rösele.
Das verliehene Buch
Es war ein prächtiges Buch mit Goldschnitt und Damasteinband, das in der guten Stube auf dem Tisch lag.
Es war ein sehr langweiliges Buch mit schlechten, sehr schlechten Illustrationen.
Es war der Stolz der ganzen Familie.
Nur der Vater durfte das Buch in die Hand nehmen. An Festtagen setzte sich der Vater sonntäglich angezogen in die gute Stube und las der Mutter und den Kindern mit sonorer Stimme und falscher Betonung aus dem feinen Buch vor. Würdevoll und prätentiös wusch er sich vorher die Hände. Häufig unterbrach er das Vorlesen und erklärte die Abbildungen. Die Kinder machten verständige Gesichter und große, kluge Augen; sie kniffen sich heimlich gegenseitig in die Beine.
Herr Mehlenzell war ein Bekannter des Vaters; er hatte einen Kolonialwarenladen und schrieb an.
Man brauchte viel im Haushalt, und das Gehalt des Vaters war klein.
Herr Mehlenzell bat eines Tages den Vater, er möchte ihm das prächtige Buch leihen. Der Vater erbleichte; er konnte nicht gut nein sagen.
„Auf ein paar Tage. Bestimmt, selbstverständlich haben Sie es am nächsten Sonntag zurück“, hatte Herr Mehlenzell gesagt. Man sprach in der Familie nur über das Buch. Die Mutter meinte, man hätte es ihm nicht geben sollen. Der Vater war sehr ernst. „Bestimmt haben Sie es am Sonntag zurück, hat Herr Mehlenzell gesagt“, verteidigte sich der Vater. „Wir wollen sehen“, brummte die Mutter.
Wo das Buch in der guten Stube gelegen hatte, war ein viereckiger Fleck auf der Tischdecke; der Plüsch war da nicht so verschossen.
Der Sonntag kam. Man war schon sehr früh aufgestanden. Es wurde Mittag; Herr Mehlenzell hatte das Buch nicht gebracht. Der Vater saß mit der Mutter in der guten Stube und war sehr ernst. Keinem hatte das Essen so recht geschmeckt. Um die Kinder kümmerte sich niemand. Man ließ sie im Garten über die Bleiche tollen und ungestört die unreifen Stachelbeeren essen. Der Vater trank eine halbe Flasche Rum. Die Mutter hatte verweinte Augen. Die gute Stube wurde abgeschlossen. Der Vater mußte Montag und Dienstag im Bett liegen. Die Mutter vernachlässigte den Haushalt. Die Kinder verwilderten.
Hundertundvierzig Mark bekam Herr Mehlenzell noch. Man durfte nicht wagen, ihn an das Buch zu erinnern.
Es war unheimlich im Hause, als ob jemand gestorben wäre. Den Vater sah man viel mit der Rumflasche hantieren. Mit der Familie ging es zurück.
Der dritte Sonntag kam, und das Buch war noch immer nicht da.
Es konnte so nicht mehr weitergehen.
Nach dem Mittagessen schrie der Vater nach seinem schwarzen Rock und den Manschetten, rasierte sich und ging zu Mehlenzells.
Frau Mehlenzell öffnete selbst.
Er fragte nach Herrn Mehlenzell, Frau Mehlenzell war mürrisch und fragte, was es sei. Ihr Mann wolle nach dem Essen nicht gestört sein; was es sei.
Es sei sehr dringend, er müsse mit Herrn Mehlenzell sprechen, beharrte der Vater.
Frau Mehlenzell ging brummend in ein Zimmer und ließ den Vater auf dem Korridor stehen.
Frau Mehlenzell hatte die Tür nicht fest hinter sieh zugemacht. Herr Mehlenzell schimpfte, man solle ihn ungeschoren lassen. Was denn der Hungerleider wolle? Dann wurde von innen die Tür zugeschlagen.
Nach einer Weile kam Frau Mehlenzell zurück; ihr Mann hätte nicht viel Zeit, er möge sich kurz fassen.
Herr Mehlenzell lag auf dem Sofa und rauchte eine Zigarre. Er stöhnte den Vater an und blieb ruhig liegen.
Er wolle ihm auf die Rechnung etwas abbezahlen, fing der Vater schüchtern an.
Herr Mehlenzell richtete sich auf und bat den Vater, doch Platz zu nehmen; er schob ihm auch das Zigarrenetui hin. „Über wieviel darf ich quittieren, bitte?“
„Über zwanzig Mark.“
Herr Mehlenzell nahm das Zigarrenetui wieder an sich.
Im Nebenzimmer übte jemand sehr auf dem Klavier.
„ - und dann, was ich sagen wollte“, quetschte der Vater hervor, „ich möchte mal nach dem Buch fragen, ob es Ihnen gefallen hat und ob Sie es vielleicht aushaben?“
„Welches Buch?“
„Sie wissen doch - das Buch von mir, das schöne Buch, was ich Ihnen vor drei Wochen geliehen habe.“
„Ach so, ja. Jetzt fällt es mir ein. Ja, wo habe ich das?“
Dem Vater standen dicke Angstperlen auf der Stirn.
„Warten Sie einmal, da muß ich meine Frau fragen. Haben Sie denn das Buch so nötig?“
Herr Mehlenzell verließ murmelnd das Zimmer,
Im Nebenzimmer spielte man zum siebenten Male „Mädchen, warum weinest du“.
Der Vater ging an die halbgeöffnete Tür und schaute hinein. Lenchen Mehlenzell saß am Klavier.
Man hatte auf einen Stuhl Bücher gelegt, damit Lenchen hoch genug sitzen konnte.
Der Vater war einer Ohnmacht nahe; Lenchen saß auf dem prächtigen Buch!
Der Vater war sonst nicht roh. Er stürzte aus dem Hinterhalt auf das nichtsahnende Kind und warf es von seinem Sitz, ergriff das Buch und floh.
Zu Hause. Das Buch wurde geprüft, es hatte gelitten. Man hatte auf dem Deckel etwas geschnitten, etwas Fettiges, wahrscheinlich Wurst. Es mußte häufig gefallen sein, die Ecken waren verbogen, und die Seiten saßen teilweise lose im Rücken.
Mit zitternder Hand blätterte der Vater in dem Buch.
Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40 - der Vater wurde stutzig - 41, 42, 43, 44, 13, 14, 15, 58, 59, 60, 61, 16 - der Vater wurde grün im Gesicht 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 105. 106, 107, 108 - dem Vater fiel sein Glasauge aus dem Kopf - 109, 110 jetzt wurden die Seiten kleiner, sehr seltsam 111, 112, Seite 110 schloß „Wanderburschen, wandert zu in die weite Welt hinaus“, und es ging weiter auf Seite 111 „mit der weißen, aristokratischen Hand durch das gewellte Haar und ging erregt auf Leonie zu“. In Vaters Buch kam keine Leonie vor. Der Vater bekam einen eiförmigen Kopf.
Der Vater erschlug die Mutter.
Aus dem Buch fiel eine Ansichtskarte an Frau Mehlenzell aus Saarbrücken und ein Zettel mit den denkwürdigen Worten: „2 Paar Socken, 3 Kragen, 1 Taschentuch, 1 Vorhemdchen, 1 Paar Manschetten“.
Der Vater sprang zum Fenster hinaus und brach sich das Genick.
Die Kinder verdarben.
Schauderhaft, höchst schauderhaft.