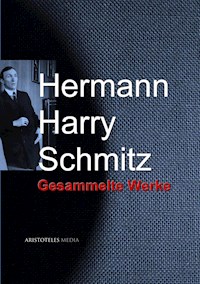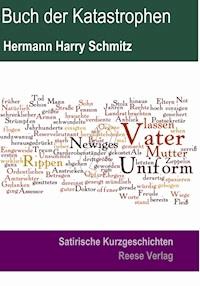
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Grotesken und Katastrophengeschichten über Menschen, Tiere und Maschinen. Fabeln ohne Moral, Geschichten, die das Leben schrieb über die Feine Gesellschaft, einem Tierfreund und dem Mann mit dem verschluckten Auge oder einem Umzug, der im Chaos endet und die Hitze in der Stadt. Hier ist ein Schriftsteller ("Dandy vom Rhein, Satiriker, Bürgerschreck"), der es mehr als verdient hat, wiederentdeckt zu werden. "Durch die radikal-surreale Gestaltung seiner Grotesken nimmt Hermann Harry Schmitz innerhalb dieses in Deutschland wenig entwickelten Genres eine Sonderstellung ein. In seiner bewusst naiv gewählten Erzählhaltung sucht er als Angriffspunkt für seine Attacken die Welt des Kleinbürgers im Industriezeitalter. Seine Protagonisten mit ihren sinnentleerten Genüssen, ihrem Technikfetischismus, Statusproblemen, aber auch Fluchtbewegungen, wie Reisewut oder falsch verstandenem Naturkult enden zumeist tödlich." (Quelle: Wikipedia) "Hermann Harry Schmitz war zu Lebzeiten so erfolgreich, dass der Kurt-Wolff-Verlag es erst mit den hohen Einnahmen seiner Bücher wagte, einen unbekannten und schwer verständlichen Autor zu verlegen. Sein Name: Franz Kafka." (Quelle: RP) "Hermann Harry Schmitz hätte einen Ehrenplatz unter den wenigen Satirikern Deutschlands verdient" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) "Schmitz war ein höchst skurriler, gescheiter, begnadeter Satiriker um die Jahrhundertwende, und seine Stücke aus dem bürgerlichen Heldenleben gehören zum Komischsten, das ich je gelesen habe..." (Elke Heidenreich) "H.H.Schmitz ist von den hunderten junger schreibfähiger menschen, die ich kenne, einer der wenigen, vielleicht der einzige, der begabung hat und dazu eigenart." (Hanns Heinz Ewers an seinen Verleger)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Harry Schmitz
Buch der Katastrophen
Aus einem rheinischen Städtchen
Turbine Muhlmann
Als wir am 30. September, morgens, aus dem Gasthaus »Zum Turm« traten, war ganz Caub beflaggt.
»Aha, wegen Sedan«, meinte Toni Bender, der nicht gern lange über etwas nachgrübelte.
»Sedan ist doch am 2. September«, belehrte ich ihn.
Ich studiere nämlich peinlich genau alltäglich den Abreißkalender, das ist zur wahren Manie bei mir geworden. Auf diese Weise sind mir die historischen Daten ziemlich geläufig. Ich rekapitulierte: »30. September: Todestag des Schlachtenmalers Franz Adam und des bekannten Chirurgen B. von Langenbeck und Geburtstag der Johanna Sebus.«
»Es wird wegen der Sebus sein«, reflektierte ich, »die hat sich ja um die Rettung aus Wassersnot verdient gemacht. Das wird schon so sein, daß man die hier in Caub, wo sich alles um die Schifffahrt dreht, feiert.«
»Mußt ja immer alles besser wissen«, sagte Toni; »von mir aus können sie auch wegen Johanna Sebus geflaggt haben. Uns kann das aber auch völlig gleichgültig sein. Mir wenigstens ist es furchtbar egal.«
Schweigend gingen wir nebeneinander her.
Eigentlich wollte es mir doch nicht so recht in den Kopf, die Sache mit der Johanna Sebus. Man hätte doch schon mal irgendwie ihren Namen in Verbindung mit Caub hören müssen.
Meine Gründlichkeit ließ mir keine Ruhe.
»Du, Toni, in welchen Beziehungen mag Johanna Sebus denn eigentlich zu diesem Städtchen gestanden haben?«
»Ihr Bruder war mit Blücher zusammen auf Quinta«, suchte Toni Bender die Frage abzutun, »und Blücher ist doch der Stadtheilige hier.«
Davon hatte ich noch nie gehört und äußerte einigen Zweifel dieser Behauptung gegenüber.
Toni Bender wurde die ganze Angelegenheit riesig lästig. »Immer deine Spitzfindigkeiten, die stehen mir schon am Hals heraus«, grollte er.
»Ich möchte das doch gerne wissen; ich werde jemand fragen«, entschloß ich mich.
»Wirst dich nett blamieren mit deiner Ignoranz«, nörgelte Toni weiter; »ich wüßte aber auch wirklich nicht, was mir annähernd so gleichgültig wäre wie die Frage, warum heute hier geflaggt ist.«
Der Steuermann Jonas Rüderke kam uns entgegen. Den fragte ich. Er war im höchsten Grade erstaunt: »Na, das wissen Sie nicht? - Frau Turbine Muhlmann hat heute Geburtstag.«
»Ach ja, natürlich«, verstellte sich Toni Bender; »ich habe es dir ja direkt gesagt«, wandte er sich an mich.
»Da hast du dich mal wieder nett blamiert«, fuhr er fort, als der Steuermann weg war.
Beklommen schwieg ich. Turbine Muhlmann - davon hatte ich noch nie gehört. Ich strengte mein Hirn vergebens an. Sollte ich, der ich mir wirklich mit Recht auf meine Datenkenntnis etwas einbilden konnte, hier versagen?
Ich mußte mir Luft machen.
»Du weißt hoffentlich jetzt wenigstens, wer Turbine Muhlmann war«, suchte ich Toni Bender zu verblüffen. »Natürlich. Die geistvolle Erfinderin der Sommersprossen«, bekam ich prompt zur Antwort.
Ich schwieg wütend und kaute an meiner Zigarre. »Entschuldige, ich glaube, ich habe mich vertan«, begann Toni Bender nach einer Weile mit dem harmlosesten Gesicht von der Welt; »Frau Muhlmann war die wackere Vorkämpferin der Kniebeuge.«
»Ich verbitte mir diesen Quatsch!« schrie ich ihn wütend an.
»Wie kann ich nur so vergeßlich sein. Du hast recht, unwillig zu sein. Ich habe das verwechselt. Frau Muhlmann war die talentvolle Erfinderin des kleinen Einmaleins«, fing Toni wieder an mit sachlich gerunzelter Stirn.
Ich boxte ihn unter das Kinn. Er trat mir gegen das Schienbein. Es gab einen Mißton in unserer Freundschaft. Wütend ging jeder einen anderen Weg.
Die Turbine Muhlmann ging mir im Kopf herum. Sie mußte doch eine historische Person sein, wenn eine ganze Stadt ihretwegen Flaggenschmuck anlegte.
Ich fragte noch etwa zwanzig Leute, denen ich begegnete, natürlich höchst diplomatisch - ich wollte mir doch keine Blöße geben -, konnte aber nicht mehr erfahren als das, was mir Jonas Rüderke gesagt hatte.
Ich betrank mich, so ärgerte mich diese Geschichte, und schlief dann bis zum Abend.
Am Stammtisch im »Turm« traf ich abends wieder mit Toni Bender zusammen. Er lachte mich freundlich an. Ich schnitt ihn.
Die Schifffahrt gab dem Stammtisch seinen Charakter. Ein kunstvoll gearbeiteter Anker aus Messing lag in der Mitte. Die Kapitäne und Steuerleute trafen sich hier. Alles famose, liebe Menschen.
Über berufliche Dinge und Tagesfragen wurde debattiert.
Eine gewisse Hitze oder Leidenschaftlichkeit, die sonst im allgemeinen derartigen Stammtischunterhaltungen anhaftet, kam hier nicht so recht auf, denn meistens war schon spätestens um halb zehn Uhr die Mehrzahl der Mitglieder der Tafelrunde eingeschlafen. Es kam sogar vor, daß Toni Bender und ich allein als letzte Überlebende am Tisch saßen.
Bis elf Uhr blieb man in der Regel so angeregt schnarchend beisammen, dann rieb man sich verwundert die Augen, trank seinen Schoppen leer und ging, höchst befriedigt von dem unterhaltsamen Abend, auseinander.
Ich wandte einmal schüchtern ein, daß es sich doch eigentlich zu Hause viel bequemer schlafen lasse. Da kam ich aber schlecht an. Man wolle auch seine Zerstreuung, sein Vergnügen haben, wenn man den ganzen Tag, von morgens um vier Uhr ab, hart gearbeitet habe. Das leuchtete mir ein. Warum man aber auch schon so früh anfange? Die Schiffe könnten doch auch zu einer anständigen Zeit, vielleicht so gegen elf Uhr, abfahren, bemerkte ich.
Davon verstünde ich nichts, hieß es.
An dem Abend von Frau Muhlmanns Geburtstag war der Stammtisch sehr gut besucht. Es ging lebhafter zu als gewöhnlich.
Man sprach allgemein von dem Geburtstagskind. Am meisten aber Toni Bender. Er finde diese einheitliche Flaggenkundgebung für diese verdiente Frau wirklich im höchsten Grade sympathisch. Er trinke auf das Wohl der Jubilarin und der Cauber Bürger, die so solidarisch in solchen Fragen zusammenhielten. Unverschämt feixend schaute er zu mir herüber.
Man wollte auch von mir hören, wie mir diese Kundgebung gefiele. »Oh, gut, ich finde das wirklich wohltuend«, erwiderte ich vor mich hinblickend.
Ich saß wie auf glühenden Kohlen. Mein ganzes Prestige wäre zum Teufel gewesen, wenn man gemerkt hätte, daß ich keine Ahnung davon hatte, wer diese bemerkenswerte und sehr gefeierte Turbine Muhlmann war.
Toni Bender, dem Halunken, war meine Verlegenheit nicht entgangen, und er wußte, wenn sich das Gespräch einem anderen Gebiet zuwenden wollte, es immer wieder krampfhaft auf die Muhlmann zu bringen.
Ich hielt es nicht länger aus. Unter irgendeinem Vorwand drückte ich mich und kehrte erst nach elf Uhr in den »Turm« zurück.
Nur noch der Wirt war auf. Der mußte mir Aufschluß geben über diese rätselhafte Muhlmann.
Ich lud ihn zu einer Pulle Cauber Pfannstiel ein.
Aus der einen Flasche wurden fünf. Als ich wankend sehr spät mein Zimmer aufsuchte, wußte ich noch immer nicht, wer Turbine Muhlmann war.
Ich habe tagelang die Menschen gemieden, mich scheu verkrochen. Meine Unwissenheit lag wie etwas sehr Schweres auf mir. Das Gespenst dieser mysteriösen Turbine Muhlmann verfolgte mich überall hin.
Dann habe ich mir ein Herz genommen und bin offiziell auf die Bürgermeisterei gegangen.
Ich habe den Bürgermeister gebeten, mir Einsicht in das städtische Archiv zu gestatten, unter dem Vorwand, daß ich die Absicht hätte, ein Werk zu schreiben über historische und legendäre Persönlichkeiten, die in irgendeiner Weise mit der Stadt in Berührung gekommen. So fehlten mir u. a. noch einige Daten aus dem Leben der Turbine Muhlmann.
Der Bürgermeister schaute mich verwundert an. »Die Urkunden und Chroniken stelle ich Ihnen recht gern zur Verfügung«, sagte er, »aber über die Frau Muhlmann werden Sie darin nichts finden. Das ist doch die Schwiegermutter vom Turmwirt, die vor einigen Tagen ihren 80. Geburtstag gefeiert hat!«
Ich machte ein recht dummes Gesicht und stotterte verwirrt heraus: »Ja, aber alles hatte doch geflaggt wie an einem patriotischen Festtag.«
»Ja, das ist hier so Brauch. Die Flaggen sitzen locker. Die Muhlmanns sind eine alte, weitverzweigte Cauber Familie«, belehrte mich der Bürgermeister. - Ich weiß nicht, ob Toni Bender von meiner Blamage gehört hat.
Er fragt mich von Zeit zu Zeit mit dem unschuldigsten Gesicht, ob ich nicht zufällig wisse, ob Blücher nicht zur Turbine Muhlmann in irgendeinem verwandtschaftlichen Verhältnis gestanden habe. -
Ich rede dann immer einige Tage nicht mehr mit ihm.
Das Elslein von Caub
Ich habe hier meine kurzsichtige Tante Anisplätzchen Wilbert zwei Tage zu Besuch gehabt.
Am ersten Tag ging ich mit ihr zum Blücherdenkmal. Kopfschüttelnd blieb sie eine Weile schweigend davor stehen. Dann sagte sie, sie finde die Auffassung des Bildhauers immerhin merkwürdig. Aus dem Kostüm werde sie vor allem nicht so recht klug. Der Kopf gehe ja, die Züge seien von einem außergewöhnlichen Liebreiz.
Ich guckte sie groß an. So konfus hatte man den famosen Marschall Vorwärts noch nicht kritisiert.
»Das ist doch ein sehr verständliches Monument«, warf ich ein.
»So, findest du? Ich kann mir nicht helfen«, beharrte Tante Wilbert, »ich habe mir das Elslein von Caub anders vorgestellt.«
»Das ist doch das Blücherdenkmal«, belehrte ich sie.
»Ach so, warum hast du das nicht gleich gesagt?«
Fast jedes Nest am Rhein hat seine Reminiszenz an einen deutschen Dichter. Meistens nehmen Gasthäuser für sich die Ehre in Anspruch, daß gerade ihr Wein oder ihre Wirtin einstens die Anregung zu dem oder jenem bekannten Gedicht gegeben habe. Häufig wetteifern mehrere Prätendenten um dieselbe Ehre.
In Königswinter gibt es eine Wirtschaft »Zum kühlen Grunde« und eine andere »Zum wirklichen kühlen Grunde«. Wie ich höre, soll noch ein dritter Wirt den kühlen Grund für sich in Anspruch nehmen und sein Lokal »Zum amtlich beglaubigten und privilegierten kühlen Grunde« nennen.
Original-Lindenwirtinnen, Original-Mädchen von Stolzenfels usw. gibt es massenhaft hier am Rhein. So sagt wenigstens Toni Bender, der sich darüber ärgert, daß die Dichter gerade gut genug sind, um als Aushängeschild für spekulative Hoteliers zu dienen.
Toni Bender ist und bleibt ein Nörgler. Auch geriet er in Wut, als ich ihn nach dem Elslein von Caub fragte. »Nicht weniger als vier behaupten, das echte Elslein von Caub zu sein«, sagte Toni Bender, »davon heißt eine Mathilde, die scheidet mal sofort aus. Die zweite hat die Gicht, die dritte wiegt 280 Pfund, und die vierte ist vor einigen Tagen Großmutter geworden. So viel Phantasie kann ich nicht aufbringen, in diesen Matronen, so rüstig sie auch sein mögen - selbst wenn sie die Tradition auf ihrer Seite haben -, das im Cauber Nationallied gepriesene Elslein von Caub, die »Schönst’ im ganzen Reich« zu sehen. Ein Elslein von Caub, an das ich glauben soll, muß einen roten Mund zum Küssen haben und mit den blitzenden Augen der siegenden Jugend in die Welt lachen. Dann braucht sie von mir aus nicht einmal Else zu heißen!«
»Das ist ja Quatsch«, warf ich ein, »ein Elslein von Caub kann nicht Marie oder Stina heißen. Das ist meines Erachtens die Hauptbedingung.« -
Es war mir aufgefallen, daß Toni überall von den bezüglichen Wirtstöchtern mit einer außergewöhnlichen, direkt verblüffenden Liebenswürdigkeit behandelt wurde. Sämtliche Backfische Caubs schienen für ihn zu schwärmen. Ich, der ich doch viel schöner war als er, wurde fast gar nicht beachtet, so große Mühe ich mir auch gab. Ich wechselte geradezu beängstigend häufig meine Krawatte, sorgte peinlich genau dafür, daß die Strümpfe in der Farbe zur Krawatte stimmten, band die Schnürbänder an den Halbschuhen zu höchst graziösen Schleifen.
Ich versuchte als angenehmer Gesellschafter zu glänzen, indem ich Kartenkunststücke machte, launige Schnurren erzählte, eine gedachte Zahl zu raten versuchte, auf einem mit Seidenpapier überzogenen Kamm trompetete, mir die Haare ins Gesicht strich und schwermütige Lieder sang. Ich bot mich an, Garn zu halten oder Ableger von Geranien zu besorgen. Alles umsonst. Es gelang mir nicht, diesen Toni Bender auszustechen.
Ich beschloß, ihn mit einer gewissen Kälte zu behandeln. Eines Tages erfuhr ich vom wackeren Turmwirt die Ursache von Tonis Erfolgen.
Er hatte es verstanden, sich ein unerhörtes Ansehen zu geben, und so nebenbei verlauten lassen, er werde dafür sorgen, daß Caub wieder eine Attraktion in einem einwandfreien Eislein von Caub erhalte.
Das hatte sich bei den ehrgeizigen Backfischen herumgesprochen.
Jetzt ging mir ein Licht auf.
Er hatte eine Schwäche für eine gemütliche, altertümliche Schenke, in der ein braunlockiges Mädel den Wein kredenzte.
Eine ausgeschlissene Steintreppe führte in die braungetäfelte Gaststube.
Wenn Toni Bender sagte, er habe eine wichtige Besorgung zu machen, fand ich ihn stets hier bei der braunen Else. Auch umgekehrt überraschte er mich, wenn ich eine dringende, höchst wichtige Kommission vorgeschützt hatte, sehr häufig hier.
Diese höchst seltene Übereinstimmung des Geschmackes brachte uns wieder näher, und eines Tages, als Toni gerade besonders guter Laune war - er hatte mich erfolgreich angepumpt -, erzählte er mir seinen Plan, das entzückende Wirtstöchterlein hier offiziell zum Elslein von Caub zu stempeln.
Bei einer monumentalen Bowle haben wir in Gegenwart von alteingesessenen Bürgern die Belehnung vor sich gehen lassen. Es fing höchst feierlich im Gehrock und mit wohlgebauten Reden an und endete in einer höchst unfeierlichen Trunkenheit.
Jetzt hat sich plötzlich das Interesse der hiesigen Backfische auch mir zugewandt. Und ich finde das nicht mehr als recht, denn ich bin wirklich schöner als Toni Bender.
Der gute Mensch
Aloys Behnewind war ein guter Mensch, ein wirklich, wahrhaft guter Mensch von einem ausgeprägten, fast krankhaften Altruismus, wie man ihn heute in der Zeit der feindlichen, räumenden Ellenbogen fast niemals mehr findet. Er war Junggeselle und hatte eine festgelegte auskömmliche Lebensrente.
Saß Aloys, der gute Mensch, bei Regenwetter in einer völlig besetzten elektrischen Bahn, so konnte er es nicht übers Herz bringen, sitzen zu bleiben, wenn sich jemand, welchen Geschlechts, Alters oder Standes er auch war, Platz suchend mit verzweifelten Gebärden in den Wagen hineindrängte. Sein gutes Gefühl, seine sensible Höflichkeit zwangen ihn, sofort aufzustehen und dem überzähligen Eindringling Platz zu machen.
Eingeengt zwischen den Wällen feindlicher Beine und Knie stand er so eines Tages mitten im Wagen und wurde bei jeder Kurve, bei jedem plötzlichen Halten oder Abfahren durch den Ruck des Wagens hin- und hergestoßen. Er trat dabei den Leuten auf die Füße, stieß aus Versehen mit seinem nassen Regenschirm jemanden in den Mund, setzte sich an einer besonders scharfen Kurve unfreiwillig auf den Schoß einer dicken Dame, wo sich bereits ein kleines Mopperl befand, sprang erschreckt und beschämt auf, um sich, von einem neuen Ruck gestoßen, in eine Pflaumentorte, die ein Konditorlehrling vorsichtig auf seinen Beinen hielt, zu setzen. Allgemeines spöttisches Lächeln auf den Mienen der Mitpassagiere. »Tölpel«, brummte ein alter Herr, dem er beim unfreiwilligen Voltigieren durch den Wagen mit seinem nach einem Stützpunkt suchenden krampfhaften Armgeschlage den Hut vom Kopfe hieb. Die alte Dame mit dem Hund schimpfte in häßlichen Ausdrücken, rief nach der Polizei und dem Schaffner. Der Konditorjunge weinte, und alle im Wagen nahmen seine Partei und sagten, Aloys müsse unbedingt die Torte bezahlen. Der Schaffner verwies ihn in strengem Ton, in der Mitte des Wagens zu stehen; er solle sich an die Vordertür stellen. Da war auch ein Ledergurt an der Decke angebracht, an dem man sich hätte halten können, wenn er nicht so schmierig und glitschig gewesen wäre.
Die Stellung an der Vordertür war äußerst quälend. Fortgesetzt mußte Aloys unter Gefahr einer Darmverschlingung den Rumpf im rechten Winkel zur Seite wenden, weil jeden Augenblick der Schaffner durch ein kleines Fensterchen mit einer Klappe, wie sie an Zellentüren in Gefängnissen angebracht sind, den Leuten auf dem Vorderperron Billetts reichte. Jetzt war einer an der letzten Haltestelle eingestiegenen alten Frau mit einem Korbe ihr 50-Pfennig-Stück, das sie krampfhaft zwischen den runzeligen, gichtknotigen Fingern gehalten hatte, entfallen und zwischen die Latten des Bodenbelages geraten. Natürlich war Aloys Behnewind mit seiner guten Seele der erste, der sich bückte, um das entfallene Geldstück zwischen den Latten hervorzuholen. Er bückte sich zu tief und fiel bei einer Kurve vornüber; dabei rutschten ihm seine Zigarren, seine Briefschaften, sein Notizbuch aus den Taschen und verstreuten sich auf dem schmutzigen Boden des Wagens. Auch der Kneifer fiel ihm von der Nase. Dann klemmte er sich, als er mit den Fingern zwischen die Latten faßte, den Zeigefinger und den Daumen ein. Niemand hatte Mitleid mit ihm, im Gegenteil, die meisten feixten höhnisch.
Da kam der Kontrolleur in den Wagen, um die Fahrkarten zu revidieren. Aloys konnte natürlich seine Karte nicht finden, sie war ihm bei der Suche nach dem 50-Pfennig-Stück entfallen. Der Kontrolleur forderte mit drohender Ader auf der Stirn die Lösung einer neuen Karte. Aloys hatte dem Konditorjungen seine letzten drei Mark gegeben und war ohne einen Groschen. Er mußte seinen Namen nennen, den der Kontrolleur mit strengem, vorwurfsvollem Gesicht in ein fettiges Notizbuch schrieb. Danach ließ der scharfe Beamte den Wagen auf offener Strecke halten und befahl ihm mit unerbittlicher Miene, sofort auszusteigen, sonst würde er ihm Beine machen. Auf den Gesichtern der anderen Passagiere lag ein Schimmer von vollkommener Befriedigung. »Das geschieht dem Tölpel recht«, sagte jemand.
Es regnete und stürmte, daß es schwer war, voranzukommen. Regen und Hagel schlugen einem um die Ohren. Aloys machte sich entschlossen auf in der Richtung seiner Wohnung, die eine gute Stunde entfernt lag. Einem Herrn, der vor ihm ging, riß ein plötzlicher Windstoß den Hut vom Kopf und zauste den aufgespannten Schirm, daß er umschnappte und im Nu das Aussehen eines verunglückten, abgestürzten Aeroplans bekam. Der Hut rollte in der entgegengesetzten Richtung von Aloysens Wohnung wie ein flüchtiger Hase durch den Straßendreck und die Gossen. Schon faßte unwiderstehlich, mit Allgewalt den guten Menschen Aloys die altruistische Manie, und in gewaltigen Sprüngen setzte er dem Hut des fremden Mannes nach. Seine Pelerine schlug sich bei dieser wilden Jagd um seinen Kopf. Er lief mit aller Kraft gegen eine Gaslaterne, daß die Laterne oben abbrach. Eine grün-blaue Beule war die Folge dieses Zusammenstoßes. Er befreite seinen Kopf von der Pelerine und rannte weiter dem fremden Hut nach. Tückisch verschlangen sich die Bänder der Pelerine um seine Beine. Er kam im vollen Lauf zu Fall und stieß sich mit dem Schienbein erheblich an dem granitenen Rand des Bürgersteiges. Sein eigener Hut wurde von der Windsbraut gleichfalls entführt. Er stieg wie ein Windvogel in die Luft und blieb an der Dachrinne eines Kirchturmes hängen. Was kümmerte ihn sein Hut? Sein gutes Herz gab ihm ein, zuerst den fremden Hut zu retten. Bald hätte er ihn erwischt, als im selben Moment ein dahersausendes Auto den Hut überfuhr und ihn in ein völlig zerfetztes Filzernes verwandelte. Es stach Aloys weh ins Herz, als er sah, daß seine Aufopferung vergeblich war. Traurig trottete er ohne Hut, mit der Beule als Kopfbedeckung, durch dieses Schweinewetter nach Hause.
Seine Bereitwilligkeit, aller Welt zu helfen, war sein Fluch und brachte ihn fortgesetzt in äußerst unangenehme und peinliche Situationen. Jeden Tag hatte er irgendeine kleinere oder größere Schererei durch seine Hilfsbereitschaft. Niemand dankte ihm; er war immer der Blamierte. Er sah nicht ein, daß der gute Mensch eben ganz und gar nicht mehr in unsere heutige Zeit paßt.
Aloys hatte einen Bekannten namens Oskar Knieß, ein krasser Egoist, der es nur darauf absah, den guten Aloys auszunutzen. Eines Tages besuchte Oskar den guten Aloys. Natürlich kam er mit einer Bitte. Oskar sprach von einem Mädchen, welches er in Büderich am letzten Sonntag kennengelernt habe. Genau konnte er sich nun nicht so recht mehr erinnern, wie sie aussah, ob sie hübsch war und was sie anhatte, er war nämlich an dem Tage erheblich betrunken gewesen und entsann sich nur unklar der Maid. Nur das eine wußte er, daß er sie für den nächsten Sonntag eingeladen hatte, um ihr die Stadt zu zeigen. Sie sollte mit dem Zug um elf Uhr kommen und Aloys müsse mit von der Partie sein.
Um elf Uhr Sonntag vormittag standen Oskar und Aloys auf dem Bahnhof, um die Donna aus Büderich abzuholen. Und sie kam. Starr schauten die beiden auf eine dicke Weibsperson mit einem knalligen Papierblumengarten auf dem Fettkopf und einer grün und rot karierten Bluse aus Flanell. Es war ein grotesker Aufzug, der die beiden Gentlemen lähmte. Die Holde näherte sich watschelnd wie ein Auto mit kaputten Pneus, ein breites, schmunzelndes Lachen auf dem sommersprossigen Gesicht, und ehe Oskar wußte, wie ihm geschah, lag sie ihm an der Brust. Der Anprall warf ihn beinahe zu Boden. Ein unendliches Mitleid erfaßte Aloys für Oskar. Mußte der betrunken gewesen sein, als er dieses entzückende Geschöpf kennenlernte! Apathisch ließ Oskar alles geschehen. Er war völlig zerquetscht und aus der Form, als die Schöne von ihm abließ. Jetzt hing sie sich bei Aloys ein. Oskar kam wieder zu sich und versuchte abzurücken, daß es so aussah, als ob er überhaupt gar nicht zu dieser Person gehöre. Wie peinlich war ihm dieser Aufzug! Er legte Wert darauf, in der feinen Gesellschaft zu verkehren, und nahm sich höllisch in acht, gegen die feinen Manieren zu verstoßen. Aloys war weniger penibel, aber daß ihn diese Lady vom Lande mit selbstverständlicher Intimität einhakte, auf offener Straße, gerade zur Promenadenzeit, wo alles unterwegs war, ging ihm doch ein wenig gegen den Strich.
Oskar Knieß ging bereits drei Meter vor dem Paar und überließ Aloys den spöttischen Blicken der Passanten. Er war mehr tot als lebendig. Flucht, rücksichtslose Flucht, das war die einzige Rettung. Aber wie? Scheu und verstohlen ließ er seine Augen herumschweifen, wo war eine Rettung? Aloys trottete schweigend neben dem Mädchen her. Sein verzeihendes Gütegefühl begann sich in seinem guten Herzen zu regen. Es war doch tragisch, wenn eine sogenannte Krone der Schöpfung so aussah wie diese Büdericher Vertreterin des schönen Geschlechts. Ein Gefühl des Wohlwollens und des herzlichen Mitleids wegen dieses tragischen Dilemmas begann sich in seinem guten Herzen zu regen. Oskar Knieß sah plötzlich scharf die Straße hinunter. Sein verdrossenes Gesicht erhellte sich sichtbar. Hoffnung lag auf seinen Zügen. Dort, etwa hundert Schritte weiter, klapperten an einem Schild zwei Messingbecken, das Zunftzeichen der Friseure. Eine glänzende Idee! »Ich muß mich eben rasieren lassen«, stieß Oskar Knieß plötzlich, kaum eine Erleichterung verbergend, hervor, »bitte, wartet eine Weile hier draußen; Aloys, du bist so gut und leistest meiner Freundin Gesellschaft. Es wird nicht lange dauern.« Schon war er in dem Friseurgeschäft verschwunden. Die Messingbecken schlugen zusammen, als applaudierten sie. -
Aloys und die Büdericherin standen am Schaufenster und beschauten die Auslagen des Friseurs. Seifenstücke, ein Gnom mit Wattebart inmitten einer sinnvollen Girlande von Zahnbürsten und Kämmen, bunte Flaschen waren mit künstlerischem Geschmack aufgebaut. Verstohlen ruhten die guten Augen des gütigen Aloys auf der anvertrauten Freundin Oskars. Die Auslage des Friseurs war auch nicht länger als eine halbe Stunde imstande, die Dame zu fesseln. Eigentlich konnte man sich in dieser Zeit unzählige Male rasieren lassen. Der Friseur wohnte an der Hauptstraße, wo sonntags die Crème der Gesellschaft promenierte. Das Paar erregte allgemeines Aufsehen. Bekannte schnitten Aloys ostentativ. Die Blume vom Lande bekam mehr und mehr Zutrauen zu Aloys und hing sich wieder bei ihm ein. So wälzten sie sich auf und ab vor dem Friseurladen. Wer nicht wieder kam, war Oskar Knieß; man hätte sich in der Zeit, die er in dem Laden war, einen langen Bart und lange Locken wachsen lassen können.
Zuweilen stieg in Aloysens Hirn mit linden Flüchen die Besorgnis auf: wenn Oskar nun überhaupt nicht zurückkäme? Aber dann fiel sein Blick auf die Prinzessin der Kartoffelgegend. Ein unbedingtes, unwiderstehliches Gefühl der Zuneigung zu dieser Blume vom Lande, die angehäufte Fülle seines monumentalen Altruismus brach mit Allgewalt hervor. Er umschlang das Mädchen aus Büderich und küßte sie vor aller Welt auf die Wange.
Die beiden Liebesleute warteten noch bis Donnerstag auf Oskar Knieß. Er kam nicht.
Aloys Behnewind heiratete den Koloß vom Niederrhein. Sie ward ihm zur unergründlichen Talsperre für den Strom seines Altruismus.
Acht Tage war friedliche Stille im Heim der Jungvermählten. Eines Tages aber hörte man lautes Geschimpfe aus der Wohnung Behnewinds. Gegen eine gelle Frauenstimme versuchte vergebens eine Männerstimme anzuschreien. Die Keiferei nahm Tag für Tag zu. Passanten blieben stehen. Dann flogen eines Tages Stocheisen, Kohlenstücke, Stiefelknechte, leere Flaschen, Stiefel, Bügelbolzen und sonstige harte Gegenstände klirrend durch die Fenster auf die Straße. Revolverschüsse, Schmähworte, die die elektrische Bahn entgleisen ließen, Droschkenpferde wild machten, sprangen aus den zerschlagenen Fenstern der Wohnung Aloysens.
Aloys, der gute Mensch, war ein Menschenfeind geworden. Seinen Altruismus und seine Herzensgüte hatten die Flitterwochen völlig vernichtet, und seine Herzlichkeit war in einen Menschenhaß, der sich auf seine Büdericher Gattin konzentrierte, umgeschlagen.
Teuflisch lockte er sie eines Tages in einen Freiballon und drückte ihr eine Höllenmaschine in die Hand. Sie ist gottergeben in die Luft geflogen.
Onkel Bogumil trinkt
Im Familienrat machte man eines Tages ernst und beschloß definitiv, Onkel Bogumil in eine Trinkerheilanstalt zu schaffen. Das konnte so nicht weitergehen, Onkel Bogumil trank zwanzig Flaschen Rheinwein und zwei Pullen dreisternigen Kognak. Das tat er nun schon seit vielen Jahren.
Seine Nase bekam dabei das Aussehen eines Glühstrumpfes. Der Datterich am Morgen wurde chronisch; und wenn der alkoholhafte Stumpfsinn ihn überkam, konnte es schon sehr schlimm werden.
Dann mochte es ihm gefallen, plötzlich an die Hängelampe zu springen und sich hin- und herzuschaukeln oder die Bilder von der Wand zu nehmen und die Farben abzulecken. Auch versuchte er, auf Schränke zu klettern. Stundenlang hüpfte er auf einem Bein im Zimmer herum, oder er bemühte sich, sich auf den Kopf zu stellen. Sah er eine Fliege, so konnte er unbändig lachen. Er trieb noch andere irre Dinge.
Die Familie hatte ihn lange Jahre ruhig gewähren lassen, hoffend, daß ein Herzschlag seinem trinkfrohen Dasein ein Ende machen würde. Als er aber eines Tages anfing, mit den leeren Flaschen aus dem Fenster die Passanten zu bombardieren, sinnlos gegen das Mobiliar wütete, alles zerschlug und nach dreißig Flaschen Wein behauptete, es seien weiße Mäuse in seinem Zimmer, und schrie, man müsse eine Falle aufstellen und Gift streuen, wurde die Familie stutzig.
Den Umstand, daß Onkel Bogumil abends stets sinnlos betrunken war und wie ein toter Klotz unter den Tisch sank, benutzte die Familie, den völlig bewußtlosen Onkel wie ein Möbelstück in ein Auto zu verladen und in die Trinkerheilanstalt des berühmten Professors Sektpropp zu schaffen. Diese Trinkerheilanstalt nannte sich unverfänglich: Alkohol-Entziehungs-Sanatorium.