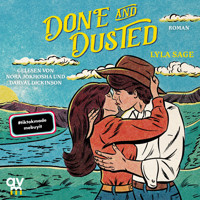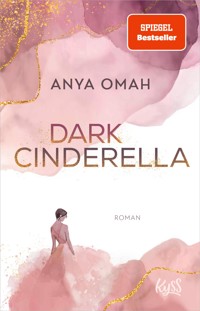Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christina Henríquez‘ gefeierter Roman über den Bau des Panamakanals. »Der Sog dieser Geschichte ist ebenso gewaltig, wie das Projekt, von dem sie erzählt.« The New York Times
Als um 1900 ein Kanal gebaut wird, der Atlantik und Pazifik verbindet, treffen in Panama die unterschiedlichsten Menschen aufeinander: Arbeiter aus der Karibik, amerikanische Journalisten, aber auch Malaria-Ärzte und Wahrsagerinnen. Viele sehnen sich nach einem neuen Leben. So auch Ada und der Fischerssohn Omar, die sich ineinander verlieben. Doch wie nah beieinander stehen Fortschritt und Ausbeutung? Und welche Rolle spielen Frauen bei dieser Unternehmung? Ein tiefer Riss geht durch die Gesellschaft, die getrennt ist durch Geschlecht, Hautfarbe und Status. Henríquezʼ gefeierter Roman behandelt Fragen, die aktueller denn je sind, und erzählt aus der Perspektive von Frauen von Menschen, die im Getriebe der Geschichte kaum wahrgenommen wurden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als um 1900 ein Kanal gebaut wird, der Atlantik und Pazifik verbindet, treffen in Panama die unterschiedlichsten Menschen aufeinander: Arbeiter aus der Karibik, amerikanische Journalisten, aber auch Malaria-Ärzte und Wahrsagerinnen. Viele sehnen sich nach einem neuen Leben. So auch Ada und der Fischerssohn Omar, die sich ineinander verlieben. Doch wie nah beieinander stehen Fortschritt und Ausbeutung? Und welche Rolle spielen Frauen bei dieser Unternehmung? Ein tiefer Riss geht durch die Gesellschaft, die getrennt ist durch Geschlecht, Hautfarbe und Status. Henríquezʼ gefeierter Roman behandelt Fragen, die aktueller denn je sind, und erzählt aus der Perspektive von Frauen von Menschen, die im Getriebe der Geschichte kaum wahrgenommen wurden.
Cristina Henríquez
Der große Riss
Roman
Aus dem Englischen von Maximilian Murmann
Hanser
GESUCHT!
VON DER ISTHMISCHEN KANALKOMMISSION
4000 tüchtige Arbeitskräfte für Panama.
2-Jahres-Vertrag.
Kostenlose Fahrt in die Kanalzone und zurück.
Kostenlose Unterkunft und medizinische Versorgung.
Arbeit im Paradies!
10—20 Cent Lohn pro Stunde.
Auszahlung alle zwei Wochen.
Bewerbung bei der Rekrutierungsstation am Trafalgar Square, Bridgetown.
Alle Bewerber werden einer ärztlichen Untersuchung und nötigen Impfungen unterzogen.
J. M. GRASSLEY
VERMITTLER, I.C.C.
1907
1
IRGENDWO VOR DER PAZIFIKKÜSTE Panamás, auf dem ruhigen blauen Wasser der Bucht, saß Francisco Aquino allein in seinem Boot. Er hatte es selbst gebaut aus dem Stamm einer Zeder, entrindet und bearbeitet mit nichts als einer Steindechsel und einem gekrümmten Messer. Er hatte geschnitzt und geglättet, war mit der Hand über jede Oberfläche und Rundung gefahren, hatte wieder geschnitzt und geglättet, bis er diesen einen Stamm zu dem geformt hatte, was er für das prächtigste Boot auf dem ganzen Meer hielt.
Francisco saß da mit dem Paddel auf dem Schoß. Seine Knie waren angewinkelt, und seine nackten Füße standen flach auf dem Boden des Rumpfs, neben seiner Angelrolle und einem Holzeimer, mit dem er Wasser aus dem Boot schöpfte, wenn zu viel davon hereinkam. Sein Netz hing an der Seite herunter.
Jeden Tag außer Sonntag stand Francisco vor dem Morgengrauen auf, ging zum Ufer und band das Boot von seinem Pfahl los. Er ruderte durch die Wellen auf das Meer hinaus, und als er weit genug draußen war, sicherte er die Knoten an seinem Netz und ließ es fallen. Dann ruderte er wieder, ganz langsam, und hörte, wie das Wasser hickste, wenn er das Paddel herauszog und wieder eintauchte. Er musste mit genau der richtigen Geschwindigkeit vorankommen, um Widerstand für das Netz zu erzeugen. War er zu schnell, ließen sich die Fische nicht täuschen. War er zu langsam, schwammen sie davon. Es war ein Balanceakt, aber Francisco hatte den Großteil seines Lebens in diesen Gewässern gefischt und wusste, was zu tun war.
Aus Osten kam eine Brise und zerzauste die Krempe seines Huts. Das Boot schaukelte sanft hin und her. Er wartete auf den richtigen Zeitpunkt. Das Wasser würde ihm sagen, wenn es so weit war. Francisco stupste den Eimer mit dem Fuß, dann stupste er ihn zurück. Vögel sausten über seinen Kopf hinweg. Er öffnete die Hände und studierte seine raue, schwielige Haut. An einem verregneten, sonnengesprenkelten Nachmittag vor langer Zeit hatte Esme seine Hände in ihre genommen und die Handflächen nach oben gedreht. Da ist eine Karte, hatte sie zu ihm gesagt, in den Linien deiner Hände. Eine Karte wovon, hatte er gefragt. Und was hatte sie nochmal gesagt? Er versuchte immer, sich zu erinnern, kam aber nie darauf.
Francisco ballte die Finger zu Fäusten und seufzte. Der Ozean erstreckte sich endlos um ihn herum und glitzerte in der frühen Sonne. Sein Boot krängte und schaukelte in der Stille.
Franciscos Sehvermögen war leider nicht mehr das, was es einmal war. Er blickte mit zusammengekniffenen Augen auf den Horizont hinaus, zu dem Ort, an dem eines Tages angeblich Schiffe, hundertmal größer als sein kleines Boot, in einer Schlange warten würden, bis sie an der Reihe wären, Panamá zu durchqueren. Er stieß ein Lachen aus. Es war eine lächerliche Idee, unmöglich zu glauben. Jeder Seemann und Entdecker, der je an diesen Ufern gelandet war, hatte davon geträumt, dass irgendwann Schiffe durch Panamá hindurchreisen würden, doch wie genau man von einem Ozean zum anderen gelangen sollte, das wusste niemand. Schließlich stand das Rückgrat der großen Kordilleren im Weg, die direkt über den Isthmus verliefen, und bei all den wundersamen Dingen, die Francisco in seinem Leben zu Gehör gekommen waren, hatte er noch nie von einem Schiff gehört, das durch einen Berg hindurchsegeln konnte. Also würden sie die Berge zerschneiden, sagten sie, ihnen das Rückgrat brechen, und sobald dies geschehen wäre, würde das Wasser der Ozeane von beiden Enden heranrauschen und sich zu einer Passage vereinen. Ein wahnwitziger Traum. Nicht ein, sondern zwei Ozeane an einem Ort, an dem es seit Abermillionen Jahren nichts als Land gab. Wer könnte so etwas glauben?
Francisco schob die Hutkrempe hoch, kniff die Augen fester zusammen und versuchte die Phantome der Dampfer, Schoner, Schlachtschiffe und Boote zu sehen, all die Schiffe, die hier angeblich hindurchfahren würden. Er schaute, doch statt Schiffen sah er über dem Wasser allein den strahlend blauen Himmel. Vielleicht brauchte ein Mensch Glauben, dachte Francisco, um Dinge zu sehen, die nicht existierten, um sich eine Welt vorzustellen, die noch nicht geschaffen worden war. Doch seinen Glauben hatte Francisco, neben so vielen anderen Dingen, vor langer Zeit verloren.
2
AUF DER ATLANTIKSEITE, ungefähr bei der Mitte der gewundenen Küste Panamas, trudelte ein Schiff in den Hafen von Colón ein. Es war ein Raddampfer der Royal Mail mit hohen weißen Masten, der mit 23.000 Briefen unter Deck und gut 800 Passagieren an Bord aus Barbados gekommen war. Bei den Passagieren handelte es sich vorrangig um Männer, aus St. Lucy und St. John und Christ Church und jedem Parish dazwischen. Sie trugen ihre besten Anzüge und standen dicht gedrängt auf dem Deck, geklammert an Metalltruhen, Koffer und fieberhafte Hoffnung.
Zwischen ihnen saß die sechzehnjährige Ada Bunting, die Arme um die Knie geschlungen. Es war für sie das erste Mal auf einem Schiff, und während der gesamten sechstägigen Reise kauerte sie hinter zwei Hühnerkisten, die auf einem schwarzen Überseekoffer gestapelt waren, und betete, dass man sie nicht entdecken würde. An dem Morgen, an dem sie von Zuhause aufgebrochen war, hatte sie eine Nachricht auf ihrem Schreibtäfelchen aus der Schulzeit hinterlassen und dieses auf den Küchentisch gestellt, wo ihre Mutter es mit Sicherheit sehen würde, sobald sie aufstand. Dass sie nach Panama fahren würde, viel mehr stand dort nicht. Und dann, im frühen Morgengrauen, zog sich Ada ihre Gartenkleidung an — eine zerschlissene Hose und eine geknöpfte Bluse —, trug den gepackten Leinensack den ganzen Weg bis zum Kai und schaffte es, sich inmitten des Trubels unbemerkt an Bord zu schleichen.
Tag und Nacht gackerten, glucksten und krächzten die Hühner in ihren Kisten, und wenn Ada sie zu beruhigen versuchte, stellte sie fest, dass sie nur noch wilder gackerten. Sie mussten hungrig sein, dachte sie, also zerkrümelte sie ihnen am zweiten Tag ein paar der Cracker, die sie mitgebracht hatte, steckte die Krümel durch die Latten der Kisten und sah zu, wie die Hühner sie aufpickten. Davon wurden sie etwas ruhiger. Am dritten Tag fütterte Ada sie wieder mit Crackern und lauschte, wie sie zufrieden gurrten. Am vierten Tag teilte sie mit ihnen etwas von dem Zuckerapfel, den sie eingepackt hatte. Sie achtete darauf, erst alle Kerne herauszuholen. Am fünften schälte sie den Deckel einer Büchse Sardinen zurück, und nachdem sie die meisten selbst gegessen und das Salz von ihren Fingerspitzen geleckt hatte, fütterte sie die Hühner mit dem Rest. Bis zum sechsten Tag war ihr mitgebrachtes Essen komplett aufgebraucht. Das Einzige, was sie den Hühnern geben konnte, war das Versprechen, das ihre Mutter ihr stets gab: Der Herr wird sich kümmern. Sie musste glauben, dass es stimmte.
In dem Moment, als das Schiff zum Stehen kam, drängten alle von Bord. Ada wartete, bis sich die Menge etwas gelichtet hatte, aber selbst als sie sich erhob, schenkte ihr Gott sei Dank niemand auch nur die geringste Beachtung. Die Leute waren zu sehr damit beschäftigt, ihre Sachen zu sammeln und zu schauen, wie Panama jenseits der Segelboote und Palmen entlang des Ufers eigentlich aussah. Der Teil der Stadt, den Ada jenseits des Kais erkennen konnte, erinnerte sie an Bridgetown: Dort gab es eine Reihe zwei- und dreistöckiger Holzrahmenbauten mit Blick auf die Hauptstraße, Geschäfte mit Markisen und Gebäude mit Schildern. Dass die Stadt so vertraut aussah, enttäuschte und erleichterte sie gleichermaßen.
Mit ihrem Sack in den Armen schob sich Ada mit allen anderen auf die Hafenseite. Ihr Hosenboden war klamm, doch dank der Hose, die ihre Mutter genäht hatte, fiel sie zwischen all den Männern nicht auf. Sie hatte auf der Reise auch Stiefel getragen, schwarze Lederstiefel, ein Geschenk von einem Mann namens Willoughby Dalton, der ihrer Mutter seit ungefähr einem Jahr den Hof machte. Von Zeit zu Zeit, meist sonntags, wenn er wusste, dass sie zu Hause waren, hinkte Willoughby mit einem neuen Präsent zu ihrer Tür — mit Wildblumen, Brotfrucht oder einer kleinen Tonschale. Ein paar Monate zuvor war er mit einem Paar schwarzer Stiefel angekommen. Sie waren an den Fersen abgenutzt und hatten ausgefranste Schnürsenkel, doch als Willoughby sie hochhielt, nahm Adas Mutter sie entgegen und sagte »Danke«, wie sie es jedes Mal tat, wenn Willoughby mit einem Geschenk kam. Und wie jedes Mal sagte Willoughby »gern geschehen«, und blieb auf der Veranda stehen, als hoffte er, hineingebeten zu werden. Es war immer derselbe jämmerliche Tanz. Ihre Mutter nickte und schob die Tür zu, und erst als sie vollständig geschlossen war, drehte Willoughby sich wieder um und ging nach Hause.
Die Seile an den Masten schnalzten im Wind, die Menschen drängelten und schubsten. Als Ada den Steg erreichte, versteckte sie sich hinter einem Mann mit Klappstuhl, in der Hoffnung, dass der Stuhl sie vor den zwei weißen Polizisten abschirmen würde, die unten am Kai standen. Am Fuße des Stegs riefen sie »Arbeitszug! Zum Arbeitszug da lang!«, und deuteten in Richtung Stadt. Die Leute strömten vom Schiff in die besagte Richtung, und Ada hatte den Eindruck, dass es am besten wäre, einfach dem Strom zu folgen, um nicht aufzufallen. Sie hatte es so weit geschafft, aber es bestand noch immer die Möglichkeit, dass einer der Polizisten Verdacht schöpfen würde — ein Mädchen, ganz allein unterwegs —, und wenn sie sie beiseitezögen und herausfänden, dass sie nicht bezahlt hatte, würden sie sie mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit zurück auf das Schiff bringen und nach Hause schicken. Ada drückte den Sack gegen ihre Brust, als sie auf den Pier trat und an den Polizisten vorbeiging. Selbst hinter dem Klappstuhl bekam sie mit, wie sich die beiden unterhielten. Der eine sagte zu dem anderen: »Teil dem Kapitän mit, dass die Fracht angekommen ist.« Sie war erst sechzehn Jahre alt, wusste aber schon, dass sie nicht von der Post sprachen.
*
Als Ada in den Zug stieg, der eigentlich nicht viel mehr war als eine Reihe luftdurchlässiger, holzgerahmter Viehwaggons, war er voll mit Passagieren vom Schiff, die Koffer, Körbe, Pflanzen und Kisten bei sich hatten. Sie schob sich bis zur hinteren Ecke des Waggons durch und klammerte sich mit einer Hand an eine Stange, mit der anderen an ihren Sack. Neben den Sardinen, Crackern und Zuckeräpfeln hatte sie zwei Paar Unterwäsche, ein Kleid, ein Fläschchen Mandelöl zum Glätten ihrer Haare, einen gesteppten Baumwollquilt von ihrem Bett und drei goldene Crowns eingepackt. Sie wünschte, sie hätte daran gedacht, mehr Essen mitzubringen, hatte sie aber nicht. Ihre Gedanken waren schneller als ihr Verstand, sagte ihre Mutter immer, und dort im Zug lächelte Ada, weil sie innerlich ihre Mutter schimpfen hörte, ihren besonderen Tonfall. Ihre Mutter hatte die Nachricht sicherlich schon gesehen, und Ada konnte auch innerlich ihre Reaktion darauf hören — deutlich strenger —, darauf, dass sie allein nach Panama aufgebrochen war, wenn auch aus gutem Grund.
Ihre Schwester, Millicent, war krank und benötigte eine Operation, die sie sich nicht leisten konnten. Als Schneiderin verdiente ihre Mutter nicht viel, und Ada hätte sich selbst einen Job gesucht, nur war Arbeit in Barbados momentan schwer zu finden. Doch in Panama, sagten alle, sei es so leicht, Arbeit zu finden, wie Äpfel von Bäumen zu pflücken. Wenn alle anderen sie pflücken konnten, hatte Ada überlegt, warum nicht auch sie? Sie würde so lange bleiben, bis sie das Geld für die Operation beisammenhätte, dann würde sie zurückgehen.
Als der Zug losfuhr, betrachtete Ada die Gesichter um sich herum, so viele junge Männer in Anzügen, die genauso angespannt und erwartungsvoll aussahen, wie sie sich fühlte. Der Zug ratterte vorbei an der Stadt, über eine niedrige Brücke und durch einen dichten Wald, bevor er ein Feld erreichte, das weit genug war, dass man in der Ferne die dunkelgrünen Berge sehen konnte. Als er in der Nähe eines Städtchens zum Stehen kam, sprang eine Handvoll Männer ab und ging zu einer Reihe von Pfahlbauten. Ein Mann, dessen Sakko-Ärmel nicht einmal bis zu den Handgelenken reichten, schaute hinaus und sagte: »Hier sollen wir wohnen?«
Ein Mann in einer schmutzigen Khakihose und einem blauen Arbeitshemd lachte in sich hinein: »Was haste erwartet? Ein Luxushotel?«
Der Mann in dem zu kurzen Sakko zeigte auf die andere Seite der Schienen, zu einer Reihe gepflegter Gebäude, weiß gestrichen und mit grauen Zierleisten, und fragte, ob sie nicht dort wohnen könnten.
Der Mann in Arbeitskleidung lachte erneut. »Die sind Gold.« Er zeigte zu den Lagern: »Wir sind Silber.«
Als der Mann in dem zu kurzen Sakko verwirrt schaute, fragte der andere, ob er das nicht gewusst habe? Alles in der Kanalzone — Geschäfte, Zugwaggons, Speisesäle, Unterkünfte, Postämter und der Lohn — war aufgeteilt in Gold und Silber. Gold waren die Nordamerikaner, Und Silber, das waren sie.
In jedem neuen Dorf oder Städtchen sprangen mehr Männer ab. Der Zug leerte sich. Ada hatte keine Ahnung, wohin sie gehen sollte. Irgendwann trat ein Mann, der in ihrer Nähe stand, zu ihr heran und sagte: »Was ist mit dir? Hast du einen Platz zum Schlafen? In den Lagern haben nur weiße Frauen Zutritt, weißt du.«
Ada umklammerte ihren Sack.
»Aber ich hab einen Platz, wo du deinen Kopf hinlegen kannst.« Der Mann tätschelte seinen Oberschenkel.
Ada wandte sich ihm zu. »Eher würde ich mich in die Hölle legen«, sagte sie. Sie ließ die Stange los und ging auf die andere Seite des Wagens, und beim nächsten Halt sprang sie, so schnell sie konnte, ab — an einem Ort, der dem Rufen des Zugführers zufolge Empire hieß.
*
Die anderen Männer, die ebenfalls ausgestiegen waren, gingen an Ada vorbei zu den Lagern. Wenn es stimmte, dass sie dort nicht zugelassen war, wie man ihr gesagt hatte, müsste sie sich ein eigenes Lager draußen zwischen den Bäumen einrichten. Morgen würde sie versuchen, Arbeit zu finden, aber im Moment war sie so erschöpft, dass sie nur noch ihren Kopf hinlegen und sich ausruhen wollte. Zu Hause teilten sich Millicent, ihre Mutter und sie das Schlafzimmer im hinteren Teil des Hauses, und sie hatten mit Spelzen gefüllte Matratzen auf Gestellen, die ihre Mutter gebaut hatte. Wie schön wäre es gewesen, jetzt in diesem Bett zu liegen, sich langzumachen, die Arme über dem Kopf zu verschränken und die Zehen zu strecken. Sie würde sich allerdings damit begnügen müssen, ihren Quilt auf dem Boden auszubreiten, wenn sie nur eine Stelle fände, die dafür groß genug wäre.
Einige Schritte tiefer im Wald wurde die Luft kühler, und es roch nach Leben. Ada hörte es überall schleichen, knirschen, pfeifen und klopfen. Wo immer sie hinkam, war der weiche Boden von Zweigen und Moos, blühenden Sträuchern und Baumstämmen bedeckt. Sie schob Farnwedel beiseite, fand dahinter jedoch nichts als Pfützen und Schlamm. Nirgends war eine trockene Stelle zu sehen. Je weiter sie ging, desto dunkler wurde es, und sie war so müde, dass sie sich am liebsten einfach ins Gebüsch hätte fallen lassen, als sie zwischen den Bäumen auf einmal etwas entdeckte, das wie ein Güterwagen aussah. Er war verrostet und verfallen, halb verdeckt von Ranken und einem Schleier aus dichtem Gestrüpp, die Hinterräder im Matsch versunken, komplett schief. Sie stand eine Weile da und schaute, ob noch jemand da war, aber sie hörte nur das Geraschel der Tiere in den Bäumen. Sie trat näher und rief laut: »Hallo?« Als niemand antwortete, ging sie bis zu der offenen Tür, die sich auf Höhe ihres Kopfes befand und probierte es noch einmal. Sie streckte die Hand aus und klopfte dreimal auf den Boden und wartete. Noch immer nichts. Der Herr wird sich kümmern, dachte sie, kletterte hinein und legte sich hin.
*
Am Morgen waren Adas Ohren erfüllt vom Surren und Ticken der Insekten. Sie setzte sich langsam auf und sah sich um, erinnerte sich, wo sie war. Sonnenlicht sickerte durch die Spalten der Holzbretter und spendete genug Licht, dass sie das ganze Innere des Waggons sehen konnte. Außer Spinnweben und haufenweise verstreuter Blätter gab es allerdings nicht viel zu sehen.
Ada hatte in den Kleidern geschlafen, die sie auf dem Schiff getragen hatte, und jetzt waren sie von der feuchten, stickigen Luft so klamm, dass sie ihr an der Haut klebten. Aus ihrem Sack, der neben ihr lag, holte sie das Patchworkkleid aus braunen und gelben Quadraten, das ihre Mutter genäht hatte, und wechselte die Kleidung. Sie stand auf, zog die Ärmel bis zu den Handgelenken hinunter und strich die Falten über ihrer Taille glatt. Sie schlüpfte in ihre Stiefel, spuckte in die Hand und beugte sich vor, um den Schlamm von den Spitzen zu reiben. Dann nahm sie ihren Sack. Das trockene Kleid und die sauberen Stiefel waren ein Anfang. Jetzt musste sie etwas zu essen finden, und Arbeit.
*
Im Wald nieselte es. Tiefer Nebel hing in der Luft. Irgendwo da draußen, dachte Ada, muss es etwas zu essen geben. Bei Tageslicht sah sie Dinge, die in der Nacht nicht zu sehen gewesen waren: Ranken und Schlingpflanzen, die von den Ästen hingen, schwertförmige Blätter, die mit Farnen verflochten waren. Ringsherum war alles stechend grün: olivgrün, jadegrün, smaragdgrün, limettengrün; das Grün verlor sich im Schatten, das Grün leuchtete in der Sonne. Sie ging durch grüne Vorhänge und über grüne Teppiche, in der Hoffnung, etwas zu finden, das sie erkennen würde — Jackfrucht, Seetrauben oder Papau — und von dem sie wüsste, dass sie es essen könnte. In Panama, so hatte sie gehört, gebe es Bananen im Überfluss, und sie schaute hoch in die Bäume, ob dort welche waren. Zu Hause wäre es einfacher gewesen. Zu Hause wusste Ada, welche Bäume Früchte und welche Sträucher Beeren trugen, so reif, dass man sie zwischen den Zähnen platzen lassen konnte. In dem Beet hinter dem Haus bauten sie Mais, Pfeilwurz, Maniok und Kräuter an und aßen ihre Ernte oder tauschten sie manchmal auch mit den Nachbarn. Der beste Tausch war, als ihre Mutter Maiskolben gegen Kirschen eintauschte, die Mrs. Callender von dem Baum in ihrem Garten gepflückt hatte — die süßesten, saftigsten Kirschen von ganz Barbados, behauptete Mrs. Callender —, und als Ada sie aß, wusste sie, dass Mrs. Callender die Wahrheit sagte. Beim Gedanken an die Kirschen lief Ada das Wasser im Mund zusammen. Hier draußen im Wald musste es doch etwas zu essen geben, und sie musste wahrscheinlich nur lang genug danach suchen, doch ihr Magen knurrte, und ihr Kleid, das sich in trockenem Zustand so gut angefühlt hatte, war jetzt vom Regen durchnässt, und ihre Stiefel waren wieder von Matsch bedeckt, und sie hatte keine Geduld, was eine ihrer schlimmsten Eigenschaften war, wie ihre Mutter sagte, denn Ada wartete nie lange genug, bis die Dinge zu ihr kamen.
*
In der Stadt herrschte reges Treiben. Ada ging auf die andere Seite der Schienen, die Empire in zwei Teile teilten, und lief über die gepflasterten Straßen der amerikanischen Seite, in der Hoffnung, dort Hinweise auf Arbeit zu finden, und natürlich auch Essen. Die Fahnen, die von den Balkonen hingen und im Wind wehten, verrieten ihr, wessen Seite es war. Sie hatte die Flagge der Vereinigten Staaten noch nie in echt gesehen, obwohl sie einmal ein Bild davon in einem Atlas erblickt hatte, und zwar in der Mädchenschule, die sie und Millicent besucht hatten. Es war in demselben Atlas — ein übergroßes Heft, dessen Seiten mit einem Faden zusammengehalten wurden —, in dem Ada auch zum ersten Mal eine Karte von Barbados gesehen hatte. Während sich die Karte der Vereinigten Staaten über zwei volle Seiten erstreckte, nahm ganz Barbados nur die untere Hälfte der linken Seite ein. Davor war ihr nicht in den Sinn gekommen, dass Barbados kleiner war als irgendein anderer Ort auf der Welt. Aber nachdem sie es gesehen hatte, fragte sie sich, wie es wohl wäre, woanders hinzugehen. Soweit sie sich erinnerte, war jeder aus ihrer Familie auf Barbados geboren und dort geblieben. Kurz nach Adas Geburt hatte ihre Mutter die Zuckerplantage verlassen, auf der sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, und die Geschichte dieses Weggangs hatte sie Ada und Millicent viele Male erzählt — jedes Mal mit Stolz. Wenn Ada sie hörte, dachte sie immer dasselbe: Ihre Mutter hätte überall hingehen können. Als sie die Plantage verließ, hätte sie auf die andere Seite von Barbados gehen oder auf die andere Seite der Welt fahren können. Doch in dem Moment, in dem alles denkbar gewesen wäre, ging ihre Mutter bis kurz hinter die offizielle Grenze Bridgetowns und ließ sich erneut nieder. Sie hatte die Grenze überschritten, aber nur mit einem Zeh. Sie hatte ihre Welt klein gehalten, und jetzt, all die Jahre später, hatte ihre Mutter nichts jenseits dieser Welt, nicht einmal einen Traum, soweit Ada wusste.
Die von zweistöckigen Häusern und Geschäften gesäumte Straße war voller Kutschen, Eselskarren und Menschen, die durch den Nieselregen eilten. Die Frauen trugen Sonnenschirme, und die Männer hatten Hüte auf. Ada hatte keines von beidem, und obwohl ihre Haare wie üblich zu einem Dutt gebunden waren, hatte sie sich nicht die Mühe gemacht, ihn nach dem Aufstehen zu richten, und in Verbindung mit dem Regen hieß das vermutlich, dachte sie lächelnd, dass sie wie eine Vogelscheuche aussah. Früher war sie immer diejenige gewesen, die Dreck auf dem Kleid und Schorf an den Ellbogen hatte, und Haare, die sie sich zu kämmen weigerte, außer es war Sonntag und Zeit für die Kirche, und selbst dann kämmte sie sich nicht wegen Gott, sondern wegen ihrer Mutter.
Nachdem Ada der Reihe nach an einer Druckerei, einem Friseursalon und einer Schmiede vorbeigekommen war, hatte der Regen aufgehört. Ihr Magen knurrte. Irgendwo musste es einen Markt geben, vielleicht auf der anderen Seite der Schienen. Mit ihrem Sack in den Armen blieb sie auf der Straße stehen und überlegte, ob sie zurückgehen und nach einem Markt suchen sollte, als ein Mann, der bei einer Gasse stand, in ihre Richtung pfiff. Sie hätte sich weggedreht, wenn er nicht auf eine hölzerne Schubkarre neben sich gezeigt hätte, die mit Obst beladen war. »Papaya, Mango, Piña, Mamey!«, trällerte der Mann, als sie auf ihn zuging. Er nahm eine Mango und hielt sie hoch.
Ada war so hungrig, dass sie alles aus der Schubkarre hätte essen können, und selbst im Schatten der Gasse konnte sie so viel leuchtendes, pralles Obst sehen, dass sie sich die Lippen leckte.
»Haben Sie Mammi gesagt?«, fragte sie, »Mammiapfel?«
Der Mann tauschte die Mango gegen eine Frucht, die einen Stiel und eine schorfige, braune Schale hatte. »Mamey«, sagte er.
Es sah tatsächlich aus wie ein Mammiapfel. In Barbados waren die Früchte noch nicht reif, aber jedes Jahr im April freute sich Ada darauf. Ihre Mutter legte das Fruchtfleisch in Salzwasser ein, damit es nicht so bitter war, und Millicent und sie aßen es entweder pur, oder ihre Mutter verarbeitete es zu Apfelmarmelade.
»Wie viel kostet einer?«, fragte Ada.
»¿Quieres?«
»Wie viel?«
Doch der Mann lächelte bloß.
Ada stellte ihren Sack ab und tastete nach den Münzen, die sie mitgebracht hatte. Drei Crowns, die ihre Mutter sorgfältig verwahrt hatte. Ada hatte sie einmal beim Herumstöbern entdeckt, und jedes Mal, wenn sie danach schaute, waren sie noch immer da. Ihre Mutter hatte das Geld vielleicht gespart, doch Ada hatte es in dem Glauben genommen, dass sie alles wieder zurückbekäme, und noch mehr. Jetzt zog Ada eine Münze heraus und hielt sie dem Mann hin. Eine Crown war zu viel für eine einzige Frucht, aber in diesem Moment war ihr das egal. Sie brauchte etwas zu essen. Sie konnte den Mammiapfel beinahe schmecken, konnte beinahe spüren, wie ihr der Saft über das Zahnfleisch lief.
Der Mann nahm die Münze, hielt sie zwischen zwei Fingern, drehte sie prüfend hin und her. Er nickte anerkennend, steckte die Münze in seine Tasche und reichte Ada die Frucht.
Mit dem Fingernagel schälte Ada gleich die dicke Haut ab und biss in das Fruchtfleisch. Es war so zart, dass sie fast weinen musste. Sie holte das Fleisch mit ihren Zähnen heraus, während sie mit dem Sack vor ihren Füßen bei der Gasse stand, und der Mann zuschaute. Sie aß die ganze Frucht bis zum Strunk, an dem sie sog, bis der Geschmack verschwunden war. Dann warf sie ihn weg und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab.
Der Mann, der neben der Schubkarre stand, sah sie mit großen Augen an.
Ada grinste. »Danke«, sagte sie, während sie ihren Sack aufhob.
Sie fühlte sich besser mit etwas Nahrung im Bauch. So bald wie möglich würde sie versuchen, einen Brief zu schreiben und nach Hause zu schicken. Wenn ihre Mutter besorgt war, wovon Ada ausging, würde ein Brief sie vielleicht beruhigen. Wenn ihre Mutter wütend war, wovon Ada ebenfalls ausging, gab es jedoch nicht viel, was sie dagegen unternehmen könnte.
3
ACHT MONATE bevor Ada Bunting an Bord eines Postschiffs ging, das sie von dem einzigen ihr bekannten Zuhause wegbrachte, hatte Marian Oswald zusammen mit ihrem Mann, John Oswald, in New Orleans neugierig einen Dampfer der United Fruit Company mit dem Ziel Panama bestiegen. Davor waren Marian und John aus ihrem Wohnort Bryson City, Tennessee, mit dem Zug angereist. Während der Reise, die fast einen ganzen Tag dauerte, hatte Marian die Hände im Schoß gehabt und aufmerksam die vorüberziehende Welt betrachtet, während John neben ihr las. Der Zug verfügte über einen Speisewagen mit strahlend weißen Tischdecken und einen Barwagen mit zwei Kellnern, die John, der nicht trank, einen Whiskey Sour aufdrängen wollten und verblüfft waren, als er stattdessen bloß ein Club Soda bestellte. In wieder einem anderen Wagen hatte John die Gelegenheit genutzt, sich die Schuhe von einem Schwarzen Gepäckträger polieren zu lassen, und Marian hatte John gedrängt, ihm ein Trinkgeld zu geben, doch er sagte: »Er macht nur seine Arbeit. Ein Mann sollte nicht belohnt werden für das, was er tun muss.« Marian hatte kein Geld bei sich, doch hätte sie welches gehabt, sagte sie sich, hätte sie einen Weg gefunden, dem Gepäckträger ein oder zwei Münzen zuzustecken.
Die Unterbringung auf dem Schiff war ähnlich luxuriös. Der Dampfer, ein Schiff der später so genannten Great White Fleet, beförderte im Frachtraum fünfunddreißigtausend Bananenstauden und in den Kabinen darüber dreiundfünfzig Passagiere. Die Oswalds logierten in einer Kabine, die genug Platz hatte für zwei Einzelbetten und einen Schminktisch dazwischen, sowie für zwei Fenster, die Aussicht auf den weiten Ozean geboten hätten, wenn John nicht die kleinen Vorhänge zugezogen hätte, weil er davon ausging, dass der Anblick der immerzu steigenden und fallenden Wellen sie wohl seekrank machen würde. Die verschlossenen Vorhänge halfen nicht. Oder sie halfen John, aber nicht Marian. Sie war noch nie auf hoher See gewesen und verbrachte den Großteil der fünftägigen Reise damit, sich in einen Blecheimer zu erbrechen, den der Schiffsarzt, der sich um sie kümmerte, jedes Mal über die Bordwand kippte, sobald er voll war. Der Arzt brachte ihr Wasser, doch Marian konnte es nicht bei sich behalten. Wasser, wollte sie ihm sagen, war genau das Problem. Sie sehnte sich nach Land. Marian war in ihrem Leben noch nie so dankbar gewesen wie in dem Moment, als das Signal ertönte, dass sie sich der Küste Panamas näherten.
Für alle anderen auf dem Schiff war der Anblick der Hafenstadt Colón offenbar Grund zu meckern. Marian hatte selbst nicht gewusst, was sie erwarten würde, doch vom Deck aus sah sie in der Ferne eine Reihe brauner Holzhäuser und Menschen, die auf der Straße davor herumliefen, Männer mit Holzbalken über den Schultern und Frauen mit Obstkörben auf den Köpfen. Halbbekleidete Kinder, die auf dem Boden hockten. Da waren Esel und Maultierkarren, freilaufende Hühner und streunende Hunde. Das Wasser am Kai war genauso braun wie alles andere. Marian bekam mit, wie eine Frau den Anblick als »trostloses Durcheinander« bezeichnete. Das erschien ihr ungerecht. Marian war in erster Linie neugierig, und das Einzige, woran sie sich beim Anlegen störte, war der faulige Geruch der extrem feuchten Luft. Als er ihr in die Nase stieg, erbrach sie sich abermals über die Bordwand. John, der neben ihr stand, blickte zu ihr und runzelte die Stirn. Sie wünschte, er würde ihr sein Taschentuch reichen, aber das tat er nicht, und sie wischte sich den Mund stattdessen an ihrer Hand ab.
Ein rothaariger Marinesoldat aus Louisiana, der sich während der Reise mit John angefreundet hatte — John zufolge hatten sie eine Runde Dame gespielt, während Marian krank in der Kabine gelegen hatte — stand mit ihnen bei der Reling. Er sagte: »Wir sind in einen Sumpf gekommen!«
John nickte. »Richtig. Und wir werden hier Ordnung schaffen.«
*
Die Oswalds fuhren mit einer Kutsche zum Haus. Später würden sie herausfinden, dass es viel einfacher war, mit dem Zug zu fahren, wenn man sich entlang der Kanalstrecke bewegen wollte, doch an diesem Tag, dem Tag ihrer Ankunft, nahmen sie eine Kutsche. Die zwei grauen Pferde, die sie zogen, waren ausgemergelt und schwach, und der Fahrer, ein Junge aus Panama, schlug sie wiederholt mit einer Gerte, als ob es Bestrafung und nicht bessere Behandlung war, was die Pferde schneller laufen ließe. Marian erschauderte jedes Mal, wenn die Gerte zum Einsatz kam. Die Oswalds hatten zu Hause in Tennessee Pferde, zwei prächtige Hengste, die sie auf ihrem Grundstück hielten. Die Pferde waren ein Hochzeitsgeschenk von Johns Vater gewesen, der meinte, dass jeder Mann reiten können sollte. Auf der Hochzeit hatte sein Vater einer Gruppe von Leuten belustigt erzählt, dass John als Junge nur widerwillig hatte lernen wollen, wie man aufstieg, kanterte, in vollem Galopp lief. »Das ist ein Defizit, das ich zu beheben gedenke.« Doch selbst als die Pferde ihm gehörten, hatte John nie Freude an ihnen. Stattdessen war es Marian, die jeden Tag zu den Stallungen ging, um sie zu striegeln und mit Äpfeln zu verwöhnen. Sie hatte ihnen die Namen Horace und Charles gegeben, nach Schriftstellern, die sie liebte, und wenn es nicht gerade in Strömen regnete, sattelte sie einen der beiden und ritt täglich über die saftig grünen Ländereien der Oswalds, die von den Great Smoky Mountains eingerahmt wurden. Beim Reiten fühlte sich Marian frei, auch wenn sie sich nie über ihr Grundstück hinauswagte.
Kurz nachdem sie die Pferde bekommen hatten, gelang es Marian, John zu einem gemeinsamen Ausritt zu überreden — ein einziges Mal. Es war früh am Morgen, und die Sonne beschien die Unterseite der Wolken. Als die Pferde aus dem Trab ausbrachen, verlor John das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, flach auf den Rücken. Charles, auf dem er geritten war, galoppierte einige Schritte weiter und blieb dann stehen.
Marian kehrte um, stieg von Horace ab und hielt mit einer Hand die Zügel. Johns Brille lag auf dem Boden, und Marian hob sie auf. Sie kniete sich zu ihm und fragte, ob es ihm gut gehe. Sie machte sich Sorgen, dass etwas gebrochen war, und später wurde die Sorge von einem Arzt bestätigt, John hatte sich zwei Rippen gebrochen. Als sie ihn in dem Moment fragte, sagte John lediglich: »Meine Brille, bitte«, und schaute beschämt weg, nachdem sie ihm die Brille gegeben hatte.
Marian brachte ihn zurück zum Haus. Er ging langsam neben ihr her, während sie Horace und Charles an den Zügeln führte. Weder John noch sie sagten etwas. Nachdem Marian die Pferde im Stall angebunden hatte, ging sie ins Schlafzimmer, wo John sich hingelegt hatte.
»Wo tut es weh?«, fragte Marian.
Er zeigte auf seine Brust.
Sie waren damals seit sechs Monaten verheiratet.
»Darf ich?«, fragte Marian, während sie nach einem der Knöpfe auf seinem Hemd langte.
John nickte.
Über ihn gebeugt öffnete Marian alle Knöpfe und schaute. Sie war es nicht gewohnt, seine nackte Brust zu sehen, schon gar nicht bei Tageslicht. Gewöhnlich schlief John in Unterwäsche, vom Hals bis zu den Knöcheln bedeckt, und weil er in Kleidung schlief, tat sie es auch. Jede Nacht, wenn John das Licht ausgemacht hatte, lagen sie nebeneinander im Dunkeln, und Marian wartete darauf, dass seine Hände zu ihr finden, ihr Nachtkleid aufknöpfen und die Dinge tun würden, die ein Mann mit seiner Frau tun sollte, all die Dinge, die sich Marian sehnsüchtig von ihm erhoffte, aber John rollte sich nie auf die Seite und legte einen Arm um sie, knabberte nie an ihrem Ohrläppchen oder ließ seine Fingerspitzen über ihren Hals wandern. Sie wartete Nacht für Nacht. Wochen vergingen. Monate. Und als sie das Warten leid war, wandte sich Marian stattdessen ihm zu, schob ihre Finger unter seinen Kragen, spürte die weiche, dünne Haut an seinem Hals. So ging sie vor, und wenn sie ihm zwischen die Beine fasste, wie sie es manchmal tat, konnte sie sein Interesse dahingehend wecken, dass er sie in einer Art blindem Rausch nahm, in einer brutalen Hast und Geschwindigkeit, als würde er auf eine Ziellinie zurasen, und plötzlich hatte er etwas Raues an sich, das sie erregte. Sie waren ein Sturm in der Nacht, entfesselt und tosend, doch im nächsten Augenblick war alles vorbei, und John legte sich zurück auf seine Bettseite.
Am Tag, als John vom Pferd fiel, konnte Marian keine unmittelbaren Prellungen erkennen. Trotzdem ging sie zur Toilette, um Baumwollgaze zu holen, und kehrte damit ins Schlafzimmer zurück. Sie schob eine Hand unter Johns Rücken, führte die Gaze hindurch und wickelte sie um seinen Oberkörper.
Er zuckte.
»Tut es weh?«, fragte sie.
John schaute auf, aber nicht zu ihr. In all der Zeit, die sie ihn kannte, hatte er etwas Unergründliches, etwas, das sie nicht ganz entschlüsseln konnte.
»Nein«, sagte er schließlich. Und dann: »Es tut mir leid.«
Leise und behutsam zog Marian den Verband gerade fest genug, dass er hoffentlich heilen würde, was darunter gebrochen sein mochte.
*
Die Kutsche blieb am Fuße eines Hügels stehen. Es war ausgeschlossen, dass die Pferde den Anstieg bewältigen würden, also mussten John und Marian in der sengenden Mittagshitze aussteigen und laufen. Jemand anderes würde ihnen später am Nachmittag ihr Gepäck bringen.
Sie folgten dem Trampelpfad durch das Gras, vorbei an Bananen- und Limettenbäumen mit kleinen, verzweigten Blüten. Über den ganzen Hügel waren karge Hütten verstreut, Bretter aus unbehandeltem Holz, die Strohdächer trugen. Bei einigen standen Fässer herum, bei anderen hingen Kleider von Stöcken im Boden. Ein Schwarzer Mann in einem Overall stand draußen und sah zu, wie das Paar vorbeiging.
»Beeil dich«, sagte John zu Marian. »Das Haus ist gleich da oben.«
Er zeigte zur Spitze des Hügels, wo ein großes weißes Haus stand, von der Sonne geküsst. Es war zweistöckig und hatte eine breite Veranda, die sich über die Front zu den Seiten hin erstreckte.
»Das ist viel zu groß«, sagte Marian.
John sagte: »Es ist unser Haus auf dem Hügel.« Theodore Roosevelt, den John verehrte, hatte ein Haus in Oyster Bay, das er als solches bezeichnete. »Es ist unser kleines Paradies über allem anderen.«
*
An dem Abend, nachdem John das Telegramm erhalten hatte, in dem seine Präsenz in Panama ersucht wurde, entdeckte ihn Marian hinter dem Haus, den Blick auf die blaugrauen, mit Schatten durchzogenen Berge gerichtet. Sie ging nach draußen, um ihm Gesellschaft zu leisten. Die Grillen verrenkten ihre Beine und stimmten ein Lied an, die Luft war herrlich, kühl und trocken.
»Sie wollen mich in Panama haben«, sagte John. Er wandte sich ihr nicht zu.
Es war eine Aufforderung, auf die John gehofft hatte. Marian ahnte, dass es nur eine Frage der Zeit wäre.
Sie richtete ihren Blick ebenfalls auf die Berge. Sie hatte ihr ganzes Leben in Tennessee verbracht, als einziges von vier Kindern, das das fünfte Lebensjahr überlebte. Ihre Mutter war eine spröde Frau gewesen, die das Haus sauber hielt, und deren einziger Genuss ein gelegentliches Stück Süßholzwurzel war, auf dem sie abends kaute, bis es flaumig und weich war. Ihr Vater hatte als Holzfäller gearbeitet und nahm sie zu langen Spaziergängen am Fluss mit und brachte ihr die Namen von Bäumen bei: Hickory, Eiche, Pappel, Fichte, Tanne. Abends, wenn sie die Näharbeit, die sie in der Schule gelernt hatte, üben sollte, verbrachte sie stattdessen Stunden bei Kerzenlicht mit der Lektüre eines Almanachs, das einzige Buch, das ihre Eltern zusätzlich zur Bibel im Haus hatten. Ihre Eltern waren seit Jahren tot, doch Marian liebte dieses Land noch immer, den Berglorbeer, der im Juni blühte, und den Rhododendron, der entlang der Straßen gedieh, die Elche, die umherstreiften, und den Schierling, der sprießte.
»Offiziell wäre ich zuständig für die Labore der Gesundheitsbehörde, aber ich hätte freie Hand, die Malaria zu bekämpfen, sie endgültig auszurotten. So wie es ihnen mit dem Gelbfieber gelungen ist.« John machte eine Pause. »Du bist mit der Wissenschaft vertraut, Marian. Was denkst du? Ist es machbar?«
Sie wusste, dass John in den letzten Jahren mit Neid von der Seitenlinie aus zugesehen hatte, wie andere Männer in Panama das Gelbfieber unter Kontrolle gebracht hatten. Und es stimmte — sie war vertraut mit den Studien und Berichten.
Sie blickte ihn an. »Ich sehe keinen Grund, warum nicht.«
John nickte, doch er starrte weiter auf die Bäume. Die Konturen seiner Silhouette waren ihr vertraut — seine nach oben gebogene Nase, sein spitzes Kinn.
Zu diesem Zeitpunkt waren sie seit zehn Jahren verheiratet. Sie hatten sich in Knoxville kennengelernt, wo Marian am Female Institute Botanik studierte. Um die Studiengebühr zu bezahlen, suchte sie sich einen Nebenjob. Damals herrschte in Tennessee ein Holzboom. Überall in den Appalachen wurden Bäume gefällt, und das Geräusch, das sie beim Fallen machten, dieses schreckliche Boom, wurde von den Menschen zu einem Wort für etwas Gutes umgedeutet. Es gab so viel florierende Industrie, so viele Fabriken und Betriebe, dass nicht nur die Nachfrage nach Holzfällern hoch war, sondern auch die nach Verwaltungspersonal, um die Firmen über Wasser zu halten. Eine Stelle bei Oswald Lumber war leicht zu bekommen. Den Oswalds gehörten auch ein Landwirtschafts- und ein Maschinenunternehmen. Ihnen gehörte halb Knoxville, wie manche raunten. Von diesen drei Unternehmen hatte sich jedes der Oswald-Kinder eines ausgesucht und schritt einer vorgezeichneten Zukunft entgegen. Marian hatte drei Jahre als Stenografin der Holzfabrik gearbeitet, Frachtbriefe und Bestellungen ausgefüllt, bevor sie erstmals John Oswald sah, den jüngsten der drei Söhne und Außenseiter des Clans, der einzige, dem man nachsagte, dass er den Ehrgeiz habe, seinen eigenen Weg zu gehen. Das bewunderte sie an ihm, ehe sie etwas anderes über ihn wusste. John kam eines Tages in das Büro, um mit seinem Vater zu sprechen, und warf stattdessen einen Blick auf sie. Einen langen Blick, der ihre Haut kribbeln ließ. Sie saß hinter einem unlackierten Eichentisch und wusste, wie sie wirkte — auffallend unglamourös und schlicht. Trotzdem starrte er sie von der anderen Seite des Raumes an, trat zu ihr herüber und sagte, noch bevor er seinen Fuß auf den Boden gesetzt hatte: »Darf ich Sie heute Abend ausführen, wenn Sie frei sind?«
Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass ein Mann auch nur das geringste Interesse an ihr zeigte. Für den Rest ihres Lebens würde sie sich fragen, was John an diesem Tag in ihr gesehen hatte. Sie fragte ihn ein einziges Mal, aber er blickte sie mit solch blankem Unverständnis an, dass es ihre Seele zerschmetterte. Sie hatte zufällig dort gesessen, mutmaßte sie, und wäre ein anderes Mädchen an ihrer Stelle gewesen, hätte er stattdessen dieses Mädchen gefragt. Es hätte womöglich Ja oder Nein gesagt, und Marians Leben, das sich in irgendeiner parallelen Sphäre abgespielt hätte, wäre unberührt weitergegangen. Doch nein, er hatte sie gefragt, und sie wusste, dass es dafür einen Grund gegeben haben musste.
Er führte sie in ein elegantes Eiscafé beim Marktplatz aus, und an diesem Abend stellte Marian fest, dass John in den unterschiedlichsten Themen bewandert war. Er sprach über Oscar Hammerstein, der im Begriff war, ein Theater in New York City zu eröffnen, und über die Arbeit von Louis Sullivan im Mittleren Westen. Er hatte eine Meinung zu Präsident Cleveland und dem Wilson-Gorman Tariff Act. Als er Marian fragte, ob sie von einem Mann namens Nansen gehört habe, der versuchte, in die Arktis zu segeln, sagte sie: »Natürlich. Und wussten Sie, dass der Name seines Schiffs, Fram, auf Norwegisch ›vorwärts‹ bedeutet?« John sah sie an, als wäre er sowohl überrascht als auch beeindruckt gewesen.
Innerhalb von einem Jahr waren sie verheiratet. Marian schloss das Studium ab. Sie überlegte sich, dass sie sich eine Stelle in ihrem Fachbereich suchen könnte, vielleicht als wissenschaftliche Assistentin, doch als sie das zur Sprache brachte, sagte John: »Warum? Was würde das bringen? Und es ist auch nicht nötig, Marian. Nicht mehr.« Er wollte sie beruhigen, aber sie sträubte sich vor der Vorstellung, dass es für eine Frau schwierig sein würde, außerhalb der Ehe etwas zu bewirken, und empfand es als erstickend.
Sie kauften ein großes Haus in einem Städtchen in Sevier County, Tennessee, etwa dreißig Meilen von Knoxville entfernt. John, dessen Karriereziele jenseits des Holzunternehmens lagen, wollte Abstand von seiner Familie gewinnen. Der Ort erinnerte Marian mit seinem Gemischtwarenladen, der Schmiede, der Schule und der Kirche an die Art, wie sie aufgewachsen war. Sie war die Tage über allein, brachte sich selbst das Kochen und Backen bei, spazierte an Flüssen und Bächen entlang, atmete die frische Bergluft ein, wanderte über Teppiche aus Wildblumen und den nadeligen Waldboden, der nach dem Regen weich war wie ein Schwamm. An vielen Nachmittagen las sie draußen in der Sonne. Grays Lektionen in Botanik und Pflanzenphysiologie, Schleidens Die Botanik als induktive Wissenschaft, Mendels Versuche über Pflanzenhybriden. Wenn sie des Lesens müde wurde, ritt sie mit Horace und Charles aus, und wenn sie zu ihnen sprach, war es oft das einzige Mal am Tag, dass sie ihre eigene Stimme hörte. John hatte begonnen, in einem kleinen Labor zu arbeiten, wo er die Theorie erforschte, dass Moskitos Krankheiten verbreiteten. Es war eine Hypothese, die siebzehn Jahre zuvor von einem kubanischen Arzt namens Carlos Juan Finlay aufgestellt und dann von dem amerikanischen Arzt Walter Reed auf den Prüfstand gestellt worden war. Doch um die Jahrhundertwende konnten das viele Menschen noch immer nicht glauben. Wie sollte dieses winzige Insekt, kaum schwerer als ein Spinnennetz, Krankheiten übertragen, die einen Menschen dahinraffen konnten? Die Skepsis spornte John nur noch mehr an. »Es ist eine unwiderlegbare Tatsache«, sagte er einmal. »Und wir werden es beweisen.« John arbeitete oft bis in die Nacht hinein, und Marians Abende waren so einsam wie die Tage. Sie war mit wenigen Erwartungen in die Ehe eingetreten. Sie war vor allem dankbar gewesen, dass sie überhaupt jemand heiraten wollte. Sie war als Einzelkind aufgewachsen, ohne viele Freunde, und sie hatte gehofft, dass die Ehe zumindest der Einsamkeit ein Ende setzen würde. Das tat sie nicht. Selbst wenn John nach Hause kam, war er mit dem Kopf noch bei der Arbeit. Er war permanent abgelenkt, geistesabwesend, körperlich anwesend in seinem Sessel, doch gedanklich ganz woanders. Wenn Marian sich mit ihm unterhalten wollte, musste sie sich nach seiner Arbeit erkundigen. Nur dann blühte er auf. Mit der Zeit erkannte sie: Wenn sie von den Büchern sprach, die sie gerade las, würde John auch darüber sprechen. Er interessierte sich für Wissenschaft, auch wenn er sich nicht für sie interessierte.
Als er ihr an jenem Abend hinter dem Haus von der Stelle in Panama erzählte, schien er erleichtert gewesen zu sein, dass sie ihm einen Erfolg zutraute. »Du hast recht«, hatte sie gesagt. »Panama ist möglicherweise die letzte Malariafront. Und jeder, der verantwortlich ist für ihre Ausrottung … nun, das sind die Menschen, die in die Geschichte eingehen werden, weißt du.« Seine Augen waren auf den Horizont fixiert, als er plötzlich nach ihrer Hand griff. Marian erschrak, ließ ihn aber gewähren. Es war ein Flehen. Sie erkannte es als solches. Er berührte sie so selten. Dass er es tat, zeigte, wie tief entschlossen er war. Vielleicht, dachte sie, würden sie dort glücklicher sein. Vielleicht würde die Veränderung etwas in ihm wecken.
»Ich weiß«, sagte Marian, während sie hinaus auf das Land blickte. »Und es gibt niemanden, der besser geeignet wäre, diese Leute anzuführen, als du.«
John drehte sich zu ihr und sah sie mit solch einer Dankbarkeit an, dass sie es einen Moment lang für Liebe hielt.
*
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Panama, auf einer der vielen Abendveranstaltungen, denen sie beizuwohnen hatten, erfuhr Marian, der das »Haus auf dem Hügel« übertrieben erschien, dass es auf dem Isthmus mindestens ein Wohnhaus gab, das noch größer war als ihres. Es handelte sich um ein Haus in Ancón, das für einen Preis von 100.000 Dollar für einen französischen Ingenieur namens Jules Dingler gebaut worden war. Im Herbst 1883, zwei Jahre nachdem die Franzosen ihren Versuch gestartet hatten, einen Kanal zu graben, war Dingler mit seiner Frau, seinem Sohn, seiner Tochter und dem Verlobten seiner Tochter hier eingetroffen.
»Und wissen Sie, was er kurz vor seiner Abreise aus Frankreich gesagt hat?«, fragte der Mann, der die Geschichte erzählte.
Der Anlass des Abends war ein formelles Beisammensein in einem Ballsaal, eine Art von Veranstaltung, die weder Marian noch John genossen. Sie waren in eine Gruppe von sechs anderen Personen geraten, die alle gebannt zuhörten, als der Mann seine Anekdote zum Besten gab.
»Er sagte: ›Nur Trunkenbolde und Chaoten bekommen Gelbfieber und sterben daran.‹«
»Aber das war damals die gängige Meinung«, sagte einer der anderen Männer.
»Wie weit wir doch gekommen sind! Nicht wahr, Mr. Oswald?«
John, der neben Marian stand, nickte und sagte: »In der Tat.«
»Der arme Dingler hätte von einer Expertise wie der Ihren profitieren können.«
»Sie meinen — ist er … dahingeschieden?«, fragte eine Frau mit langen Samthandschuhen.
»Nein, nein, das ist er nicht, meine Liebe. Doch wenige Monate, nachdem Dingler eingetroffen war, erkrankte seine Tochter an Gelbfieber und …«
Die Frau schnappte nach Luft.
»Richtig«, sagte der Mann. »Kurz darauf dann sein Sohn. Dann der Verlobte seiner Tochter. Dann seine Frau.«
»Alle am Gelbfieber?«, fragte jemand.
»Ja.«
»Und was war mit Dingler?«
»Er kehrte schließlich nach Frankreich zurück, sicher mit gebrochenem Herzen.«
Alle standen da wie gelähmt, bis einer der Männer sagte: »Sie wissen wirklich, wie man eine Party in Schwung bringt, Badgley.«
»Ich hielt es für angemessen, dass unsere neuen Gäste es erfahren.«
»Was erfahren?«, sagte jemand anderes. »Dass der ganze Ort verflucht ist?«
Badgley lächelte. »Nun, das mag er gewesen sein, aber nicht mehr. Das Gelbfieber ist ausgerottet, und Mr. Oswald hier wird dasselbe mit der Malaria machen.« Er klopfte John auf die Schulter. »Nicht wahr?«
Marian sah, dass John leicht errötete. Es war ihm lieber, Moskitos in den Mittelpunkt zu rücken, als selbst dort zu stehen.
»Das ist der Plan, ja«, sagte er.
Badgley, dessen Hand noch immer auf Johns Schulter lag, sagte: »Seien Sie nicht so bescheiden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wir alle hören, dass Sie der richtige Mann für die Aufgabe sind. Was sagen Sie? Glauben Sie wirklich, dass es möglich ist, diesen Seuchenherd ein für alle Mal von der Malaria zu befreien?«
John zwang sich zu einem angespannten Lächeln, und nach einem kurzen Moment ergriff schließlich Marian das Wort, um ihm aus der Patsche zu helfen. »Das ist durchaus möglich. Und Sie haben recht — er ist der richtige Mann für die Aufgabe.«
*
Es gab zwei Jahreszeiten in Panama: die nasse und die trockene. Sie waren in der trockenen angekommen, zu Beginn des Jahres, als die Brise am Abend kühl war, doch im Mai, als der Regen vom Himmel zu strömen begann, wurde Marian von John ermahnt, nicht zu viel Zeit im Freien zu verbringen. »Wenn es nass ist, wimmelt es von Moskitos. Sie gedeihen unter solchen Bedingungen.«
»Aber was soll ich dann machen?«, fragte sie.
Darauf gab er keine Antwort. »Das Wetter wird im Januar besser«, sagte er.
Ihr ganzes Leben hatte Marian noch nie so viel Regen vom Himmel fallen sehen. Als Mädchen in Tennessee tauchte sie immer ihre Hände in die Schlammpfützen, die überall auf dem Grundstück ihrer Eltern klafften, und tastete darin nach Fröschen, wenn ein Sturm vorübergezogen war. Immer wenn es nieselte oder schüttete, blickte ihr Vater aus dem Fenster und sagte stets dasselbe: »Wenigstens freuen sich die Bäume.« Sie fragte sich, was ihr Vater wohl über den Regen hier gedacht hätte. Oft kam er in einem Schwall. Der Wind wurde stärker und brachte die Baumwipfel zum Wanken, und der Regen peitschte durch die Luft. Und dann hörte er ganz plötzlich auf, als ob der Himmel zugeschlagen wäre, und die Sonne kam wieder heraus. Doch wie sie festgestellt hatte, waren die Unterbrechungen normalerweise kurz, gerade lang genug, dass die Wolken mehr Regen sammeln konnten, um ihn erneut zu entfesseln.
Nach Beginn der Regenzeit saß Marian mehrere Wochen auf der Veranda und schaute hinaus in den Regen. Durch die Kupfergitter konnte sie ein bisschen von der darunterliegenden Stadt sehen, einige Gebäude sowie den Bahnhof, wo den ganzen Tag lang schwarze Lokomotiven ein- und ausfuhren. Überall, wohin sie blickte, kamen und gingen Menschen, selbst bei den schlimmsten Regengüssen, und sie betrachtete sie mit Missgunst. Wie konnte John ihr ernsthaft abverlangen, die ganze Zeit drinnen zu bleiben? Die Bücher, die sie mitgebracht hatten, waren von Schimmel bedeckt. Es gab keine Pferde zum Reiten. Und sie war nicht den ganzen Weg gekommen, nur um auf einer Veranda zu sitzen.
Als sie das erste Mal nach draußen ging, spazierte Marian einfach den Hügel hinunter und wieder hinauf, einzig aus dem Vergnügen, das Haus zu verlassen. Sie rutschte auf dem Weg nach unten im Schlamm aus und landete auf dem Hintern, und sie lachte über sich selbst, und ihr Lachen fühlte sich fast so gut an wie das Laufen. Als sie ins Haus zurückkehrte, wusch sie ihre Kleidung im Waschzuber aus und putzte ihre Stiefel, und als John von der Arbeit nach Hause kam, wusste er von nichts.
Schließlich wagte sie sich weiter, am Fuß des Hügels vorbei in die Stadt. Selbst im Regen ging das Leben weiter. Männer liefen die Straße mit so stark durchnässten Hüten entlang, dass ihnen die Krempen senkrecht nach unten hingen. Frauen umklammerten ihre Sonnenschirme und wichen Pfützen aus. Und Marian war einfach nur glücklich, all das zu sehen.
Die Stadt Empire lag am höchsten Punkt der Kanalroute, ungefähr in der Mitte zwischen dem Pazifischen Ozean und dem Atlantik. Sie thronte auf einem Felsvorsprung, der den gewaltigen Culebra Cut überblickte, den neun Meilen langen Abschnitt des Kanals, der von den Bergen behindert wurde, durch die hindurchgegraben werden musste. Manchmal ging Marian auch nach draußen, um sich genau das anzusehen, um den steilen Abhang hinunterzublicken, und jedes Mal wurde ihr schwindlig von dem kolossalen Ausmaß, das beinahe unmenschlich wirkte. Drei Millionen Jahre zuvor, so hatte Marian gelesen, waren Unterwasservulkane ausgebrochen und hatten große Mengen Sediment an die Oberfläche befördert, wodurch die zwei Kontinente verbunden worden waren und sich die Landbrücke gebildet hatte, auf der sie alle standen. Nun lautete die Aufgabe offenbar, sie wieder zu trennen, das Land von Ozean zu Ozean zu öffnen. Was die Natur vollbracht hatte, wollte der Mensch wieder rückgängig machen.
*
Monate waren vergangen, und der Regen fiel noch immer.
Zu Hause holte Marian ein Couponheft aus dem Küchenschrank und zog sich ein Regencape über. Das Cape bedeckte den Großteil ihres Kleides bis zu den Knien. Jenseits davon würde sie wohl oder übel nass werden.
Die Köchin, Antoinette, stand am Herd und nahm den Deckel von einem großen Eisentopf mit Fischsuppe. Als Marian sagte, dass sie nach draußen gehen würde, zog Antoinette eine Augenbraue hoch und fragte, ob das eine gute Idee sei, bei dem Regen.
»Ich denke, das ist gut so«, sagte Marian und zupfte an einer Falte des Umhangs. »Dafür habe ich das hier.«
Antoinette war ihnen von einem anderen Ehepaar empfohlen worden, das aus Georgia stammte, und das die Oswalds bei einem Willkommensdinner kennengelernt hatten, das ihretwegen organisiert worden war. Marian hatte sich zu diesem Anlass ein Kleid aus Seidenvoile mit kunstvoll verzierter Spitze angezogen und die Haare zu einer leicht geschwungenen Tolle frisiert, und John bemerkte weder das eine noch das andere und wollte auf der Fahrt wie immer nur über seine Arbeit reden. Er fragte sie nach ihrer Meinung zu einer statistischen Anomalie, auf die man ihn an diesem Tag aufmerksam gemacht hatte, und obwohl sie ihm riet, einfach mehr Daten zu sammeln, war er über alle sechs Gänge hinweg von dem Problem abgelenkt. Er hatte still die Schildkrötensuppe, den Putenbraten und alles andere gegessen, das ihnen serviert wurde, während die Gäste ringsherum schwelgten und lachten. Als er einmal nach seinem Glas griff, stieß er eine brennende Kerze um und setzte kurz das Tischtuch in Brand, bis einer der anderen Männer am Tisch aufsprang und das Feuer mit Wasser aus seinem Trinkglas löschte. John sank auf seinem Platz in sich zusammen, und der Gastgeber machte einen Scherz, um die Situation zu überspielen, und keiner sprach mehr darüber. Aber Marian wusste, dass dies etwas war, wofür sich John kasteien würde. Das einzig Gute an dem ganzen Abend war, als die Frau aus Georgia, die neben Marian saß, fragte, ob sie bereits Hilfen gefunden habe. »Hilfen?«, sagte Marian. »Die Auswahl hier ist grauenhaft«. »Die Schwarzen hier sind nicht wie die Schwarzen zu Hause. Sie tun nicht, was man ihnen sagt, und offenbar bringt sie keine Ermahnung der Welt dazu, schneller zu arbeiten.« Sie wisse jedoch von einer guten Köchin, einer Frau aus Antigua, und gab Marian den Namen. Marian hatte nie eine Köchin oder ein Dienstmädchen oder irgendeine Hilfe in diese Richtung gehabt — weder als sie jung war, noch in ihrem Eheleben —, doch John, der mit Personal aufgewachsen war, überredete sie, es auszuprobieren. »Es war eine Sache in Tennessee, aber hier ist alles anders. Erzähl mir nicht, dass du weißt, was man mit einer Kokosnuss macht. Und ich esse sehr gerne.«
Jetzt legte Antoinette den Deckel auf den Topf und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. Sie war siebenundvierzig Jahre alt und immer noch so wohlproportioniert wie einst als junge Frau, auch wenn ihre Haare an den Schläfen grau wurden, und die Adern auf ihren Handrücken stärker hervortraten als früher. Sie betrachtete diese Adern manchmal mit Missfallen und wünschte sich die Tage zurück, in denen sie noch geschmeidiger, noch frischer gewesen war. In Antigua hatte sie ihren Lebensunterhalt mit der Zubereitung von geschmortem Salzfisch, Ziegenwasser mit Yamswurzeln und Callaloo verdient, wobei letzteres ihre Spezialität war, und die Menschen in der Nachbarschaft waren bereit zu zahlen, weil ihr Essen so gut schmeckte. Aber so gut es auch schmeckte, verdiente sie trotzdem nicht viel. Vor ein paar Jahren hatte sich ihr Mann, den sie dreiundzwanzig Jahre geliebt hatte, ein junges Blümchen gepflückt, das halb so alt war wie er. Sie hätte ihn nicht zu so etwas imstande gehalten, aber offenbar war er das, vermutlich weil eine frisch erblühte Blume süßer roch als eine rasch verwelkende. Sie hatte ihm vier Kinder geboren. Kurz nachdem sich ihr Mann aus dem Staub gemacht hatte, geriet ihr Bruder in eine schwierige Lage, weshalb er und seine zwei Kinder bei ihr einzogen, und das ergab drei zusätzliche hungrige Mäuler. Insgesamt acht Menschen, sie selbst eingeschlossen, die es zu ernähren galt, neben dem guten Dutzend zahlender Kunden aus der Nachbarschaft, bedeuteten viel zu viel Arbeit für so wenig Lohn. In Panama, hatte ihr jemand erzählt, könne sie halb so viel kochen und das Doppelte verdienen. Wie sich herausstellte, hatte diese Person mit ihrer Berechnung ein wenig danebengelegen. In Panama erkannte Antoinette, dass sie ein Fünftel von dem kochen konnte, was sie zuvor gekocht hatte, und drei Mal so viel verdiente.
Die Suppe musste noch ein paar Stunden köcheln. Sie würde sie heute zum Abendessen servieren. Danach würde sie zu ihrem Zimmer in dem überfüllten Mietshaus in Panama-Stadt zurückkehren, an ihre vier Kinder denken, die sie zurückgelassen hatte, und sich fragen, ob das Geld, das sie alle zwei Wochen nach Hause schickte, sicherstellte, dass sie gut aßen, besonders ihr Jüngster, Arthur, der acht Jahre alt und seit jeher schmächtig war.
»Ich denke, ich werde in einer Stunde zurück sein«, sagte Mrs. Oswald jetzt, und bevor Antoinette eine weitere Frage stellen konnte, ging sie.
*
Es gab eine Commissary in fast jeder Stadt entlang der Kanallinie. Dem Commissary Department gehörten neben den Geschäften eine Eisfabrik, Wäschereien, eine Bäckerei, die jeden Tag über zwanzigtausend Brotlaibe produzierte, eine Druckerei, und ein Zug, der jeden Morgen aufbrach, um Kunden direkt zu beliefern. Doch die Geschäfte waren die wichtigste Einnahmequelle. Sie waren bis zum Rand gefüllt mit Gemüsekonserven, Keksen, Streichhölzern, Schuhen, Baseballhandschuhen, Kampferkugeln, Maismehl, Corned Beef, Haarpomade, Seife, Nagelbürsten, Handtüchern, Taschentüchern, Satinbändern, Taftbändern, Vaseline, Sonnenschirmen, Stoffen, Spitze, Fingerschalen, Eisschalen, Butterdosen, Kleiderbügeln, Uhren, Kabeljau, Zucker, Traubensaft, Zigarren, Schwämmen, Naturteppichen, Möbelpolitur, Rattenfallen, Eiern, Wurst, Lammfleisch, Schweinefleisch, Leber, Steaks, Frischkäse, Neufchâtel, Roquefort, Schweizer Käse, Gouda, Edamer, Camembert, Pinxter, MacLaren’s, Kondensmilch von St. Charles und Nestlé, Quaker Haferflocken, Quaker Maiskuchen, Grapefruits, Cranberries, Rote Beete, Tomaten, Sellerie, Spinat, Sauerkraut, Speiserüben, Pastinaken, Kürbis, Auberginen, Besteck, Kellen, Reiben, Sieben, Zangen, Schneebesen, Mänteln, Strümpfen, Knöpfen, Hüten, Pfeifen, jedem Luxus und Komfort, den man sich vorstellen konnte.
Marian brauchte nichts davon. Der Gang zur Commissary war nur ein Vorwand, um das Haus zu verlassen.
Als Marian bei dem Geschäft ankam und eintrat, war ihr Regenumhang schwer vom Wasser, und ihre Ziegenlederstiefel waren völlig durchnässt. Sie streifte die Kapuze ab und stampfte ein paar Mal mit den Füßen. Molly, die junge Kassiererin schaute auf, und als sie Marian erblickte, lächelte und winkte sie. Marian fand Molly, die mit ihren Eltern nach Panama gekommen war, stets freundlich. Sie hatte langes und glattes blondes Haar, das sie entgegen der Sitte offen trug. Vielleicht war es harmlos, aber Marian deutete dies als kleinen Akt der Rebellion, und fühlte sich dem Mädchen deshalb verbunden.
»Guten Tag, Ma’am. Es regnet wohl noch immer?«
»Es wird bis Januar regnen, befürchte ich.«
Molly lächelte. Vor Panama hatte sie auf Hawaii gelebt, wo es natürlich auch regnete, aber nicht so viel wie hier. Mit ihren Eltern hatte sie auch auf Kuba und den Philippinen gelebt, aber bis jetzt gefiel es ihr in Panama trotz des Regens am besten. Sie besaß eine Kamera, eine 4×5 Laufbodenkamera von der Größe eines Brotlaibs, die sie überallhin mitgeschleppt hatte, doch in Panama hatte sie noch nicht viel Gelegenheit gehabt, sie zu benutzen. Sie würde eines Tages gerne Journalistin werden, vielleicht sogar eine Nachrichtenfotografin, die mit ihrer Kamera durch die Welt reiste, aber das hatte sie noch niemandem erzählt. Vorerst war es bloß ein Hobby.
Als Mrs. Oswald sich nicht von der Stelle rührte, an der sie in der Tür stehengeblieben war, rief Molly: »Suchen Sie heute etwas Bestimmtes, Ma’am?«
Marian blieb bei der Tür stehen, ihr Umhang triefte, und sie wollte keine Wasserspur im Laden hinterlassen. Auf Mollys Frage blickte sie sich um. Die Dinge, nach denen sie sich im Leben sehnte — Verbundenheit, Wissen —, waren in keinem Laden der Welt zu finden.
»Ich weiß nicht«, sagte Marian. »Gibt es etwas Neues?«
»Nun, wir haben erst heute Morgen eine Ladung Papaya bekommen. Aus Florida, glaube ich.«
»Papaya?«
»Ja, Ma’am. Ich habe sie dort gestapelt.«
Molly zeigte darauf, und Marian drehte sich um und sah auf einem Tisch große, gelbe Papayas — die größten, die sie je gesehen hatte —, in Etagen geschichtet wie eine Torte. Sie schaute wieder zu Molly. »Aber Papayas wachsen hier.«
»Hier?«
»In Panama«
Molly, die nicht richtig verstand, worauf Marian hinauswollte, hielt es für das Beste, ihr einfach zuzustimmen. »Ja, Ma’am, das tun sie.«
»Aber warum wurden sie dann aus Florida importiert?«
»Ich … Ich weiß nicht, Ma’am. Aber ich weiß, dass die Papayas hier im Laden ganz frisch sind. Sie sind eben angekommen.«
»Aus Florida.«
»Ja, Ma’am.«
Molly rieb sich die Hände, und Marian tat es leid, die junge Frau in Verlegenheit gebracht zu haben.
»Wenn das so ist«, sagte Marian, die noch immer bei der Tür stand, »nehme ich eine. Oder lieber zwei. Ich nehme zwei.«