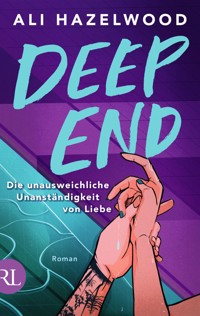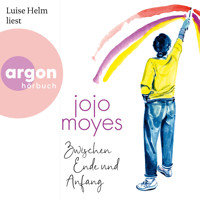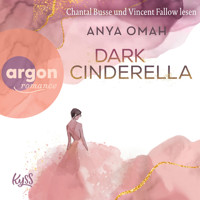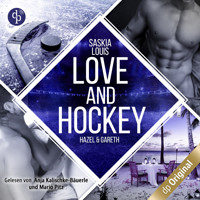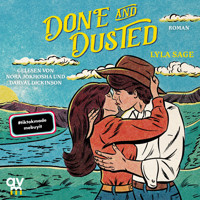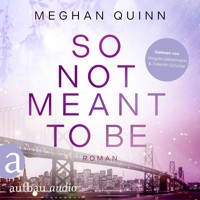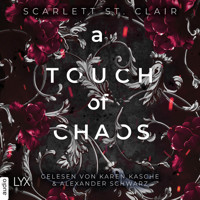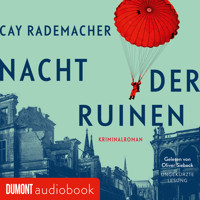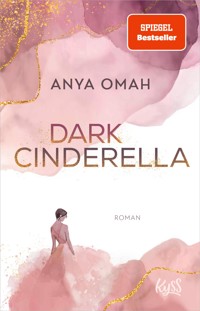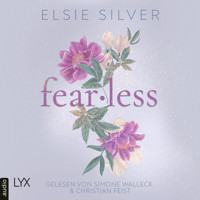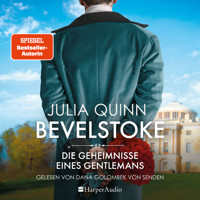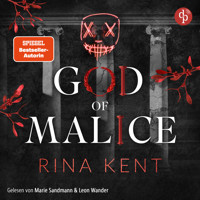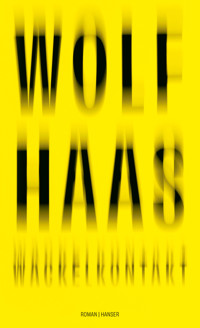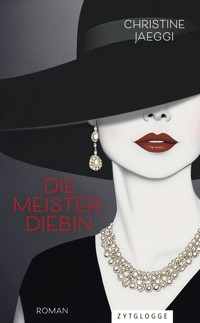Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bittersüß und zutiefst politisch schreibt Dmitrij Kapitelman in seinem neuen Roman über Familie und die (Un-)Möglichkeit der Verständigung in Zeiten alter und neuer Kriege.
Eine Familie aus Kyjiw verkauft russische Spezialitäten in Leipzig. Wodka, Pelmeni, SIM-Karten, Matrosenshirts – und ein irgendwie osteuropäisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Wobei, Letzteres ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht mehr zu haben. Die Mutter steht an der Seite Putins. Und ihr Sohn, der keine Sprache mehr als die russische liebt, keinen Menschen mehr als seine Mutter, aber auch keine Stadt mehr als Kyjiw, verzweifelt. Klug ist es nicht von ihm, mitten im Krieg in die Ukraine zurückzufahren. Aber was soll er tun, wenn es nun einmal keinen anderen Weg gibt, um Mama vom Faschismus und den irren russischen Fernsehlügen zurückzuholen? Ein Buch, wie nur Dmitrij Kapitelman es schreiben kann: tragisch, zärtlich und komisch zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine Familie aus Kyjiw verkauft russische Spezialitäten in Leipzig. Wodka, Pelmeni, SIM-Karten, Matrosenshirts — und ein irgendwie osteuropäisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Wobei, Letzteres ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht mehr zu haben. Die Mutter steht an der Seite Putins. Und ihr Sohn, der keine Sprache mehr als die russische liebt, keinen Menschen mehr als seine Mutter, aber auch keine Stadt mehr als Kyjiw, verzweifelt. Klug ist es nicht von ihm, mitten im Krieg in die Ukraine zurückzufahren. Aber was soll er tun, wenn es nun einmal keinen anderen Weg gibt, um Mama vom Faschismus und den irren russischen Fernsehlügen zurückzuholen? Ein Buch, wie nur Dmitrij Kapitelman es schreiben kann: tragisch, zärtlich und komisch zugleich.
Dmitrij Kapitelman
Russische Spezialitäten
Roman
Hanser Berlin
Teil I
Der Wetterreporter von Atschinsk und meine Mutter-Sprache
Der russische Wetterreporter warnt das russische Fernsehvolk. Und somit auch meine russisch fernsehvölkische Mutter. Die seit Jahrzehnten vom sichersten aller Ostdeutschlands aus an der russischen Welt teilnimmt, Leipzig.
»Im sibirischen Atschinsk wüten für diese Jahreszeit ungewöhnlich heftige Schneestürme und Eisregen, bei bis zu minus 30 Grad. Einwohner sind aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben.« Die Fernsehbilder zeigen indes Bewohner von Atschinsk, wie sie seelenruhig ihrer schneegepeitschten Frühlingswege gehen. Rentner schleppen ihre russischen Einkäufe in Richtung russischer Wohnblöcke aus der Sowjetzeit. Rechts russischer Schnee, der ihnen über den Kopf ragt, links russischer Schnee, der ihnen über den Kopf ragt. Ein geteiltes russisches Schneemeer, als hätte Moses kurz in Atschinsk Hand angelegt. Damit die Leute sich weiterhin gelobte Flusskrebskonserven und in Russland eingelegte Tomaten kaufen gehen können. Im heutigen Russland würde Moses (mit väterlich russischem Namen Moses Amramowitsch) sicher trotzdem nach russischem Recht verhaftet werden — wegen Spaltung.
Ein mit Dutzenden Schals vermummter Junge schaukelt im Schneesturm. Milizionäre und Feuerwehrleute klopfen an Dächern hängende Eiszapfen auf Volksfeindlichkeit ab. Immerhin, die Straßenhunde von Atschinsk sieht man fiepend nach einem Unterschlupf suchen. Komisch, dass sie die Hunde mit reingeschnitten haben beim russischen Propagandasender. Russische Realitäten, selbst die der russischen Köter, sind normalerweise nichts für die Russen da draußen.
»Na und?! In Atschinsk sind es auch schon mal minus 50 Grad!«, ruft meine Mutter, dem Wetterreporter irgendwie recht und doch eine kältekulturelle Korrektur gebend. In symbiotischer Dissonanz zur russischen Sendung. Stolz schwingt dabei in ihrer Stimme. Worauf eigentlich? Die mächtige russische Kälte? Die Fähigkeit der sibirischen Shopper und Schaukler, diese unerbittliche Kälte wegzurussen?
Durch das Küchenfenster fällt etwas sächsisches Sonnenlicht auf das graugelb gewordene Haar meiner Mutter. Sie raucht zu viel und altert zu viel. Das Zigarettenstopfgerät musste sie aus Abnutzungsgründen ersetzen. Auf dem Esstisch sind wie immer Hunderte Dinge, die nichts mit Essen zu tun haben. Tabakeimer, Ladekabel, Tabletten, Katzenkämme, Briefe, ausgerissene Kalenderseiten. Und auch gebratene Auberginen, irgendwo unter alldem begraben, mit Walnusspaste nach georgischer Art. Die beherrscht meine Mutter inzwischen meisterhaft russisch. Seit unser eigener Russische-Spezialitäten-Laden, der Магазин, geschlossen wurde, ist sie Rentnerin. Und runder geworden, ohne die Kanten zu verlieren. Im Gegenteil. Sie wird Großmutter Kante um Kante ähnlicher.
Großmutter bestand wiederum täglich darauf, die deutschen Wetterberichte zu sehen. Je öfter am Tag, desto besser. Und blieb doch die meiste Zeit in der deutschen Wohnung. Denn da draußen verstand kaum jemand meine russisch sprechende Großmutter. Ihre Tochter schaut nun im unpogromigsten aller Ostdeutschlands jeden Tag etliche Wetterberichte für Russland. Ich gezwungenermaßen manchmal mit, wenn ich sie und Papa besuche. Und denke dabei öfter, dass sich die Atmosphäre eines Landes recht genau daran messen lässt, wie politisiert seine Wetterberichte sind. Auf den Übersichtskarten mit allen großen russischen Städten tauchen neuerdings militärisch geraubte ukrainische Städte auf, als wären sie schon immer genau da verzeichnet gewesen: Russisch-Donezk, drei Grad und Schneeregen beispielsweise.
In Russland selbst hat meine Mutter paradoxerweise kaum je Zeit verbracht. Geboren wurde sie in Sibirien, doch mit drei Jahren brachte Großmutter ihr Töchterchen ins wärmere Moldawien — die kleine Lara vertrug die russische Kälte nicht. Ihr russischer Vater war da schon über alle Berge und ließ die beiden zurück. In Moldawien wuchs meine Mutter zur Frau heran. Und diese Frau beschloss, einmal volljährig, in das große Kyjiw zu gehen. 1986 war sie ein zweites Mal in Russland, und auch das lediglich für einen Kurztrip nach Moskau. Dorthin trug sie mich mit in ihrem Bauch. Vielleicht, damit ich die sprachgewaltigste Stadt aller sprachgewaltigen russischen Städte schon einmal durch ihren Körper hindurch hören konnte. »Moskau, das ist eine Stadt, wie es sie nicht noch einmal gibt«, schwärmt sie noch heute. Entbunden und erzogen hat sie mich dann aber natürlich wieder zu Hause, in Kyjiw. In der Hauptstadt der Ukraine. Außer ihrer Sprache und ihrem sprechenden Fernseher verbindet meine Mutter also fast nichts mit dem russischen Staat.
Aber was heißt schon »außer« Sprache? Seit diesem Krieg weiß ich überhaupt nicht, was Sprache eigentlich ist. Was sie soll. Was sie will. Was sie kann. Ob sie gehört, wem sie gehört, wohin sie gehört. Wie sehr Sprache der Zeit hörig ist.
Mein Verhältnis zur Sprache meiner Mutter, meiner Mutter-Sprache, war nicht immer so entmündigend politisch. Es gab Zeiten, da waren die Wörter zwischen uns treue Boten des Vertrauens. Nicht undurchsichtige Vertreter von Zusammengehörigkeit oder ewiger Trennung. Von Unschuld und Kriegsverbrechen, Leben und Tod letztlich.
Viele Wetterberichte ist es her, da standen meine noch junge, unabhängig ukrainische Mamochka und ich vor unserem sowjetischen Wohnblock in Kyjiw. Ein märchenhafter Winterabend Anfang der Neunzigerjahre, an dem fast alle ukrainischen Nachbarn unabhängig voneinander beschlossen hatten, spazieren zu gehen. Über den knackend kichernden Schnee. Kinder der unabhängigen Ukraine fuhren Schlitten auf der jüngeren Geschichte, schaukelten und sangen Lieder von Eisbären. Gleich neben dem Spielplatz verteilte Moses Flusskrebse am Stiel. Die störenden Schalen spaltete er natürlich für jeden und schenkte den unabhängigen ukrainischen Straßenhunden die Reste. Und als Milizionäre kamen, um die Papiere von Moses Amramowitsch zu kontrollieren, zeigte er ihnen seinen Heiligenschein. Also sind sie wieder davongestampft, jeder fröhlich mit einem Flusskrebs am Stiel. Gut, seien wir ehrlich, sie haben jeder zwei Krebse für sich einverlangt. Ja selbst die unabhängig ukrainischen Alkoholiker ringsherum schütteten die grünlichen Parfümfläschchen, die sie notgedrungen soffen, beseelt in den blütenweißen Schnee. Und marschierten, wenn auch schlängelnd, zum Kiosk, um sich entgiftenden Birkensaft zu bestellen. Bis auf Yashka, dem war herzlich egal, was er noch soff. Weil Yashka eh angefangen hatte, seine Organe zu verkaufen. Die nicht länger vom Weltkrieg, von stalinistischen Säuberungen, Gulagsystem, Aufbruch, Umbruch und Abbruch des sowjetischen Systems verbitterten Senioren saßen nun auf unabhängigen ukrainischen Bänkchen. Und erzählten ihren Mitmenschen Wintermärchen. Wobei sie nicht gern hörten, wenn man ihre Geschichten als Märchen bezeichnete. Nein, sie bestanden darauf, dass es Legenden seien. Denn jeder weiß doch, dass Legenden nichts anderes als eine glückliche Familie vieler Erzählungen sind. Und unabhängige ukrainische Erzählungen, die kommen von den unabhängig ukrainischen Leuten, die kann man als nahezu gesichert annehmen. Was unabhängig ukrainische Erzählungen fast so zuverlässig macht wie Wetterberichte.
Viele schier elektrisierte Zuhörer lauschten also andächtig den Ältesten im Wohnblock. Deren von Weisheit honigweich gewordene Stimmen in Eintracht mit den Schneeflocken durch die Nacht schwangen. Manche alten Legendenwetterberichter erzählten auf Russisch, andere auf Ukrainisch: »Ja, dorogije Ljudi (russisch), ja, dorohije Ljudini (ukrainisch), es ist wahr. Wer es schafft, bis zu den Eiszapfen an den Dächern der höchsten Chruschtschowkas im Viertel zu klettern, und für jedes Mitglied einen der magischen Eiszapfen abbricht, dem wird die Familie ewig gesund bleiben!« Unter dem Jubel der Leute in unserem Wohnblock warfen die jungen, kräftigen ukrainischen Männer ihre Mützen in den Schnee, rannten los und kletterten an den höchsten sowjetischen Chruschtschowkas hoch. Damit nichts in der Welt ihren Familien je wieder Leid zufügen können würde. Die Feuerwehr stand anfeuernd bei und breitete für alle Fälle, um nicht zu sagen Stürze, Auffangnetze aus. Was haben wir gelacht, wenn einer der jungen unabhängig ukrainischen Männer fiel, gleich wieder aus den Sicherheitsnetzen hüpfte und sich zurück in den Hohe-Häuser-Kampf warf. Ich selbst war noch zu klein, um die Chruschtschowkas edelmütig zu erklimmen. Aber meine Mamochka zog mich ohnehin zur Seite, um mir eine viel zärtlichere Zauberei zuzuflüstern.
»Siehst du den Stern über uns, Sinulja?« (Söhnchen)
»Ja.«
»Streck deine Hände nach ihm aus.«
»Tak?« (So?)
»Da. Aber verbinde deine Daumen und mach deine Handflächen ganz auf. Wenn du Wärme von dem Stern spürst, ist es dein Stern. Wenn du aber Kälte fühlst, ist er nichts für dich. Vergiss ihn und geh weiter.«
Würde ich diese Worte meiner Mutter heute beherzigen, müsste ich sie vergessen und weitergehen. Denn von ihr geht die Kälte des Kriegs aus, die große, autoritäre Gewalt des Kremls, die von allen Seiten herandrängt. Sei es aus Russland über die Ukraine oder China, Ungarn, Italien, Frankreich vielleicht und erst recht aus dem wieder grandiziösen Amerika. Nicht zuletzt von deutschen Faschisten, die immer mehr Wahlen gewinnen. Ich fühle mich nicht bereit für all diese heranrauschende Gewalt. Das dumme Glück hat mich zu weich gemacht. Aber wenigstens konnte ich die Gewalt bisher der Außenwelt zuschreiben. Eine Grenze zwischen mir und ihr ziehen. Das geht nicht länger, wenn sie im Innersten der Familie gutgeheißen wird, von der eigenen Mutter. Das demoralisiert. Das demoralisiert gewaltig.
Dem Wetterreporter des russischen Staatsfernsehens mag sie wohlwollend widersprechen. Den russischen Nachrichten, die von einer gerechten Spezialoperation gegen das ukrainische Naziregime faseln, stimmt sie aber zu. Gibt allen außer Russland die Schuld. Der Nato, Amerika, der Ukraine und in gewisser Weise auch mir. Weshalb? Das will ich gar nicht mehr wissen. Ich bin mittlerweile völlig unwillig, meine Mutter zu verstehen. Selbst wenn es fast mehr wehtut, diese Hoffnung auf Verständnis zu begraben.
Wenn wir beide miteinander reden, fühlt es sich manchmal so an, als wäre uns nur noch die gemeinsame russische Sprache geblieben. Dabei waren wir noch nie weiter von einer gemeinsamen russischen Sprache entfernt. Und dennoch habe ich fast anderthalb Stunden an meinem russischen Sprachinhalator gehangen, bevor ich zu Besuch kam. Und gelesen. Nach etwa einem Jahr Invasion beschloss ich, trotz des russischen Terrors täglich genauso viele Seiten russischer Literatur zu lesen, wie ich Lebensjahre zähle. Aktuell also 36 Seiten täglich. Um etwas, das ich gar nicht näher bestimmen kann, nicht an die Vergangenheit zu verlieren. Möglichst halblaut, damit ich meine Mutter-Sprache von mir selbst höre. Nicht von meiner Mutter. Ich trage eine Sprache wie ein Verbrechen in mir und liebe sie doch, bei aller Schuld. Neben aus der Ukraine geflohenen Menschen stehe ich stumm wie ein Baumstumpf. Zumindest bis ich einige von ihnen ebenfalls Russisch sprechen höre.
»Auf der Schnellstraße nach Irkutsk kommt es vermehrt zu Sperrungen«, mahnt der russische Wetterreporter währenddessen weiter vor den russischen Naturgewalten. Im Bild: lauter Autos und Busse, die sich gegen die Sperrungen sperren und weiter auf die R255 zwischen Nowosibirsk und Irkutsk drängen.
»Mama, fällt dir etwas am Wetterreporter auf?«
»Nein. Was denn?«
»Na ja, er steht im Schneesturm bei minus 30 Grad und warnt vor der lebensgefährlichen Kälte.«
»Ja? Und?«
»Aber trägt keine Mütze. Warum trägt er keine Mütze?«
Sie stutzt. Und schaut kurz anders auf ihr Fernsehrussland. Nicht kritisch, aber immerhin verwundert.
»Stimmt. Seine Stirn ist schon knallrot«, sagt meine Mutter, einem universellen Schmunzeln relativ nah.
Einen Moment lang schweigen wir friedlich. Und warm, dank des vor sibirischer Kälte warnenden russischen Wetterberichts.
Der Магазин — Russische Spezialitäten
Unser dritter Frühling in Deutschland, lila Fliederstaub schwebt zwischen ausgeblichenen Leipziger Plattenbauten. Wie Schmetterlinge um sozialistische Skelette. Oder aber deutsche Zehn-Mark-Scheine — je nachdem, was man vor den wiedervereinigten Augen hatte, eine gute Handvoll Jahre nach dem Mauerfall. Wobei die Wohnkomplexe ringsherum immer noch gnadenlos arbeiterstaatlich dastanden: kollektivbetoniert, sozialistisches Elfgeschoss an Elfgeschoss an Elfgeschoss. Sodass der wiedervereinigte Wind in den wenigen Quadratgassen manchmal ganz schön Wucht bekam. Dann flog alles noch viel schneller, regelrechte Fliederautobahnen in der Trabantenstadt.
Ich war elf und hielt die Geschichten über diese Fliederflüge zuerst bloß für ostdeutsche Ammenmärchen. Wobei ihre Erzähler nicht gern hörten, wenn man ihre ostdeutschen Geschichten als ostdeutsche Ammenmärchen bezeichnete. Nein, sie bestanden darauf, dass es ostdeutsche Legenden seien. Denn jeder weiß doch, dass ostdeutsche Legenden nichts anderes als ein eingeschworenes Kollektiv von Halbwahrheiten sind. Und ostdeutsche Halbwahrheiten bestäuben die Wirklichkeit bekanntlich ebenso real wie Fliederpollen. Wenn der Frühlingswind also halbwahr genug durch die Platten pfiff, konnten sich die Pollen so wild zusammenballen, umherbefruchten und wiedervereinigen, dass ganz eigentümliche neue Wesen aus ihnen hervorgingen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, in der wiedervereinigten Plovdiver Straße. Da stolzierten aus einem dieser violett vibrierenden Befruchtungsbälle plötzlich zwei Herren in Anzügen hervor. Mit Aktenkoffern und Krawatten und goldenen Uhren und überhaupt allem Geldgeschäftlichen. Und aus diesen zwei Herren blüteten wiederum weitere Dutzend solcher Herren. Diese Herrschaften ließen sich allerdings keine Sekunde lang anmerken, dass sie Auswürfe des wendigen Windes sein könnten. Und marschierten schnurstracks auf sämtliche Elfgeschosser zu. Um den Wiedervereinigten darin Aktien der Deutschen Telekom zu verkaufen. Wie die Unbeirrbarkeit höchstselbst in Lackschuhen traten sie auf. Durch sämtliche Haustüren und die mit Hakenkreuzen beschrifteten Fahrstühle hoch. Irgendwann öffneten auch Mama und Papa ihnen die Tür. Baten sie herein, durch unseren Korridor in Ziegelmustertapete von Möbel Höffner. Stellten die Musik von Wladimir Wissotzky leiser, der ihnen reibeisenstimmig von einer staubigen sowjetischen Stadt sang, in der die Menschen nicht länger wie Menschen aussehen. Bloß noch schwarze Gesichter, sodass man weder Freund noch Feind in ihnen erkennen kann. Auf unserem Wohnzimmertisch wurde Platz gemacht für die betörend lila hereinwehenden Unterlagen, Notizblöcke voller Diagramme und Taschenrechner. Mama und Papa boten den Fliederfinanciers zur Feier des Tages eine Schüssel Уха an. Die wohl herzlich einfachste und russischste aller russischen Fischsuppen. Aber da rümpften die Herren nur ihre Goldnasen.
Wahrscheinlich roch unsere Familie 1997 an sich noch stark nach Ukraine. Papa und ich schworen weiter auf das ukrainische Mineralwasser aus Myrhorod, das all unseren wiedervereinigten deutschen Bekannten viel zu salzig schmeckte.
»Deine drecksche Russenplörre kannst du in deinen hässlichen Pisspott kippen«, hat beispielsweise Patrick Karolat aus der 5a über meine geliebte Mirhorodskaya geätzt. Und sie angewidert ausgespuckt.
Mama schminkte sich weiterhin so, als würde draußen der glamouröse Kreschatik warten, voller makellos kosmetisierter Kyjiwer Konkurrentinnen. Statt grüner Latzhosen und Heckenscheren im Rahmen der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, zu denen sie vom wiedervereinigten Amt eingeteilt wurde.
Meine Eltern stimmten also zu, an der Finanzmarktkapitalisierung der Deutschen Telekom teilzuhaben, aus unserem Plattenbau heraus. Und investierten fast alles, was sie in Kyjiw jahrelang angespart hatten. Vielleicht weil sie deutsche Unternehmen damals noch für unverwüstlich hielten. Sich zum Abschied an einem ähnlichen Siegerlächeln versuchend, wie die sofort nach Signatur zum Hakenkreuz-Fahrstuhl eilenden Herren. Nein, nach dem Flieder der Sieger sah das alles eher nicht aus. Ich ging auf unseren Balkon und schaute den Herren hinterher. Von der unguten Ahnung beschlichen, dass diese Gestalten vielleicht doch nicht so grandiose Geldgötter sein könnten. Spätestens als sie einem aus den wiedervereinigten Büschen auftauchenden vietnamesischen Mann verstohlen zwei Blöcke Marlboro abkauften und diese hastig in ihre glorreichen Aktenkoffer stopften. Den relativ ehrlich arbeitenden vietnamesischen Verkäufer ins wiedervereinigte Gebüsch zurückschubsend. Wenige Meter weiter hielten zwei Neonazis einen dritten Neonazi fest, damit ein vierter Neonazi dem Festgehaltenen aufs Maul hauen konnte. Mit einem massiven wiedervereinigten Schlagring. Neonazi Nummer vier rief: »Wenn du dich wie eine geizige Judensau aufführst, Moarcel, dann wirste von uns ooch wie eine Judensau geklatscht!« Zum Glück zauberte der Frühling alles gütig, und die Platzwunden des Zusammengeschlagenen wurden sogleich vom herangewehten Flieder getüncht. Die Fliederaktienhändler schritten indes souverän an der Judenbestrafung vorbei.
Das Investment stank ab wie Fischsuppe. Und von den gerade noch übrig gebliebenen zweitausend Mark beschloss meine Mutter, den Магазин zu eröffnen. Papa beschloss das zwar auch, aber eher als post-entscheidende Zweitstimme. Vielleicht wurde der Магазин das neue Lebensmodell meiner Eltern, weil Handel alles war, was sie kannten. Sowohl aus der Sowjetunion als auch den wahnwitzigen Jahren danach. Wenn es Produkte gab, musste man schnell handeln. Und wenn es keine Produkte gab, die Regale immer wieder leer standen und der Staat vor dem Zusammenbruch — musste man erst recht HANDELN.
Oder aber die russischen Spezialitäten — Kaviar, Flusskrebse in Tomatensauce, gezuckerte Kondensmilch, Mirhorodskaya, aus echter Birke gemachte Birkengemälde, die CD mit den größten (und bedrückendsten) Hits von Wladimir Wissotzky — all diese Dinge waren etwas Vertrautes, Verständliches und Eigenes. Etwas, woran man sich festhalten konnte. In einem ansonsten völlig fremden, fliederflüchtigen und feindseligen Umfeld.
Den Namen Magasin empfahl ein deutscher Bekannter. Магазин, weil dieses Wort für Lebensmittelladen den lange zwangsberussten Leuten aus der DDR noch ein Begriff sei. Und so stand es dann auch in dicklich grünen kyrillischen Buchstaben am Schaufenster: Магазин. Darüber eine Weißfläche, kremlrot und elegant kursiv überschrieben: Russische Spezialitäten. Die Räumlichkeit mieteten Mama und Papa im Westen der wiedervereinigten Stadt. In moneymaking Kleinzschocher.
Von da an fuhren die beiden abwechselnd nach Kyjiw, um unsere Waren handzuverlesen. Mit riesigen Taschen voll ukrainisch-russischer Spezialitäten zurückkehrend: Matrjoschkas, schwarze Schatullen mit russischen Landschaften oder noch lieber Märchenmotiven verziert, feierlicher Krimsekt. Doch obwohl ich diese Dinge wunderschön fand, stimmten sie mich auch traurig. Ja, nun waren diese Prachtstücke aus Kyjiw bei uns, aber eben dadurch noch viel unerreichbarer. Die Kyjiwljani hatten sie immer zur Verfügung. So wie sie auch stets zu einem Spitzenspiel von Dynamo Kyjiv gehen konnten. Oder darauf bauen durften, dass ein gesellschaftlicher Grundrespekt für Mirhorodskaya-Mineralwasser fortbesteht. Wir mussten für all das dreißig Stunden Bus fahren, durch drei wiederenteinigte Länder hindurch. Außerdem könnte jederzeit Patrick Karolat aus der 5a mit seinen Eltern reinkommen, probieren, ausspucken und pöbeln: »Steckt euch eur’n Trecks-Магазин in eur’n hässlischen Russenpisspott! Das Gelumpe, ey! Bevor’sch eure Salzseiche trinke, sauf’sch libber aus der Gloschüssel!«
Verrückt eigentlich, dass man immer in der Öffentlichkeit einkauft. Es ist doch total intim, was man so sehr haben möchte, dass man Geld dafür ausgibt. Erst recht bei uns im Магазин. Wo auf einer der mitgebrachten Matrjoschkas unsere ganze Familie gemalt wurde. Mitglied für Mitglied, Holzpuppe für Holzpuppe. Papa als größte Matrjoschka, etwas zaghaft hinter seiner Brille lächelnd, ein in Osteuropa absolut original erhältliches Shirt von Calvin Klein tragend (bisschen anders buchstabiert vielleicht). Dann Mama, kyjiw-kompatibel geschminkt, mit viel russischem Rotgold behangen und sibirischer Katze auf dem Schoß. Ich, jubelnd im Trikot von Dynamo Kyjiv, einen Fußball auf dem Kopf. Großmutter gespannt vor der Wetterkarte. Diese ukrainische Matrjoschka stand dann auch als erste Russische Spezialität im Schaufenster.
Nur über unseren russischen Boden gab es kurz vor der grandiosesten russischen Eröffnung, die Kleinzschocher je gesehen hat, Streit. Das eigentlich schmucke alte Fischgrätenparkett des Raums schien Mama plötzlich zu dunkel für einen Магазин. »Dann sieht man die Produkte nicht!«, warnte sie. Also kam Onkel Jakob zu Hilfe, mit goldenen Händen von Gott beschenkt und vielleicht deshalb stets ein Summen auf seinen Lippen. Bis es daranging, die Räumlichkeiten für den Магазин zu renovieren, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass wir einen Onkel Jakob in Deutschland haben. Oder überhaupt irgendwo. Unser lieber Onkel Jakob also kam gerannt und überdeckte das Parkett noch fix mit hellerem, krankenhausgrünem Linoleum. Ging nach getaner Arbeit allerdings sehr verstimmt, ja richtig angefasst davon.
Auf russischem Boden
Drei Jahre später wische ich ebendiesen grünrussischen Boden, nach der Schule im Магазин aushelfend. Mama erledigt die Abrechnungen im Büro und schreibt neue Bestelllisten. Eigentlich ist es eher ein fensterloses Kabuff hinter dem Verkaufsbereich. Wo das trübe Sparlampenlicht einem die Augen verdüstert und Aktenordnertürme noch den größten Menschen unter sich begraben könnten. Aber Mama kommt dort irgendwie zurecht, sogar ganz ohne Sauerstoff, ausschließlich zigarettenbelüftet.
Papa sitzt an der Kasse und führt so eine Art Verkaufsgespräch. Mit Yashka, dem ewigen Draufgänger. Yashka hat sich längt sein ukrainisches Obolon-Bier gekauft. Bleibt aber da und will wie immer noch quatschen. Er hockt sich auf einen Stapel Gratismagazine, Russkaya Germania (»Russisches Deutschland«), die sehr gern von den Nashi mitgenommen werden. Also vorausgesetzt, Yashka sitzt gerade nicht drauf. Nashi, das sind übersetzt die Unseren, womit eigentlich alle Osteuropäer gemeint sind.
Tatsächlich gibt es neuen russischen Gesprächsstoff. Genauer einen neuen, überhaupt erst den zweiten demokratisch gewählten Präsidenten Russlands. Von Aufbruchsstimmung ist aber eher wenig zu spüren. Unsere (chinesischen) Russlandfähnchen dümpeln weiter unbegehrt im Regal für Gemischtes. Neben Nudelhölzern und Sonnenblumenkernen.
Ein KGBschnik, raunen die meisten Nashi über den neuen Präsidenten. Einer vom ebenso blutigen wie ewig sowjetischen Geheimdienst. Eigentlich raunen die Unseren auch nicht, eher reden sie dieses Wörtchen KGBschnik zügig und unwillig von sich weg. Bevor es Ansprüche auf ihre Zungen erhebt. Einmal zu lange über die Vergangenheit geredet, zack, schon sitzte bei ihr im Verhörzimmer! Aber nicht Yashka. Nein, Yashka nuckelt schon sein drittes Obolon-Bier leer und posaunt fluchend rum: »Vollgewichster KGBschnik! Und wenn schon, bljad? Wir haben das 21. Jahrhundert, nachuj! Dieses Jahrhundert klaut uns keiner! Lange wird sich der alte KGBschnik nicht an der Macht halten, bljad!«
Papa sitzt an der Kasse, nestelt an seiner Brille und antwortet nicht viel darauf. Genau genommen nichts, er lässt Yashka und das Bier reden:
»Na ja, aber dass er den Tschetschenen mal richtig Restgeld gegeben und da aufgeräumt hat, nachuj. Das war stark! Scheißmusulmanen, noch mal trauen die sich sicher nicht, Russland zu terrorisieren, bljad! Ljonja, kannst du mir noch eine Flasche Bier anschreiben? Sei ein Bruder!«
Papa schreibt für Yashka an, aber hält sich die Zunge für das neue Jahrhundert lieber unbeschrieben. Erst als Yashka rotzenstraff raustorkelt, meint Papa leise über den neuen Präsidenten: »Ein KGBschnik hat nur eine bestimmte Art, die Welt zu sehen. Nur eine Art, zu denken. Der ist immer noch im Kalten Krieg und kann richtig gefährlich werden, wenn man ihn lässt.« Als Papas Blick auf meinen triefenden Mopp fällt, plagen ihn allerdings akutere Sorgen: »Das ist viel zu viel Wasser, Dim! Du machst ja richtige Pfützen! Das ist schlecht für das Linoleum!«
Ich wringe aus und wische weiter vor dem Getränkeregal. Das nimmt auf der linken Seite fast die Hälfte der Ladenfläche ein. Die Limonaden strahlen lila, rot, grün, golden und enthalten genug Farbstoff, um ein Einhorn anzulocken. Buratino, Djujes, Rosinka, Tarjun — unser Магазин bietet sämtliche sowjetischen Erfrischungsklassiker. Ich frage mich, wie übersüßte Limonaden eigentlich ins sozialistische Weltbild passten. Ich meine, so dekadent viel Zucker, ist das nicht was für Reiche? Vielleicht kalkulierten die alten sowjetischen Präsidenten ja, dass man den Leuten ab und an eine Limo lassen muss. Weil sich sonst zu viele ungesüßte Worte in ihren Mündern stauen und irgendwann sauer herausschießen. Also ließ man die Limonade lieber in die eigene Ideologie einfließen: »Seht her, ihr abgehobenen Kapitalisten! Unsere sozialistische Limonade ist genauso süß wie eure Cola! Aber alle kriegen sie in gleichen Mengen!« Darauf konnten die kapitalistischen Präsidenten natürlich kontern: »Seht ihr, eure Limonade ist genauso süß wie amerikanische Cola! Und jeder eurer Arbeiter und Bauern träumt in den Trinkpausen vom maßlos süßen Leben!«
Hinter den Getränken kommen erst die Konservendosen und dann diverse Kühlschänke. Voller Quark und Käse und Kefir und Weißkraut (die Nashi kaufen Weißkraut wie wild, wirklich, als ob Gold drin wäre). Dann folgt die große Theke mit Fleisch und Fisch. Ich könnte schwören, dass ich die Fische manchmal mit meinen Eltern reden höre. Und dass sie dabei immer ganz frech kichern. Zu mir haben sie aber noch nie etwas gesagt. Diese Wichtigtuer … In der Mitte ist der Магазин von vier weißen Säulen durchzogen. Dick und schmucklos und auch ein bisschen unpassend unter der supersachlichen grauweißen Kassettendecke. Es ist übrigens gar nicht so leicht, um die Säulen herum zu wischen. Weil man auf ihrem Weiß sofort die hässlichen Schmutzspritzer sieht.
DING-DONG.
Der Bewegungsmelder am Eingang des Магазин schrillt. Er ist so laut eingestellt, dass man ihn noch in Kyjiw hören könnte. »Privet!« ruft Ira und schlendert gemächlich herein. Ira ist als zusätzliche Verkäuferin angestellt. Halbtags ab 14 Uhr, so ähnlich wie ich nach der Schule. Wenn Mama und Papa einen Termin haben, schmeißen wir den Магазин manchmal zu zweit. Und die Geschäfte gehen gut. Die Rede ist sogar von einem Lager, hinten in Großzschocher, für deutschlandweiten Großhandel. Bald ist der Магазин größer als die Telekom! Und das, obwohl der Bewegungsmelder sogar unsere Stammkunden regelmäßig beim Eintreten aufscheucht. Mama besteht aber auf dieser Lautstärke, damit sie auch hinten im Kabuff noch hören kann, wenn jemand reinkommt. Besonders, weil sie neuerdings russisches Fernsehen im Büro empfängt. Nicht wegen der Nachrichten und des neuen russischen Präsidenten. »Politik ist mir egal«, hat sie schon häufig gesagt. Auch nicht der fernen Wetterberichte wegen. Sondern weil sie die russischen Krimiserien so sehr vermisst. Ich persönlich finde nicht, dass die russischen Krimis allzu anders sind als die deutschen. Auch der russische Kommissar hat einen Schäferhund. Und der Schäferhund klaut ihm immer die Wurst. (Das ist lustig, weil der Kommissar die Wurst gern selbst gegessen hätte.) Fast wie ein Diktator, der einem das Jahrhundert immer ganz knapp vor der Nase wegschnappt.