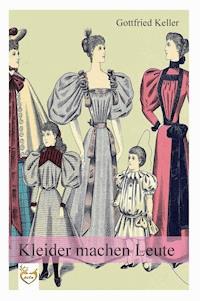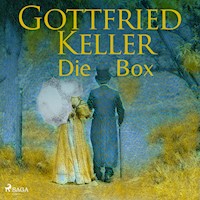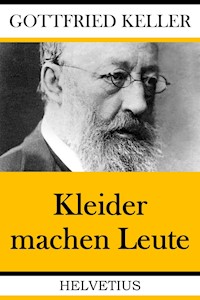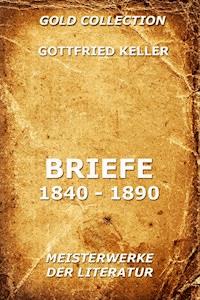Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Gottfried Keller (19.07.1819–15.07.1890) war ein Schweizer Dichter und Staatsbeamter. Man kann ohne Zweifel sagen, dass Gottfried Keller der wichtigste Autor der Schweiz im 19. Jahrhundert war. Wegen eines Dummejungenstreiches von einer höheren Schulbindung oder gar einem Studium ausgeschlossen, fand der Halbwaise über den Umweg der Lehre zum Landschaftsmaler doch noch zur Literatur. Er hinterlässt ein großes Werk an Gedichten, Dramen, Novellen und Romanen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Das verlorene Lachen
Novelle
Gottfried Keller
Das verlorene Lachen
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-93-5
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel
Drei Ellen gute Bannerseide, Ein Häuflein Volkes, ehrenwert, Mit klarem Aug, im Sonntagskleide, Ist alles, was mein Herz begehrt! So end ich mit der Morgenhelle Der Sommernacht beschränkte Ruh Und wandre rasch dem frischen Quelle Der vaterländ’schen Freuden zu. Die Schiffe fahren und die Wagen, Bekränzt, auf allen Pfaden her; Die luft’ge Halle seh ich ragen, Von Steinen nicht noch Sorgen schwer; Vom Rednersimse schimmert lieblich Des Festpokales Silberhort: Heil uns, noch ist bei Freien üblich Ein leidenschaftlich freies Wort! Und Wort und Lied, von Mund zu Munde, Von Herz zu Herzen hallt es hin; So blüht des Festes Rosenstunde Und muss mit goldner Wende fliehn! Und jede Pflicht hat sie erneuet, Und jede Kraft hat sie gestählt Und eine Körnersaat gestreuet, Die niemals ihre Frucht verfehlte Drum weilet, wo im Feierkleide Ein rüstig Volk zum Feste geht Und leis die feine Bannerseide Hoch über ihm zum Himmel weht! In Vaterlandes Saus und Brause, Da ist die Freude sündenrein, Und kehr nicht besser ich nach Hause, So werd ich auch nicht schlechter sein!
Dieses Lied sang der Fahnenträger des Seldwyler Männerchores, welcher an einem prachtvollen Sommermorgen zum Sängerfeste wanderte. Nachdem die Herren am Abend vorher aufgebrochen und einen Teil des Weges auf der Schienenbahn befördert worden waren, hatten sie beschlossen, den Rest in der Morgenkühle zu Fuß zu machen, da es nur noch durch schöne Waldungen ging.
Schon breitete sich der glänzende See vor ihnen aus mit der buntbeflaggten Stadt am Ufer, als die sechzig bis siebzig jüngeren und älteren Männer des Vereines in zerstreuten Gruppen durch einen herrlichen Buchenwald hinabstiegen und das hinter den großen Stämmen wohnende Echo mit Jauchzen und einzelnen Liederstrophen widerhallen ließen, auch etwa einem weiterhin niedersteigenden Fähnlein antworteten.
Nur der allen vorausziehende Fahnenträger, ein schlank gewachsener junger Mann mit bildschönem Antlitz, sang sein Lied vollständig durch mit freudeheller und doch gemäßigter Baritonstimme. Geschmückt mit breiter reich gestickter Schärpe und stattlichem Federhut, trug er die ebenso reiche, schwere Seidenfahne, halb zusammengefaltet, über die Schulter gelegt, und deren goldene Spitze funkelte hin und wieder im grünen Schatten, wo die Strahlen der Morgensonne durch die Laubgewölbe drangen.
Als er nun sein Lied geendet, schaute er lächelnd zurück, und man sah das schöne Gesicht in vollem Glücke strahlen, das ihm jeder gönnte, da ein eigentümlich angenehmes Lachen, wenn es sich zeigte, jeden für ihn gewann.
»Unser Jukundi«, sagten die hinter ihm Gehenden zueinander, »wird wohl der schönste Fähnrich am Feste sein.« Er führte nämlich den heiter klingenden Namen Jukundus Meyental und wurde mit allgemeiner Zärtlichkeit schlechtweg der Jukundi genannt. Es erwahrte sich auch die Hoffnung; denn als die Seldwyler, am Orte angekommen, sich zum Einzuge unter die langen Sängerscharen reihten, erregte seine Erscheinung, wo sie durchzogen, überall großes Wohlgefallen.
Denjenigen, welche schon mehrere Feste gesehen hatten, war er auch schon auf das vorteilhafteste bekannt als eine mustergültige Festerscheinung. Von steter Fröhlichkeit und Ausdauer vom ersten bis zum letzten Augenblicke, war Jukundi dennoch die Ruhe und Gelassenheit selbst; immer sah man ihn teilnehmend an jeder allgemeinen Freude und an jeder besonderen Ausführung, ausharrend und hilfreich, nie überlaut oder gar betrunken. Den schreienden Possenmacher wusste er zu ertragen wie den übellaunischen Festgast, der sich übernommen und die Freude verdorben hatte, und beide verstand er voll Duldung und Freundlichkeit aus allerlei Fährlichkeiten zu erlösen, wenn die allgemeine Geduld zu brechen drohte, und sie aus beschämendem Schiffbruche zu erretten. Selbst den bewusstlosen Jähzornigen führte er, alle Schmähungen überhörend, mit stillem Geschick aus dem Gedränge und erwarb sich Dank und Anhänglichkeit des Nüchterngewordenen.
In dieser Übung konnte er übrigens nur als eine Darstellung aller Seldwyler gelten, wenn sie zu Feste zogen. So ungeregelt und müßig sie sonst lebten, so sehr hielten sie auf Ordnung, Fleiß und gute Haltung bei solchen Anlässen. Rühmlich zogen sie auf und wieder ab, eine gut gemusterte einige Schar, solange die Lustbarkeit dauerte, und sich im voraus auf die zwanglose Erholung freuend, welche zu Hause nach so ernster Anstrengung sich langehin zu gönnen sein werde.
In dieser Weise hatten sie auch den Gesang, mit welchem sie am Sängertage um den Preis zu ringen gedachten, trefflich eingeübt und schonten ihre Stimmen mit großer Entbehrung. Sie hatten eine Tondichtung gewählt, welche »Veilchens Erwachen!« betitelt und auf irgendein nichtssagendes Liedchen aufgebaut, aber so künstlich und schwer auszuführen war, dass es schon Monate vorher ein großes Gerede gab an allen Orten, als ob die Seldwyler zu viel unternommen und sich dem Untergang ausgesetzt hätten.
Als aber der Tag der Wettgesänge vorgerückt war und in der mächtigen weiten Halle Tausende von Hörern vor fast so viel tausend Sängern saßen und das Häuflein der Seldwyler, da ihre Stunde gekommen, mit dem Banner einsam vortrat in dem Menschenmeere, da hielten sie den ebenso zarten als schweren Gesang durch alle schwierigen Harmonien und Verwickelungen hindurch aufrecht ohne Wanken und ließen ihn so weich und rein verhauchen, dass man das blaue Veilchenknöspchen glaubte leise aufplatzen und das erste Düftlein durch die Halle schweben zu hören.
Rauschend, tosend brach der Beifall nach der atemlosen Stille los, die erhabenen Kampfrichter nickten vor allem Volke sichtbar mit den Häuptern und sahen sich an, die goldenen Dosen ergreifend, Ehrengeschenke entlegen wohnender Fürsten und Völker, und sich gegenseitig Prisen anbietend; denn es befanden sich von den ersten Kapellmeistern darunter.
Die Seldwyler selbst traten mit ruhiger Haltung zurück und wussten ohne Aufsehen aus der Schlachtordnung sich hinauszuwinden, um in einem schattigen Garten ein mäßiges Champagnerfrühstück einzunehmen. Keiner begehrte mehr als seine drei Gläser zu trinken, niemand merkte, wo sie gewesen seien, als sie wieder in der Halle sich einfanden.
Dergestalt würdig verhielten sie sich während der Dauer des ganzen Festes, bis die Stunde der Preisverteilung kam. Das Gold der Nachmittagssonne durchwebte den bis zum letzten Platz angefüllten Festbau, welcher mit rotem Tuch und Grün ausgeschlagen, mit vielen Fahnen geschmückt, in feierlichem Glanze wie zu schwimmen schien. Auf erhöhter Stelle, wo die zu Preisen und Festgeschenken bestimmten Schalen und Hörner in Gold und Silber leuchteten, saßen einige Jungfrauen, auserwählt, die Kränze an die gekrönten Sängerfahnen zu binden.
Oder vielmehr dienten sie der Schönsten und Größten unter ihnen zum Geleit, der schönen Justine Glor von Schwanau, welche sich mit vieler Mühe hatte erbeten lassen, das Anbinden der Kränze zu übernehmen. Sie sah auch aus wie eine Muse; im reichgelockten braunen Haar trug sie einen frischen Rosenkranz und das weiße Gewand rot gegürtet.
Aller Augen hafteten an ihr, als sie sich erhob und den ersten Kranz ergriff, welcher soeben den Seldwylern unter Trompeten- und Paukenschall zugesprochen worden war. Zugleich sah man aber auch den Jukundus, der unversehens mit seiner Fahne vor ihr stand und in frohem Glücke lachte. Da strahlte wie ein Widerschein das gleiche schöne Lachen, wie es ihm eigen, vom Gesichte der Kranzspenderin, und es zeigte sich, dass beide Wesen aus der gleichen Heimat stammten, aus welcher die mit diesem Lachen Begabten kommen. Da jedes von ihnen sich seiner Eigenschaft wohl mehr oder weniger bewusst war und sie nun am andern sah, auch das Volk umher die Erscheinung überrascht wahrnahm, so erröteten beide, nicht ohne sich wiederholt anzublicken, während der Kranz angeheftet wurde.
Eine Stunde später ordnete sich der letzte und rauschendste Zug durch die Feststadt, unter den unzähligen Wimpeln und Kränzen und durch das wogende Volk hindurch, indem die gewonnenen Festgeschenke und die gekrönten Fahnen umhergetragen wurden. Da sahen sich die beiden wieder, als Justine von der Gartenzinne ihrer Gastfreunde aus den Zug anschaute und Jukundus vorüberziehend seine Fahne schwenkte; und am Abend ereignete es sich, da das gute Glück heute besonders fleißig war, dass Jukundus während des Schlussbankettes der Schönen am gleichen Tische gegenüberzusitzen kam, sodass sie um Mitternacht schon in aller Fröhlichkeit und Freundlichkeit aneinander gewöhnt waren.
Sie trafen sich auch am nächsten Morgen als gute Bekannte auf einem großen beflaggten Dampfboote, welches die Festregierung mit einer Zahl eingeladener Verdienst- und Ehrenpersonen und auswärtiger Freunde zu einer Lustfahrt den See entlang tragen sollte. Ein wolkenloser Himmel breitete sich über Wasser, Land und Gebirge und öffnete die letzten Quellen edler Freude, welche noch verschlossen sein konnten. Das Schiff durchfurchte das tiefgrüne kristallene Wasser, bald von den Klängen guter Musik getragen, bald von Liedern umtönt. Von den blühenden Ortschaften an den weithin sich ziehenden Ufern rechts und links schallten Grüße und winkten Fahnen herüber, und mit Stolz wies man den Gästen das wohlbebaute Land, die reichen Wohnsitze und Ortschaften. Ein stattlicher Kranz von Frauen saß auf erhöhtem Platze des Schiffes, unter ihnen Justine Glor in schöner einfacher Modekleidung, den Sonnenschirm in der Hand, sodass Jukundus, als er in seiner Fahnenträgertracht grüßend vor sie trat, überrascht von ihrem veränderten und fast noch feinern Aussehen, beinahe befangen wurde. Sie wechselten jedoch nur wenige Worte, wie zu geschehen pflegt, wenn ein reichlich langer Sommertag zu Gebote steht.
Als eine Weile später Jukundus wieder in ihre Nähe kam, winkte sie ihm und teilte ihm mit, dass ihre Eltern in Schwanau, welches am obern Teile des Sees lag, die ganze Gesellschaft auf den Abend in ihre Gärten einladen, dass das Schiff dort vor Anker gehen würde und dass sie hoffe, er werde auch so lange dabeibleiben. Diese vertrauliche Mitteilung, von der nur noch wenige wussten, trug ihm sofort Anspielungen und Glückwünsche der Umstehenden ein, die er bescheidentlich ablehnte, aber gerne vernahm.
In der Tat wurde es bald kund, dass das Schiff gegen Abend in Schwanau anhalten würde und dass alle gebeten seien, die letzte Erfrischung im Besitztume der Familie Glor einzunehmen. Dieselbe tat das der Tochter zu Ehren, um zu zeigen, dass sie wo zu Hause sei und eigentlich nicht nötig habe, an fremden Festtafeln zu sitzen, sondern selbst ein Fest geben könne. Denn es waren Leute, die auf ihre Besitztümer, als selbsterworbene, etwas viel hielten.
Um also den vielverheißenden Abend unverkürzt zu genießen, wurden die Aufenthalte an den übrigen Uferorten, wo das Schiff erwartet wurde, genau abgemessen und innegehalten, und das tönende und singende Schiff fuhr rechtzeitig quer über den funkelnden See, von Kanonenschlägen begrüßt, nach Schwanau hinüber und legte an, wo die hohen Bäume der Glorschen Gärten sich im Wasser spiegelten und darüber weg von den Terrassen und Hügeln ihre Häuser glänzten.
Während das Sängervolk sich unter den Bäumen ausbreitete, verschwand Justine im Hause, um den Ihrigen Handreichung zu tun, wogegen der Vater und die Brüder sich um die zahlreichen Gäste und deren Begrüßung bemühten. In Lauben und Veranden waren Niederlassungen für die Frauen mit den entsprechenden Erfrischungen bereitet; in einer frischgemähten Wiese, unter Fruchtbäumen, lange Tische für die Männer gedeckt. Es dauerte aber nicht lange, so waren auch alle Frauen auf der Wiese, angelockt von den Scherzen, Possen und Neckereien, welche die junge Männerwelt unter sich trieb, um ein Aufsehen zu erregen. Und es gab genug zu schauen und zu lachen, da Laune und Geschicklichkeit der einzelnen hundert kleine artige Erfindungen und Stücklein hervorbrachten, wobei das Naivste, mit guter Art entstanden, in der allgemeinen glücklichen Stimmung den herzlichsten Beifall weckte. Selbst ein unvermutet geschlagener Purzelbaum fand seine Gönner, und sogar der unglückliche Virtuose, welcher auf seinem Frisierkamm allen Ernstes eine gefühlvolle Weise hatte blasen wollen und daran scheiterte, freute sich über die ungetrübte Heiterkeit, die er erweckt, und tat den ihm aufgesetzten Strohkranz nicht mehr vom Kopfe.
Nur Jukundus fühlte sich etwas vereinsamt in dem Treiben, weil er Justinen gar zu lange nicht mehr erblickte, an die er schon ein kleines Anrecht zu haben glaubte, wenigstens für diesen letzten Tag. Indessen fand sich eine holde Erlösung, da unversehens die Jungfrau dicht bei ihm stand, ohne dass er wusste, wo sie herkam, und ihn dem Vater und den Brüdern vorstellte als den Bannerherren des erstgekrönten Vereines. Er wurde von den Männern höflich und auch freundlich gegrüßt und willkommen geheißen, aber nicht ohne jene feste kühle Haltung, welche so reiche Arbeitsherren einem nichts oder wenig besitzenden Seldwyler gegenüber bewahren mussten, insofern er etwa Mehreres vorzustellen gedächte als einen stattlichen Festbesucher.
Der gutmütige Sänger fühlte das doch augenblicklich und wurde etwas verlegen; so auch Justine, welche ihn darum zur Entschädigung weiterführte, als die Herren weggegangen, und ihm das Gut zu zeigen vorschlug.
Zwei gleichgebaute villenartige Häuser neuesten Stiles, welche zunächst dem See in den schattigen Anlagen standen, bezeichnete sie ihm als die Wohnungen der beiden Brüder, wovon jeder schon seine eigene Familie gegründet hatte, ohne deswegen aus der Gesamtfamilie auszuscheiden. Dann stieg sie mit ihm Wege und Treppen empor, bis wo über den Wipfeln der untern Bäume die Wohnung der Eltern stand, worin sie selber lebte, von etwas älterer Bauart, aber immerhin ein stattliches Herrenhaus, umgeben von Wirtschaftsgebäuden und Ställen; weiterhin sah man lange hohe Gewerbshäuser mit zahllosen Fenstern, welche an die staubige Landstraße grenzten, die hier vorüberführte. Jenseits der Straße aber, an dem ansteigenden Bergabhang, dehnten sich Äcker, Weinberge und Wiesen mit Wäldern von Obstbäumen, und hoch über allem diesem zeigte ihm Justine das Haus der Großeltern als den Stammsitz der Ihrigen, in der Abendsonne weit über das Land hin schimmernd, ein weitläufiges vornehmes Bauernhaus von altertümlicher Bauart, mit hellen Fensterreihen, weißem Mauerwerk und buntbemaltem Holzwerk an Dach und Scheunen, mit steinernen Vortreppen und künstlich geschmiedeten eisernen Geländern. Hier hausten der Großvater und die Großmutter mit ihrem Gesinde, beide achtzigjährige Landleute, beide noch täglich und stündlich schaffend und befehlend, zähe und gestrenge alte Personen von einfachster Lebensweise und stets fertig mit ihrem Urteil über alle Jüngeren, wie Justine ihrem Begleiter sie schilderte. »Wollen wir noch schnell hinaufgehen und sie grüßen, da sie es verschmähen, von ihrer Höhe herunterzusteigen und unsere Lustbarkeit anzusehen? Es ist eine herrliche Aussicht dort oben!« so sagte das Mädchen. Aber Jukundus empfand eine Art Scheu vor den Alten und dankte höflich für weitere Bemühung seiner Führerin, da ihn überdies all das ausgedehnte Wesen eher ängstigte als erfreute.
Sie kehrten daher wieder zurück und mischten sich unter die Festgenossen, die je länger, je lustiger wurden, bis im Osten der Vollmond aufging und nach dem Niedergang der Sonne hinüberschaute, sodass Rosen und Silber sich in den Lüften und auf den Wassern vermengten und das Schiff zur Abfahrt bereitet, auch bald bestiegen wurde.
Es gab ein Gedränge hiebei, da jeder den Wirten, die am Ufer standen, die Hand geben wollte, während die Schiffleute zur Eile mahnten. So kam es, dass Jukundus Meyental von seinem Vorhaben, von der schönen Justine Abschied zu nehmen, abgedrängt wurde und dem Strome folgen musste, da sie nicht am Wege stand. Freilich schüttelten auch ihm Vater und Brüder die Hand, flüchtig sprechend: »Es hat uns gefreut«, aber der eine nannte ihn Herr Talmeyer, der andere Meienberg, der dritte gar Herr Meierheim, und keiner sagte: »Auf Wiedersehen!«
Als das Schiff in den Abendglanz hinausfuhr, sah er sie auch nicht mehr, da sie mit den anderen Frauen im dunkelnden Schatten der Bäume stand.
*
Zu Hause lebte Jukundus bei seiner Mutter, deren einziger Sohn und Jukundi er war und deren große Hoffnung. Weil der Vater früh gestorben, so hatte er das von auswärts zugebrachte Vermögen der Frau nur halb aufbrauchen und sie mit der anderen Hälfte den Sohn aufziehen können; und es war auch jetzt noch etwas da, obschon er noch keinen entschiedenen Anlauf gemacht und noch wenig erworben hatte. Aber es war von ihm auch noch nichts verschwendet worden, weil er der Mutter, von welcher er seine Schönheit und Gesundheit besaß und die ihn mit Freundlichkeit liebte, leidlich gehorchte und sich von ihr leiten ließ.
Bei einem bestimmten Berufe war er noch nicht geblieben. Zuerst hatte es geschienen, dass er für technisches Wesen Neigung zeige, und er war deshalb eine Zeit lang auf die Bureaus eines Ingenieurs gegangen. Dann änderte sich aber diese Stimmung zugunsten des Kaufmannsstandes, und er trat in ein Geschäft ein, welches bald darauf aus Missgeschick sich auflöste, ohne dass er viel einbüßte; jetzt war er gerade in der Richtung, sich dem Militärwesen zu widmen, indem er sich zu einem Unterrichts- und Stabsoffizier ausbildete. Da er hiebei den größten Teil des Jahres auf den Waffenplätzen zuzubringen hatte und Sold empfing, so gewährte das für einstweilen ein stattliches Dasein, ohne dass es bei seiner mäßigen Lebensweise großen Zuschuss eigener Mittel erforderte.
Als er nun nach dem Feste in schmuckem Kriegsgewand und den Säbel an der Seite zu Pferde saß, beschaute ihn seine Mutter mit Wohlgefallen und bemerkte dabei, dass sein anmutiges Lächeln eine kleine Beimischung von Melancholie oder dergleichen gewonnen hatte. Er schien auszusehen wie einer, der irgendein Heimweh oder eine Sehnsucht aufgelesen hat. Sie dachte darüber nach und stellte auch einige vorsichtige Forschungen an, und als sie von dem Abenteuer mit der Kranzjungfrau hörte und wie er etwa von den andern damit geneckt wurde, ging ihr ein Licht auf, bei dessen Scheine sie sofort still an die Arbeit ging, um ein Glück zu schaffen, wohl angemessen und gut genäht.