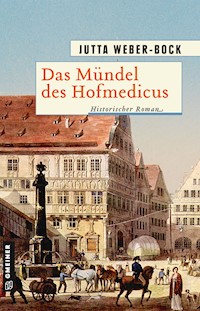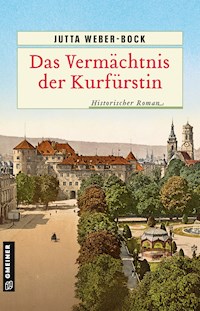
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod von Christianes Ziehvater liegt das Sorgerecht bei dessen Schwester, der Bergrätin Elisabeth Hehl. Um ihrem Einfluss zu entgehen und eine gute gesellschaftliche Stellung zu erlangen, flieht Christiane. Doch eine standesgemäße Heirat wird ihr von Elisabeth verwehrt. Als Christiane herausfindet, dass Kurfürstin Mathilde ihr eine ansehnliche Geldsumme vermacht hat, schmiedet Elisabeth einen teuflischen Plan, wie sie nicht nur an das Vermögen herankommen, sondern Christiane für immer zu ihrem Mündel machen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jutta Weber-Bock
Das Vermächtnis der Kurfürstin
Historischer Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stuttgart._Schlossplatz_mit_Altem_Schloss_LOC_ppmsca.52635.tif
ISBN 978-3-8392-7196-4
Widmung
Für meinen Mann, den Lyriker und Fotografen Wolfgang Haenle, dem ich für seinen kritischen Blick und die Fotos von den Schauplätzen danke. Er hat mich stets in meinem Vorhaben bestärkt, ohne ihn würde es auch dieses Buch nicht geben.
Vorbemerkung
Die Arbeit an diesem Projekt wurde gefördert durch ein Stipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Die Autorin dankt dem Stipendiengeber sehr herzlich.
STUTTGART
Sie war die einzige Frau in der ganzen Stadt, der es an diesem Montag in den Sinn kam, eine Chocoladentorte mit zweiundzwanzig Eiern zu backen. Sie war die Ausnahme. Elisabeth Hehl reckte sich. Sie prüfte die Eier genau und sortierte eines mit gesprungener Schale aus. Den Korb stellte sie für später in der Ecke bereit und siebte ein dreiviertel Pfund Zucker. Süß war er wie die Bruderliebe, mit der Ludwig sie als Jüngste der Schwestern überhäuft hatte. Wie er ihr immer geschmeichelt, sie vergöttert und gleichzeitig an ihr herumerzogen hatte. Sie hatte sich dagegen gewehrt und konnte sich seiner Liebe doch nicht entziehen. Es war Zeit. Befreien wollte sie sich von ihm. Nicht er sollte länger bestimmen, sondern sie hielt das Schicksal des Kindes in der Hand. Die Vormundschaft stand ihr zu. Das würde sie durchsetzen.
Entschlossen schob sie die Schüssel mit dem Zucker beiseite und schaute in den Garten. Ein heimlicher Müßiggang. Die ersten Forsythien blühten. Zu kühl war es für Mitte März, wie der Gärtner gesagt hatte, nachdem er die Tannenzweige von den Beeten genommen hatte.
Sie ging ins Wohnzimmer und öffnete das Fenster zur Straße. Über den Dächern hing eine graugelbe Dunstglocke. Der Himmel drückte auf die Häuser, raubte ihnen den Atem. Eine ungelüftete Stube jedoch ertrug sie nicht.
In der Morgendämmerung hatte sie die Milchmädchen beobachtet. Auf dem Weg vom Hohen Bopser in die Stadt hielten sie sich Schnupftücher vor die Nasen.
Wie sich Elisabeth Hehl schämte für die Residenz. Der Talkessel stank. Sie griff nach der Schürze und presste sie vors Gesicht. Montags war der Geruch aus dem Nesenbach immer besonders beißend.
Zwei Kutschen ratterten vorbei. Von der Leonhardskirche schlug es neun. Da ertönte der Ruf nach frischen Brezeln, die neuerdings von einem fliegenden Händler feilgeboten wurden. Sie winkte ihm und kaufte eine, seine waren die besten. Der Duft von Hefe und Lauge, dazu grobkörniges Salz. Sie leckte sich über die Lippen.
In einer Stunde hatte der Backofen das richtige Feuer. Heißer als sonst. Sie hatte noch Zeit und schob die Ärmel ihres blaugrünen Kleides nach oben. Diese Farbe stand ihr exzellent.
Auf der anderen Seite der Charlottenstraße rüsteten sie ein Haus ein. Das Hämmern drang ihr durch Mark und Bein. Ihr schienen die Knochen im Leib zu vibrieren. Lasten quietschten am Lotterseil, wie der Gärtner auch eines in der Küche angebracht hatte. So sei es leichter, die Töpfe aufs obere Regal zu hieven und die Kräuter aufzuhängen. Elisabeth Hehl hatte ihn gewähren lassen, wenn bloß Amalie, ihre geschätzte Köchin, nicht von der Leiter fiel.
Zur Geburt des lang ersehnten Kronprinzen hatte König Wilhelm befohlen, zwei Kastanienalleen auf dem Schlossplatz zu pflanzen. Nur bei einem Buben, das sah die Ordnung der Württemberger vor. Stattdessen hätte er die Straßen pflastern lassen können, fand sie, denn nach wie vor watete man im Dreck. Und das im Jahr 1823. Nicht mal in der Nähe des Schlosses gab es eine passable Chaussee. Nur Löcher und Pfützen. Und wie oft war sie über die Kastanien gestrauchelt.
Die Milchmädchen kehrten heute schon aus der Stadt zurück. Sie schwatzen und hatten alle Zeit der Welt. Hinter den Schnupftüchlein reckten sie die Hälse. Sie aber ließ sich nicht in diesen Montag schauen. Für das Rezept der Großmutter brauchte sie Ruhe. Etwas ganz Besonderes war diese Chocoladentorte. Ihre Gardinen blieben geschlossen, wenn auch das Fenster noch offen war. Die Linden vor dem Haus hatten immer für einen gewissen Abstand gesorgt. Jetzt waren sie weg. Die Stadt hatte die beiden Bäume absägen lassen, was nicht rechtens gewesen war, denn sie standen auf ihrem Grundstück. Gefällt für ein Trottoir. Wie lächerlich. Ein Gehsteig, damit die Spaziergänger zum Bopserbrünnlein wandern konnten. So weit war es gekommen. Stuttgart flanierte an ihrem Wohnzimmerfenster vorbei. Ihr Gatte hielt sich aus allem heraus. Reiste lieber nach Sankt Petersburg. Etzel baute eine neue Steige, und zum Glück blieb die Charlottenstraße eine Sackgasse. Sonst gäbe es noch mehr neugierige Blicke. Es war zu teuer, den Bopserberg abzutragen. Selbst ein Oberbaurat musste auf der anderen Seite des Hügels in die Stadt hinunter. Zum Wilhelmsplatz.
Die Glocken der Stiftskirche läuteten. Sie schüttelte den Kopf und zog ihre Taschenuhr aus der Kleidertasche. Beinahe zehn Minuten über der Zeit. Auf nichts war mehr Verlass. Stuttgart war eine einzige Baustelle. Zum wiederholten Mal. Nur das neue Kornhaus auf dem Leonhardsplatz wollte Elisabeth Hehl gelten lassen. Da hatte ihr Bruder ausnahmsweise recht. Als Hofmedicus lag es ihm am Herzen. Die Leute mussten satt werden, sonst wurden sie renitent. Wie unnötig diese Aufstände in der ganzen Welt! Portugal, Spanien, Griechenland. Nichts war so fern und so nah zugleich wie Unruhen. Das neue Kriegsministerium am Charlottenplatz bezeugte es. In Stuttgart hatte die Erde gebebt. Das war im November gewesen. Die Erdstöße hatten sich im Dezember und Januar wiederholt. Ein Grollen, weil keiner mehr mit der Ordnung zufrieden war? So wie sie? Aber die Dinge ließen sich nicht vergleichen. Die Gardinen bauschten sich. Sie hielt die Luft an und schloss das Fenster. Der Wind wehte den Gestank erst so richtig herein. Schnell zurück in die Küche.
»Lisbeth«, hatte die Großmutter immer gesagt, »sei nicht unachtsam. Die Chocoladentorte muss tadellos sein.«
Die Worte schwirrten in ihrem Kopf herum.
Der alte Rattler von Hofbaumeister Fischer, der seinen Herrn um zehn Jahre überlebt hatte, sprang durch ihren Garten und verbellte Amseln, statt die Ratten zu jagen, die aus dem Nesenbach krochen. Der Gärtner klatschte in die Hände. Kurz darauf stand er in der Hintertür.
»I gang dann mal, wenn Sie mich heute nicht mehr brauchen«, sagte er und reichte ihr einen winzigen Strauß Schneeglöckchen. »Sind die letzten. Es wird regnen.« Er knetete die Hände und zeigte zum Himmel, wo sich dunkle Wolken zusammenballten.
Sie strich den Rock glatt, als er endlich um die Hausecke verschwand.
»Unser Gärtner ist ein quadratischer Dickschädel von der Alb«, hatte ihr Gatte gesagt, nachdem er ihn eingestellt hatte. »Er tut nur das, was er will.«
Inzwischen war er ihr ergeben und sonst niemandem. Sie lächelte in sich hinein und hängte die Schneeglöckchen kopfüber an einer Schnur auf. Am Kräuterbalken zog sie den Strauß in die Höhe. Eine gute Idee mit dem Lotterseil. Amalie würden die Blumen gefallen zwischen Peterling und Dill. Die Köchin hatte frei bis zum Nachmittag.
Ein dreiviertel Pfund Mandeln rieb Elisabeth Hehl nun in eine irdene Schüssel. Flink musste jetzt alles gehen. Wie bei der Großmutter. Ihr fiel eine Haarsträhne ins Gesicht. Sie hielt inne, ging in den Öhrn und warf einen Blick in den Spiegel. Ordentlich sah sie aus und aufrecht stand sie da. Das hätte der Großmama gefallen. Wenn nur die eine Haarsträhne nicht so widerborstig wäre. Eine neue Angewohnheit. Sie strich diese zurück ins Haarnest. Rötlich schimmerte sie und wollte nicht folgen. Schon wieder hing sie ihr im Gesicht. Sie griff nach der Schere. Das hätte sie längst tun sollen. Ritsch. Jetzt hatte sie Ruhe. Nein, sie würde nicht mehr in den Spiegel schauen. Von der Leonhardskirche läutete es zehn.
Sie nahm den Korb mit den Eiern. Sanft schlug sie die erste Schale an einer Porzellantasse auf, eine scharfe Kante war wichtig. Sie roch am Ei. Einige Mal war die Köchin bei der Auswahl auf dem Wochenmarkt nachlässig gewesen. Sie schwätzte zu gern und war übermütig, wenn auch in anderen Dingen als dieses Kind, das sogar Schläge nicht gebessert hatten. Jetzt war es bald neunzehn. Mehr als zehn Jahre hatte sie es mit ihm versucht. Es aus dem Haus zu weisen, war die einzige Möglichkeit gewesen. In der Fremde musste es sein Brot verdienen, das hatte sie eingefädelt. Das Kind würde sehen, wie mühsam die Ehre zu bewahren war.
Zweiundzwanzig Eier schlug sie auf, trennte sorgsam das Gelbe vom Weißen. Leicht ging ihr das von der Hand. Wenn es bei Ludwig nur auch so einfach wäre. Er stellte sich dagegen, das Kind aus der Residenz zu verbannen. Vermitteln wollte er. Sie aber hatte längst Tatsachen geschaffen. Zwei Monate zu spät kam er, nicht nur, um seinen Geburtstag mit ihr zu feiern. An einem Montag. Sie schüttelte den Kopf. Nichts war, wie es sein sollte.
Mit dem breiten Holzlöffel in beiden Händen rührte sie Zucker, Mandeln und Eigelb. Hundert Mal hatte ihr die Großmutter eingeschärft. Nicht mehr und nicht weniger. Vor zwei Jahren war sie selbst nicht gewissenhaft genug vorgegangen, als sie die Chocoladentorte für das Kind gebacken hatte. Doch hatte nicht die Köchin das Malheur zu verantworten gehabt? Diese hatte die Torte damals in der Sonne stehen lassen, bis die vielen Eier sie ungenießbar machten. Wäre das Kind nicht derart gierig gewesen, hätte es sich nicht den Magen verdorben. Es war ganz allein schuld. Sie rührte rechtsherum, wie die Großmutter es wollte, bis die Masse cremig war und gelb leuchtete wie ihr Haus.
Alle sollten sehen, wo sie residierte. Nicht so groß wie das von Ludwig war ihr Heim, aber es hatte einen Garten. Er hatte sich als Hofmedicus ein Anwesen auf der Königstraße gekauft. Ihres lag außerhalb der alten Stadt, die längst über sich hinausgewachsen war. Wie sie, als sie das Kind damals zu sich genommen hatte. Eine selbstlose Mutter war sie immer gewesen, untadelig. Das Wichtigste.
»Lisbeth, denk an die Chocolade. Nicht naschen!« Die Großmutter. »Lass das nach! Du brauchst ein halbes Pfund, pulvrig gerieben. Stauben muss es. Was hustest du? Eine Hausfrau atmet nicht, bis die Torte im Rohr ist.« Großmamas Stimme kreiste um den Herd. Wie sie es hasste, mit Lisbeth angeredet zu werden. Genau so nannte sie der Bruder, und immer lag ein Vorwurf darin.
In einen alten Topf, den sie zum Blumengießen im Garten benutzte, füllte sie drei Finger heißes Wasser aus dem Wasserschiff. Sie gab die Zitrone hinein und bürstete sie. Ein halbes Vermögen hatte sie gekostet. Das war ihr der Bruder wert. Ludwig würde sogleich einsehen, dass das Kind in der Fremde trefflich untergebracht sein würde.
Sie verteilte die abgeriebene Zitronenschale auf der Chocoladenmasse und hob sie vorsichtig unter. Ein wenig mussten sie jetzt beide ruhen. Aber nicht zu lange. Sie setzte sich auf den Hocker und aß die Brezel, dick mit Butter bestrichen. Angewidert wischte sie sich die Hände an der Schürze ab. Wie konnte sie nur! Sie lauschte und sprang wieder auf. War da nicht ein Geräusch? Der Wind, redete sie sich ein. Ein Lot Zimt brauchte sie. Exakt abgewogen. Nicht atmen. Sie schüttete ihn auf die Chocolade. Er klebte fest. Die Waage pendelte leer aus.
»Sei sorgsam beim Würzen.« Wieder die Großmutter. Zusammen mit den Mandelresten zerstieß Elisabeth Hehl zwölf Gewürznelken im Mörser und nickte vor sich hin. So musste man auch mit den Widerworten des Kindes umgehen. Das Stärkemehl. Ein achtel Pfund. Die Waage brauchte sie dafür nicht. Es konnte weniger sein. Wie die Butter bei der Brezel.
Ludwig war ihr Bruder. Er wollte dieses Kind als eigenes anerkennen. Niemals durfte das geschehen. Oder war es wahrhaftig seine Tochter? Wie immer es sich verhielt, wenn er nicht von seinem Vorhaben abließ, musste er es büßen. Mit einem Soldaten hatte sich das Kind eingelassen. Es konnte nicht weiter in der Stadt bleiben. Ihrer aller Ehre! Ein Name stand ihm nicht zu. Sie schlug mit der flachen Hand auf den Herd, verbrannte sich um ein Haar. Die Chocolade war in diesem Jahr kräftiger als sonst, beinahe schwarz. Das hatte seinen Preis. Sie zahlte ihn gerne. Für ihren Bruder war ihr nichts zu teuer. Er würde einsehen, dass es geschickt war, was sie eingefädelt hatte. Morgen würde das Kind erfahren, wohin es zu gehen hatte. Es gehörte ihr. Ludwig sollte sich nicht einmischen.
Sie holte das Häfele mit den Zibeben und nahm aus der hinteren Küchenlade das Gewürz der Großmutter. In einer alten Tasse vermischte sie reichlich davon mit Stärkemehl und gab es in den Teig. Sie rührte links um. Damit stellte sie sich gegen Großmama. Tadellos musste alles mit dem Gewürz vermengt sein. Unter dem Ausguss saß eine Ratte. Sollte sie dortbleiben. Von der Stiftskirche erklang das Mittagsläuten. Zu spät, wie sie. In der metallenen Schüssel schlug sie das Eiweiß mit dem Schneebesen. Sie nahm eine Handvoll Zibeben und verteilte den Eischnee. Nicht die Chocoladenmasse berühren. Das mochte der weiße Schaum nicht. Sie hob ihn mit einem Holzlöffel unter, aß eine Rosine und drückte die restlichen Weinbeeren oben in den Teig. Für die Ratte waren sie zu schade. Die würde sehen, was sie davon hatte, so gierig zu sein. Wie das Kind. Sie sah es vor sich, wie es die Arme um den Leutnant legte und den Mund zum Kuss darbot. Schluss!
Ins Backrohr. Heiß, so heiß war es. Ein paar Jahre in der Fremde, bis das Kind volljährig war, dann würde sie es an einen Bauern oder Handwerker verheiraten. Ihre Verwandtschaft war groß. Da fand sich immer ein Witwer und sie behielt es unter Kontrolle. Zuerst aber strebte sie danach, es korrekt zu erziehen. Sie wollte das Beste. Und da würde Ludwig ihr nicht dreinreden. Das Kind sollte annehmen, sie habe die Hand von ihm abgezogen, später würde es umso bitterer sein.
Eigenhändig fegte sie und räumte die Küche auf. Der Köchin musste sie mehr auf die Finger schauen, diese Fettreste waren unerträglich.
Um drei röstete sie die Kaffeebohnen. Pünktlich ritt ihr Bruder auf seinem Mecklenburger vor. Er brachte einen Wolkenbruch mit. Der Gärtner hatte recht gehabt. Sie strich den Rock glatt und wollte die Haarsträhne hinters Ohr schieben, aber da waren nur noch Borsten. Ludwig stand schon im Öhrn, er musste wieder einmal den Hintereingang genommen haben. Und wie sah sie denn aus? Ein Loch in der Frisur, der Spiegel lachte. Dem würde sie es zeigen. Die Wut brodelte in ihr. Mühsam bezähmte sie sich.
»Lisbeth! Ich hab dir Wasser vom Schwefelbrünnele mitgebracht. Du weißt, jeden Tag ein Glas. Es wird dich kühlen. Du bist erhitzt. Das tut dir nicht wohl.«
Er kämmte mit den Fingern seine dunkelblonden Haare, um die sie ihn immer beneidet hatte, nach hinten und strich ihr über die heiße Wange.
»Ich bin auf dem Sprung, ein Blasensteinschnitt. Verzeih, ich habe es anders versprochen.« Sanft berührte er ihre Schulter. Sie hielt still, obwohl sie sich am liebsten geschüttelt hätte.
»Komm erst mal rein. Es gibt Chocoladentorte, sie ist wie immer mein einziges Geschenk.« Sein weißes Halstuch war verrutscht. »Riechst du die Kaffeebohnen? Und die Chocolade? Exquisit ist sie dieses Mal.«
»Wie ich höre, pfeift der Kessel mit dem Kaffeewasser. Weil du es bist und ich es versprochen habe.«
»Mach es dir im Salon gemütlich, ich bringe uns den Kaffee.«
Sie stellte die Tassen ab, als sie zurückkam, und zündete die Lampe an. Die hellgrauen Vorhänge zupfte sie zurecht.
Ludwig rührte im Kaffee und schaute dann auf. »Hol mir dein Schreibzeug. Nanette darf sich von nun an ›von Klein‹ nennen, wie angekündigt. Ich schreibe ihr ein Anerkenntnis. Du sollst es sehen, ich will mit dir im Einvernehmen leben.«
»Das ist auch mein Name, ich bin eine geborene von Klein und eine verheiratete von Hehl. Ich habe das Kind aufgezogen. Mich seiner erbarmt. Niemals darf es diesen Namen erhalten.« Unsanft stellte sie die weiße Tasse mit dem Goldrand ab, stand auf und ging zu ihrem Schreibschrank. Der bauchige Korpus des Sekretärs glänzte goldbraun im Schein der Lampe. Sie strich über die schwarzen Ebenholzleisten. Von draußen drang gedämpft das Wiehern der Pferde und Brägeln der Kutscher herein. Der Regen rauschte. Sollte er alles wegspülen.
»Lisbeth, ich gebe ihr meinen Namen. Sie wird abreisen, wie du es vorgesehen hast. Ich weiß Bescheid. Du hättest es Schneidermeister Welsch nicht anvertrauen dürfen. Du kennst ihn. Es scheint mir das Beste, wenn Nanette die Stadt verlässt. Du hast recht. Ich werde sie allerdings nicht allein reisen lassen. Bei der Taufe des Kronprinzen am Freitagvormittag muss ich zugegen sein, die Kutsche nach Ulm geht zum Glück erst am Abend. Und mit Freuden habe ich vernommen, dass der Baron vom Stein zu Rechtenstein sie in den Dienst nimmt. Wir kennen uns aus Hohenheim. Ich habe seine Frau entbunden. Leider sind Mutter und Tochter gestorben. Das kann auch ich manchmal nicht verhindern.«
»Ich werde es unterbinden, dass du dem Kind ein Anerkenntnis ausstellst. Du bist mein Bruder. Es ist lediglich dein Mündel. Mehr nicht. Vertrau es mir gänzlich an.«
»Du hast dir Nanette längst unter den Nagel gerissen und verweigerst ihr trotzdem deinen Namen. Der Baron vom Stein zu Rechtenstein hat mir geschrieben, er freue sich auf Mademoiselle Hehl. Was hast du vor? Warum erkennst du sie nicht als Tochter an? Der Bergrat wäre entzückt. Das hat er mehrfach betont. Nanette hätte damals bei den Pfarrersleuten bleiben sollen. Du jedoch wolltest dich mit ihr schmücken wie mit einer Puppe. Ich habe seinerzeit nichts dagegen gesagt, um dich als meine Schwester nicht zu kompromittieren. Du hattest keinen leichten Start ins Leben, man muss dir vieles nachsehen. Das hat mir die Mutter erzählt. Die Sterne bei deiner Geburt standen misslich. Wein und Getreide gerieten nicht und das Obst verfaulte am Baum. Die magnetischen Schwingungen waren nicht günstig. Das weiß ich heute. Als du auf die Welt gekommen bist, war ich vier, eine Eule hätte unentwegt geschrien und die Hunde hätten geheult. So unsere Mutter. Sie hat inständig darum gebeten, dass ich mich deiner annehme. Das Blut ist dir bereits als Kind oft in den Kopf gestiegen. Gib mir das Schreibzeug. Du willst es ja nicht tun. Mein Leben lang habe ich mich bemüht, dich zu verstehen und zu lenken. Es ist unmöglich, und mir ist es genauso unheimlich wie damals die unselige Konstellation, als du auf die Welt gekommen bist.« Er deutete zum Sekretär.
Sie rang nach Luft. Ihr Bruder hielt ihr ein Fläschchen mit Riechöl hin und strich ihr über den Rücken. Früher hatte es sie beruhigt, heute rasselte ihr Atem. Er wollte es nicht hören, nahm stattdessen einen Rosenquarz aus der Sammlung ihres Mannes und wog ihn in der Hand.
»Lisbeth, sei milde mit Nanette wie ich mit dir. Du brauchst nicht nach Luft zu schnappen. Ich kenne dich. Asthma hast du nicht, bescheinigt habe ich es dir nur, damit du Ruhe gibst. Mach nachher einen Spaziergang zum Bopserbrünnlein. Der Regen soll nachlassen.«
Sie zog den Vorhang beiseite und öffnete das Fenster. Feuchter Wind strich herein. Tief atmete sie ein und hustete sogleich. Das hatte Ludwig davon. Er streckte die Arme nach ihr aus. Sie ging zu ihm und ließ sich wie früher trösten. Sie genoss seine Nähe und hasste sich dafür.
»Willst du dich nicht einer magnetischen Kur unterziehen? Wie ich sehe, hältst du nichts davon. Trotz alledem, du hattest Glück mit deinem Schicksal.«
»Das gibt es nicht. Ich verfüge über mein Leben und bestimme es. Lisbeth nennst du mich, das war nie ein Kosename, sondern ist bis heute immer Schelte und Vorwurf. An meinem Schicksal, wie du sagst, bin ich unschuldig. Und jetzt gibt es Chocoladentorte.«
»Erst schreibe ich das Anerkenntnis für Nanette. Sonst habe ich keine Ruhe. Gib mir die Eisengallustinte und das schwere Papier. Es ist ein Documentum.«
Sie öffnete den Sekretär, zögerte und wandte sich um. »Lass es mich bitte bezeugen. Damit alle es für wahr halten.«
»Ich war sicher, du wirst einlenken. Wir beide wollten immer das Beste für Nanette.« Er nickte in sich hinein, als ob er sich seiner Worte vergewissern müsse, und tauchte die Feder in die Tinte.
Mit Schwung setzte er die Buchstaben aufs Papier. Sie legte die Hände auf seine Schultern und sah zu, was er schrieb. Ungeheuerlich. Das stellte alles auf den Kopf.
Ludwig erhob sich und wies auf den Hocker vor dem Schreibschrank. Sie setzte sich umständlich und las noch einmal, was er für sie aufs Papier gesetzt hatte:
Hiermit bezeuge ich, dass Christiane eine natürliche Tochter meines Bruders ist, des Hofmedicus Ludwig von Klein. An ihrer moralischen und sittlichen Bildung besteht kein Zweifel.
»Unterschreib mit deinem vollen Namen. Bezeuge die Worte. Sie entsprechen nicht der Wahrheit, sind aber nützlich.«
»Und was ist die Wahrheit?«
»Die kann ich dir niemals anvertrauen, das habe ich geschworen.«
Elisabeth Hehl unterzeichnete und schob das Blatt von sich. Sollte die Tinte trocknen. Niemand würde je lesen, was geschrieben stand. »Du hast recht, lieber Ludwig. Das Kind braucht ein Anerkenntnis, wie hatte ich das in Abrede stellen können. Die Worte auf dem Dokument werden es auf einen anständigen Weg bringen.«
»Komm her. Ich muss dich abhorchen. Mir scheint, deine Atemwege sind verschleimt.« Er öffnete seine Doktortasche und holte sein neues Stethoskop heraus.
Sie stand vor ihm und ließ es geschehen, dass er die Röhre aus Holz auf ihren Busen setzte. Sie unterdrückte ihre Atemzüge. Er sollte nicht merken, wie aufgeregt sie war. Wie gut, dass er sie nicht berührte. Aus seiner Tasche lugten seitlich die Spielkarten heraus.
Ludwig nahm das Ohr von der Ohrplatte und sagte: »Amalie soll dir zu gleichen Teilen aus Huflattich und Lindenblüten einen Tee bereiten. Er wirkt krampflösend und beruhigend, was du brauchen kannst.« Er steckte das Hörrohr zurück in die Tasche.
»Warte. Sicher wolltest du mir die beiden Spielkarten geben.« Sie deutete auf die Doktortasche. »Als Erinnerung an das Kind. Den Tee werde ich brav trinken. Mit Honig. Er wird guttun. Ich danke dir. Überlass mir Herzsieben und Ecksteinsieben. Sie werden mir ein Trost sein.«
Ludwig schüttelte den Kopf. »Sie gehören der Kartenmalerin. Dein Gatte wird sie Gräfin Jenison geben.«
»Du kannst sie hierlassen. Ich händige sie ihm aus. Versprochen. Bis dahin kann ich sie ein wenig anschauen. Was hast du da für ein entzückendes Tüchlein? Zeig mal! Sieht edel aus, die Stickerei.« Sie streckte die Hand aus, aber Ludwig klappte die Tasche zu und stellte sie neben sich. Für den Blasensteinschnitt führte er stets ein Skalpell, eine Sonde und eine Steinzange mit sich. Nie verließ er das Haus ohne seine Instrumente. Und in dem Etui brachte er auch alles unter, was niemand zu Gesicht bekommen sollte. Wie die Spielkarten. Hinzugekommen war dieses Tüchlein, das sie gern näher angeschaut hätte. Blumenranken, wie sie die Königinwitwe anfertigte und jeden damit beschenkte. Sie bezwang sich, nicht mit dem Fuß aufzustampfen. Womöglich bekam sie einen richtigen Asthmaanfall. Der Bruder hatte sie von Anfang an durchschaut, gleichwohl bestärkte er sie in ihrem Gebrechen, weil er sonst sein eigenes Versagen bei ihrer Erziehung und bei der des Kindes hätte zugeben müssen. Dieses musste dienen lernen in der Fremde und durfte keine Freude mehr haben im Leben. Warum sollte es ihm besser ergehen als ihr? Ahnte Ludwig, wie er ihr Stunde um Stunde, Tag für Tag und alle Jahre vergällt hatte? Zuckersüß war die Torte, im Gegensatz zu seinen Erziehungsmaßnahmen an ihr, das führte ihm seine Schuld vor Augen. Wenn er sie geschlagen hätte, wäre es einfach, ihm zu verzeihen. Doch immer hatte er Verständnis gehabt für alles und ihr Einsicht abverlangt. Wie jetzt.
Sie eilte in die Küche. Einen Moment blieb sie am Fenster stehen und schaute in den Garten. Durch den Regenvorhang sah sie, wie die Wege beim Rondell mit den Rosen strahlenförmig in einem Punkt zusammenliefen. Es war der richtige Tag.
Sie öffnete die Speisekammer. Die Chocolade entfaltete ihre Wirkung langsam. Alle Zutaten mussten trefflich durchziehen. Die Menge machte es. Lächelnd ging sie zurück in den Salon und hielt sich aufrecht. Sie setzte die Teller auf dem Tisch ab und strich das Häkeldeckchen glatt, das vom Kind vor Jahren bestickt worden war und recht stümperhaft anmutete. Dicht neben Ludwig ließ sie sich nieder.
Er stellte die Tasche an der anderen Seite des Sofas ab. »Lisbeth. Die Sahne ist gut gemeint, aber meine Leber. Lass uns tauschen.« Er schob ihr seinen Teller hin und nahm dafür ihren. »Superb, dass du dich durch nichts abbringen lässt, diese Chocoladentorte zu backen. Verzeih, dass es dieses Jahr gedauert hat, bis ich Zeit gefunden habe.«
»Jetzt habe ich dir extra das große Stück aufgelegt. Hast du zu Mittag gespeist? Wie ich sehe, hast du es dir versagt.« Sie vertauschte die Teller wieder. »Lass die Sahne liegen. Du hast recht, die Torte ist schwer genug. Und die schwarze Katze wird sich freuen. Ein schmales Stück gönne ich mir dieses Mal, das große darf ich nicht. Die Kleider sind im Winter arg eng geworden. Ach, was rede ich. Lass es dir schmecken.« Sie begann zu essen und lehnte sich genießerisch zurück. Ludwig griff erst nach seiner Gabel, als sie ihren Teller bis auf den letzten Krümel geleert hatte.
»Hmm! Dieses Jahr schmeckt die Chocoladentorte ausgesprochen deliziös!« Er nahm einen großen Bissen. »Du hast recht mit dem Mittagessen. Ich nehme gern noch ein Stück. Hol dir auch eines.« Er tätschelte ihre Hand.
Als sie zurückkam, hatte er die Vorhänge aufgezogen und die Lampe gelöscht. Es klarte auf. Sonnenstrahlen tauchten den Salon in ein freundliches Licht.
Sie setzte sich, nahm einen Schluck vom Kaffee und aß. Auch Ludwig langte zu. Kurze Zeit später hielt er ihr den leeren Teller hin. »Wie früher als Bub, dein Lächeln. Du sollst noch etwas haben.« Sie drohte ihm scherzhaft mit dem Finger. Mit seinem Teller kehrte sie flugs zurück in den Salon. Ihren hatte sie in der Küche gelassen, was ihm nicht auffiel.
Er nahm die Kuchengabel. Verstohlen beobachtete sie ihn und legte das Zeugnis auf den Tisch. Keinesfalls durfte er es mitnehmen. Und sie brauchte die Spielkarten sowie das Tüchlein aus seiner Tasche. Was hatte es damit auf sich?
»Habe ich jetzt die ganze Torte gegessen und nichts für dich übrig gelassen?«, fragte Ludwig auf einmal.
Sie lächelte und legte den Kopf schräg. Das mochte er. »Es freut mich von Herzen, dass sie dir geschmeckt hat. Sie sei dir gegönnt. Ich kann gut darauf verzichten. Keine Sorge, es gibt noch einen Rest.«
Von der Leonhardskirche schlug es halb vier. In diesem Augenblick schaute die Köchin zur Tür herein. Zu früh. Das war ihr ausnahmsweise recht. Sie winkte sie zu sich. »Amalie, bringen Sie uns bitte vom Kaffee. Er ist warm gestellt.«
»Sehr wohl, Frau Bergrat. Ich nehme die Tassen gleich mit.« Sie sprang herbei, wie es ihre Art war. Die dicken Zöpfe flogen ihr um den Kopf. Wie konnte sie solch feste Haare haben und so spindeldürr sein? Wenn sie nicht diese rosigen Wangen hätte, sähe sie aus wie ein Geist.
Die Köchin beugte sich über den Tisch. »Lassen Sie nur, Amalie. Ich muss eilen, mein Patient wartet.« Ludwig stand auf und nahm seine Tasche.
Elisabeth Hehl schnellte in die Höhe. Wie zufällig stieß sie mit der Köchin zusammen. Ludwigs halb volle Tasse ergoss sich über das Zeugnis. Er langte nach dem Papier. Seine Tasche fiel zu Boden.
Mit dem Fuß schob Elisabeth Hehl diese hinter das Sofa und herrschte die Köchin an. »Passen Sie doch auf! Warum sind Sie in der letzten Zeit immer derart ungelenk? Und nehmen Sie das mit, das lässt sich nicht mehr brauchen!«
»Lisbeth, ist ja gut. Das macht nichts. Ich schreib es noch mal und gebe es Nanette am Freitag. Du kannst deine Worte auf einem separaten Bogen niederlegen. Pack bitte den Rest von der Torte für Lotte ein. Sie schimpft jedes Jahr, dass ich ihr nichts mehr davon mitbringe, wo sie doch meine liebste Tochter sei. Schick Amalie in die Königstraße.«
Ludwig bückte sich, nahm seine Tasche und schaute sie eindringlich an, bevor er ging. Anders als Lotte hatte er sie sich nicht zum Medium machen können. Sie hatte sich gewehrt gegen sein Mesmerisieren, mit dem er sich ins Abseits stellte, und dies nicht allein bei seinen Arztkollegen. Sein Blick war ihr immer unheimlich gewesen. Wenn er aber tatsächlich hinter die Dinge schauen konnte? Er liebte seine jüngste Tochter mehr als sie, seine jüngste Schwester. Das würde Lotte büßen.
Was er sich mit dem Anerkenntnis da erdacht hatte. Wie sie sich die Großmutter ersonnen hatte. Darin waren sie sich gleich. Sie malten sich beide etwas aus und hielten es für die Wahrheit. Ihr blieben vier Tage bis zur Abfahrt der Kutsche, um die Spielkarten und das Tüchlein zu erlangen.
Die Tür fiel ins Schloss. Sie eilte in die Küche. Die Köchin stand vor dem Herd. Das Anerkenntnis hielt sie in der Hand. Kaffee tropfte auf den Boden.
»Amalie, schaffen Sie Ordnung. Werfen Sie den Fetzen ins Feuer. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Mein Bruder hat recht. Das macht nichts. Wenn ich Sie nicht hätte.« Elisabeth Hehl tätschelte ihr den Rücken. Ausgesprochen nett würde sie fortan zu Amalie sein. Die Köchin konnte, wie der Gärtner, ganz anstellig sein. Das wollte sie sich zunutze machen.
»Bringen Sie bitte das Stück Torte hier in die Königstraße. Für meine liebste Nichte. Sie haben gehört, was der Hofmedicus gesagt hat. Geben Sie es Lotte heimlich. Die Schwägerin wird dagegen sein. Das Kind ist ja so empfindlich. Das bisschen wird ihm aber nicht schaden. Eilen Sie. Sie wissen, wo die Familie von Klein residiert. Was schütteln Sie den Kopf? Haus Nummer zweiundfünfzig in der oberen Königstraße. Merken Sie sich das endlich!«
SCHLOSS BRANDENBURG AN DER ILLER
1
Fanny Marika, die Baronesse vom Stein zu Rechtenstein, kraulte ihrem Araberhengst die Ohren und legte die Wange an seinen Hals. Der Schecke schnaubte. Ein Geschenk ihres Vaters. Sie wandte sich um. Schloss Brandenburg lag am Steilrand gegen die Iller auf einem Bergvorsprung. Der Fluss nagte beständig am Fuße des Abhangs wie sie an der Sehnsucht nach Stuttgart. Zwei Wegstunden waren es bis Ulm, wenn es kein Hochwasser gab. Von einer alten Burg war der Götzengraben geblieben. Er zerriss den schmalen Bergrücken. Jeden Morgen sprang sie mithilfe eines Stocks hinüber. Der Vater durfte es nicht wissen. Sein Wolfshund aber wusste alles. Er folgte ihr auf Schritt und Tritt in gebührendem Abstand. Niemandem erlaubte er es, ihn anzufassen.
Aus der nahe gelegenen Mineralquelle holte sie vom Sauerwasser. Es stank nach faulen Eiern. Sie kniff die Nase zu. »Jeden Tag musst du davon trinken. Es ist gesund, sagen die Bauern.« Die Köchin hatte ihr den Becher hingehalten und sie hatte gehorcht. Elsa hatte sie aufgezogen, nachdem die Mutter gestorben war.
In Stuttgart hatten die Heiratsbewerber sie Männin geschimpft. Keiner wollte sie. »Die Stammlinie derer vom Stein zu Rechtenstein ist in Gefahr. Fanny Marika, nimm Vernunft an«, hatte der Vater ihr vorgehalten. »Du bist fünfundzwanzig und von Adel. Deine Bestimmung kennst du.« Trotz alledem hatte er ihr den Wunsch nicht abgeschlagen und ein Pferd geschenkt, das sie jetzt in einen lockeren Trab brachte. Bis zum Sulzhof ritt sie und zog eine Schleife gen Regglisweiler. Die Landstraße nach Leutkirch schnitt den Ort in ungleiche Teile. Er war zerrissen wie der Bergrücken vom Götzengraben – und wie sie. Dabei konnte sie nicht nur Pferde striegeln, sondern auch leidlich sticken. Kochen für den Hausgebrauch hatte sie gelernt und geschickt im Heuwenden war sie.
Sie schnalzte mit der Zunge und lenkte Casanova, wie sie den Gescheckten genannt hatte, zum Schloss zurück. Wie ein Mann ritt sie auf deutsche Art.
»Monsieurmadame!«, hatte sie ihr Französischlehrer in Hohenheim gerufen. Er hatte sie mit zehn in seine Familie aufgenommen und ihr ein Zuhause gegeben. Seine Frau hatte sie wie die eigenen Kinder bemuttert.
Der Vater hatte sie in die Heimat seiner Vorfahren gebracht, um sie zu vermählen. Die Witwe Rindsmaul, eine verheiratete Fugger, hatte Konkurs gemacht. Schloss Brandenburg war günstig gewesen. Sie waren von Adel, reich waren sie nicht, wie die Rechnungsbücher zeigten.
Der Vater plante, auf Viehzucht umzustellen, sie durfte den Bauern nichts davon sagen. In England sah er sich um nach neuen Rinderrassen. Das gab ihr eine Atempause. Sie wollte nicht über sich bestimmen lassen. Im Damensitz auf dem Pferd? Sie schüttelte den Kopf. Casanovas Hufe flogen, wenn sie ihm wie ein Mann die Sporen gab. Ihren Besitz konnte sie auf diese Weise an einem halben Tag durchmessen und nach den Blachfeldern schauen. Das Wintergetreide war aufgeschossen und glänzte grün im Sonnenlicht. »Anfang Juli können wir den Emmer ernten«, hatten die Bauern gesagt. Nächste Woche wollten sie das Sommergetreide ausbringen. Hirse, das sei ihr hoffentlich recht. Sie hatte genickt, kannte sich nicht aus.
Im Schritt ließ sie das Pferd zur Schlossanlage hochsteigen. Die Zinnenmauer bröckelte. Der Vater wollte es nicht sehen. Sie hatte ihn mehrfach darauf hingewiesen, er hatte abgewunken. Sie wohnten im Herrensitz, das zählte für ihre Verheiratung. Nicht der Nebel im Tal oder die Nachtfröste im Frühjahr. Vor Hagelschlag müssten sie sich nicht fürchten, hatten die Einheimischen ihr erzählt. Und zum Glück auch nicht mehr vor dem dicken Friedrich, der im Herbst sechs Jahre tot war. Kaum hatte er die Königskrone getragen, verkaufte er das Land samt Untertanen an Bayern. Später hatte er es sich wieder einverleibt. Das Schloss war in Fugger’schen Händen geblieben. Giacomo Casanova schrieb derweil in Böhmen seine Memoiren. Der erste Band war auf Deutsch erschienen. Sie würde ihn nie lesen dürfen.
Sie klopfte dem Schecken auf den Hals. »Gib niemals auf, Casanova«, flüsterte sie. »Griechenland kämpft um die Unabhängigkeit. Die Welt geht dahin und mit ihr die Säulen der Antike, auf denen das Abendland gebaut ist.« Sie legte die Wange auf die Mähne und ließ sich kitzeln.
»Eine Stunde breit ist das Illertal hier bei Dietenheim. Es erweitert sich beständig gen Norden zu.« Die Worte ihres einheimischen Kutschers bei der ersten Rundfahrt vor einem Jahr fielen ihr wieder ein: »Der Fluss mäandert und verzweigt sich, umfließt Inseln und Kiesbänke. Kein Durchkommen ist zwischen den Buschhölzern. Die Ufer sind mit Griesen bewachsen.«
Welch ein Wort für Gras. Sie würde sich daran gewöhnen. Wie an den Kutscher. Baldur stand ihr nach dem Willen des Vaters als Diener und Gärtner zur Seite. Wenn ein Mann im Haus sei, könne er beruhigt seinen Geschäften nachgehen. Mit diesen Worten war er davongeritten. Tags darauf hatte Baldur ein vierzig Pfund schweres und mannslanges Hechtweib zum Schloss hochgeschleppt. Heimlich aus dem Wasser gezogen. Der Hecht gehörte Bayern und würde umso besser munden. Elsa hatte mit der Zunge geschnalzt, den Rogen gewürzt und ausgebraten. »Eine Delikatesse.«
An diesem Tag hatte Fanny Marika sich zu den Bediensteten an den Tisch gesetzt und sie auf das Du als Anrede verpflichtet. Sie wollte Geschwister wie in Hohenheim in der Familie ihres Französischlehrers.
Marie, ihre blutjunge Magd, hatte bloß auf ihren Teller geschaut. »Marie, sei nicht so scheu! Ich werde dich Maria Marie nennen, wie meine Puppe. Baldur, erzähl uns, was du über die Hechte weißt.«
»Sie schrecken vor den eigenen Artgenossen nicht zurück«, sagte er. »Bedenken Sie das, werte Baronesse. Lassen Sie uns, wo wir sind. Mit Elsa ist es anders.«
»Auch für dich bin ich Fanny Marika«, hatte sie geantwortet. Er war zehn Jahre älter als sie, ein großer Bruder. Sie würde ihn lehren, sich so zu betragen.
Baldur aber hatte seinen kastanienbraunen Lockenkopf geschüttelt. »Stellen Sie sich vor, werte Baronesse, der Magen eines Hechts ist oft voller Fischschuppen. Einmal habe ich sogar eine Teichralle gefunden. Bedenken Sie, was Sie da von uns verlangen.«
Ihre Gabel war zu Boden gefallen. Vor dem Vogel ekelte sie sich nicht, doch mit seiner Weigerung verwies Baldur sie auf ihren Platz, nicht umgekehrt, wie es sein müsste. Das Duzen im Schloss würde sie allemal durchsetzen. Sie war die Baronesse. In der Küche aber hatte sie nie wieder gegessen.
Und jetzt, einige Tage vor dem Vollmond zu Ostern, erwartete sie eine Kammerzofe. Als ob sie sich nicht allein ankleiden könnte. Der Vater hatte es veranlasst, damit sie nicht einsam sei, ein wenig Gesellschaft habe, wie er gesagt hatte. In Wahrheit ging es ihm darum, eine Dame aus ihr zu machen. Christiane von Hehl. »Nicht aus dem schwäbischen Uradel wie unsere Familie, aber aus annehmbarem Hause«, hatte der Vater betont. Frau Bergrat Hehl suche eine Aufgabe für die Tochter. Könnte ihr Christiane eine kleine Schwester sein?
Casanova schnaubte und wandte den Kopf nach hinten. Als ob er ihre Gedanken verstünde. Sie ritt in den weitläufigen Hof mit dem Ziehbrunnen, saugte das weiche Licht des Frühlings ein und drehte eine weitere Runde auf dem Schecken. Der Hof grenzte das Schloss deutlich von Waschhaus und Backstube, von der Remise und den Ställen ab. Dahinter führte ein mit roten Ziegeln gedeckter Gang zu einer alten Kapelle. Sie stieg vom Pferd und beschattete die Augen.
Von den beiden Türmen flatterte die Fahne mit dem Familienwappen, den schwarzen Wolfsangeln auf gelbem Grund. Im Stall befanden sich welche, man könne nie wissen, hatte der Vater gesagt. Sie sattelte ab und rieb Casanova trocken, gab dem Schecken eine Handvoll Hafer und stellte ihm einen Eimer mit Wasser hin. Die Wolfsangeln lagen in der hintersten Ecke. Sie schloss die Augen und hörte die Stimme des Vaters: »Die Enden mit den Widerhaken werden mit Ködern versehen, am besten ist Aas. Man befestigt sie weit oben, der Wolf muss danach springen. Wenn er zuschnappt, bleibt er hängen.« Er hatte gelacht und auf die Kette gezeigt, die mit dem Anker am Baum festgemacht wurde. Welches Tier hatte das verdient? Und was für ein Mensch hatte sich das ausgedacht? War das ihr Vater? Und würde der Wolfshund auch nach einem Köder springen? Nachts heulte er den Mond an. Niemals hatte sie ihn bellen hören.
Sie ging auf die Terrasse und schaute ins Tal. Die Sonnenuhr warf ihren Schatten auf die Fünf. Auf der Schaukel gab sie sich den Schwingungen und Schwankungen des Lebens hin. In der Brechung der Luft halte ich Hof, murmelte sie vor sich hin. Erst nach einer ganzen Weile sprang sie ab. Es half nichts. Eine Baronesse war sie, ohne Familie. Sie warf den langen rotblonden Zopf auf den Rücken und stürmte in die Küche.
Dort saßen sie zusammen. Köchin, Magd und Kutscher. Sie stoben auseinander und gingen scheinbar einer Arbeit nach. Dabei wäre das nicht notwendig gewesen. Sie wollte nur Gesellschaft, nicht immer einsam sein.
»Baldur, du nimmst heute Abend die geschlossene Kutsche, um die Kammerzofe abzuholen. Ich rieche Regen, den die Felder dringend brauchen. Die Diligence nach Ravensburg hält außerplanmäßig in Dietenheim, darum habe ich gebeten. Du musst nicht eilen. Vor acht kann sie nicht am Fuggerhaus sein. Elsa, bereite ein leichtes Nachtessen vor. Gibt es nicht noch Hechtklößchen? Und Marie, richte die Zirbelstube. Ich bin stolz darauf, mit so wenig Personal das Schloss zu bewirtschaften. Das wollte ich euch schon lange sagen. Die neue Kammerzofe wird für uns alle eine Entlastung sein.«
Es schlug sechs, als Baldur den Hof verließ. Sie schaute der Kutsche aus dem Fenster nach. Gemächlich trotteten die beiden Pferde den Hügel hinunter. Am liebsten wäre sie mitgefahren, doch das ziemte sich nicht. Der Wolfshund blieb im Hof und heulte. Er wusste, dass sie nicht darinnen saß. Ihr fröstelte.
»Willkommen auf Schloss Brandenburg, liebe Christiane von Hehl! Alt und neu vereinen sich hier. Der Spiegel mit den Schnörkeln. Scheußlich. Doch man sieht schlanker darin aus. Dagegen das Sofa mit dem grünen Samt. Klar wie die Farbe des Waldes im Frühling.« Die Baronesse wies in die Runde. Die weitläufige Eingangshalle war zugig. »Was darf ich anbieten? Sherry? Oder Schnaps von unseren Marillen?«
»Wenn ich Sie um einen Kamillentee bitten dürfte, werte Baronesse.« Die mädchenhafte Frau neben ihr schaute zu Boden. Den Handkoffer stellte sie nicht ab, als ob sie gleich wieder abreisen wolle.
»Elsa!«, rief sie in Richtung Küche. »Brüh bitte einen Kamillentee auf.« Mit langen Schritten durchquerte sie das Esszimmer, das groß wie ein Saal war. Die schweren Teppiche und die Brokatvorhänge raubten ihr den Atem. Dieser Teil war reserviert für hohen Besuch, den sie zum Glück bislang nicht gehabt hatten. Bei der Tür am Ende der langen Tafel wandte sie sich um und ließ ihrer neuen Kammerzofe den Vortritt. »Das Lesezimmer. Was sage ich, unsere Bibliothek! Bücher sind meine zweite Leidenschaft, gleich nach dem Reiten.« Erker in den Wänden luden zum Lesen ein, und die Sitznischen an den Fenstern waren für heiße Sommertage, wenn man ein Lüftchen brauchte. »Hier kann man zu Hause sein.«
»Baronesse, bitte verzeihen Sie. Ich bin nicht sehr gesprächig heute Abend.«
»Nicht so förmlich. Ich werde dich Christiane nennen. Wie alle hier im Schloss nur einen Vornamen haben. Wir sind eine Familie. Verzeih. Ich vergaß. Mein Beileid.« Sie drückte ihr die Hände. »Sag bitte Fanny Marika zu mir, wie die anderen hier. Nimm Platz.« Sie zeigte auf das geschwungene Sofa und ließ sich rittlings auf einem Stuhl nieder, der neben einem niedrigen Tisch mit Gläsern stand. Die Arme legte sie auf die Lehne. »Wie konnte das geschehen, mit deinem Onkel? Erzähl mir, was passiert ist. Ich wusste nicht, dass er dich begleitet. Wir kennen uns. Er wollte mich vermutlich überraschen.«
»Er hätte nicht reisen sollen. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Er ist erst in Degerloch, das liegt auf der Höhe, am Rande der Residenz, in die Postkutsche gestiegen.«
»Du musst mir Stuttgart nicht erklären. Ich bin in Hohenheim aufgewachsen«, sagte die Baronesse.
Die Magd stellte das Häfele mit Kamillentee auf den Tisch und huschte wieder hinaus. Christiane pustete und nippte. Nach jedem Schluck hob sie den Kopf. Ihre blauen Augen standen im Kontrast zu den dunklen Haaren.
»Erzähl mir alles von eurer Reise.«
Christiane schluchzte auf. Sie sagte mit erstickter Stimme: »Verzeihen Sie, Baronesse, ein Sherry wäre doch eine vorzügliche Stärkung.«
»Einmal noch will ich dir die Anrede nachsehen. Beim dritten Mal gibt es Schläge, wenn du nicht gehorchst.« Sie schenkte ihr ein und ging zum Fenster. Ein Dreiviertelmond hing am Horizont und tauchte das Illertal in ein fahles Licht. Sie schlug ihre Bediensteten nie, bei einer kleinen Schwester wäre es anders, die musste sie erziehen. Und als Herrschaft durfte sie schlagen, mäßig, aber sie durfte.
»Verzeihen Sie, Baronesse, ich meine, Fanny Marika. Mir fehlen heute Abend die Worte. Hab Dank, dass du mich aufnimmst. Die Reise? Stuttgart hat sich gestern in Regen gehüllt, obwohl morgens der Kronprinz getauft worden war. Auf der Alb liegt Schnee wie so oft kurz vor Ostern. Mein Onkel war die ganze Woche erschöpft. Sein Bauch hat ihn gedrückt. Unmäßig von der Chocoladentorte habe er gegessen, die seine Schwester zum Geburtstag gebacken habe. Das war es nicht allein. Überarbeitet hatte er sich. Zu Tode geschafft für den König. Zu viele Ämter.« Tränen rannen ihr übers Gesicht.
Fanny Marika hielt das Glas gegen das flackernde Licht des Kronleuchters. »Der Hofmedicus hatte immer für alle ein Ohr, nur für sich selbst nicht. Es ist ein paar Jahre her, dass wir uns zuletzt begegnet sind. Bereits damals sah er blass und angegriffen aus. Es schmerzt mich, dass er sich für den König aufgeopfert hat. Nimm einen Schluck, der Sherry wird dich beruhigen. Der Herr Vater hat ihn von der letzten Reise aus England mitgebracht. Zurzeit ist er zusammen mit König Wilhelm unterwegs. Sie haben einen jungen Burschen mitgenommen. August von Weckherlin. Er trägt immer ein weißes Jabot, sogar wenn er in den Stall geht. Ich bin ihm etliche Male in Hohenheim begegnet. Er kennt sich aus mit der Rinderzucht. Auf ihm ruht Wilhelms Hoffnung. August hilft meinem Vater, auf Viehhaltung umzustellen. Wir sind erst seit einem Jahr in Brandenburg. Ich bin im Augenblick hier verantwortlich. Verzeih, ich habe dich unterbrochen. Erzähl weiter von deinem Onkel.«
»In Ulm wollte ich ihn nach Stuttgart zurückschicken, weil es ihn derart geplagt hat. Du hast recht. Er war schon länger angeschlagen. Der Kutscher hat in Dietenheim gehalten und gesagt, dass ein Wagen käme, um uns aufs Schloss Brandenburg zu bringen. Ich wusste nicht, dass Onkel Ludwig dich kennt. Jetzt ist er nicht mehr bei mir!« Sie heulte auf und schüttelte sich, konnte nicht weitersprechen.
Fanny Marika strich ihr über den Rücken.
»Wir sind aus der Kutsche gestiegen. Niemand war da. Der Wagen wird sicher gleich kommen, habe ich gedacht. Onkel Ludwig hat die Kerze in unserer Laterne angezündet. Geschwind und geschickt hat er Zunderschwamm und Feuerstein eine Flamme entlockt. Ganz der Alte war er plötzlich und hat geplaudert. Wir sind ein paar Schritte gegangen. Zum Fuggerhaus. Am Brunnen haben wir uns auf einen Stein gesetzt. Dicht nebeneinander. Wir wussten nicht, wie lange wir warten mussten. Es war kühl. Er hat unentwegt geredet und mir von früher erzählt. Das konnte er, Geschichten erzählen. Als Kind habe ich am liebsten ihm gelauscht.« Sie nahm einen Schluck Sherry und hielt sich am Glas fest. »›Alors, ma chère. Voilà. Vous êtes libre!‹, hat er gesagt. Ich wollte ihn fragen, was er damit meint. Dazu bin ich nicht mehr gekommen. Mit dem Kopf ist er plötzlich an meine Schulter gesunken. Ein neuer Schwächeanfall, dachte ich. Die Kerze in der Laterne ist erloschen. Fast wäre der Onkel in diesem Augenblick zur Seite gekippt. Gerade noch konnte ich ihn festhalten. Ich habe nach seinem Herzen getastet, aber da war nichts mehr. Hilfe wollte ich holen und konnte nicht aufstehen. Wie hätte ich ihn loslassen können? Was weiter passiert ist? Ich kann mich nicht erinnern.«
»Baldur hat dich gefunden. Er hatte bei einem Freund gewartet. Die Postkutsche ist durch den Ort gefahren und hat gehalten. Sogleich sei er aufgesprungen und zum Fuggerhaus geeilt, hat er mir erzählt. Niemand war dort. Er wollte nicht rufen und alle aufwecken. Erst nach einer Weile hat er dein Schluchzen gehört. Hör auf zu weinen. Der Hofmedicus hat nicht leiden müssen.«
»Ich weiß es wieder. Baldur hat mir Onkel Ludwigs Leib entwunden. Ich habe mich an ihn geklammert, hätte auf immer mit ihm sitzen bleiben können. Was hat er mit ihm gemacht?« Sie sprang auf und wollte davonstürzen.
Fanny Marika legte ihr eine Hand auf den Arm. »Beruhige dich. Sie haben ihn in einen Schuppen gebracht. Der Arzt schaut ihn morgen an. Er stellt das Dokument aus. Gott hab ihn selig, den Hofmedicus von Klein. Ein guter Mensch. Auch er hatte den Tod nicht in der Hand. Warte, ich zeig dir was. Vielleicht ist es dann leichter für dich.«
Flink kletterte sie die Leiter am Bücherregal hoch und griff sich einen Folianten. Sechs Jahre jünger als sie war Christiane. Sie könnte ihr wahrlich eine kleine Schwester sein und die Einsamkeit vertreiben. Es war recht mit den Bediensteten. Doch ihr Stand war zu verschieden. Christiane war ihr näher. Der Hofmedicus verband sie.
Mit dem Bildband in den Händen stieg sie freihändig wieder hinunter. Sie setzte sich neben Christiane, die abwechselnd am Kamillentee und am Sherry nippte, und legte das Buch auf den Tisch. Zielsicher fanden ihre Finger die Seite mit der farbigen Zeichnung von der nackten Frau und dem Kind im Bauch.
»An der Schwester«, sagte sie und zeigte auf die Leibesfrucht, »ist meine Mutter gestorben. Der Hofmedicus war machtlos. Einen Tag durfte ich weinen, nicht länger. Mit fünf Jahren. Dann musste ich nach dem Willen des Vaters wieder springen und lachen. Das gilt jetzt auch für dich.«
Christiane schluchzte erneut auf und schniefte.
»Keine Sorge. Der heutige Abend zählt nicht«, sie tätschelte ihr den Rücken. »Morgen darfst du weinen. Am Montag kommst du deinen Aufgaben nach. Sei mir eine Schwester, das vor allem, damit ich nicht einsam bin.« Sie wies auf die Leibesfrucht. Am Nachmittag hatte ein Storchenpaar den hohen Dachfirst bezogen. Hoffentlich war das kein Zeichen. Sie wollte nicht heiraten und ein Kind. Nicht enden wie die Mutter.
Nach einem kurzen Abendessen, das Christiane kaum anrührte, obwohl Elsas Hechtklößchen wie immer exzellent waren, brachte sie Christiane zur Zirbelstube. »Unser bestes Zimmer für dich. Holzvertäfelt. Schau, der Polstersessel und das Sofa. Beide in orange. Die grünen Kissen hat Marie sich ausgedacht. Sie ist ein Waisenkind und lernt bei uns den Haushalt und das Leben. Hinter dem Paravent dort in der Ecke stehen ein Bett und ein Nachttisch. Alles aus Zirbelkiefer. Riechst du, wie aromatisch es duftet? Die Waschschüssel ist aus bester Emaille, und das dicke Handtuch mag dich erquicken. Und sicher gefällt dir der Spiegel. Es soll dir an nichts fehlen. Das hier ist unser Steinmarder.«
»In der Naturaliensammlung des Königs, die meinem Vater, dem Bergrat von Hehl, untersteht, gibt es auch einen. Welch entzückendes Tier habt ihr hier auf dem Schloss! Das weiße Lätzchen und die wachen Ohren.«
Fanny Marika zog die Augenbrauen hoch und wies zur Wand. »Mein Eichhörnchen. Ich habe es mit einer Schleuder vom Baum geholt. Das war in Hohenheim. Den Rehbock in der Ecke hat der Vater geschossen. Und der Bussard dort hinten, der lag letzten Herbst im Schlosshof. Tot. Bei Tieren macht mir das nichts aus.«
Christiane wandte sich ab. Ihre Schultern bebten. Zum Glück brachte Elsa den Handkoffer. Sie blieb in der Tür stehen.
»Wir Bediensteten essen zusammen in der Küche. Halb sieben Frühstück, Punkt eins Mittagessen, Nachtessen um acht. Immer nach der Herrschaft, morgens früher.«
»Christiane ist meine Gesellschafterin. Wie eine kleine Schwester speist sie mit mir. Ich esse nicht mehr allein.«
Elsa reckte ihr Kinn in die Höhe. »Fanny Marika, du weißt, was dein Vater sagen würde.«
»Schreib mir bitte das Rezept für die Hechtklößchen auf.« Sie seufzte und wandte sich wieder an Christiane. »Schlaf aus und richte dich ein. Morgen ist Sonntag, da haben alle frei. Du kannst also ausgiebig weinen. Stell die Öllampe auf den Tisch. Zünd dir eine Kerze an.« Sie zeigte auf einen einarmigen Leuchter. »Morgen darfst du trauern, Montag … Da kommt Baldur mit deiner Reisetruhe. Sie war dir voraus, hat seit einer Woche in Dietenheim gewartet. Der Kutscher kümmert sich, wie gesagt, weiter um von Klein. Als Hofmedicus stand dieser in den Diensten des Königs, der sicher für den Transport der Leiche aufkommen wird.«
2
Die Zimmertür fiel ins Schloss. Christiane sank aufs Sofa. Sie wollte weinen, aber konnte nicht. War weit weg von der Welt. »Leiche«, hatte die Baronesse gesagt. Onkel Ludwig. Ein Leichnam. Tot. Wie der Bussard. Sie nahm diesen von der Wand und setzte sich mit ihm aufs Sofa. Hielt ihn auf den Knien. Der Onkel hatte in ihrem Arm gelegen, seine Augen hatten sie angeschaut. »Zudrücken, du musst sie ihm schließen«, hatte eine Stimme in ihr geflüstert. »Er braucht Ruhe.« Nie wieder würde er sie öffnen. Sie hatte es nicht gekonnt, über seine Lider zu streichen, ihm das Licht zu nehmen. Er war warm gewesen. Sie hatte ihr Gesicht in seinem Umhang vergraben. Den Bussard konnte sie nicht umarmen. Er kratzte und sie ließ ihn fallen, beinahe wäre auch sie vom Sofa gerutscht. Die Kerze flackerte. Alles verschwamm vor ihren Augen. Sie hatte geweint, ohne es zu merken. Über dem Bett grinste der Marder. Das Eichhörnchen an der Wand beim Kachelofen hielt eine Nuss in den Pfoten und blinzelte ihr zu. Christiane schlang die Arme um sich. Langsam schaukelte sie vor und zurück. Sie war über eine Schwelle gegangen.
Onkel Ludwig hatte sie ihr ganzes Leben gehalten. Und jetzt war er tot, und sie hielt ihn. Solange sie lebte, blieb er bei ihr. Eine Leiche. Sie würgte. Sauer, wie die Hechtklößchen. Wenn sie die Wahrheit erzählte, gab es eine polizeiliche Ermittlung. Undenkbar. Onkel Ludwig hätte das nicht gewollt. »Ich habe mich von meiner Schwester all die Jahre füttern lassen wie die Ratten«, hatte er in der Kutsche gesagt. »Es kommt auf die Menge an. Ein Selbstversuch. Ein winziges Stück Chocoladentorte. Dieses Mal hat auch sie vom Kuchen gegessen. Da habe ich mich verführen lassen.« Onkel Ludwig hatte sich vergiftet, doch das durfte niemand wissen, und sie musste es so schnell wie möglich vergessen. Der Rehbock in der Ecke schaute sie an. Waidwund. Er hatte eine kahle Stelle von der Kugel. Sie schob den Bussard mit dem Fuß beiseite. Ein Bein war abgebrochen. Onkel Ludwigs Knochen waren unversehrt und doch war er tot. Aber was war mit seiner Schwester, die auf Schloss Brandenburg als ihre Mutter galt? Frau Bergrat Hehl. War sie gleich dem Onkel gestorben? Etwas hüpfte in ihrem Herz herum und sang: »Die Hehl ist tot, die Hehl ist tot, sie kann nicht mehr krähn, kokodi, kokoda …« Das alte Kinderlied aus ihrer Zeit bei den Pfarrersleuten, wo sie aufgewachsen war. »Die Hehl ist tot, die Hehl ist tot, sie kann nicht mehr schlag’n, koko koko kokodi, kokoda …« Sie selbst war endlich frei. Frau Bergrat Hehl konnte nicht länger über sie bestimmen. »Vous êtes libre!«, hatte Onkel Ludwig gesagt. Erst jetzt verstand sie, was er gemeint hatte.
Sie erhob sich und öffnete die Reisetruhe, die nicht sie gepackt hatte. Frau Bergrat Hehl hatte dafür gesorgt, dass diese ihr vorausgeeilt war. Mit dem Packwagen. Musste sie ihr das zugutehalten? Ihre Kleider! Sie waren nicht fort. Sie dankte Gott und nicht Frau Bergrat. Das grüne Samtkleid mit dem weißen Kragen. Sie umarmte es. Es passte zum flaschengrünen Kachelofen in der Ecke. Heiß, so heiß war er. Sie drückte die Puppe mit den gelben Haaren, setzte diese aufs Sofa, gelb zu orange mit grünen Kissen. Die Puppe sang: »Die Hehl ist tot, kokodi, kokoda …« Christiane zog das wollene, altrosafarbene Reisekleid aus. Sie wusste nicht mehr, wie die Dinge zusammengehörten.
An ihr hing nach wie vor der Geldgürtel. Sie band ihn los und legte ihn zwischen Unterwäsche und Nachtzeug in den schmalen Wandschrank unter der Schräge. Davor schichtete sie ihre Monatsbinden. Eigenhändig gesäumt. Niemand würde in ihren leiblichen Sachen wühlen. In der prall gefüllten Geldkatze war ein Vermögen, das sie hüten musste. Fünfzig Goldgulden von ihrer ersten Amme, die diese als Kostgeld erhalten und ihr geschenkt hatte. Die Silbergulden von Onkel Ludwig fielen nicht ins Gewicht und waren für sie viel mehr wert. Sie schluchzte auf. Kein Gedanke daran, schlafen zu gehen, wie es vernünftig gewesen wäre. Stattdessen tauschte sie den Steinmarder über dem Bett gegen das Eichhörnchen. Sie streichelte sein Fell. Es war nicht weich, wie es aussah, sondern fettig und borstig. Wie sie immer gewesen war. »Die Hehl ist tot, sie kann nicht mehr schlag’n, kokodi, kokoda …« Sie regelte die Öllampe nach. Vor dem Spiegel kämmte sie sich die Haare. Sah sich zu und war nicht mehr allein. »Die Hehl ist tot, koko, koko …« Ihre Stimme erhob sich. Klar und rein schwang sie sich aus dem offenen Fenster durch die Nacht. Da heulte es. Hatte es hier in der Gegend Wölfe? Ein Schatten huschte über den Hof.
Es klopfte. »Sei still! Ich will schlafen!« Baldur.
Sie hielt den Atem an. In Unterkleidern stand sie da. So konnte sie ihm unmöglich gegenübertreten. Schritte auf dem Flur. Eine Tür. Sie atmete auf und strich sich die Haare glatt. Ihre Finger flochten einen französischen Zopf. Nicht wieder singen. Zitternd drehte sie die Lampe höher und setzte sich mit einer Stickarbeit aufs Sofa. Mitten in der Nacht. Schlafen war unmöglich. Der Marder grinste. Die Ridicule schaute sie mit offenem Maul an.
»Du bist ein hinter den Hecken gefundenes Kind!«, hatte Frau Bergrat vor ein paar Wochen gesagt und sie nach Brandenburg verbannt. Ihren Namen hatte sie ihr nicht entzogen. Christiane von Hehl hieß sie auf dem Schloss. Dagegen wollte sie einstweilen nichts sagen. Sie war gleich der Baronesse von Adel. Ihr Zimmer war diesem Status angemessen. Niemand ahnte die Findelkindgeschichte. Und das Bürgerrecht, das der Bergrat ihr gekauft hatte, würde ihren Namen bezeugen. Wo war es? Sie griff in die Ridicule. Onkel Ludwig hatte ihr die Urkunde in der Kutsche gegeben. Beim Pferdewechsel in Waldenbuch. Das Märchen von der schönen Lau hatte er ihr erzählt. Sie hatte ihm gelauscht und das Papier vergessen. Ihr Fehler, den sie niemandem vorwerfen konnte. Sie faltete die Urkunde dicht neben dem Kerzenleuchter auseinander.
Jungfer Heinerjette Christiane Mayer, geboren daselbst am 11. August 1804 in Stuttgart wurde in der Bürger-Zunft aufgenommen. Dafür bezahlt Bergrat Hehl siebenundzwanzig Gulden und fünfzehn Kreuzer. 2. August 1819.
Verbrennen, in die Flamme damit. Niemand durfte im Schloss davon wissen. Sie knüllte das Papier zusammen. Was sollte sie mit dem Namen Heinerjette? Der war unmöglich. Christiane hießen viele. Das ließ sie gelten. In ihrer Schulklasse war sie eine unter sieben gewesen. Mayer? Das passte nicht zu ihr. Die Buchstaben tanzten vor ihren Augen. Die Kerze leckte gierig, es roch angebrannt.
»Halt ein!«, rief eine Stimme. Onkel Ludwig?
3
Es klopfte. Sie riss die Augen auf. Helllichter Tag! Wo war sie? Der Marder grinste. Schloss Brandenburg. Alles fiel ihr wieder ein. Onkel Ludwig! Was hatte er ihr aus seiner Tasche geben wollen? Es war seine Stimme gewesen. Sie sprang auf. Sank zurück aufs Bett. Er war tot!
Knarrend öffnete sich die Tür. Marie trat ein und wedelte mit der Hand. »Den Nachttopf kannst du im Winkel neben dem Stall ausleeren.« Sie riss das Fenster auf.
Erneut pochte es. Christiane hielt die Luft an, setzte sich auf. Was hatte sie angestellt? Elsa stand auf der Schwelle und knetete ihre kräftigen Hände. »Verzeih, ich wollte dir sagen, dass du achtsam sein sollst. Wir haben dich gleich ins Herz geschlossen. Nicht wahr, Marie? Die Baronesse sieht uns als Familie. Sie hat ja keine. Nur den Vater, der nie da ist. Also nennen wir sie Fanny Marika, bis auf Baldur, der sich standhaft weigert. Ich kenne sie von klein auf, mir fällt es leicht. Untereinander benutzen wir niemals ihren Vornamen. Die Baronesse bleibt die Herrschaft. Sie wünscht, später den Tee mit dir im roten Salon einzunehmen. An der Stirnseite des ersten Stocks. Dort in den Polstersesseln lässt es sich trefflich handarbeiten. Ich soll dir Bescheid sagen, du hast die Klingel überhört. Arbeiten müssen wir am Sonntag nicht, doch da sein. Am Ende des Gangs kannst du dich frisch machen.«
»Dort ist auch der Abtritt«, sagte Marie. »Das haben wir gestern Abend versäumt, dir zu sagen. Wir haben alle unser eigenes Reich. Baldur bewohnt manchmal das gelbe Zimmer nebenan. Aber er ist lieber in seiner Kammer beim Pferdestall.«
Wenig später schlich Christiane die Wendeltreppe hinunter. Ihre Stickarbeit trug sie in der Ridicule. Zuerst musste sie mit Baldur reden. Sie brauchte Onkel Ludwigs Tasche. Zögernd betrat sie die Küche. Elsa nickte ihr aufmunternd zu. »Bitte, sag mir, wo ist Baldur? Ich muss ihn sprechen. Dringend!«
»Er hat frei und besucht wie jeden Sonntag Verwandte in Ulm. Er kehrt morgen in der Früh zurück. Komm frühstücken. Du bist blass. Ich hab dir ein paar getrocknete Pflaumen in den Hirsebrei geschnitten.«
Am nächsten Morgen winkte Baldur sie in die Küche. Christiane atmete auf. Die Tasche! Du brauchst einen Namen, Onkel Ludwigs Stimme. Hatte er ihr ein Anerkenntnis geben wollen? Damit wäre sie frei, auch wenn sie für den Moment keine Idee hatte, wie sie vom Schloss Brandenburg fortkommen sollte.
»Die Baronesse lässt sich zum Frühstück entschuldigen. Sie überwacht diese Woche die Aussaat des Sommergetreides und speist mit dir zu Mittag. Richte dich darauf ein.« Baldur musterte sie von der Seite und unterdrückte ein Niesen. »Die Birke im Hof, immer wenn sie blüht, erwischt es mich. Verzeih. Ich habe es deinem Onkel weich eingerichtet in seiner Kiste. Das ist dir sicher recht. Er ist auf dem Weg gen Stuttgart.«
»Oh mein Gott! Kann ich ihn nicht verabschieden? Ihn noch einmal sehen? Er wollte mir etwas Wichtiges geben. Wo ist seine Tasche?«
»Sie fährt mit. Ich habe nichts fortgenommen von ihm.«
»Kann man den Wagen nicht einholen? Spann an und gib den Pferden die Peitsche.«
Baldur schüttelte den Kopf. »Auf dem Weg zurück von Ulm habe ich in Dietenheim alles veranlasst. Darum hatte mich die Baronesse gebeten. Der Hofmedicus ist seit zwei Stunden unterwegs und seine schwarze Doktortasche fährt mit ihm. Er ist längst auf der Alb. Ein Brief eilt voraus.«
Christiane stürzte davon, ohne zu frühstücken. Im roten Salon war ihr Stickzeug. Das hatte sie gestern vergessen. Daran konnte sie sich festhalten. Nein, sie würde nicht weinen. Auch wenn alle Hoffnung auf ein Anerkenntnis, auf einen Namen, vergebens gewesen war. Nicht heulen, weder vor Schmerz noch aus lauter Enttäuschung. Was Fanny Marika mit fünf Jahren gekonnt hatte, würde sie ebenfalls zuwege bringen.
Sie fand sich in ihrem Zimmer am Tisch mit einem Schreibzeug wieder. Beinahe eingetrocknet, die Tinte. Die Feder kratzte über das Papier. Ein Brief an Onkels Ludwigs Witwe. Sie schluckte. Witwe, das passte nicht zu Tante Friederike. Es half nichts. Christiane sprach umständlich ihr Beileid aus und schwor, dass sie den Onkel bekniet habe, damit er umgehend nach Stuttgart zurückkehre. Er sei nicht zu überzeugen gewesen. Sie berichtete ausführlich, was sich zugetragen hatte. Die Tränen hielt sie zurück. Die Tinte! Sie endete mit den Worten: