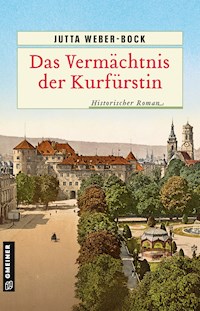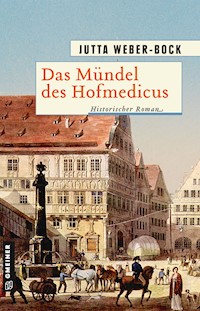
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Stuttgart 1804. Das heimlich in einem Gasthof geborene Mädchen Christiane wird seiner adeligen Mutter weggenommen. Durch Herzensbildung oder durch Strenge und Zwang, wie gedeiht ein Kind am besten? Ein Erziehungsexperiment, bei dem die Spielkarten Herzsieben und Ecksteinsieben eine geheimnisvolle Rolle spielen. Christiane wird wie ein Spielball hin- und hergeworfen. Mit siebzehn tanzt sie auf einem Maskenball in den Himmel der Liebe. Sie isst eine Chocoladentorte, doch diese ist vergiftet. Zufall oder Mordversuch?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jutta Weber-Bock
Das Mündel des Hofmedicus
Historischer Roman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © Stadtarchiv Stuttgart 9050/00634a
ISBN 978-3-8392-6664-9
Dank
Die Arbeit an diesem Projekt wurde gefördert durch ein Stipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Die Autorin dankt dem Stipendiengeber sehr herzlich.
Widmung
Für meinen Mann, den Lyriker und Fotografen Wolfgang Haenle, dem ich für seinen kritischen Blick und die Fotos von den Schauplätzen danke. Er hat mich stets in meinem Vorhaben bestärkt, ohne ihn würde es dieses Buch nicht geben.
ERSTER TEIL
Die Spielkarten
Prolog
Das Tal war von Weingebirgen und Wald eingeschlossen. Es öffnete sich gegen Morgen hin zum Neckar und ließ dort eine freiere Aussicht. An der tiefsten Stelle des Kessels lag die Innere Stadt mit dem Alten und Neuen Schloss, der Akademie und dem Komödienhaus. Zur reichen Vorstadt im Norden mit winkelrecht gehenden, breiten Fahrwegen und prächtig verzierten Häusern aus Stein wie dem Gebäude des Landtags mussten alle, ohne Standesunterschied, mehrere Fuß hinaufsteigen. In der Inneren Stadt krümmten sich die meisten Straßen und verdienten ihren Namen nicht. Enge und finstere Kehrwieder boten keinen Durchschlupf.
Über den Stuttgarter Marktplatz rund um das ehemalige Herrenhaus eilten an einem späten Nachmittag im August 1804 viele Menschen zwischen den Hühnern durch die verwinkelten Gassen. Der Kurfürst würde den Landtag neu ausschreiben, hieß es.
Im Haus Nummer 511 setzten bei der blutjungen Frau des Hofconditors die Wehen ein. Vier Wochen zu früh. Sie japste und krümmte sich zusammen. Die Wehmutter drückte ihr die Beine auseinander und langte mit beiden Händen in den Schoß. Geschickt packte sie den Kopf des Kindes, sodass der Leib mit Schwung herausglitt. Sie reichte das Neugeborene an die Nachbarin weiter, warf sich auf den gewölbten Bauch und drückte, bis die Nachgeburt herausrutschte. Ein Stöhnen entwich Frau Hofconditor. Mühsam stand sie auf, hockte sich über eine Schüssel mit heißem Wasser und wusch sich zwischen den Beinen. Die Wehmutter hantierte auf der Wäschekommode mit dem Kind und einem Kissen, stolperte und schrie: »Rasch! Den Pfarrer!«
Statt des Seelsorgers brachte die Nachbarsfrau den Stadtmedicus. Er legte ein Bündel auf der Kommode ab, steckte ihr und der Hebamme jeder einen Beutel zu und schickte sie fort. »Die beiden werden keine Not haben zu reden. Ihr Kind nehme ich mit in die Tübinger Anatomie.«
»I wü’s behoitn. Es g’hert mir, wocht glei wieder auf!«
»Es ist tot! Geben Sie Ruhe!«
»Na, es lebt. I wü’s behoitn!« Sie schlug die Hände vors Gesicht. Ein Schluchzen entwich ihr zwischen den Fingern. »Gib mir mei Kind z’ruck!«
Der Stadtmedicus legte ihr das Bündel von der Kommode in die Arme und zog die Decke zurück. Dunkle feuchte Haare schmiegten sich an einen schmalen Kopf. Die Augen waren von einem klaren Blau. »Eine halbe Stunde ist es alt, ein Mädchen wie das Ihre. Eine Amme trägt ein Leben lang Verantwortung wie eine Mutter.« Der Stadtmedicus tastete die Brüste ab und schnupperte. »Sie essen kein Fleisch. Die Milch wird zuckersüß sein«, sagte er. Sein Blick war eigentümlich verloren, als könne er hinter die Dinge schauen. »Dieses Kind hier an Ihrem liebreizenden Busen, es lebt und es muss am Leben bleiben. Eine geheime Geburt im Gasthof ›König von England‹. Zur selben Stunde wurde es geboren wie das Ihre, es ist also Ihres. Ich kann das bezeugen. Es soll den Namen Christiane tragen, nennen Sie es Nanette, die Begnadete. Sie haben den Auftrag, es nach den neuesten Erkenntnissen zu erziehen. Alles Notwendige finden Sie in Pestalozzis Ratgeber ›Lienhard und Gertrud‹. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. Und nehmen Sie das. Für’s Erste müsste es reichen.«
1
»I wü’s behoitn, es g’hert mir«, murmelte Gottliebin Rumetsch. Eine Schleife aus ihrer Wiener Kindheit zog sich hinter ihr her, derweil sie in ihrer Wohnstube herumging. Sie lauschte dem eiligen Klappern der Hufe auf dem Pflaster und ihren Worten nach. Für ein paar Minuten kehrte Ruhe ein.
In der Wiege prustete Nanette. Die Ärmchen zuckten a weng, aber sie wachte nicht auf. Erst seit einigen Wochen war sie ruhiger und schrie beim Schlafen nicht mehr auf, dass es einem durch Mark und Bein ging.
Gottliebin deckte ihr Nanele behutsam mit einer Wolldecke zu und öffnete das Fenster. Der Qualm vom Ofen entwich. Sie beugte sich weit hinaus. Zwei Dienstmägde in weißen Sonntagsschürzen redeten am neuen Brunnen neben dem Rathaus und schmeckten den Martinsgänsen nach, die ihre Herrschaften zum Mittagessen hatten. Wenig später mühten sie sich mit ihren Wassereimern zum Graben hinauf, der einzigen langen, geraden Straße an der Grenze zur Inneren Stadt. In den Gassen hing Rauch, vermischt mit dem Geruch von Dung, vergorenen Trauben und unreinem Wasser. I wü’s behoitn, es g’hert mir, echote es in ihr. Beim Gasthof »Königvon England« standen zwei Polizeidiener in ihren schmucken blauen Uniformröcken, um die Bürger mit einer ersten Runde durch die Straßen daran zu erinnern, dass es bald dunkelte und sie nach Hause gehörten. Wie das Nanele. Es war ihres. Leben musste es. Sie wollte es behalten.
Ihr Hausbesitzer, Schneidermeister Welsch, trat aus dem Schatten des Erdgeschosses. Sie zuckte zurück. Wie gewohnt trug er die graue Perücke mit dem gepuderten Zopf, und französische Pantalons verdeckten sein Holzbein. Wenn er damit aufstampfte, hielt die Stadt den Atem an, einzig das Nanele wimmerte wie ein Kätzchen. Sie solle sich vor ihm hüten, hatte die Nachbarin gesagt.
Mit klopfendem Herzen schloss sie das Fenster. Erneut ratterten zwei Kutschen vorbei. »Mein Gott, gib der Stadt ihre Ruhe. Und lass mir den Schneidermeister nicht nachsteigen, wenn ihm seine Dienstmagd nicht zur Verfügung steht«, flüsterte sie. Sie holte Nanette aus der Wiege und summte, legte das Gesicht an ihre Wange und streichelte den Kopf, wie es Pestalozzi beschrieb.
Auf ihrem Lieblingsschemel in der Ecke neben dem Ofen, in dem ein paar Scheite glühten, lehnte sie sich mit dem Rücken an die Wand und legte das Nanele an die Brust. Es gluckste beim Trinken. Das rot-weiß geblümte Wolltuch rutschte ihr von der Schulter. In einer Schale auf dem winzigen Tisch standen die letzten Trauben. Süß schmeckten sie dieses Jahr. Aus ihrem hochgesteckten Zopf löste sich eine blonde Strähne, die sie sich um den Finger wickelte.
Nanettes schwarze Haare waren nach der Geburt nicht ausgefallen. Ihr Mann kitzelte sie gerne mit seinen langen weißblonden Locken. Wie sie tief aus dem Bauch heraus giggelte. Wer wusste schon, woher eine Haarfarbe stammte.
Nanette drehte den Kopf, prustete und streckte die Ärmchen aus. Gottliebin schluckte die Tränen hinunter. Kinder durften nichts vom Kummer der Eltern bemerken, schrieb Pestalozzi. Sie setzte das Nanele auf den Schoß und stützte es mit einer Hand. Den Kopf zur linken Seite gelegt, quietschte es vor Freude, als sie mit ihren Fingern über den Bauch krabbelte. Gott hatte ihr ein neues Kind geschickt, sie sollte glücklich sein, es fühlte sich an wie ihr eigenes und roch genauso. Es jauchzte, war aber sicher bald müde. Ein gemütliches Stündchen am Ofen mit Erich und früh schlafen gehen. Conditorle machen. Die Glocken läuteten den Tag aus.
Nach ihrer Hochzeit hatte sie vom Brauttörle aus die Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock bestaunt. Einzig das Festtagsläuten war in ihrem Sinn gewesen. An die Schläge der Viertelstunden dachte sie genauso wenig wie an das Exerzieren und Pauken auf dem nahen Schlossplatz morgens um fünf. Das Haus mit seinen vorkragenden Stockwerken war das letzte am Ausgang der Kirchgasse und lag direkt neben der Stiftskirche. Der Kurfürst hatte ihnen die Wohnung bei Schneidermeister Welsch vermittelt und gleich den Obolus für ein Jahr entrichtet. Wenn ihm sein Hofconditor nicht abhandenkam, blieb für den dicken Friedrich alles im Lot, mochte Napoleon auch um Länder und Herrscher würfeln. Das hatte Erich gesagt.
Die Schläge erschütterten die Stube und bannten sie auf ihren Schemel. Sie hielt Nanette die Ohren zu. Eine Öllampe brannte vor dem Fenster an einem Seil, das seit Kurzem zwischen dem »König von England« und der Stiftskirche gespannt war, und erhellte die Wohnstube aufs Allerbeste. Sie sparte das Licht, obwohl sie nicht hätte knausern müssen, und setzte sich wieder auf den Schemel. »Schlafe, Prinzesschen, schlaf ein«, summte sie und wiegte Nanette, die selig die Augen schloss.
Kühl strich plötzlich die Luft aus dem Stiegenhaus um ihre Waden. Auch sie musste eingeschlafen sein. Ein Schatten. Sie griff sich an den Busen und sprang auf. Schneidermeister Welsch! Er konnte es nicht lassen.
Nanette schnaufte kaum hörbar. Der Schemen bewegte sich. Eine hochgewachsene, breite Frau. Sie marschierte durch ihre Stube, hatte sich nicht mit der Glocke angekündigt. Ehe Gottliebin sich’s versah, war sie mit zwei Schritten bei ihr und riss ihr Nanette aus den Armen. Die heulte auf und strampelte. Sie nahm das Nanele an sich und legte es in die Wiege. Seine Stimme überschlug sich. Wenn es nur nicht vergaß zu atmen.
»Mein Bruder schickt mich«, sagte die Frau, »der Stadtmedicus von Klein. Sie kennen ihn. Er operiert Blasensteine und konnte nicht selbst kommen. Ihre Aufgabe als Amme ist beendet.«
Geschwind zündete Gottliebin die große Argandlampe an. Energisch strich die Frau sich eine dunkle Haarsträhne zur Seite. Schwarz wie Nanettes Haare, was nicht sein konnte. Gegen die Gepflogenheiten trug sie keine Haube. Das Blaugrün ihres Kleides schmerzte in den Augen. Mit aller Kraft klammerte sich Gottliebin an die Wiege. I wü’s behoitn. Es g’hert mir, schrie es in ihr, doch sie sagte ganz ruhig: »Da muss eine Verwechselung vorliegen. Bitte gehen Sie. Mein Mann kommt gleich aus dem Schloss nach Hause.«
»Geben Sie mir das Kind. Weigern Sie sich, wird man feststellen, dass Sie Ihr neugeborenes Mädchen umgebracht haben. Auch wenn Sie erst achtzehn Lenze zählen, wissen Sie, was auf Kindsmord steht. Der Käs. Kopf ab! Nicht nur in Stuttgart und Württemberg. Die Wehmutter und die Nachbarin können die Tat bezeugen.«
»Niemals tun sie das! Ich bin unschuldig am Tod meines Kindes!«
Nanette japste nach Luft und riss die Augen auf. Gottliebin griff sich an den Hals. Was war ihr da widerfahren! Ihr, einer Tochter des Wiener Hofconditors. Wieder begann das Nanele zu schreien und brüllte, als ob es um sein Leben ginge. Die Frau reichte ihr einen Brief. Gottliebin sank auf den Stuhl neben der Wiege, brach das Siegel und faltete den Bogen auseinander. Sie wollte weinen und konnte nicht. Sie müsse es fortbringen, stand dort. Der Stadtmedicus hatte die Zeilen unterschrieben. Zum wiederholten Male strich sie das Papier glatt.
»Das Kind hier wird zu seiner Mutter gebracht. Und Sie tragen Sorge dafür.« Die Frau trat an die Wiege.
Nanettes Stimme kippte und brach. Gottliebin sprang auf, aber die andere drängte sie mit einer Handbewegung, wie es die Adeligen tun, beiseite und schob dem Nanele, das wie wild strampelte, etwas unter das Leibchen. Mit einer Hand hielt sie es grob fest. Das war nicht zum Ansehen.
»G’nua jetzt!« Gottliebin gab ihr einen Schubs. »Nu schau net wia r a Hen untarn Schwaaf!«, schrie sie und kannte sich selbst nicht mehr.
Tiefschwarz waren die Augen dieser Frau und spießten sie auf.
»Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich bin eine geborene von Klein und die Schwiegertochter des Stuttgarter Bürgermeisters! Das lasse ich mir nicht bieten.«
Sie schmierte ihr eine, so schnell konnte sie sich nicht ducken. Ihre Wange fing Feuer. Nanette brüllte noch lauter. Die Frau stemmte die Hände in die Hüften.
»Armes Hascherl!« Sie nahm ihr Nanele hoch, legte es auf dem Bauch zurück in die Wiege und tätschelte es.
»Sehr gut, wie das Kind sich abstützen und bereits den Kopf heben kann. Was es von nun an sieht, bestimme ich. Es wird lernen, mir mit den Augen zu folgen. Und ich werde immer ein Auge auf es haben. Vergessen Sie das nie!«
Die Frau wandte sich ihr zu. Gottliebin stellte sich vor die Wiege. Niemals gab sie das Nanele her. Sie war die Mutter, hatte von Klein gesagt. Das zählte.
»Wie ich sehe, sind Sie wieder vernünftig. Wenn Sie befolgen, was ich sage, wird Ihnen nichts geschehen. Fatschen Sie das Kind, umwickeln Sie es wie allgemein üblich fest mit dem Band hier, das ich mitgebracht habe. Dann ist es ruhig, und niemand, auch nicht der Schneidermeister, wird merken, dass Sie es aus dem Haus schaffen. Eine Stunde vor Mitternacht kommt eine Lohnkutsche und bringt Sie nach Degerloch auf die Höhe. Dort wartet eine Chaise mit einer Wärterin. Sie überlassen ihr das Kind mit Herzsieben unter dem Leibchen und bekommen dafür Ecksteinsieben als Beweis der Übergabe. Verwahren Sie die Spielkarte gut. Ich hole sie bei Gelegenheit ab. Die beiden Beutel hier geben Sie der Wärterin. Dieser ist für Sie.«
Bevor Gottliebin sich fassen konnte, schob die Frau sie beiseite und trat an die Wiege. Sie drehte Nanettes Kopf zu sich. »Wir aber sehen uns bald wieder!«
2
Mit langen Schritten eilte Elisabeth Hehl über den Kirchplatz. Eine geborene von Klein war sie und die Schwiegertochter des Stuttgarter Bürgermeisters. Die junge Rumetsch hatte den Zeilen geglaubt und die Unterschrift ihres Bruders für echt gehalten. Es war einfacher gewesen als gedacht. Ein rechtes Kind war die Rumetsch, die ein Kind erziehen sollte. Was Ludwig da eingefallen war. Er hätte sich ihr vor drei Monaten anvertrauen können, statt zu sagen, er handele im Auftrag. Lächerlich. Er traute ihr die Erziehung nicht zu. Wenn sie nur im August in Stuttgart gewesen wäre. Ein Fehltritt ließ sich vertuschen. Am Anfang. Niemals hätte er das Kind in der Residenz lassen dürfen. Wo er in wenigen Monaten heiraten wollte. Er habe es in seiner Eigenschaft als Stadtmedicus auf die Welt geholt. Ja, Herr Bruder, in doppeltem Sinne hast du ihm auf die Welt verholfen.
Es war eine gute Idee gewesen, sich bei ihrem Vater heimlich diese beiden Spielkarten auszuleihen und den Kartentausch zu ersinnen. Mit einem Kind zu spielen, das würde auch dem Kurfürsten gefallen. Was hatte der Vater mit zwei einzelnen Karten gewollt? Er war Hofarzt. Gaigeln gehörte dem gemeinen Volk, was ihn nicht davon abhielt, sich manches Mal damit zu vergnügen. Besonders hübsch gezeichnet waren diese beiden Spielkarten. Vielleicht hatte er sie deshalb in seinem Besitz. Herzsieben, ein Idyll. Die Mutter mit den Kindern, unterstützt von der Amme, wie bei ihnen zu Hause. Bei Ecksteinsieben purzelten die nackten Kindlein vom Himmel. Sieben wirst du haben, sagte der Bruder immer und tätschelte ihr den Rücken. Grässlich. Die Mutter hatte elf, neun waren am Leben geblieben. Die Stadt hatte daher auch von ihr eine Mutterschaft erwartet. Dem genügte sie jetzt, sie hatte nun ein Kind. Es war das ihre. Ganz nach ihrem Ebenbild würde sie es erziehen. Bis es einen gewissen Verstand entwickelt hatte, blieb es bei einer Amme. Solange es sich beschmutzte, kam es ihr nicht ins Haus. Es von einer Pflegerin aufziehen zu lassen, war nicht ungewöhnlich. Wenn es reinlich war, würde sie es zu sich nehmen und ihrer Mutterschaft nachkommen.
Sie wandte sich beim Rappschen Garten nach links, schnaubte vor sich hin und steckte den blauen Schal, den sie über den Schultern trug, mit der Brosche fest. Der Kurfürst hatte einen neuen Landtag ausgeschrieben, obwohl der Kurprinz noch in Paris weilte. Erziehen wollte Friedrich seinen Sohn wie die Bürger. Darum ging es ihm. Allen zeigen, wer der Herrscher ist. Es war eine gewisse Ehre, für den heutigen Abend ein Billett ins Komödienhaus erhalten zu haben. Weshalb hatte der Kurfürst sie nicht geladen? Und warum hing er an den neuen Methoden nach Rousseau und Pestalozzi? Sogar die Lehrerausbildung wollte er danach ausrichten. Das konnte nur ins Verderben führen. Sie musste ihm die Gefahren einer Erziehung ohne den rechten Zwang am lebendigen Beispiel zeigen. Diese drei hochnäsigen Mädchen von Frau Stadtrat Schnabel hätte sie anführen können. Und erst Legationsrätin Harpprecht mit ihren Buben, die sich an nichts hielten und unentwegt schwätzten, obwohl niemand sie etwas gefragt hatte. Ein Affront gegen den Herrscher. Sie konnte jetzt ein Kind ihr eigen nennen. Gar bald wollte sie den Vater ins Schloss begleiten. Leider war ihr das zu selten möglich gewesen. Kaum war Friedrich Herzog geworden, hatte sie nach der Heirat Stuttgart verlassen und ihrem Mann folgen müssen. Wie es sich gehörte. In den Schwarzwald, bis Freudenstadt. Weiter gen Neuenstadt, bis sie in Möckmühl geblieben waren. Wie froh war sie gewesen, jener viel zu armen Oberamtsstadt zu entkommen und zurück in der Residenz zu sein. Man musste sich beim Herrscher beständig in Erinnerung rufen.
Von der Kaserne marschierten Soldaten der Gardelegion an ihr vorbei. Schritt, zack, Schritt, zack, gleich im Schritt und zack zack. Herr Bruder, du lässt mir die Finger von diesem Kind. Dieses Mal entspreche ich deinen Anweisungen nicht. Eine Erziehung, die einem Kind gerecht wird, hast du schon an mir probiert. Pestalozzi soll ich folgen, sobald sich Nachkommen einstellen, dass ich nicht lache. Ich bin schneller zu einem Kind gekommen als gedacht. Und dieses gehört mir, nicht wie unsere kleine Schwester damals. Wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich sie wohl zu formen gewusst. So musste ich ihr das Kissen in die Wiege legen. Ganz fürsorglich. Damit das Näschen nicht kalt wird. Ich bin die Prinzessin geblieben. Als Ältester hast du große Gewalt über mich, Herr Bruder. Du weißt, wie mich das erschreckt und zugleich wütend macht. Und doch vergehe ich in zärtlicher Liebe für dich. Das wird sich ändern. Nicht du bestimmst fortan, sondern ich.
Von rechts donnerte eine Postkutsche aus der Gasse. Sie sprang beiseite und landete geradewegs in einem breitgewalzten Pferdeapfel. Seines Lebens konnte man nicht mehr sicher sein in dieser Stadt. Mit dem Handrücken strich sie sich flüchtig über die Stirn. Der Postkutscher gab den Pferden die Peitsche, und die Häuserwände warfen das Rollen der eisenbeschlagenen Räder zurück auf das Pflaster. Sie ertappte sich dabei, wie sie mit überkreuzten großen Zehen dastand und auf den Boden starrte, ziegenfüßig. Angeekelt hob sie ihren Rock und stieg über einen breiigen Kothaufen, der den Geruch nach verdorbenem Kohl verströmte. Die erste Aufgabe des Kurfürsten war es, für Reinlichkeit in der Stadt zu sorgen, aber Durchlaucht hatte einzig den eigenen Glanz im Sinn. Ein erblicher Adelstitel wäre ihrem Gatten angemessen, wo er nun die Verantwortung über die Blitzableiter in der Residenz trug.
Vor dem Eckhaus zur Weinstraße blieb sie stehen und sah zu Cafetier Silber hinüber. Ausschließlich die Männer hatten Zutritt dort und konnten sich vergnügen. Sie schnaubte in sich hinein und stieg betont langsam im Haus von Seifensieder Krauß die Treppe hinauf. In der Beletage wohnten sie, zum Graben gewandt, leider zur Miete. Trotzdem wäre es recht und billig gewesen, wenn nicht allein ihr Mann an diesem Abend ins Komödienhaus geladen worden wäre, sondern wie Wilhelmine Cotta auch sie.
Der Duft von Bratäpfeln mit Zimt strömte ihr aus der Wohnung entgegen und versöhnte sie. Welch Wohltat, dieser aus allen Löchern stinkenden Stadt zu entkommen. Sie leckte sich über die Lippen. Amalie, ihre Köchin, die sie aus dem Waisenhaus geholt hatte, war kaum älter als die junge Rumetsch und wusste sich einzuschmeicheln. Sie wollte ihr das nachsehen. Die Äpfel waren gar zu gut, wenn sie nur den Backofen ordentlich wieder reinigte, der war ihr heilig. Ein eigenes Bratrohr, darauf bestand sie, solange sie nicht ins Backhaus gehen musste wie die gewöhnlichen Leute. Die Rumetsch ließ ihren Mann im Alten Schloss backen. Ausschließlich die luftigsten Katzenzungen und saftigsten Nussbögen mit Kirschfüllung durfte er dem Kurfürsten vorsetzen. Wie lächerlich, das Neue Schloss nicht mit einer Küche auszustatten. Die Speisen wurden allesamt über die Planie getragen, eine Prozession, die nicht nur den Verkehr, sondern vor allem die Sitten störte. Ein rechter Schwabenstreich. Wie ein großer Herrscher baute Friedrich sein Reich aus. Er holte sich einen Hofconditor aus Preußen. Seine Heirat mit einer Wienerin war ihm recht gewesen.
3
»I wü’s behoitn. Es g’hert mir, ganz mir, behoitn wü’ i ’s, behoitn«, schluchzte Gottliebin. Sie ermahnte sich sogleich.
Der Kutscher trug einen runden Hut mit breiter Krempe. Er drehte das Licht der Stocklaterne neben dem Kutschbock nicht wie vorgeschrieben höher und wusste wohl, warum.
Mühsam hatte sie Erich gegenüber die Geschichte mit dem Nanele geradebiegen müssen. Ihm von den Goldmünzen erzählt. Erst wollte er nichts damit zu tun haben, später hatte er sie getröstet. Sie würde bald ein neues Kind haben und solle aufpassen, dass sie nicht ins Gerede komme. »In Stuttgart weiß der Nachbar, was du tust, bevor du selbst daran gedacht hast«, hatte er gesagt. Wie wahr.
Schneidermeister Welsch hatte sich die Hände gerieben, als sie heute so spät das Haus verlassen hatte. Nanette war nicht ruhig zu bekommen gewesen, was hätte sie tun sollen, außer zu singen. Nicht ums Verrecken wäre es ihr in den Sinn gekommen, den kleinen Leib mit diesem Band zu umwickeln, es zu fatschen. Sie sang also und das Kind schrie. Beides zusammen gab eine gute Komödie ab. Jetzt wusste nicht nur der Schneidermeister, sondern die ganze Stadt, dass sie es fortbrachte.
Beim Gasthof »Zum Wilden Mann« ließ der Kutscher die Pferde im Schritt gehen. Sie kniff die Nasenflügel zusammen und hielt sich ein Tuch vor den Mund. An der Großen Wette ging es über die Nesenbachbrücke. Vor der Leonhardskirche bogen sie rechts ab. Am Hauptstätter Tor mit den gemauerten Rundbögen und den beiden Wachtürmen warteten fünf Chaisen. Das würde dauern. Sie schloss die Augen. Die Stimmen der Stadt verwirrten sich in ihrem Kopf, krochen bis in den Bauch, wo sie einen Sauerkrauttanz aufführten. Der Kutscher furzte und knallte mit der Peitsche. Sie waren an der Reihe. Wortreich zahlte er das Sperrgeld, aber der Wächter wollte unbedingt einen Blick in das Innere der Chaise werfen. Obwohl es dunkel war, bemerkte er Nanette und verlangte noch einen Obolus, denn für das Kind müsse auch gezahlt und es müsse registriert werden. Das Nanele wimmerte und schrie dann auf. Es brüllte, dass ihr die Knochen im Leib schlotterten. Hinter ihnen standen die Wagen in einer langen Reihe. Flugs gab sie dem Wächter die fehlenden vier Kreuzer und klopfte Nanette beruhigend auf den Rücken. Diese schluchzte ohne Unterlass und hörte nicht auf, an ihrem Leibchen zu zerren. Der Kutscher zerknüllte ein Papier, pfefferte es in den Kandel und fluchte, dass sie zusammenzuckte. Die Räder ruckten an. Nanette war still, doch sie atmete und das Herz schlug kräftig. Gottliebin schob den Vorhang zur Seite und erschauderte. Der Käs! Kopf ab! Madame Caput! Sie! Nein, das konnte, das durfte nicht sein. Sie wollte leben! Vom nahe gelegenen Kutterhaufen drang ein pestilenzialischer Gestank herüber. Sie bedeckte die Nase mit dem Schultertuch, vermochte aber den Blick nicht abzuwenden und wiegte Nanette, was nicht nötig gewesen wäre. Ab und zu huschte ein fahler Schein über den Himmel.
Die Pferde sprengten über die Chaussee Richtung Tübingen. Außerhalb der Stadttore galt keine Beschränkung der Geschwindigkeit. Wenig später zog der Kutscher die Zügel wieder an. Er schonte die Gäule und sparte sich den Vorspann. Der Wagen folgte der Weinstaig zwischen Wiesen und Weingärten hinauf. An der Gaststätte »Sieh dich für« hielt er sich links. Sie war den Weg oft gegangen, um sich mit ihrer Freundin auf der Degerlocher Höhe zu treffen, heimlich, ohne das Wissen ihrer Gatten. Charlotte hatte vor ein paar Tagen ein Kind bekommen. Gottliebin schluchzte auf. Heiter, ermahnte sie sich, wie die Freundin immer sagte. Sei frohgemut, lass der Schwermut keinen Raum.
Die Pferde arbeiteten sich durch die Obere Heusteig. Gottliebin klammerte sich an längst vergangene Sommerbilder, an in der Sonne leuchtende Strohhüte und den Duft von frisch gemähtem Gras. Weintrauben hingen in Reih und Glied nach der Ordnung der Württemberger. Könnte sie doch fliegen wie ein Bussard. Sie würde bis zum Wienerwald gleiten, das Kind wohlbehütet unter dem Gefieder. Nahe der Hofburg landen und im Getümmel des gemeinen Volkes entkommen. Mit dem Nanele giggeln, bis ihnen der Atem wegblieb. Wie jetzt bei jedem Schlagloch. Die Chaise schwankte hin und her, Steine knirschten. Die Gemarkungsgrenze. Die Degerlocher waren zu arm, um die Chaussee zu erhalten. Pflastergeld durften sie nicht mehr erheben und sollten dennoch zahlen für die Herrschaften auf der Durchreise. Das hatte Charlotte erzählt. Die Chaise neigte sich bedrohlich nach links. Der Kutscher fluchte und knallte zugleich mit der Peitsche.
Sie drückte den kleinen Leib an sich. Da war Herzsieben unter dem Hemdchen. Hervorziehen sollte sie die Spielkarte, zerreißen und ein Ende machen, mit ihrer Tochter fliehen, die Extrapost nach Schaffhausen nehmen. In Frauenfeld wohnte eine Tante. Warum sie Geld bei sich hatte, wusste sie erst jetzt. Ein Windstoß trug drei Glockenschläge herein.
»Dreiviertel eins«, rief der Kutscher. »Wir halten am Gasthof ›Ritter‹, hier kann ich die Pferde tränken. Bleiben Sie im Wagen. Der Wind ist schneekalt.« Die beiden Blecheimer, die er unter dem Bock hervorholte, schepperten.
Eine Frau stieg ein, setzte sich auf die gegenüberliegende Bank und zupfte ihr Kleid zurecht. Gottliebin drehte die Öllampe hoch und wollte nichts sehen. Die andere trug ein samtenes Halsband mit Glasperlen und eine Haube mit einer Schleife. Nanette wimmerte.
»Ich bin die neue Wärterin. Regina Breusch.« Sie gab ihr die Hand, die feucht und glitschig war, und griff in die Rocktasche. »Diese Spielkarte ist für Sie. Ecksteinsieben. Dafür kriege ich das Kind.«
Gottliebin nahm die Öllampe vom Haken und leuchtete. Sieben Putten mit roten Ecksteinen als Flügel. Sie meinte, den Pinselstrich zu kennen, doch das konnte nicht sein.
»Nun geben Sie schon her!«
Sie reichte Frau Breusch ihr Nanele. Es schrie und zappelte, dass es Gott hätte erbarmen müssen. Aber der schwieg. Die Decke rutschte herunter. Wie hatte der Stadtmedicus gesprochen? »Eine Amme trägt ein Leben lang Verantwortung.« Sie war keine, sie war Mutter. Das hatte er auch gesagt. Wie könnte sie das Kind fortgeben? Sie war nicht bloß eine Wärterin, streckte die Arme aus und zog sie wieder zurück. Sie wollte das Nanele behalten und traute sich nicht, es festzuhalten. Im Herzen würde es freilich immer ihr gehören.
Frau Breusch hielt Nanettes Beine fest, tastete ihre Brust ab und zog die Herzsieben hervor. Sie schaute diese kurz an, nickte und steckte sie in eine Tasche, die sie bei sich trug. Wie gerne hätte Gottliebin die Spielkarte abgebusselt, dem Nanele all ihre Liebe mitgegeben. Es brüllte und schlug mit den Armen um sich, war verzweifelt wie sie.
»Warum ist das Kind nicht gefatscht! Ich habe nichts dabei, um es ruhigzustellen.«
Zwei Wagen rasten dicht an ihnen vorbei, ihre Chaise schwankte. Gottliebin hielt sich an ihren gefalteten Händen fest. »Auf ausdrückliche Anweisung des Stadtmedicus habe ich Nanette niemals umwickelt. Sie muss ihre Glieder gebrauchen. Ihr richtiger Name ist Christiane. Ich nenne sie Nanele, das mag sie besonders. Heute war die Stadt so unruhig, und jetzt ist Nanette ganz narret. Richten Sie bitte der Mutter meine besten Grüße aus. Ich hoffe, ich habe alles recht gemacht.« Sie reichte Frau Breusch die beiden Beutel.
Diese nahm eine Münze heraus und biss hinein. Sie nickte, steckte das Geldstück ein und umwickelte Nanette, die aus Leibeskräften brüllte, fest mit ihrem Umhang. Unvermittelt war es still. Nanette regte sich nicht mehr.
»Lassen Sie ihr Luft. Sprechen Sie mit ihr, sie muss Ihre Stimme kennenlernen.« Gottliebin wollte das Tuch zur Seite ziehen. Frau Breusch wehrte ab, öffnete den Wagenverschlag und kletterte mit dem Bündel hinaus.
Mit leeren Händen saß Gottliebin da. Der Verschlag fiel zu, der Wagen ruckte an. Unfähig, sich zu rühren, rutschte sie wie eine Puppe von links nach rechts und zurück.
Nachdem sie die Gemarkungsgrenze passiert hatten, rollte die Chaise leichter dahin. Da schoss die Milch ein. Sie schrie auf und schluchzte: »Gib mir mei Kind z’ruck! Gottverdammt! Wie kannst du es mir wegnehmen?«
Mit den Fäusten trommelte sie auf ihrer Brust herum. Es sollte wehtun, sie zerreißen. Die ganze Zeit hatte sie die Contenance bewahrt. Sie lachte bitter auf.
»Du bist die Tochter des Hofconditors! Die gibt sich nicht ihren Gefühlen hin. – Oh doch, liebste Mutter!«
Sie riss sich das Schultertuch herunter und zerrte am Kleid, saß mit blankem Busen da und krümmte sich zusammen, presste die Milch aus sich heraus. So süß roch es, dass sie sich die Finger ableckte, an sich saugte. Sie schmeckte das Nanele und kostete von der Bitterkeit des Lebens.
Ein Kind gegen Spielkarten zu tauschen! Zum Beweis der Übergabe. Umso schlimmer. Und wieso Herzsieben und Ecksteinsieben? Was hatten die Karten für eine Bedeutung? Vornehm wie bei den Adeligen sollte das Leben sein. Sie wollte nicht und musste doch. Warum durfte sie nicht einfach Mutter sein?
»Wenn wir auch selbst nicht von Adel sind, adelt uns sehr wohl die Tortenkunst deines Vaters. – Ach, Mutter, hör auf.«
Verdammt war sie, das zu tun, was andere wollten. Und Erich sagte ständig, »bei Hofe, da …« Sie hätte das Nanele nicht hergeben dürfen. Wie hatte sie dem zustimmen können!
»Gottverdammt noch einmal! I will mei Kind z’ruck! Mein Gott, sag mir den Grund. Du hast mir das eigene genommen und mir ein fremdes an den Busen gelegt. Das kann nicht falsch gewesen sein, wenn Du es so bestimmst. Warum muss ich es wieder hergeben? I hab doch nur das eine, das eine … Mein Gott, was hast Du der Frau da eingegeben?«
4
Eine geborene von Klein war sie. Als Schwiegertochter des Stuttgarter Bürgermeisters musste sie sich jetzt mit dieser Wärterin Breusch herumschlagen. Die Pferde trabten durch den Spalerbach in Metzingen. Die Amme hatte nach ihr verlangt. Persönlich. Hoch spritzten Kot und Unrat auf. Wie in Stuttgart. Schnell zog sie den Kopf in die Kutsche zurück. Hinter der Ermsbrücke bog ihre Chaise in die Straße »Am Entenbach« ein. Schon hörte sie das Kind brüllen und bösartig kreischen, wie es ihr von einer Bekannten beschrieben worden war. Unerträglich! Unweit des Gasthauses »Zum Grünen Baum« ließ sie den Kutscher halten, stieg aus und betrat die Wohnstätte der Wärterin von der Gartenseite her.
»Schwätz mr nur koin Lohkäs, Frau«, sagte eine Männerstimme. »Ich weiß Bescheid. Es ist das letzte Kind, das du mir holst. Bring’s in die Kammer neben der Küche. Sonst meint der Ackerknecht, wir müssen die Stube für drei Köpfe heizen, und fordert noch mehr Miete. Das Hochwasser damals hat uns nicht ruiniert, allerdings bist du auf dem besten Weg. Ich hab Hunger. Lass es halt schreien, es wird bald aufhören.«
Ein hagerer Mann stürmte an ihr vorbei. Sie durchmaß die dämmrige Stube. Die Wärterin war dabei, das Kind zu säubern, und fuhr erschrocken herum. Das war recht. Sie sollte sich nur nicht in Sicherheit wiegen. Es war nicht ihres. Wie dünn es war! Das musste sich ändern. Elisabeth Hehl nahm den nackten Leib hoch und schüttelte ihn. Da grillte das Kind, dass es ihr ins Ohr schnitt. Wie bei einem Tier war der Rachen zu sehen. Mit der flachen Hand verschloss sie den Mund. Das Balg zappelte und schrie unentwegt, fast wäre es ihr heruntergefallen. So weit kam es noch, dass sie sich schuldig machte. »Wir werden dir diese Allüren austreiben.« Sie gab ihm einen Klaps auf den Podex. »Ruhe!« Es war still. Ein wenig Strenge zur rechten Zeit wirkte Wunder. Doch was war das? Ihre Schuhe! Sie waren nass. Angeekelt legte sie das Kind ab, zum Glück war ihr Rock unversehrt geblieben. Sie stieg über die Pfütze am Boden und stemmte die Hände in die Hüften. »Widerlich! Machen Sie das weg. Wie das stinkt! Gleich entleert es sich womöglich noch. Das Kind braucht eine Windel, beeilen Sie sich, bevor es ein neues Unglück gibt. Sanft soll ich sein mit ihm, nicht laut sprechen, auf seine Bedürfnisse hören, sagt mein Bruder. In den Abgrund treiben uns die modischen Neuheiten. Diese Kinder werden bereits im zartesten Alter zügellos und ruinieren uns, wie Sie sehen können. Warten Sie, das Fatschen, ich zeig’s Ihnen, wie es richtig geht. Man beginnt an der Brust, in der Herzgegend, zur Abwehr des bösen Blicks. Zuerst wickelt man spiralförmig nach unten bis zu den Füßen und zwingt so die Knochen des Kindes zusammen, auf dass sie gerade wachsen.« Sie beschrieb der Wärterin, wie sie es zu tun habe. Die Beine lang gezogen, die Arme seitlich eng am Leib. Zum Schluss den Kopf fixieren und die Enden des breiten Bandes auf dem Rücken zusammenstecken.
»Recht viele Nadeln müssen es sein. Wie bei einem guten Strumpfwirkerstuhl für die Seide. Da kenne ich mich aus.« Die Wärterin ruckte beim Reden mit dem Kopf wie ein Huhn.
»Bis zu einem Jahr fatschen Sie das Kind und schnüren den Kopf mit ein. So. Sehen Sie, wie es wirkt? Kein Laut mehr. Es ist eingeschlafen. Ein kleiner Engel.« Sie räusperte sich. »Später nehmen Sie es ins Gängelband und stecken es dann ins Laufgeschirr. Ein Mensch ist es erst, wenn es gehen kann und gewisse Eigenschaften entwickelt hat, die allen Menschen gemein sind. Bis dahin bleibt es in Ihrer Obhut. Geben Sie mir jetzt Herzsieben zum Beweis der richtigen Übergabe.«
»Ihr Bruder hat sie mir abgenommen. Kaum hatte ich den Milchfluss wieder in Gang gebracht, nachdem mein Bub gestorben war, ist er aufgetaucht. Dabei hatte das Kind hier bloß ein bisschen Husten. Woher wusste er das? Das Fieber war nicht der Rede wert. Einen Auszug aus Huflattichblättern mit Pfennigkraut hat er verordnet. Frau Pfarrer hat mir in allem geholfen. Kommen Sie mit in den Garten zur Schießmauer. Das Haus hat gar zu viele Ohren. Sie wissen schon, der Obolus für den Ammendienst. Sie glauben gar nicht, welch einen Aufwand ein krankes Kind verursacht. Die teure Kost, die Ihr Bruder verordnet hat. Fleischbrühe und Milchreis mit gequirltem Ei.«
Hatte sie es sich gedacht, es ging um Geld. Nicht um das Kind. Keinen Heller extra gab es. Es war wohl das richtige, wenn die Wärterin es auch nicht mit Herzsieben beweisen konnte. Längst hätte sie mit der Erziehung zur Reinlichkeit beginnen müssen. Ihr Bruder hatte sich also die Spielkarte unter den Nagel gerissen.
»Sie sagen ja gar nichts. Ich hab auch Hunger, nicht nur das Kind. Die Zeiten sind nicht gut. Dem Kurprinzen geben die Landstände Geld aus ihrer Schatulle, für sein lustiges Leben in Paris. Das Volk hat kaum ein Auskommen. Für die hohen Herrschaften sollen wir hungern.«
Elisabeth Hehl hängte das Bündel an einen Nagel neben der Tür. Das Geschrei hatte sie konfus gemacht. Ruhe war. Kinder brauchten ein sicheres und geborgenes Gefühl wie im Mutterleib.
Ein Reiter sprengte durch die nahe Furt. Die Pferdehufe rissen klirrend die dünne Eisschicht los. Das Wasser gurgelte und zischte: Eine geborene von Klein.
5
Für den Blasensteinschnitt führte er in seinem Etui ein Skalpell, eine Sonde und eine Steinzange mit sich. Es wurde Mitte Januar, bis Ludwig von Klein erneut bei der Amme Breusch vorbeischauen konnte. Er klopfte. Niemand öffnete. Die Tür war nicht verschlossen, er trat ein. Umgehend nahm er das Bündel vom Haken. Hatte er gehört. Nicht mal mehr die Bauern auf der Alb behandelten derart ihren Nachwuchs. Frau Pfarrer hatte ihm berichtet, wie die Amme Breusch mit dem Zögling zu verfahren pflegte. Er entfernte die Nadeln. An die fünfzig Stück, immer drei nebeneinander. Behutsam wickelte er das Band ab. Wie konnte man ein Kind so fest schnüren? Und das nicht nur in der Nacht. Die Frauen waren hierzulande besonders gründlich darin. Es war bequem, wenn es sich nicht bewegte. In Frankreich und England wurde diese Methode längst nicht mehr angewandt. Wie Mumien sahen die Kinder aus, dabei befanden sie sich am Anfang des Lebens und mussten die Welt begreifen. Im ursprünglichen Wortsinn. Fatschen brach den Lebenswillen, ähnlich wie bei Mohnsamen oder Wein. Krünitz beschrieb die Wirkung in seiner Enzyklopädie.
Nanette war frei und lächelte zaghaft. Sie blieb still liegen. Ihr Herz schlug ganz langsam. »Du schläfst wohl viel. Kannst du auch schreien?« Er zwickte sie in den Arm. Sie drehte den Kopf weg. Selbst diesen hatte die Amme Breusch fixiert gehabt. Prüfend bewegte er seinen Zeigefinger. Das Kind griff nicht danach, wie es dem Alter entsprochen hätte. Zeit, es fortzubringen. Wie gerne kam er dem Auftrag nach. Er ließ sich mit Nanette aufs Bett nieder, streifte ihr ein Wollkleid über und zog ihr dicke Strümpfe an. Drei Dinge wollte er testen. Zuerst griff er ihr unter die Arme und zog sie zum Stehen hoch. Sie stemmte sich nicht mit den Füßen gegen die Unterlage und federte nach, sondern knickte schlaff ein. Das hatte seine Vorteile. Er setzte sie auf ein Knie, stützte sie mit einer Hand und tippte sich auf die Nase, dann ihr. Sie lachte und versuchte, es ihm nachzumachen, traf aber nicht. Hier war sie also ebenfalls in der Entwicklung zurückgeblieben. Die Linke hatte sie genommen, was nichts sagte. Zu guter Letzt fasste er ihr in den Mund und tastete den Kiefer ab. Zähne spürte er keine, das machte es einfach. Sie saugte am Finger und hielt inne, als sie die Tür hörte. Sofort begann sie zu schluchzen und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust.
Die Amme Breusch stolperte herein und stammelte: »Herr Stadtmedicus! Ich war geschwind auf dem Markt. Da musste ich sichergehen. Ihre Schwester …«
»Ich nehme das Kind mit nach Stuttgart, da das Klima ihm hier nicht zuträglich ist. So sagen Sie es allen.« Er gab der Amme Breusch einen dicken Beutel, den sie nicht öffnete, sondern sich stattdessen schluchzend auf den einzigen Stuhl in der Kammer setzte.
»Mein kleines Mädchen. Sie können es mir nicht einfach wegnehmen.«
»Geben Sie mir Herzsieben. Die Spielkarte hat auf dem Sims gestanden bei der ersten Visitation. Den Rest vom Kostgeld dürfen Sie behalten. Hier ist etwas extra.«
Energisch schüttelte die Amme Breusch den Kopf. Ihr Gesicht mit der roten Nase war noch runder geworden. Wie die Spitzenhaube mit der Schleife kratzte, er fühlte es anstelle des Kindes. »Ihre Aufgabe ist beendet.«
»Aber Ihre Schwester war recht zufrieden mit mir. Das Kostgeld bleibt also bei mir. Und der Beutel. Herzsieben. Ihnen mag ich sie geben. Ihre Schwester hat ebenfalls danach gefragt. Doch sie wollte mir nichts bieten. Sie verstehen.«
Die Amme Breusch zog die Karte unter einer Schüssel hervor. Links oben hatte Herzsieben ein Eselsohr, und auf dem Kleid der Mutter war ein Fleck. Am Rand wellte sich die Spielkarte. Schade. Mit dem Beutel verschwand die Amme Breusch in der Küche. Ein Milchkind brachte Geld. Darum ging es auch hier. Das Einkommen eines Strumpfwebers war recht kärglich, wie er gehört hatte.
Er setzte Nanette auf seine Hüfte und stützte sie. Hin und her drehte sie jetzt den Kopf und lutschte am Handrücken. Leise redete er mit ihr und verbarg sie unter dem weiten Umhang. Die Amme Breusch ließ sich nicht mehr blicken, sodass er sich französisch empfahl. Frau Pfarrer war in den frühen Morgenstunden niedergekommen, ein gesundes Mädchen, sehr kräftig. Nanette war ganz still unter dem Umhang. Er streichelte sie. Es würde gehen, sie wie gewünscht inkognito als zweites neugeborenes Kind der Pfarrersleute auszugeben. Bei ihnen war sie gut aufgehoben. Drei Jahre durfte sie bleiben, bis Lisbeth die Erziehung in die Hand nehmen sollte. So die Anweisung. Doch das letzte Wort war bisher nicht gesprochen.
Er umrundete die Martinskirche und bog nach rechts in die Helfergasse ab. Bei Nummer sieben ging er in den Garten und betrat das Pfarrhaus durch den Hintereingang. In einem Sack auf dem Rücken trug er zwei gleiche Taufkleider, schlicht gehalten. Passend dazu gerüschte Häubchen. In einer Woche war die Taufe. Die Pfarrerskinder schliefen noch. Nach dem Mittagessen durften sie die Zwillinge sehen.
ZWEITER TEIL
Das Zwillingskind
Prolog
Die Alb fiel überall jäh und prallig ab, nur bei der Ebene des Ermstals war sie sanfter gestimmt. Diese freundliche Lage zeichnete Metzingen aus. Auf seiner Markung trafen sich Äcker und Wiesen mit Obstzucht und Weinbau. Im milden Klima an den südlichen Abhängen gediehen Trauben und Textilhandwerk gleichermaßen, sodass sich ländliche und städtische Sitten aufs Trefflichste vermischten. Vom Lindenplatz, wo der Viehmarkt stattfand, zog sich die Langgasse, die geschottert und mit Kandeln versehen war, gen Rathaus. Sie beherbergte niedrige Bauernhäuser, Handwerkerstätten und Ladengeschäfte. An Markttagen stauten sich hier Leiterwagen, Räuberkarren und Gespanne aus den umliegenden Orten. Im Norden begrenzten Kelterplatz und Spalerbach das Pfarrdorf. Enge, krumme Straßen zogen sich in einem weiten Bogen gegen Mittag zu um die baumbestandenen Schlossgärten inmitten des Häusergewirrs bei der Martinskirche.
Zu Ostern erklang ihre große Glocke. Die vollen Schläge hallten in den Gassen nach. Beim neunten Mal öffneten sich die ersten Türen, und im schwarzen Sonntagsstaat traten mehr ehrbare Bürger als sonst auf die reinlich gefegten Straßen.
An der Kalebskelter hielt Unterbürgermeister Gfrörer den Zunftmeister der Strumpfweber auf und sagte: »Kromer, hast du gehört? Der Pfarrer soll eine Erscheinung gehabt haben. Im hinteren Pfarrgarten war’s, gestern erst. Er hat die Hände zum Himmel gehoben. Meine Frau hat’s gesehen, sie war bei der Nachbarin. Karsamstag fleht er immer Jesus an. Jedes Jahr wartet er, dass dieser zu ihm spricht. Die Weibsleute haben sich heimlich herangeschlichen, und da haben sie gehört, wie der Pfarrer gerufen hat: ›Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?‹ Er hat sich der Länge nach auf die harte, kalte Erde geworfen. Da ist plötzlich ein Licht aufgeflackert hinter den kahlen Zweigen des Pflaumenbaums und eine Stimme hat gesagt: ›Du machsch des scho recht. Hasch a großes Herz. Des wird di ned em Stich lassa. Aber pass guot auf, dass da emmer auf deim Weg bleibschd.‹ Meine Frau schwört, dass es nicht der Pfarrer war, der da gesprochen hat. Am alten Pflaumenbaum sind die Knospen angeschwollen und aufgeplatzt. Zugucken hat man können. Reinweiß waren die Blüten, nicht zartrosa. Da hat sie drei Kreuze geschlagen wie die Katholischen.«
»Was die Frauen so reden, Gfrörer. Die Kirche wartet. Gehen wir. Der Pfarrer macht’s recht, man muss sich Gottes vergewissern. Der hat ihn dafür mit Zwillingen gesegnet.«
»Meine Gattin hat gehört, es soll nicht mit rechten Dingen zugegangen sein bei der Geburt. Was könnten wir sagen? Wir sind Paten.«
»Lass gut sein, Gfrörer, und komm.« Zunftmeister Kromer blieb unter dem vorkragenden Fachwerk vom Schulhaus stehen und legte den Kopf in den Nacken. »Mit Gottes Beistand. Den kann der Pfarrer wahrlich gebrauchen.«
1
Keiner werfe den ersten Stein. Steinheil trat aus der Tür des Pfarrhauses in der Helfergasse. Immer wieder strich er über seine teuflische linke Braue. Er schritt kräftig aus und kam nicht von der Stelle. Worüber sollte er predigen, nach der Erscheinung gestern unter dem Pflaumenbaum? Die Kirche würde gut besucht sein. Die Leute redeten. Stets betete er im Frühjahr für die Reben. Im Herbst sammelten sie für die Armen unter den Weinbauern. Sie alle waren Weinstöcke im Weinberg Gottes. Ja, das ging.
»Du machsch des scho recht«, begann er. Die Gemeinde tuschelte. Jedes seiner Worte war ein Hilferuf an Jesus, ihnen den richtigen Weg zu weisen. Vor allem ihm selbst. Was hätte er tun sollen mit diesem Kind? Er hatte Nanette zusammen mit der eigenen Tochter getauft. Das konnte nicht schaden. Was machte es, ein Sakrament zweimal zu vergeben. Manchmal standen die Vorschriften gegen das Leben. Wie froh waren sie, dass sich Nanette von ihrer schweren Krankheit erholt hatte. Er betete das Vaterunser. Sie sangen, und die Glocken läuteten den Gottesdienst aus.
Möglichst oft an die frische Luft sollte Nanette. Das hatte von Klein verordnet. Steinheil schickte seinen Ältesten daher häufig mit ihr in den Garten. Friedrich war mit acht recht kräftig und trug die Schwester sicher herum. Auf keinen Fall solle er mit ihr den Pfarrgarten verlassen, das hatte er ihm eingeschärft.
Friedrich setzte das Nanele gerne in den Schubkarren, den er leuchtend rot angestrichen hatte. Zwischen den Hühnern und der Ziege kurvte er herum. Jonathan folgte ihm und pfiff durch seine Zahnlücke. Nanette jauchzte. So viel hing ab von einem roten Schubkarren. Darüber musste er einmal predigen.
Zur Kalten Sophie füllte sich das Haus mit dem Rauch von getrocknetem Bohnenkraut, das seine Frau im Ofen verbrannte. Zum Schluss gab sie einige Wacholderbeeren in die Glut, die Leib und Seele stärkten, und sah ihn lange an. Wie gerne schaute er ihr in die Augen, die in einem satten Braun leuchteten wie bei Louisle. Nanette hingegen hatte die blauen Aigle seines Ältesten. Gott hatte es bestimmt. Louisle und Nanette waren Zwillinge, wenn auch nicht von einer Art. Wie verschieden Kinder sein konnten. Pausbäckig und gesund war Rosine als erste Tochter von Geburt an, mit festen dunkelblonden Haaren und stämmigen Beinen. Ganz die Mutter. Maria, das zweite Mädchen, war von Anfang an ein trotziges Kind. Wilhelm war fünfzehn Monate später auf die Welt gekommen und gleich nach der Geburt gestorben. Maria war die Prinzessin, bis sie Anfang des Jahres die doppelte Aufmerksamkeit an die Zwillinge verloren hatte.
Dem Nanele hatte es gutgetan, wie neugeboren sein zu dürfen. Doch die natürliche Entwicklung ließ sich nicht aufhalten. Sie mussten aufpassen, dass niemand Verdacht schöpfte. So wurde es gewünscht. Er bat Gott um Verzeihung, aber dieser antwortete ihm nicht. Also ging er ins Amtszimmer und las in der Bibel wie jeden Morgen. Nach einer Weile befiel ihn eine plötzliche Unruhe. Er stand auf und sah aus dem Fenster, wie die Buben mit dem Nanele im Schubkarren über die Straße witschten. Dieses eine Mal wollte er es dulden. Es sah nach Regen aus, weit würden sie nicht kommen.
Statt der Buben stand wenig später Strumpfweber Kromer vor der Tür. Nanette sei beim Marktbrunnen aus dem Schubkarren gefallen und Frau Breusch habe sich Friedrich in den Weg gestellt, sagte er und strich sich über den Schnauzer. Sein Gesicht war voller scharf gezeichneter Furchen. Er war nicht alt, aber als Zunftmeister hatte man immer eine Sorge. Auch darüber ließ sich trefflich predigen, was da einer für die anderen tat.
Er nahm die Buben mit dem schluchzenden Nanele selbst in Empfang. »Ihr bleibt mit ihr im Garten. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.« Friedrich nickte und senkte den Kopf.
»Wer ist die Frau?«, fragte Jonathan und wartete nicht auf eine Antwort. Er rannte zum Pflaumenbaum am Ende der Wiese, weit weg vom Haus. Sein Ältester folgte ihm und hockte sich daneben, stützte den Kopf in die Hände. Er schlich zu den beiden und verbarg sich hinter den Brombeerranken.
»Weshalb hat die Frau gesagt: ›Das wäre bei mir nicht passiert! Wäre sie bloß bei mir geblieben.‹? Sie scheint das Nanele zu kennen. Warum hat es derart geschrien?« Jonathan wollte aufspringen, aber Friedrich legte seinen Arm um ihn. »Bleib sitzen und hör mich an: Wenn diese Frau Breusch so redet, machen wir ihre Worte nicht besser, indem wir ihnen durch unsere Fragen eine Krone aufsetzen. Was wissen wir schon von ihr. ›Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten,‹ so steht es geschrieben.«
Steinheil faltete die Hände. Jonathan schüttelte Friedrich ab und sprang auf. »Du taugst zu nichts anderem als zum Pfarrer. Sie decken alles zu mit den Worten der Kirche.«
»Mit dem Wort Gottes, mein Sohn«, sagte er und trat zu den beiden. »Und wer da stehet, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Alle vorschnellen Zungen sollen schweigen. So steht es geschrieben im ersten Brief des Paulus an die Korinther. Jonathan, merke es dir und lasse es gut sein. Die Frau hat großen Kummer erlitten. Kommt euren Pflichten nach.«
In den folgenden Wochen bemerkte er, wie sein Ältester das Nanele beobachtete. Bei Tisch konnte sie alleine auf einem Stuhl sitzen, mit einem Kissen unterm Podex. Am Klang seiner Stimme erkannte sie, was er von ihr wollte. Bald faltete sie ihre Finger von selbst ineinander, wenn er das Dankgebet sprach. All das ging weit über Louisles Fähigkeiten hinaus. »Für unsere Buben habe ich in der Bibel eine Erklärung gefunden«, schrieb er an von Klein, »aber Frau Breusch entzieht sich meinem Einfluss.«
2
Für den Blasensteinschnitt führte er in seinem Etui ein Skalpell, eine Sonde und eine Steinzange mit sich. Auch bei Kindern erzielte er damit beste Heilergebnisse, was von Klein für den Moment nicht in Betracht ziehen wollte.
Er band den Mecklenburger an einen Baum und ging über die Wiese. Eine kurze Rast für ihn und das Pferd. Auf dem Rückweg von Tübingen war er, wo er an der Universität zur Geburtshilfe referiert hatte. Eine Stunde hatte er Zeit, das fiel weiter nicht auf.
»Jetzt lernt Mademoiselle also laufen!«, entfuhr es ihm, als Nanette auf ihn zustürmte und jauchzte. Er hielt ihr einen Finger hin, und sie griff danach, er zog ihn zurück. Sie lachte. Er schnappte nach ihr, sie zog die Hand weg. »Du erinnerst dich, wie ich sehe. Mit dem Laufen bist du der Zeit voraus und wieder nicht.« Er kitzelte sie mit einem ihrer winzigen Zöpfe, die unter dem Häubchen hervorschauten. Sie lallte. »Die Erziehung hier tut dir gut. Auch wenn du das Krabbeln ausgelassen hast.«
Frau Pfarrer trat zu ihnen. »Alles kommt zur rechten Zeit. Wie es in den Briefen zur Erziehung steht. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei uns im Baumgarten an der Erms. Nanele, gib Onkel Ludwig die Hand.«
Nanette schüttelte den Kopf und gluckste. Sie beugte den linken Arm, in dem sie eine Puppe mit gelben Haaren hielt, zeigte auf Rosine und machte eine Faust. Unentwegt zupfte sie an ihm herum. Er nahm sie auf den Arm, wo sie kaum zu halten war, so wendig bewegte sie sich. Also setzte er sie ins Gras, wo sie sich an seinen Pantalons hochzog. Eine dunkle Haarsträhne fiel ihr in die Augen. Steinheil legte die Leiter ab, kam zu ihnen und nahm sie auf den Arm.
Sie gingen zur Erms hinunter. Hinter einer alten Weide mit einem verwachsenen Stamm gluckste und rauschte ein Wasserstrudel und deckte seine Worte zu. Die Buben spielten Verstecken in der Nähe. Besser, sie schnappten nichts auf.
»Ihr Schwager hat es eingefädelt, dass Sie nach Kirchberg an der Murr versetzt werden. Doch erst in zwei Jahren. Dann können die Mädchen leicht für alle Fremden als Zwillinge gelten. Bis dahin müssen Sie hier in Metzingen ausharren. Frau Breusch und ihr Mann wandern nach Amerika aus. Die beiden werden die Prämie nicht ausschlagen. Für Sie gibt es in Kirchberg einen Neuanfang. Bis dahin richten Sie es sich in Metzingen ein. Nanette darf den Pfarrgarten, der groß genug und gut abgeschirmt ist, einzig in Begleitung der Eltern verlassen, wie es auch in den Erziehungsanweisungen steht, immer mit einem Häubchen versehen, auf dem Arm gehalten oder mit Louisle in einem Wagen, wie Sie ihn benutzen, wenn Sie hierher in den Baumgarten gehen. Ich denke, wir verstehen uns.«
Steinheil strich sich über seine teuflische Braue. »Verzeihen Sie, was passiert ist. Es wird nicht erneut vorkommen. Schwager Ferdinand hat uns von der Pfarrstelle erzählt. Wenn wir nur das Nanele mitnehmen dürfen.«
Verhalten nickte von Klein. »Meine Schwester hat vor einem Jahr gedacht, ich sei Nanettes Vater und sie müsse mich vor übler Nachrede schützen.« Er schaute sich um. Sie waren alleine mit dem Rauschen der Erms. »Ich vertraue Ihnen. Sie sollten jedoch meiner Schwester nicht trauen. Freundlich ist sie und garstig zugleich. Sie wird sich wieder einmischen. Ich beginne von nun an die Anweisungen zur Erziehung stets mit einem Satz zum Blasensteinschnitt. Verzeihen Sie, ich muss eilen. Ich soll Napoleon im Gefolge des Kurprinzen zur Landesgrenze begleiten. Damit der Kaiser nicht zu Schaden kommt. Wilhelm ist endlich zurück aus Paris. Ihn hätte Napoleon gerne als neuen König gesehen. Stürzen wollte er Friedrich, aber auf diese Weise gegen seinen Vater hat sich Wilhelm nicht gestellt. Hier, das Kostgeld fürs nächste Jahr. Für das Kind lasse ich Ihnen ein Documentum zukommen.«
»Wie gesagt, würden wir Nanette gerne an Kindes statt annehmen. Sie hat so viel Freude zu uns gebracht. Von Natur aus ist sie mit einem sonnigen Gemüt gesegnet.«
Bei den letzten Worten wachte sie auf und prustete Steinheil ins Ohr. Von Klein lachte und strich ihr über den Kopf. Sie war gut aufgehoben in Metzingen. Und Frau Pfarrer machte es ganz recht mit der Erziehung nach Pestalozzi.
3
Ganz nach der Anschauung lernten die Kinder lange vor der Zeit das Rechnen an zerteilten Äpfeln, ohne einen Begriff davon zu haben. Immerzu ermunterte Johanna Steinheil selbst die Kleinsten, bei allem tatkräftig mitzumachen, was das Leben erforderte.
Es war kein rechter Schlaf gewesen in der letzten Nacht in Metzingen. Sie strich über ihren dicken Bauch. Ferdinand war am Abend gekommen und packte kräftig mit an. Er verbot ihr, etwas anderes zu tun, als ein Auge auf alles zu haben.
Schwer wie ein Ackergaul bewegte sie sich seit ein paar Wochen und nahm nun neben Ferdinand auf dem Kutschbock Platz, mit einem Kissen unterm Gesäß. Er war jetzt nicht nur Finanzminister, sondern auch Geheimer Oberfinanzrat.
Für die Umzugsreise hatte sie einen Kräutersud in einem irdenen Krug bereitgestellt. Hopfen, Johanniskraut, Majoran, Melisse und Thymian zu gleichen Teilen, getrocknet auf dem Dachboden der Martinskirche, die ihr fehlen würde. Sie nahm aus einer Kelle ein paar Schluck, und langsam wurde sie ruhiger. Es schmerzte, den Kräutergarten zu verlieren. Einige Pflanzen hatte sie vorsichtig ausgegraben und in tönerne Töpfe gesetzt. Sie würden sich schwertun, in fremder Erde anzuwachsen, es war zu heiß. Noch einmal ein Bub wäre schön. Friedrich war eine rechte Freude und mit Jonathan wurde es langsam besser. Warum hatte Wilhelm gleich nach der Geburt sterben müssen? Damit Platz fürs Nanele war, sonst hätten sie es nicht nehmen können. Gott hatte es bestimmt.
Ihr Mann ritt vor ihnen und zog mit seinem Pferd den Wagen mit den Hühnern und der Ziege. Den Talar wollte er nicht hergeben und band ihn, zu einer Rolle geschnürt, hinter dem Sattel fest.
Umsichtig lenkte Ferdinand den gedeckten Wagen mit den beiden Pferden um alle Schlaglöcher. Er summte leise wie früher als Bub. Sie legte ihren Kopf an seine Schulter und ließ sich von ihm durch die Stunden schaukeln. Tief zog sie die Haube in die Stirn. Die Sonne war gar zu heiß heute. In jedem Pfarrdorf standen frische Pferde bereit, Ferdinand hatte gut vorgesorgt. Die Hunde sprangen meistens frei neben ihnen, ab und zu pfiff einer der Buben sie zurück. Eifrig räumten die beiden die größten Steinbrocken aus dem Weg und hopsten zurück auf den Pritschenwagen. Die Mädchen waren bei ihr und suchten Schutz unter der Plane. Obwohl sie im Schritttempo fuhren, kamen sie kräftig voran und erreichten die Residenz kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Der Bruder hatte sie in Waldenbuch verlassen und war auf Umwegen in die Stadt geritten, die letzten Meter kutschierte Friedrich und war ganz anstellig.
Stiftsdiakonus Dapp, ein kleines zähes Männlein, bot ihnen eine Herberge. Daher konnten sie die beiden Wagen, von den Hunden bewacht, oberhalb der Kirche im Hof des Helferhauses abstellen. Alle Tage waren dort Pfarrer mit ihren Familien zu Gast, sodass sie nicht weiter auffielen.
Von Klein kam zwei Stunden vor Mitternacht und untersuchte Johanna. »Ein wenig Schlaf wird Ihnen und dem Kind wohltun.«
In der Wohnstube legte sie sich auf die Chaiselongue, schloss die Augen und öffnete die Ohren. Die Männer redeten leise miteinander. Zum Glück war Frau Hehl nicht in der Stadt. Von Klein hatte sie für die Sommermonate nach Freudenstadt zur Kur geschickt.
»Dieses Dokument hier. Ich habe es in Metzingen angekündigt. Brechen Sie das Siegel nur im Notfall.« Von Klein verabschiedete sich, als wolle er nicht hören, was noch gesagt wurde. Sie blinzelte. Dapp warf ihr einen Blick zu.
»Sie wissen, werter Kollege«, wandte sich dieser an ihren Mann, »wie das ist, wenn ein Kind getauft werden soll. Man muss etwas hineinschreiben. Das habe ich gemacht.« Er wies auf das Schriftstück. »Für Stuttgart gibt es ein Nebentaufbuch, es liegt in meiner Verantwortung. Niemand wirft freiwillig einen Blick auf die Schande.«
Ihr Mann steckte das Dokument in ein Buch. Ob es in Metzingen auch zwei Taufbücher gab? Oder gar in Kirchberg? Nie hatte sie den Eintrag zur Taufe der Zwillinge angeschaut. Was wusste sie schon. Nur, dass sie für Nanette fast mehr Liebe empfand als für die eigenen Kinder, da sie einer Stärkung von innen bedurfte. Lange lag sie wach und lauschte auf das Schnarchen ihres Mannes, die Stundenschläge der Stiftskirche und auf das Stampfen der Pferde im Hof. Man muss etwas hineinschreiben.
Friedrich und Jonathan stürmten am nächsten Morgen in die Stube. Die beiden rissen sie aus tiefem Schlaf. Das war ihr lange nicht passiert. »Unter den Kastanien auf der Planie, lauter tote Vögel! Amseln und Spatzen, ein junges Rotkehlchen!« Abrupt setzte sie sich auf. Nanele und Louisle stolperten herein, ließen sich auf den Boden fallen und blieben bewegungslos liegen. Rosine hockte sich zu ihnen und legte die Arme um sie. Maria stampfte mit dem Fuß auf. Johanna gab den Kindern Schnupftücher. »Haltet sie euch vor die Nase, wenn ihr hinausgeht.« Rosine nahm die Zwillinge an die Hand. Maria heulte hinter ihnen her. Über der Stadt hing ein Gestank nach Kloake und Fäulnis.
»Unser Nesenbach«, sagte Dapp. »Es hat lange nicht geregnet. Heute sind die Ausdünstungen besonders schlimm, die Vögel sind von den Bäumen gefallen.« Er half ihr auf den Wagen. »Seit er König ist, klagt Friedrich ständig, dass der untere Stock des Neuen Schlosses nicht bewohnbar sei.« Er legte einen Finger auf den Mund. »Da die Herzöge ihre Residenz unbedingt im Stutengarten bauen wollten, hat Gott nichts dagegen gesagt. Der Herr behüte euch. Gesegnete Reise.«
Mühsam brachte ihr Ältester den Wagen durch eine Engstelle auf der neuen Königstraße. Sie drehte sich um. Ihr Mann fuhr hinterher und hatte ein Auge auf alles. Jonathan saß ungewohnt still neben ihm. Sie ließ das Taschentuch sinken. Über den Kastanien leuchtete die Königskrone, von der sie gehört hatte.
Sie wandte sich zu den Kindern um. Rosine wiegte Louisle, und Maria verschränkte die Arme vor der Brust. Nanette kniete aufrecht hinter ihr und schnupperte mit hoch erhobenen Händen. Wie gut ihr die Zeit im Metzinger Pfarrhaus getan hatte, wenn es auch Momente gab, in denen sie ohne ersichtlichen Grund ängstlich war. Wie bei der Abreise gestern Morgen.
Erst hatten sie und Louisle eifrig die gelben Rüben einzeln zum Wagen getragen. Lernten die Kleinen dabei doch, dass alles mit musste. Nichts zurückbleiben konnte. Das Haus war still gewesen und Nanette alleine durch die ausgeräumten Zimmer gelaufen. Sie war ihr heimlich gefolgt. Ganz verwirrt schien ihr das Nanele. In der Küche stand der Herd mit der leeren Holzkiste, hinter der es sich versteckte und gleich wieder herauskam, weil niemand nach ihm suchte. Es war die Treppe hinunter durch den Öhrn in den Hof gerannt. Johanna roch die Angst, vergessen zu werden. Nanette war nicht wie Louisle. Es war, als ob sie sich an etwas erinnern und es nicht wissen konnte. Wenn Friedrich sie kitzelte, kam sie zu sich.
Der Wagen ratterte über das Pflaster. Am neuen Königstor ließen sie die Wachen ohne Kontrolle passieren. Wie gestern Abend. Gott hatte sie erhört, und ihr Bruder hatte wohl auch seine Hand im Spiel. Niemand wollte wissen, wer sie waren. Trotzdem war sie erleichtert, als Ferdinand in Zuffenhausen die Zügel übernahm.
Zum Abendläuten erreichten sie die ersten Häuser, die zu Kirchberg zählten, fuhren aber bald noch eine Viertelstunde auf einer reinlich gehaltenen Dorfstraße an Obstwiesen und Gemüsegärten vorbei. In der langsam nachlassenden Hitze übertönte der schwere Duft von Lavendel die Würze des Josefskräutleins. Sie würde es recht bald brauchen. Viel reine Muttermilch gab es davon, und die Kinder liebten den herzhaften Geruch des Basilienkrauts. Die Häuser drängten sich dichter aneinander.
In der Magengasse neben der Lukaskirche warteten ihre Eltern. Aus Oberesslingen waren die Schwiegerleute herübergekommen. Mutter Steinheil versteckte sich unter ihrer Haube und murmelte: »Ach Gott, ach Gottle.«
Die Pferde zogen den gedeckten Wagen durch die Einfahrt in den Pfarrhof.
»Die musstet ihr also auch mitbringen!« Ihre Mutter rieb sich über das linke Ohrläppchen mit dem Haarbüschel. »Es hat noch nie Zwillinge gegeben in der Familie. Ich wollte bei der Taufe nichts sagen und euch das Fest verderben. Gleich habe ich es gesehen, dass etwas nicht stimmt. Frau Unterbürgermeister Gfrörer ging es genauso, und das Wetter war eine Strafe Gottes. Ihr wollt davon nichts wissen. Als ob eure Kinder nicht reichen. Und nun kommt wieder eines. Woher hattet ihr zwei gleiche Taufkleider? Nicht von unserer Familie und nicht von den Gegenschwiegern.«
»Liebste Mutter, alles hat seine Ordnung«, sagte Johanna leise. »Und bedenken Sie die Ohren der Kinder.«
Ihr Vater klemmte sich die Bibel unter den Arm und schob Nanette durch die Toreinfahrt zur Magengasse. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger wies er nach oben. »Der Drache wird dich fressen. Vergiss das nicht.«
Das Nanele schlug die Hände vors Gesicht und zog die Schultern hoch. Sie strich ihm übers Haar.
»Du bist groß, hilf beim Abladen«, sagte Rosine und zog Nanette mit sich.