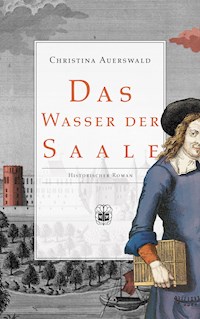
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Saalegeflüster
- Sprache: Deutsch
Halle, August 1698 Ein Augenblick genügt, um Magdalene in die Vergangenheit zu versetzen, an den Tag vor dreizehn Jahren, als ihr Bruder Christoph ermordet wurde. Christophs bester Freund Rudger steht auf dem halleschen Marktplatz, nachdem er jahrelang wie vom Erdboden verschwunden war. Was weiß er? Er war Zeuge des Mordes. Warum hat er sich nicht bei Ihr gemeldet? Als sie ihn endlich aufstöbert, findet sie ihn zwar in Armut, aber höflich und zuvorkommend. Kann sie ihm trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zuvor …
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
ZUVOR …
Ein Händedruck besiegelte das Geschäft. Einer der beiden Männer, der dreißigjährige Luxuswarenmanufakteur Daniel Vogeler aus Leipzig, steckte mit einem zufriedenen Lächeln den Beutel ein, in dem sich vierzig schwere Goldstücke befanden. Die Münzen waren frisch geprägte holländische Gulden, eine Währung, die überall akzeptiert wurde. Der andere Mann, einer der beiden Geschäftsführer des in Amsterdam ansässigen Handelskontors Visser & Bonacker, der zweiunddreißigjährige Johannes Bonacker, sah ihm mit ernster Miene zu. Sie befanden sich in einem Hinterzimmer des Gasthauses »Zum Goldenen Schwan« in Frankfurt am Main. Die Messe war gerade zu Ende gegangen, ringsum reisten die meisten Händler ab, und dass die beiden Männer überhaupt ins Geschäft kamen, blieb dem Umstand geschuldet, dass sie als letzte Quartiergäste im Gasthaus in ein vertraulicheres Gespräch geraten waren als in den zwei Wochen vorher.
Ihr Zusammentreffen im Gasthof war ein Zufall gewesen, und ein Zufall ließ sie auf den ersten Blick wie Brüder wirken, weil sie das gleiche kurz geschorene kastanienbraune Haar besaßen.
An diesem Punkt endete die Ähnlichkeit. Vogeler, lang und dünn, besaß große graue Augen und einen lachenden Mund. Sein Auftreten hatte etwas Schalkhaftes an sich, das sich erst seit wenigen Jahren, mit dem Ernst seines Berufes, um einige Grade verloren hatte. Er trug teure Kleider, ein aus glänzender Seide gefertigtes Justaucorps, ein strahlend weißes Jabot und an der Linken einen dicken goldenen Ring.
Bonacker hingegen, ein Mann mit verkniffenem Mund und schmalen Lippen, besaß grau und grün gesprenkelte Augen. Er war nur etwas mehr als mittelgroß und gedrungen gebaut, mit kräftigen Gliedern, großen Händen und breiten Schultern. Seine Kleider waren die eines strengen Calvinisten, dunkel und ohne jeden Zierrat. Johannes Bonacker sprach ausgezeichnet Holländisch ohne Akzent, obwohl es nicht seine Muttersprache war. Sein Gesicht war gebräunt, weil er sich oft am Hafen seiner Heimatstadt Amsterdam aufhielt, wo seine Gesellschaft ein Lagerhaus besaß, in dem die Waren für ihren Handel ins Baltikum gelagert wurden. Wenn ein Schiff von dort zurückkam, brachte es Pelze und Weizen und fuhr erneut aus, um das Tuch zu verkaufen, das sie aus Gent, Sint-Niklaas und Turnhout in Flandern geholt hatten.
Flandrisches Tuch war es auch, über das Bonacker mit Vogeler zu reden begonnen hatte. Vogeler war ein Bewunderer der feinen Qualität und hatte sich nach den neuesten Moden erkundigt, von denen Bonacker zwar nichts hielt, für die er aber trotzdem jeden Stoff lieferte, den ein Schneider haben wollte. So waren sie auf die Messen zu sprechen gekommen, von der Frankfurter auf die Leipziger, über die Vogeler viel wusste, weil er neben etlichen Handelshäusern in der Mitte der Stadt Leipzig wohnte. Bonacker war vor Jahren einmal in Leipzig gewesen und sprach von der Gegend in den wärmsten Tönen. Sie hatten überrascht festgestellt, dass sie gemeinsame Bekannte besaßen, und genau darin lag der vierzig Goldgulden umfassende Handel begründet.
»Ich glaube, dass Ihr die Sache richten könnt«, sagte Bonacker zu Daniel Vogeler. »Ihr habt einen wachen Verstand und seid umsichtig. Ich vertraue Euch. Gebt mir Nachricht, sobald Ihr etwas herausgefunden habt. Wenn dabei die eine oder andere Neuigkeit über Halle herausspringt, schreibt sie mir dazu. Besonders ein Handelshaus interessiert mich, Rehnikels Spezereienhandel am Klaustor.«
Daniel Vogeler lachte laut. »Nicht nur Euch, mein Freund, nicht nur Euch. Von Georg Rehnikel habe ich alles gelernt, was heute den Grundstock meiner Manufaktur ausmacht. Rehnikels Experimente liefern mir die besten Rezepte für meine Luxuswaren.«
Und nicht nur das, setzte er in Gedanken hinzu. Aber er ließ das Lächeln auf seinem Gesicht stehen, als wäre die Zufriedenheit mit dem Geschäft alles, was ihn bewegte.
»Eines solltet Ihr bedenken, Vogeler«, setzte der Holländer unerwartet hinzu, »lasst Euch in keine unrechten Sachen hineinziehen. Vom Grundsatz her glaube ich an das Gute im Menschen, aber irgendetwas ist faul an der Geschichte. Ich habe gehört, dass eine Menge Geld zu machen ist, wenn man den Zoll spart und die Grenze an einer unbewachten Stelle überschreitet. Lasst die Finger davon, ich bitte Euch. Ich will nicht auf mein Gewissen laden, dass ich Euch den Floh ins Ohr gesetzt habe, der mit Euch ins Unrechte hüpft.«
»Sicher nicht. Der Mann, den ich finden soll«, Vogeler schluckte, »ist das einer, der in unrechte Geschäfte verwickelt ist?«
Bonacker zuckte unbestimmt die Schultern.
»Dann schuldet er Euch Geld?«
»Das auch«, sagte Bonacker, und die Art, wie er es aussprach, ließ Vogeler verstehen, dass er nicht weiter in den Fremden dringen sollte. Er betrachtete den Amsterdamer Händler stumm. Der Mann klopfte mit den Fingern auf den Tisch, und das verriet mehr als die Gelassenheit, die er zu zeigen versuchte. Die Leute in Holland waren die gerissensten Händler der Welt, und um keinen Preis würde der Mann die ganze lukrative Geschichte verraten. Dass eine dahinterstand, bezweifelte Daniel Vogeler nicht. So viel verstand er vom Handel: Wer vierzig Goldgulden auf den Tisch legt, um einen Mann zu finden, der ihm Geld schuldet, der verspricht sich viel, viel mehr davon. Ein Händler holt nicht nur seinen Einsatz heraus. Ein Händler will bei jeder Sache etwas gewinnen. Es gab keinen Händler, der nicht mit jeder Faser seines Herzens davon träumte, reich zu werden.
Und das, in drei Teufels Namen, würde auch Daniel Vogeler gelingen.
1. KAPITEL
Ein einziger Blick auf einen blonden Schopf brachte alles durcheinander.
Wenn man Magdalene Rehnikel gefragt hätte, ob sie es für möglich hielt, dass ein einziger Anblick einen Aufruhr in ihrem Leben verursachen könnte, dann hätte sie noch tags zuvor energisch den Kopf geschüttelt und ungerührt weiter die Wäsche auf dem Waschbrett gebürstet. Ein einziger Anblick! Sie hätte gelächelt und ihre roten, rissigen Hände aus dem Wasser genommen, um sich mit dem Oberarm die kastanienbraune Locke aus der Stirn zu streichen.
Einen Tag später, als die Hemden auf der Bleiche beinahe trocken waren, als ihre Hände die allzu rote Farbe verloren hatten, als die Pflicht sie für die nötigen Einkäufe aus dem Haus lockte und ihr damit Gelegenheit verschaffte, sich ein paar Strahlen Sonne auf der Nasenspitze zu gönnen, geschah das, was sie tags zuvor noch ausgeschlossen hätte.
Zwar war das Wetter trüb und kühl, viel zu kalt für diese Jahreszeit, und auch das Geschäft auf dem Marktplatz blieb hinter ihren Erwartungen zurück, aber sie genoss die Abwechslung. Das tat sie bereits auf dem Weg über die Straße vom Klaustor, den Korb am Arm, mit der einen oder anderen Nachbarin in ein paar Worte Geschwätz verhakt. Mit wenigen Schritten war sie am ersten Gemüsestand. Sie kaufte ein paar Rüben und den neuen Gürtel, den der achtjährige Hans für seine Hose brauchte, beschloss, sich nach vernünftigen Schuhen für den Jungen umzusehen, und ging über den Platz zu den Händlern vor dem Roten Turm.
Die Wolken lagen wie bleierne Matten über dem Marktplatz, hockten auf der Spitze des Roten Turms und streckten ihre Arme nach den vier Türmen der Marktkirche aus. Ein feuchter Wind strich aus dem Grau. Dienstags, donnerstags und samstags fand der gewöhnliche Markt statt. Magdalene erreichte die Händler am Roten Turm, wo auch das Corps du Garde angebaut war, das Haus, in dem die Gens d’armes ihren Platz hatten. Sie fühlte mit der Hand nach ihrem Beutel. Er war noch da, innen am Gürtel, und genauso schmal wie immer. Geld war in ihrem Haushalt Mangelware. Das hielt sie nicht davon ab, umherzuschlendern, sich umzusehen und zu träumen. Magdalene liebte den Trubel, die bunten Waren, das Stimmengewirr. Sie war neugierig, was es Besonderes gab, denn irgendetwas Neues war jedes Mal dabei, Akrobaten, Schauspieler oder vornehme Leute in prächtigen Kleidern. Manchmal gab es reisende Händler, die Bänder und Spitzen aus Frankreich oder Delikatessen aus Holland anboten, oder Künstler stellten Missgeburten und Zwerge aus. Außerdem war es eine Zeit, in der sie sich keinen Pflichten unterwarf. Es war wohliges Nichtstun.
Magdalene spazierte langsam, um den Müßiggang auszukosten. Sie knöpfte den Mantel ein Stück weiter zu und band die Haube fest, weil der Wind um die Bänke pfiff und ganze Hände voll Staub zwischen die Menschen warf. Sie hoffte, jemanden zu treffen, den sie kannte, aber ihre beste Freundin Sybille war in der Woche zuvor nach Dessau gezogen, wo ihr Base Elisabeth, die dort lebte, eine Stellung im Schloss vermittelt hatte. Tatsächlich vermisste Magdalene Sybilles Geplapper zu den Neuigkeiten aus der Stadt, über das sie sich früher lustig gemacht hatte. Nicht einmal eine Nachbarin war zu sehen, darum blieb Magdalene nichts anderes übrig, als sich allein zu vergnügen. Am nächsten Stand blieb sie stehen und sah sich die angebotenen Waren an. An dieser Ecke des Marktes regierten die Töpfer, in der Auslage standen Krüge und Schüsseln. Sofort, als sie ihren Blick über die Auslagen schweifen ließ, setzte der Lobgesang der Handwerkerfrauen ein. Jede pries ihr Geschirr, streckte die Hände vor und wies auf ihre besten Töpfe. Magdalene griff nach einem blauen Krug mit weißen Tupfen und betrachtete ihn, und sofort rief die Händlerin ihr einen Preis zu. Sie wollte einen ganzen Silbergroschen dafür haben. Der Krug erinnerte Magdalene an ihre Kindheit. Sie wusste noch, dass ihre Mutter genauso einen in der Fensterbank stehen gehabt hatte.
Einen Silbergroschen für einen Krug auszugeben, war nicht drin. Die Versuchung führte dazu, dass sie trotzdem handelte, bis auf einen halben Silbergroschen sogar, aber es war nutzlos, auch den halben hatte sie nicht übrig. Sie stellte den Krug ab und schlenderte zu dem alten Schuster, der an der Ecke zum Steinweg einige Paar Stiefel aufgebaut hatte. Sie wechselte ein paar Worte mit ihm, prüfte jedes seiner Angebote und dachte darüber nach, wie dringend ihr Sohn neue Schuhe brauchte. Schließlich verwarf sie die Sache. Ein, zwei Wochen konnte es noch warten, bis dahin würden vielleicht gute Geschäfte das Einkommen der Familie verbessern. Ein paar Schritte weiter kam ihr ein buckliger Hausierer mit einer Warentasche vor dem Bauch entgegen, der Schnüre und Schnallen feilbot.
Die Wolken sanken tiefer, sie gingen mit einem Nieselregen schwanger. Der Wind grub seine Schneisen durch die Menschentrauben. Die Leute beeilten sich mit ihren Einkäufen. Die Händlerinnen mit den empfindlichsten Waren, Tuch, Leinen und Weißwäsche, verschränkten die Arme und schwenkten die Blicke gen Himmel. Auch Magdalene legte die Hand an die Stirn und sah prüfend nach oben. Hinter der Spitze des Roten Turmes zog eine schwarze Wolke auf, die aussah, als könnte sie sich gerade über dem Markt erleichtern. Dann passierte es.
Als sie den Blick senkte, sah sie einen Mann mit dem Rücken zu ihr vor einem Stand mit Ledergürteln stehen. Er strich sorgsam mit der Hand über eines der teuren Stücke, so wie sie eben über den Krug, als würde er gern etwas kaufen und spürte dem Griff des Leders nach. Der Mann war jung und trug einen blauen Mantel, neu und von guter Wolle, der seinem blonden Haar schmeichelte. Es war feines Haar, das im Wind flog, etwas länger und gerade geschnitten. Vom ersten Augenblick an wusste sie, dass sie ihn kannte. Er drehte sich um und zeigte ihr damit sein Gesicht.
Magdalene begann zu zittern. Sie erkannte den Mann. Ihn zu erkennen, bedeutete, dass sie an etwas denken musste, an das sie sonst nie dachte, und dafür hatte sie Gründe. Magdalene war eine Hausfrau von sechsundzwanzig Jahren, die tagaus, tagein ihre Pflicht tat. Wenn eine Frau für eine Familie sorgen muss, gibt es ungezählte Aufgaben; für das Grübeln bleibt keine Zeit. Sie hatte den Haushalt im Haus »Zu den Drei Rössern« zu versorgen, nahe beim Klaustor, mit zwei Stockwerken und einem Dachgeschoss, einem Hof, einem kleinen Garten und einem Stallanbau. Sie hatte sich mit Hilfe einer Magd um die Kinder zu kümmern und für ihren Mann da zu sein, den Spezereienhändler Georg Rehnikel, dreiundfünfzig Jahre alt, Innungsmeister der Krämerinnung und Vater von drei Kindern. Sie führte ein glückliches Leben, war seit acht Jahren verheiratet und lebte zufrieden mit ihrer Familie, vom Gesinde geachtet, von ihrem Mann geliebt. Für diese Auszeichnung dankte sie Gott jeden Abend im Gebet. Alles war gut. Warum hätte sie sich mit schrecklichen Erinnerungen das Leben schwermachen sollen?
Aber nun stand sie auf dem Marktplatz, und ihr zitterten die Knie. Sie hielt sich mit einer Hand am Tisch eines Töpfers fest, um nicht zu stürzen. Nicht einmal den Bruchteil eines Augenblicks hatte sie gebraucht, um den Mann wiederzuerkennen, obwohl es dreizehn Jahre her war, dass sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Sie wusste sofort, wo das gewesen war, und damals war sein Rücken der letzte Anblick, den sie von ihm zu sehen bekam. Er hatte sich verändert, war an den Schultern breiter und um die Mitte dicker geworden. Das Haar war noch dasselbe, er trug es genau wie früher. Es erinnerte sie an eine schreckliche Zeit in ihrem Leben. Wieso war dieser Mann am Leben?
Seit ihrem dreizehnten Lebensjahr hatte sie geglaubt, er sei genauso tot wie ihr Bruder Christoph, sein bester Freund. Nie gab es Anlass, am gemeinsamen Tod der beiden zu zweifeln. Aber der Mann lebte. Innerhalb eines Augenblicks war eine dreizehn Jahre andauernde Gewissheit zu Staub zerfallen. Er stand drei Schritte von ihr entfernt, als wäre nie etwas Schlimmes passiert. Seine Gesichtszüge waren dieselben wie damals, hell und weich wie Weizenbrot. Seine Nase war dicker geworden, die Wangen hingen schlaff herab, ein Doppelkinn war ihm gewachsen. Mit seinen wasserblauen Augen sah er an ihr vorbei.
Sie konnte sich nicht erklären, warum sie nicht die Hand hob und winkte. Es mochte daran liegen, dass er ungewohnt erwachsen wirkte, anders als sie ihn zuletzt gesehen hatte, als ungestümen, pausbäckigen Jüngling mit frechem Grinsen. Er schaute ernst, die Miene beinahe versteinert. Sie begriff, dass ihr Zögern noch eine andere Ursache hatte. Er ängstigte sie, weil er eine grimmige Miene zog, als wollte er die Zähne fletschen.
Sie drehte sich zur Seite, aber ihre Vorsicht war unnötig. Er sah mit so reglosem Blick an ihr vorbei, dass er sie nicht erkannt haben konnte. Entschlossen hob er das Kinn und ging mit festen Schritten in Richtung Neunhäuser. Er schlug den Kragen seines Mantels hoch und rieb fröstelnd die Hände über die Ärmel.
Als er ein paar Schritte entfernt war, gelang es ihr, sich zu fassen. Sie folgte ihm und versuchte, dabei unbemerkt zu bleiben. Er ging schnell und sie musste sich beeilen, um ihn zwischen all den Marktbesuchern nicht aus den Augen zu verlieren. Als er geradeaus über die Steinstraße hinweg in die Barfüßerstraße strebte, fiel ihr sein Name ein, nur der Vorname, denn mehr hatte sie nie gekannt: Rudger.
Christoph wäre jetzt zweiunddreißig Jahre alt, wenn er nicht vor dreizehn Jahren erschlagen worden wäre. Magdalenes Herz klopfte heftig. Seit dreizehn Jahren hielt Christoph unter der Erde seinen allerletzten großen Schlaf. Rudger und Christoph. Christoph und Rudger. Als ihr Bruder noch lebte, hatte es nie einen Zweifel gegeben, dass die beiden eins waren. Jetzt war nur noch Rudger da, Rudger allein, und das machte den Schmerz um Christophs Verlust mit einem Mal wieder so stark, dass sie ihn kaum ertragen konnte.
Rudgers Schritte führten zielstrebig fort, die Sporen an seinen Stiefeln klickten auf der steinernen Rinne in der Straßenmitte. Ohne sich umzusehen, verschwand er in einem der vorderen Häuser der Barfüßerstraße. Es war ein zweistöckiges Gebäude mit einer Handelsstube im Erdgeschoss, morschen Balken im Fachwerk, das Mauerwerk mit hellgelber Farbe übertüncht. Sie kannte das Haus, weil jeder in Halle es kannte. Hier wohnte der Jude Wolff. Wenn ein Hallenser hier eintrat, hatte er Geschäfte zu erledigen, so sagte man dazu, ein wenig verschämt, aber mit diesen Worten, die jeder verstand. Es waren Geschäfte, in denen Münzen, Schuldscheine oder Wechsel über den Tisch gingen. Man betrat das Haus nur aus diesem einen Grund, sonst hatte man nichts mit den Juden zu schaffen, den Ketzern, die für nichts anderes taugten als für Geldgeschäfte.
Magdalene blieb stehen und musterte die Tür, in deren Schatten der blonde Mann eingetaucht war. Fremde Leute passierten sie, Wagen rollten, eine Katze strich Magdalene um den Rock. Sie wartete eine Weile, aber Rudger blieb im Haus des Juden verschwunden, darum wandte sie sich ab und ging zurück in Richtung Markt.
Ihre Glieder zitterten, die Handflächen waren feucht. Dreizehn Jahre lang hatte sie ihren Bruder pflichtgemäß ins Gebet eingeschlossen, ohne etwas anderes vor sich zu sehen als den lebendigen, fröhlichen Christoph. Den Toten nicht, niemals. Dreizehn Jahre lang war der Anblick seines blutigen Leichnams aus ihrem Gedächtnis gelöscht gewesen. Das war vorbei. Ein Augenblick hatte genügt, um ihn hervorzuholen. Dieses Kapitel ihres Lebens war nicht so tief begraben, wie sie geglaubt hatte.
Statt die Klausstraße hinunter nach Hause zu gehen, wandte sich Magdalene die Rathausstraße hinauf. Mochten sie zu Hause glauben, sie hätte eine Freundin getroffen und sich verplaudert. Mochten sie glauben, sie hätte ihren Haushalt ein einziges Mal vergessen. An diesem Vormittag war es wichtiger, eine andere Pflicht nachzuholen. Viel zu lange war sie nicht mehr an Christophs Grab gewesen. Dort, hoffte sie, würde sie ihre Ruhe wiederfinden.
Die Sonne ließ sich nicht blicken, Wolken bedeckten den Horizont mit dunkelgrauen Kissen. Niesel setzte ein und verwandelte sich bald in einen satten Regen. Magdalene raffte ihren Mantel enger um die Schultern. Langsam ging sie die Straße hinauf, die hinter dem Markt gerade so viel anstieg, dass das Gehen nicht beschwerlich wurde. Ihr Weg führte zum alten Zeughaus, von dort an der Stadtmauer entlang zum Galgtor. Sie verließ die Stadt und bog hinterm Tor nach links. Dort lag der Gottesacker.
Der Regen hatte sich zu einem beständigen Rauschen entwickelt. Die Haube klebte ihr auf dem Kopf, die Feuchtigkeit zog den Mantel bleiern nach unten. Der aufgeweichte Weg führte durch den Torbogen auf den Friedhof. Der Gottesacker, eine Fläche von über zweihundert Schritten in Länge und Breite, war der schönste Friedhof des ganzen Landes, umgeben von einer Mauer aus vier Schritte tiefen Grabkammern, bekrönt von einem Dach, sodass die aneinandergereihten Grabkammern einen riesigen Hof bildeten.
Die Kammern zeigten zur Hofseite eine bogenförmige Öffnung. Draußen rumorte der Lärm der Vorstadt, drinnen zwischen den Bögen herrschte Ruhe. Selbst das Glockenläuten klang dumpf. Jede Grabkammer war an die zwölf Schritte breit und hatte ihre Besitzer. Manche Bögen gehörten der Stadt, andere hatten ein, zwei oder mehrere Eigentümer. Es war eine hohe Ehre, einen halben oder gar ganzen Bogen zu besitzen, als Familienbegräbnis oder zusammen mit anderen. Dort gab man sich der Andacht an die Verstorbenen hin, betete vor ihren Särgen, die an den Wänden der tiefen Grüfte gestapelt waren. Die Bögen waren nach dem Geschmack ihrer Besitzer auf das Prächtigste ausgestattet und mit Inschriften in Latein oder Deutsch versehen. Am Eingang mancher Kammern hatten die Besitzer kunstgeschmiedete Gitter oder Geländer anbringen lassen, um sie vor dem Zutritt durch Fremde zu schützen. An allen vier Seiten durchbrachen Tore die Reihe der Grabkammern, zur Stadt mit einem Durchgang samt Torhaus, zu den drei Landseiten hin mit Portalen. Eine Betsäule stand im Inneren des Gottesackers, Bäume ragten aus dem Grün, Efeu schlängelte sich des Wegs und umarmte den Stein. Farne gediehen im Halbdunkel.
Wind und Regen vieler Jahre hatten den Sandstein der Bögen grün und grau gefärbt, die Inschriften zerfließen lassen. Wenn die Sonne seitlich auf einen Stein schien, zeichnete sie im Schattenriss für ein paar Momente klare Buchstaben. Ein Brunnen spendete Wasser. Wenige Menschen hielten sich hier auf; schritten gemächlich und redeten gedämpft miteinander.
Magdalene ging über den aufgeweichten Weg zu Christophs Sarg. Er stand im vorletzten Bogen in der hinteren linken Gruft, Wand an Wand mit den Särgen anderer geachteter Hallescher Familien. Sie erinnerte sich an Christophs Beerdigung. Es war ein strahlend schöner Sommertag gewesen, Lerchen sangen am Himmel, als wäre das Schicksal nicht grausam und hätte sie allein zurückgelassen. Sie sah die große Zahl an Trauergästen, in den Gesichtern der meisten eine Fassungslosigkeit, die ihre eigenen Empfindungen nicht traf. Magdalene war zu diesem Zeitpunkt unfähig gewesen, irgendetwas zu empfinden. Sie war starr und stumm und weigerte sich zu glauben, was alle anderen rings um sie hinnahmen: dass ihr Bruder nie mehr wiederkommen würde, dass er sich in den steifen Toten verwandelt hatte, der drei Tage lang im Erdgeschoss ihres Zuhauses aufgebahrt gelegen hatte. Zwar hatte sie sich von dessen Existenz überzeugt, indem sie einen Blick auf den Leichnam warf, aber der Unterschied zwischen diesem und dem lebendigen, warmen Körper von Christoph, den sie noch kurz zuvor berührt hatte, machte dieses Unglück unglaubwürdig. Ihr Bruder hatte einen mattglänzenden Sarg aus dunkler Eiche bekommen, ein teures Stück, seinem Stand angemessen. Die Beschläge sahen aus wie Blütenranken, in poliertem Metall erstarrt.
Magdalene kniete vor der Gruft nieder. Der Sarg stand in dunkler Tiefe. Es war der zweite von oben, inzwischen war der Sarg eines fremden Menschen daraufgestellt worden. Magdalene konnte das Relief der Metallbeschläge erkennen, wenn Licht hinfiel. Vor den Bögen bestand der Boden aus weichem Kies. Schon viele hatten hier gekniet, aber seit Jahren waren es eher die Verwandten der anderen Toten. Seit Jahren betete kaum noch jemand an Christophs Sarg.
In den ersten Jahren nach dem Tod ihres Bruders war sie noch ein Kind gewesen und konnte sich in dieser Sache auf Anna verlassen, ihre Amme. Anna verbrachte jeden Sonntag einige Stunden hier, betete und weinte um den Jungen. Sie redete oft von ihm, so oft, dass es Magdalene zu viel wurde. Aber seit Anna tot war, hatte Magdalene mit niemandem mehr über Christoph gesprochen. Sie war seit Monaten nicht ein einziges Mal hier gewesen.
In den ersten Jahren nach seinem Tod hatte sie jeden Abend auf eine kindlich-anhängliche Weise für ihn gebetet, aber das hatte sie nun schon lange nicht mehr getan. Andere Aufgaben beherrschten ihr Leben, und die Sorge um die Lebenden minderte die Kräfte, die sie für Gedanken an den Toten verwenden konnte. Sein Gesicht verblasste, und immer öfter fiel es ihr schwer, sich an Einzelheiten seines Aussehens zu erinnern.
Sie stand auf und verharrte erstaunt vor dem Bogen. Während ihres Gebets, als sie den Blick schweifen ließ, war ihr etwas ins Auge gefallen. An Christophs Sarg, an der Ranke des Metallbeschlags, hing ein frisches Blumengebinde. Zartviolette Veilchen und Knabenkräuter leuchteten hervor. Sie blinzelte, sah ein zweites Mal hin. Nichts hatte sich geändert. Es hing eindeutig an Christophs Sarg und das Gebinde war frisch.
Für den Sarg hatte ihr Onkel Conrad eine Menge Geld ausgegeben; er war aus dem teuersten Holz, das man bekommen konnte. In eine Platte war Christophs Name graviert. Darunter stand sein Geburtsdatum, der 17. Februar 1666, und am Ende in lateinischen Worten: gestorben von fremder Hand am 23. Juni im Jahr des Herrn 1685. Eine Efeuranke war von der Wand des Bogens bis in die Gruft hineingewachsen und hatte sich um den Griff des Sarges geschlungen, als wäre das Holz zum Leben erwacht.
Ein Freund musste es sein, der das Blumengebinde zum Sarg gebracht hatte, der die Stufe hinabgestiegen war und die Blumen an den Kringel des Beschlags gesteckt hatte, wohin auch Anna früher Blumen gesteckt hatte. Das frische Gebinde konnte nur von Rudger stammen. Wer sonst sollte so viele Jahre nach dem Begräbnis noch Blumen zu einem Sarg bringen, in dem die Gebeine längst vermodert waren? Wer außer Rudger? Er war Christophs Herzensfreund gewesen. Außer Magdalene und Rudger gab es niemanden, der sich noch an Christoph erinnerte. Onkel und Tante waren strikte, sachliche Menschen und würden so etwas nicht tun. Weitere Verwandte hatten sie nicht, Anna war gestorben und die Pflicht zur Höflichkeit für Nachbarn oder Bekannte vorbei. Magdalene stand mitten im Rauschen des Regens vor dem steinernen Bogen und hielt die Hände gefaltet, und das Gebet wollte ihr auch jetzt nicht gelingen. Es war nicht der Sarg, es waren nicht die Blumen, die sie am meisten bekümmerten. Es war ihre eigene Schuld. Wie hatte sie Christoph so vergessen können? Seinen grausamen, ungesühnten Tod? Während sie daheim längst die Suppenschüsseln abräumten, lehnte Magdalene am Steinbogen der Gruft und hoffte auf die Rückkehr eines guten Gefühls, auf irgendeine Ausrede oder Ablenkung, etwas, das sie mit ihrem Versäumnis aussöhnte. Nichts davon wollte sich einstellen.
Sie hielt die Augen geschlossen. Allmählich kehrten die alten Bilder wieder. Sie sah Christoph, wie er zur Zeit der größten Schrecken in ihrem Leben ausgesehen hatte: ein hoch gewachsener, schlanker Junge von sechzehn Jahren mit dichtem rotbraunem Haar, buschigen Brauen und wilden Augen. Christophs Augen, von blassem Grau wie ihre. Das blaue Halstuch, das er stets trug. Seine dunkle Stimme. Seine Hände waren größer als die aller anderen Menschen, die sie kannte, wie Schaufeln hoben sie alles mit Leichtigkeit an. Wenn er eine Hand auf ihre schmale Schulter legte, war ihr, als müssten ihre Knochen brechen. Seine Hand war ein Schutzwall um Magdalene, den es sonst nirgends gab. Es war sogar ein Schutzwall gegen die Pest.
2. KAPITEL
Das Grauen lag siebzehn Jahre zurück. Magdalene war ein kleines Mädchen gewesen, und kleine Mädchen vergessen eigentlich schnell. Aber die Schrecken dieser Zeit hatten sich so in ihr eingebrannt, dass sie sich an jeden einzelnen Tag genau erinnerte, an jedes gesprochene Wort, jede Geste. Die Pest erreichte die Stadt, und rings um die Familie Bertram starben immer mehr Menschen. Caspar Bertram, Magdalenes Vater, wohnte mit seiner Familie am Trödel, unweit des Alten Marktes. Er besaß eines der schmalen Bürgerhäuser, das mit der Traufseite zur Straße stand und zu dessen Eingangstür zwei Stufen hinaufführten. Wenn Anna zur Wasserkunst ging, brachte sie jedes Mal neue Nachrichten mit, wer gestorben war. Anfangs kroch mit jedem Namen das Entsetzen in die Kehlen: Der auch? Und die?
Frau Elisabeth, Magdalenes Mutter, saß mit den beiden Kindern schreckensstarr in der Küche und wagte sich nicht hinaus, denn was man hörte, gab jeden Tag mehr Anlass zur Sorge. Erwachsene, gesunde und starke Menschen starben an der furchtbaren Krankheit, nicht nur kleine Kinder und Alte. Auch Anna ging bald nicht mehr hinaus, weil sie vor lauter Angst schweißnasse Hände bekam, sobald sie an der Tür stand. Sie holte das Wasser nachts, heimlich, um niemanden zu treffen. Sie mochte keine neuen Namen hören, sie mochte nicht wissen, wen sie nie mehr grüßen würde.
Caspar Bertram ging seinen Geschäften nach, solange er konnte, aber er vermied Gänge in Menschenansammlungen. Sie besaßen nur noch wenige Vorräte zum Essenkochen; selten brachte Anna über sich, einem Händler die Tür zu öffnen. Ohnehin waren die Preise unerhört gestiegen. Die Leute horteten, was sie bekommen konnten. Das Gerücht kursierte, es gäbe bald kein Mehl mehr, und daraufhin gab es tatsächlich kein Mehl zu kaufen, weil jeder zu Hause die Säcke versteckte. Niemand fand mehr Eier zu kaufen, als hätten die Hühner plötzlich das Eierlegen eingestellt. Die Händler labten sich, schimpfte der Vater, an der Knappheit. Man behauptete, jede Wirtschaft sei zum Erliegen gekommen. Das war nicht ganz die Wahrheit, denn nach wie vor gab es Wagemutige, die kauften und verkauften, aber die bestimmten die Preise.
Monatelang saß die Familie in der Küche, betete dieselben Psalmen und hoffte, dass Gott ein Einsehen hatte und die Seuche zu Ende brachte. Im Herbst des Jahres 1681 blieb die Zahl der Toten noch überschaubar und nährte die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Seuche. Der Glaube an das Bestehen der schweren Prüfung wuchs, weil es sich bei den Verstorbenen vorwiegend um Leute aus den Häusern an der Saale handelte, wo das Bettelvolk wohnte. Die Hoffnung trog. Es war lediglich der Kälteeinbruch des Winters, der die Zahl der Toten in Grenzen hielt. Der Beginn des Frühlings im darauffolgenden Jahr 1682 entfachte die Krankheit mit aller Macht, als würde sie mit dem Grün aus der Erde wachsen.
Magdalene war in diesem Frühling neuneinhalb Jahre alt. Sie hörte ihren Vater in einem leisen, aber bestimmten Tonfall sagen, dass sie aufs Land gehen sollten, in das Dorf Beesen, wo der Bruder ihrer Mutter einen Hof bewirtschaftete. Magdalene war erleichtert. Hinaus! Fort von der düsteren Stimmung in der Stadt, sich endlich bewegen! Das Herumspringen vermisste sie am meisten, weil der Vater sie seit Wochen nicht aus dem Haus ließ. Seit Wochen hatte sie keines der Nachbarskinder gesehen, nicht ein einziges Mal Verstecken oder Hüpfen gespielt. Zu dritt verließen sie ihr Zuhause am frühen Morgen eines Sonntags im April und wanderten durch die leeren Straßen, jeder ein dicht gewickeltes Bündel mit Kleidern auf dem Rücken. Es schien, als wolle der Frühling das Sterben der Menschen machtvoll ausgleichen. Das Licht rieselte honiggelb über die Hausdächer. Magdalene mit ihren rotbraunen Zöpfen lief trippelnden Schritts in der Mitte des kurzen Zuges, vor ihr die Mutter, hinter ihr der Bruder. Überall sprossen die hellgrünen Spitzen der Gräser zwischen den trockenen Halmen des Vorjahrs hervor. Die violetten Blüten des Lerchensporns leuchteten im Gebüsch. Ein gelber Marienkäfer, der erste in diesem Frühjahr, landete auf ihrem Mantel.
Die drei fielen, nachdem sie das streng bewachte Stadttor verlassen hatten, in einen gleichmäßigen und zügigen Schritt. Die Häuser der Vorstadt Glaucha hockten schweigend und dicht gedrängt an den Straßenrändern, die Läden vor den meisten Fenstern blieben auch an diesem Vormittag geschlossen. Allmählich öffneten die Höfe ihre Schöße in das freie Land. Links und rechts breiteten Gemüsegärten ihre Arme aus, aber auf ihnen standen Wegerich, Brennnesseln und erfrorener Kohl aus dem Winter. Niemand bestellte seinen Acker, auch nicht die, die noch lebten. Die Menschen blieben in ihren Häusern, nicht einmal Bettler oder Hausierer waren zu sehen. Christoph, Magdalene und ihre Mutter wanderten über den Feldweg. Der Pfad war klebrig von der nassen Erde, das Gehen beschwerlich.
Es war der Tag, der auf den folgte, an dem sie eilig ihre Großmutter beerdigt hatten, die in der Brüdergasse gelebt hatte. Die alte Frau war gestorben, ohne dass Magdalene sie in ihren letzten Tagen noch einmal zu Gesicht bekommen hatte. Der Eifer, mit dem die Familie die Kranke zwei Wochen lang versteckt gehalten hatte, ließ Magdalene vermuten, dass auch sie der Pest zum Opfer gefallen war. Bis zu ihrem Sterben war die Familie verschont geblieben, weder bei Conrad noch bei Caspar Bertram war jemand aus der Familie oder dem Gesinde krank geworden. In den Menschen scheint der von Hoffnung getragene Glaube verankert zu sein, Furchtbares träfe zuerst die anderen und nicht einen selbst. Der Tod war zunächst in den ärmeren Straßen am Saaleufer geblieben, in den Straßen der Hurenhäuser, der Spelunken, der betrügerischen Krämer; er rekelte sich wochenlang im Spital an der Moritzkirche und bleckte die Zähne nach den Vorstädten. Ein Hochwasser fraß etliche Häuser auf dem Strohhof vor dem Klaustor und lenkte die Aufmerksamkeit für einige Tage von der Seuche ab. Einige Leute meinten, in den Vorstädten müssten Gottes Strafen am meisten zu spüren sein, dort seien sie schließlich verursacht worden.
Dann löste sich die scheinbare Grenze auf. Die ersten Vorfälle tiefer in der Stadt geschahen am Trödel, vertuscht und verheimlicht, und auch Caspar Bertram redete mit seiner Familie nicht darüber. Das trügerische Gerechtigkeitsempfinden hielt sich bis zum Ende ihrer Großmutter, dann machte es Platz für tiefes Entsetzen, das in jeden Winkel ihres Hauses kroch. Hätte man herausbekommen, dass die Großmutter nicht wie behauptet an Altersschwäche gestorben war, dann wäre die Familie zu einer quarantaine de jours verurteilt gewesen, einer vierwöchigen Verbannung ins eigene Haus. Man hätte sie eingesperrt und die Türen vernagelt. Für vier Wochen reichten ihre Vorräte nicht, das wusste der Vater, und niemand von ihnen hätte noch etwas zu kaufen bekommen, wenn man von dem Krankheitsfall erfahren hätte, ganz abgesehen davon, dass sie keinen Brunnen besaßen und die vom Rat bestimmten Pestdiener zu dezimiert waren, um ihren Versorgungsaufgaben nachzukommen. Die grausame quarantaine, gleichbedeutend mit dem Tod entweder durch Hunger, Durst oder die Pest, wollte der Vater ihnen ersparen. Das war der Grund für den schnellen Aufbruch.
Es war ein Fußweg von nicht einmal zwei Stunden, der die kleine Gruppe zu ihrem Ziel führte, einem Gehöft aus Scheune, Stall und Wohnhaus, dazu einer Toreinfahrt an der vierten Seite. Es lag außerhalb des Dorfes, auf einem erhöhten Platz in der Nähe der Stelle, wo sich Saale und Weiße Elster vereinigen. Die drei fanden die Torflügel verschlossen. Die Sonne schien hell, es war Mittag. Von drinnen hörten sie Geräusche: das Klappen einer Tür, das fortgesetzte Bellen des angeketteten Hofhundes, Schritte durch das Haus. Die Stalltür knarrte. Es roch nach warmem Kuhmist.
Zuerst klopften sie. Die Mutter rief nach ihrer Schwester, die dort wohnte, sagte ihren Namen und dass sie Zuflucht suchten. Magdalene, die sich auf den Hof gefreut hatte, weil sie sich an frühere Besuche erinnerte, an frisches Brot und warme Eier aus dem Nest der Hühner, hielt sich an der Hand ihres Bruders fest und sah mit großen Augen zu ihm auf. Die Mutter rief, flehte, aber sie bekam keine Antwort. Nach langem Warten hörten sie eine Stimme. Es war die Tante, die ihnen aus dem sicheren Hort hinter der Mauer zurief, sie sollten in ihre verseuchte Stadt zurückgehen. Dieser Hof sei von der Pest frei, aber wenn man Leute aus dem verseuchten Halle hineinließe, so wie sie, sei es mit ihnen vorbei. Sie sollten weggehen und sie nicht mit in den Tod reißen.
Die drei blieben den ganzen Nachmittag in der Nähe der Hofmauer. Wohin hätten sie gehen sollen? Hierher würde Magdalenes Vater kommen, wenn er seine Angelegenheiten geregelt hatte, und in die Stadt würden sie nicht mehr hineingelassen. Wer die Stadt einmal verließ, musste draußen bleiben. Das hatte der Rat verfügt, um die Seuche einzudämmen.
Sie liefen ratlos um das Gehöft herum. Das leise Murmeln der beiden Flüsse war bis zu den Häusern zu hören, dazu das Schnaken von Enten, der Flügelschlag der Vögel und das Klappern eines Storches. Als es dunkel wurde, lehnten Elisabeth Bertram und ihre Kinder sich nebeneinander an die Mauer, aus deren körnigem Rumpf der Sand rieselte. Magdalene war so kalt, dass ihre Zähne klapperten, aber sie wagte nicht zu jammern. Ihre Finger waren steif, die Füße gefühllos, und im Gesicht stand ihre Nase rot wie eine Mohnblume. Die Mutter breitete eine Decke über das Mädchen, sodass es, den Kopf auf ihrem Kleiderbündel, trotz der Kälte einschlief.
Magdalene erwachte von der Feuchtigkeit des frühen Morgens. Sie hatte Mühe, sich zu erinnern, warum sie sich in dieser ungewohnten Umgebung befand, steifgefroren und mit dem sanften Rauschen des Flusses im Ohr. Es dämmerte rötlich. Dicht bei ihr lag ihre Mutter, den Rücken halb an die Mauer gelehnt. Nur ihr leises Schluchzen war zu hören. Magdalene blieb starr liegen. Als sie ihren Blick wendete, sah sie in die offenen Augen ihres Bruders, der den Zeigefinger über die Lippen legte.
Der aufsteigende Morgen brachte etwas Wärme, im Gelb der Mauer verfing sich die Morgensonne. Das Mädchen sah zu, wie die Mutter aufstand und in den Himmel sah. Dort oben war eine verfrühte Lerche zu hören, die so laut zwitscherte, dass es ihr grell in die Ohren fuhr.
Über den Feldweg näherte sich ein Reiter. Magdalene erkannte eine dunkle Gestalt mit wehendem Mantel. Der schwarze Tod, durchzuckte sie der erste Gedanke. Es war ein schwarzes Pferd und auch der Mantel des Mannes war schwarz, sein Hut tief in die Stirn gedrückt. Solche Zeichnungen hatte sie auf Flugblättern gesehen, unter dem Hut ein Totenschädel und darunter mit verschnörkelten Buchstaben: Morbus Pestilenzis. Der Reiter, der sich ihnen näherte, besaß keinen Totenschädel. Es war das Gesicht ihres Vaters. Er ritt bis auf wenige Schritte an ihren Lagerplatz heran. Christoph, der ihm entgegenlief, stockte und blieb stehen. Von diesem Moment an durchraste Magdalene ein Erschrecken bis tief ins Mark ihrer Knochen, es hörte nicht auf zu rasen, es war so stark, dass sie es auch als erwachsene Frau manchmal noch spürte. Am Hals ihres Vaters prangte eine schwarze Beule.
Sie hatte in der Stadt Bettler mit solchen Beulen gesehen. Sie krümmten sich am Straßenrand im Fieber und starben irgendwann. Manche lagen tagelang ohne Begräbnis an derselben Stelle, umsummt von Fliegen und von Käfern bekrochen, bis einer der Pestdiener die Leiche auf seinen Karren lud. Hier draußen gab es keine Pestdiener. Hier gab es nur weites, leeres Land, unbestellten Acker und ein verschlossenes Hoftor. Ihr starker, sonst so unerschütterlich ruhiger Vater zitterte auf seinem Pferd, so heftig, dass sie es aus der Entfernung von zehn Ellen sehen konnte.
»Ich wollte euch in Sicherheit wissen, ehe ich sterbe«, sagte er. »Ihr dürft mich nicht berühren.«
Die Mutter ging auf ihn zu, aber er wehrte sie mit einer Handbewegung ab. »Es geht uns gut, mach dir keine Sorgen«, flüsterte sie bebend. Der Vater ächzte und sank auf dem Pferderücken in sich zusammen, und wäre seine Frau ihm nicht zu Hilfe gesprungen, dann wäre er vom Pferd gefallen. Christoph näherte sich, aber ein scharfes Wort ließ ihn erstarren. Versteinert sah der Junge zu, wie seine Mutter den schlaffen Körper ihres Mannes mühsam über das Erdreich schleifte und an die Mauer lehnte. Magdalene hockte, die Beine angezogen und die Arme darum geschlungen, mit aufgerissenen Augen ein Stück entfernt an derselben Mauer. Nicht nur Magdalenes Vater, die gesamte heile Welt lag im Sterben.
Ihr Vater tat am gleichen Abend seinen letzten Atemzug. Er sagte kein einziges Wort mehr, nur sein Stöhnen drang in ihre Ohren. Er blieb, wo er war, zehn Schritte entfernt zu Füßen der Mauer auf dem kalten Erdreich. Auch die Mutter ging nicht mehr fort. Sie blieb neben dem Toten sitzen. Im folgenden Morgengrauen, nicht einmal einen halben Tag nach ihrem Mann, starb auch sie. Magdalene sah die Blicke der beiden erlöschen, nachdem sie über Stunden ihr Ächzen gehört hatte, dann das Ende der keuchenden Laute und die mühsamer werdenden Atemzüge, sie hörte das letzte Röcheln und fühlte sich, als geschähe es nicht ihr selbst, sondern einer anderen, fremden Person. Vaters Pferd war fort, vielleicht war es weggelaufen oder auch gestorben. Magdalene war es egal.
Christoph begann, mit bloßen Händen im weichen Ackerboden zu scharren, und Magdalene tat dasselbe. Sie benutzten einen Ast und einen Stein, gruben und schaufelten und schufen auf diese Weise ein Loch, das groß genug war, um die beiden Toten hineinzulegen. Es gab nichts, was sie sonst für ihre Eltern tun konnten, nur, eine Grube zu schaffen, damit ihre Leichname nicht von Tieren gefressen würden.
Später, wenn sie daran dachte, wunderte sie sich, dass dies innerhalb weniger Stunden geschah. Als sie am Saaleufer hockte, schien es die Zeit nicht mehr zu geben. Magdalene existierte, und sonst nichts. Vater hörte auf zu sein, Mutter hörte auf zu sein, die Zeit hörte auf zu sein, die Welt schmolz zu einer hohlen Hand voll Saalewasser. Wenn es keine Zeit mehr gibt, gibt es auch keinen Unterschied zwischen dem Sein und dem Nichtsein. Wenn einer gestern gewesen ist und heute nicht mehr ist, dann ist es besser, wenn Gestern und Heute gar nicht existieren. Dann ist nicht wahr, dass Tote tot sind. Mit diesen Gedanken überstand Magdalene diese ersten Stunden ohne ihre Eltern.
Auf der rötlichen Decke des Himmels standen Sterne. So sehr Magdalene sich selbst betrog, sie konnte nicht verhindern, dass rings um sie das Verrinnen der Zeit sichtbar wurde. Die Sterne bewegten sich, sie schoben sich unerbittlich in den Morgen. Magdalene wandte den Blick ab, um nicht mit ansehen zu müssen, wie schnell sich das Firmament veränderte. Sie betrachtete die Wirbel im Strom. Selbst wenn sie in der Lage gewesen wäre zu schwimmen, von der Kälte des Wassers würde sie binnen weniger Minuten sterben. Sie nahm dem Saalewasser das Versprechen dankbar ab. Ein bisschen noch, sagte sie dem Fluss, einen Augenblick musst du auf mich warten, ich komme gleich.
Das Licht des neuen Tages leuchtete am Horizont, als es in der Uferwiese neben ihr raschelte. Christoph setzte sich ins Gras. Seine Lider waren rot, seine Augen glühten wie die eines tollwütigen Hundes. Er sah seine Schwester nicht an und redete nicht, legte nur seine Hand auf ihren Arm und hielt sie fest.
Sie blieben den ganzen Tag am Saaleufer sitzen. Als es Abend wurde, stand Christoph auf, und Magdalene folgte ihm. Sie gingen in Richtung des nächsten Dorfes. Christoph schien sich nicht darum zu kümmern, ob seine kleine Schwester ihm folgte; er musste sie hören, denn sie stakste hinter ihm in dem Versuch, Erwachsenenschritte nachzuahmen. Die Nacht verbrachten sie in einer Scheune am Dorfrand. Magdalene dämmerte im Halbschlaf, sie träumte, sie säße auf einem Boot mit geteerten Planken und glitte über die glitzernden Scherben. Im Traum stand sie am Bug, während das Boot in lautlosem Vorwärtsgleiten Welle um Welle fraß. Es war kein Fluss, es war ein Ozean, die Wellen wurden größer und hoben sich über ihren Kopf. Langsam erwachte sie, sah sich verwirrt in der Scheune um und brauchte einige Zeit, um sich ins Gedächtnis zu rufen, wie sie hergekommen war.
Von diesem Tag an gingen sie jede Nacht woanders hin, bettelten, stahlen und versteckten sich. Zu trinken gaben ihnen die Saale oder der Regen, der von den Dächern lief und in Pfützen stehen blieb. Magdalene war gleich, wohin sie gingen, solange sie in der Nähe der Saale blieben. Der Fluss würde sie zu sich nehmen, wann immer sie das wollte. Sobald der letzte Weg verschlossen war, würde sie zum Flussufer gehen und den Schritt tun, von dem Christoph sie abgehalten hatte.
Sie hob sich diesen Schritt einen Tag auf und noch einen, und so wurde es Sommer. Christoph suchte ihren Weg und ihre Nahrung, und sie tat, was er tat. Magdalene fror nicht mehr; es war warm genug, um im Freien zu schlafen und von den Feldern und aus den Gärten zu essen. Mit anderen Menschen redeten sie nicht. Die Leute warfen mit Steinen nach ihnen und schrien: »Bettelpack!« Magdalene konnte nicht glauben, dass sie gemeint waren, die Kinder eines geachteten Juristen aus der Stadt. Aber vielleicht musste sie alles vergessen, was einmal gewesen war. Den Juristen gab es nicht mehr, er war nur noch ein Haufen Knochen und verwesendes Fleisch unter einer dünnen Erddecke am Rand eines Ackers. Vergessen all das, was früher ihre Zeit schön gemacht hatte: ein Becher Milch am Morgen, ein Hüpfspiel auf der Straße, ein Gutenachtkuss der Mutter, eine weiche Decke in der Nacht. Es gab keine schönen Tage mehr, nur noch Tage, die vergehen mussten. Vielleicht war sie jetzt nur noch Magdalene, das Bettelmädchen. Christoph und sie blieben in der Nähe ihrer Heimatstadt Halle, umkreisten sie in kleinen und großen Schleifen und gingen durch Dörfer, die nicht weiter davon entfernt waren als drei oder vier Stunden Fußweg.
Manchmal gab ihnen eine mitleidige Seele etwas zu essen, aber das kam in diesen traurigen Monaten nur selten vor. Zu viele wie sie gab es, denen die Pest alle Angehörigen geraubt hatte. Um eines der Dörfer kreiste Christoph lange, dort wohnte eine Bauernfamilie, mit deren Sohn er befreundet war und der ihm hin und wieder etwas zusteckte. Es war ein winziges Dorf aus Katen am Ufer des Reidebaches, der eine Schneise zwischen die Gemüsefelder grub. Christoph verzweifelte beinahe an der Gesellschaft seiner Schwester. Magdalene redete nicht, obwohl er sie oft ansprach, saß nur im Gras und starrte in den Himmel. Er fragte immer wieder, redete, schrie sie an, gab ihr Ohrfeigen. Es nützte nichts. Sie gab keinen Ton von sich. Stundenlang entfloh er der Gesellschaft seiner stummen Schwester. Magdalene blieb in der Hütte aus Zweigen hocken, die Christoph für sie in einer geschützten Senke am Bach gebaut hatte, und starrte aus der Türöffnung in die Wolken.
Gegen Ende des Sommers kamen sie wieder durch Beesen. Sie schlichen sich nahe an den Hof ihres Onkels und ihrer Tante heran. Die Torflügel waren wie beim letzten Mal verschlossen, als wären seit dem Tod der Eltern nicht sechs Monate vergangen, nur, dass kein Hund mehr bellte und auch sonst kein Geräusch zu hören war. Christoph versuchte nicht, in den Hof hineinzugelangen. Er blieb am Ackerrain stehen und betrachtete das unbestellte Feld, an dessen Rand, wenn man genau hinsah, die Spuren des Grabes zu sehen waren, das sie mit ihren Händen geschaffen hatten. So, wie Christoph mit verlorenem Blick auf den schweren braunen Boden starrte, sah Magdalene auf einmal, was er sah, sie sah die Körper ihrer toten Eltern in diesem ungeweihten Grab liegen. Ihr war erbärmlich einsam zumute. Als hätte sie ihre Eltern nicht all die Zeit vermisst, überfiel die Sehnsucht nach Mutters Hand auf ihrem Haar sie so sehr, dass sie wider alle Vernunft redete. »Ich will nach Hause!«
Augenblicklich kroch Totenstille über den Acker, alle Vögel hörten zu singen und die Grillen vergaßen das Zirpen. Christoph drehte sich mit erhobenen Brauen um und betrachtete seine Schwester so kritisch, wie er sie all die Monate nicht betrachtet hatte. Eine Weile stand er still und dachte nach. Dann zupfte er ihr ein paar Grashalme aus dem verfilzten Haar und sagte: »Komm.«
Christoph ging geradewegs auf die Stadt zu. Obwohl man Halle anfangs nicht sehen konnte, musste er wissen, wo es lag. Bald tauchten in der Ferne die vier Türme der Marktkirche auf, daneben die Spitze des Roten Turms, und Magdalenes Herz begann bei diesem Anblick schneller zu klopfen. Es war ein Mittag zu Ende September, als sie nahe an das Rannische Tor herankamen, das die Stadt nach Süden hin abschloss. Magdalene konnten schon durch seine große Öffnung schauen und erkannte ein kleines Stück der Straße. Die Sonne bedachte das Pflaster mit mattem Glanz, der Wind hob Heu von den Wiesen an der Straße. Geschäftigeres Treiben als im Frühjahr belebte die Wege, Wagen rollten, Passanten mit Gepäck und Körben gingen vor und hinter ihnen.
Kurz vor dem Tor hielt einer der Wächter seinen Spieß vor Christophs Brust. »Bettler dürfen nicht herein.« Christoph straffte seinen Rücken, Protest färbte seine Wangen rot, aber er gab keinen Ton von sich. Magdalene erkannte mit einem Mal, wie sehr ihr Bruder in diesem Sommer gewachsen war.





























