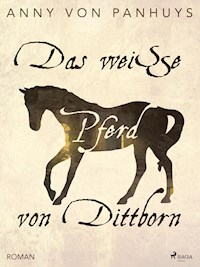
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit der jungen Josefa Burger. Mit fünf Jahren verliert sie die Mutter, von der sie die Schönheit, die Musikalität und das Zigeunerblut erbt, zehn Jahre später ist auch ihr Vater tot. Groß ist das Glück, als ihr eine Stelle als Gesellschafterin in Mecklenburg auf Schloss Dittborn zugesagt wird. Allerdings gibt es viele Gerüchte um das Schloss, in dem es so spuken soll, dass keine Gesellschafterin es dort lange aushält. Vor nichts fürchtet sich Josefa weniger als vor Gespenstern, aber seltsam ist die Stimmung in dem großzügigen und elegant eingerichteten Schloss schon. Baronin Dittborn ist keineswegs eine pflegebedürftige weißhaarige Dame, sondern eine robuste Frau, die im scharfen Galopp über das Land reitet. Der junge Baron, ein gut aussehender Dreißiger, ist so zurückhaltend wie pflichtbewusst und Gäste oder Einladungen scheint es nicht zu geben. Doch Josefas stille Heiterkeit bringt Leben in das düstere Schloss und mit ihrem emotionalen Geigenspiel öffnet sie endgültig die Herzen: bald erfährt Josefa den Grund der verhaltenen Traurigkeit und auch die Geschichte des weißen Pferdes, das die Baronin immer wieder zu Tode erschreckt. Als es eines Tages auch ihr begegnet, ahnt sie schnell, was wirklich hinter dem Spuk steckt ...Die Geister der Vergangenheit – eine ungewöhnliche Liebesgeschichte!-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Das weiße Pferd von Dittborn
Roman
Saga
Das weiße Pferd von Dittborn
© 1920 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570470
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Josefa Burger lehnte am offenen Fenster des Erdgeschosses und blickte erwartungsvoll dem Briefträger entgegen, der eben drüben, jenseits der schmalen Kleinstadtstrasse, aus einem der Häuschen trat. Er zeigte ihr schon von weitem einen Brief, den Josefa, nachdem ihn ihr der Mann zum Fenster hereingereicht hatte, hastig öffnete. Ihr Herz klopfte heftig, und in ihrem Kopf war nur der einzige Gedanke: Lieber Gott, wenn man mich auf Dittborn doch nur haben will! —
Sie las hastig und dann färbte sich das schmale bräunliche Gesicht von dem Freudenrot, das in ihre Wangen strömte.
„Frau Kruschina !“ rief sie laut und eilte hinaus in die Küche, wo die Frau des Stadtkapellmeisters Kruschina eben dabei war, das Frühstück für ihren Gatten herzurichten.
„Frau Kruschina, liebe Frau Kruschina, endlich habe ich eine neue Stellung gefunden, es war aber auch die höchste Zeit, ich durfte Ihrer Güte doch nicht länger zur Last fallen.“
Das junge Mädchen holte den Brief aus dem Umschlag hervor und las der zuhörenden, grauhaarigen Frau vor:
„Unter allen Bewerberinnen, die sich für den Gesellschafterinposten bei meiner Mutter meldeten, gefallen sowohl meiner Mutter als auch mir Ihre Bedingungen sowie Ihr Bild am besten und bitten wir Sie, die Stellung möglichst sofort anzutreten. Einer Drahnachricht, mit welchem Zuge wir Sie erwarten dürfen, damit Sie abgeholt werden können, entgegensehend, hochachtungsvoll Freiherr von Dittborn.“
Josefa streichelte das gelbliche Briefpapier.
„Ach, liebe Frau Kruschina, wie froh bin ich, endlich Unterschlupf gefunden zu haben.“
Die ältliche Frau nickte bedächtig. „Hoffentlich ist der Unterschlupf gut und von Dauer.“
Das junge Mädchen lächelte. „Ich bin voll guten Mutes,“ und, ernst werdend, sprach sie weiter: „Ob ich es allerdings noch einmal im Leben so treffen werde, wie bei Frau von Durkhardt, bei der ich Verwaiste drei Jahre lang wie im Elternhause lebte, das glaube ich kaum.“
Die andere nickte bestätigend.
„Frau von Durkhardt war auch die Güte selbst, und ich glaube, wenn sie der Tod nicht gar so plötzlich weggerissen hätte, dann wären Sie von ihr in ihrem Testamente sicher bedacht worden, aber sie starb zu jäh.“
Das dunkelhaarige Mädchen blickte sekundenlang sinnend vor sich hin, und dann strich es mit der Hand über die Stirn. — „Wollen nicht von traurigen Dingen reden, Frau Kruschina, denn jetzt habe ich nur Grund, mich darüber zu freuen, so schnell untergeschlüpft zu sein, und morgen früh will ich reisen, erst werde ich den Fahrplan studieren und dann gleich nach Dittborn Drahtnachricht senden.“
Josefa Burger verliess eiligst die Küche. Die Frau trug ihrem Manne das Brett, auf dem sie das Frühstück zusammengestellt, ins Zimmer, in dem er gemütlich auf dem Sofa sass und ihrer wartete.
„Fräulein Josefa hat nun eine Stellung, die Baronin Dittborn wünscht sogar, sie möge gleich kommen,“ erzählte die Frau die Neuigkeit an ihren Mann weiter.
Der behäbige Alte mit der dünnen grauen Stirnlocke, auf die er sehr stolz war, klopfte mit dem Löffelstiel ein Ei auf.
„So hat sie nun einen Posten, das arme Ding. Möge sie wenigstens Glück haben, denn das muss man ihr gönnen.“ — Er trank einen Schluck des heissen Kaffees. „Hat viel Pech gehabt, das ‚Zigeunermädchen‘, denn den Namen wird sie hier nun nicht mehr los. Erst stirbt ihre Mutter, die ja tatsächlich eine Zigeunerin gewesen sein soll, die sich der Maler Burger irgendwo aus Kroatien mitbrachte, dann stirbt der Vater, der viel Geld verdiente, aber nichts als ein paar angefangene Bilder hinterliess. Darauf nimmt Frau von Durkhardt das Mädchen als Gesellschafterin und Vorleserin zu sich ins Haus, um dann plötzlich zu sterben, ohne das arme Geschöpf mit einer Kleinigkeit zu bedenken. Nun muss sie sich nach einer neuen Stellung umtun, und bis sie die gefunden, botest du ihr unser Heim zum Aufenthalte an, Marie, das half ihr ein bisschen über den Berg.“
Frau Kruschina lächelte in leichter Verlegenheit.
„Hab’ das Zigeunermädchen schon gern gehabt, als es noch ein verwöhntes Elternkind war und mit dem Violinkasten zu uns ins Haus kam, um von dir unterrichtet zu werden. Man muss sie ja liebhaben,“ setzte sie innig hinzu, „sie ist so frisch und gutherzig und so wunder-, wunderhübsch.“
Der Kapellmeister kaute mit vollen Backen, und wenn auch etwas undeutlich, wiederholte er: „Wunder-, wunderhübsch.“ Nach einer Weile meinte er: „Wie heisst das Gut, wo sie nun hinreist?“
„Dittborn, genau so wie die Herrschaft, die es bewohnt, und es liegt in Deutschland, in der Mark Brandenburg,“ erfolgte die Antwort.
„Dittborn, Dittborn,“ sagte der alte Herr langsam, die Silben dehnend, vor sich hin. „Mir ist der Name schon letzthin aufgefallen, ich muss irgend etwas gehört oder gelesen haben, worin Schloss Dittborn erwähnt wurde.“
„Dittborn, Dittborn,“ sprach ihm seine Frau nach, „aber natürlich, eben fällt es mir auch ein.“ Sie schenkte ihrem Manne eine frische Tasse Kaffee ein und nahm in einem altmodischen Strohsessel Platz. „Da war letzthin in einem Heft unserer ‚Wochenwarte‘ eine Auslese von alten deutschen Schlössern, in denen es spuken soll. Von der weissen Frau in den Hohenzollernschlössern an, war da allerlei vermerkt. Schloss Dittborn war auch genannt, aber wer dort spukte, das habe ich wirklich vergessen.“
Der Kapellmeister nickte.
„Hast recht, Marie, nun weiss ich, weshalb mir der Name bekannt vorkam. Sage mal, kannst du das betreffende Heft nicht herbeischaffen, jetzt, nachdem ich weiss, Schloss Dittborn ist vorläufig Josefas zukünftige Heimat, möchte ich die Stelle, in der über Dittborn gesprochen wird, nochmal lesen.“
Josefa Burger trat nach raschem Anklopfen zum Ausgang gekleidet ein.
„Guten Morgen, Herr Kapellmeister, nun, haben Sie schon von Ihrer Frau das Neueste vernommen. Ja? — Ich habe mich inzwischen mit dem Reisehandbuch beschäftigt und herausgebracht, dass ich morgen früh mit dem Sechsuhrzug fahren muss, dann bin ich nachmittags um drei auf der Station Greifstal, von wo aus ich nach dem Gute abgeholt werde.“
Der Kapellmeister erzählte dem jungen Mädchen, worüber er soeben mit seiner Frau gesprochen.
Josefas dunkle Augen leuchteten.
„Das wäre famos, wenn es auf Dittborn spukte, habe für dergleichen immer eine grosse Neigung gehabt, und ich kann mir nichts Drolligeres denken, als wenn ich abends in den Schlossgängen irgendeiner alten Ahnfrau auf die Schleppe träte, oder einem Ahnherrn gegen den rasselnden Harnisch stiesse.“
Frau Marie hob abwehrend die Hand. Sie hatte ein Heft aus einem Schränkchen genommen und blätterte nun darin. Auf eine Seite deutend, hielt sie es Josefa Burger hin. Die überflog einige Zeilen und las dann laut vor:
„Auch auf Schloss Dittborn in der Mark Brandenburg geistert eine alte Sage. Dort kündet nämlich ein grossmächtiger Schimmel den Schlossbewohnern besondere Geschehnisse an, heisst es.“ Josefa Burger schwenkte das Heft. „Ein Schimmel spukt auf Dittborn, ein Schimmel. O, das ist doch wenigstens mal etwas anderes, als die ewigen Ahnen.“
Frau Marie kniff die Lippen ein. „Vor einem Pferde würde mir mehr graulen, als vor einer spukenden menschlichen Gestalt.“
„Bleiben Sie lieber noch ein bisschen bei uns und suchen Sie sich in Ruhe hier in Österreich eine minder unheimliche Stellung,“ meinte der Kapellmeister.
Josefa Burger lachte silberhell. „Bewahre, nun freue ich mich erst richtig auf Dittborn, und wenn ich dem Spuk begegne, dann schreibe ich Ihnen darüber, Herr Kapellmeister.“
Sie rückte das schwarze Seidenhütchen tiefer in die Stirn. „Jetzt muss ich aber zur Post, mein Telegramm besorgen!“ —
In der nächsten Morgenfrühe nahm Josefa Burger in einem Abteil des D-Zuges Platz, und ihr weisses Taschentüchlein wehte zum Fenster hinaus, solange die umflorten Augen das alte Kapellmeisterehepaar zu erblicken imstande waren. Sie fuhr sich mit dem Tuch über die feuchtgewordenen Wimpern und nahm Platz. Der Abschied von den lieben Menschen war nicht leicht gewesen. Fast zwei Monate hatte sie in ihrem kleinen Hause gelebt, selbstlos hatte sich das alte Paar ihrer Verlassenheit erbarmt, und die geringe Summe, die sie sich bei Frau von Durkhardt erspart, wäre während der Wartezeit nach einer neuen Stellung längst draufgegangen, wenn sie Wohnung und Nahrung hätte bezahlen müssen.
Josefa Burger befand sich allein in dem Abteil, und sie konnte ungestört ihren Gedanken nachhängen.
Ihre ganze Vergangenheit wurde wach und formte sich zu Bildern zusammen, die wie ein leise zitternder Film an ihrem Denken vorüberzogen. Sie meinte, wieder die dunkelhaarige, wunderschöne Mutter zu sehen, die so jung sterben musste, und den lebenslustigen Vater, der mit Pinsel und Palette die Welt erobern wollte und kaum genügend zusammenbrachte, um seine letzte Ruhestätte bezahlen zu können. Just achtzehn Jahre war sie gewesen, als dem Vater die schaffensfrohen Arme müde niedersanken. Damals nahm sich die reiche Frau von Durkhardt ihrer an, und drei Jahre brachte sie in deren schöner Villa zu, bis der unersättliche Tod sich unerwartet diese mütterliche Herrin holte. In jenen schweren Tagen hatten ihr die Kruschinas angeboten, zu ihnen zu ziehen, bis sich ein neuer Wirkungskreis für sie erschlossen. In einer Berliner Zeitung, die ihr der Zufall in die Hände spielte, fand sie ein Inserat, in dem auf ein Gut in der Mark für eine ältere Dame eine Vorleserin und Gesellschafterin gesucht wurde. Sie spürte Lust, Deutschland kennenzulernen und meldete sich darauf, um nach zweimaligem Briefwechsel einen Abschluss zu erzielen.
Josefa schaute hinaus in die herbstliche Landschaft, und das Herz ward ihr bedrückt, da sie nun sann, wie lange sie wohl die deutsch-böhmische Heimat nicht mehr sehen würde. Über den lieblichen Bergen lag die Oktobersonne, und wie goldene Tücher hing ihr kosender Schein um die schon etwas gelbblätterigen Bäume und bräunlichen Hecken. Schimmernd goldflüssig wand sich ein Bächlein durch die noch grüne Wiese, und Dörfer schmiegten sich in die Täler ein, als suchten sie Schutz vor Wetter und Feinden. — Wie herrlich die Heimat war, niemals war dem Mädchen das stärker zum Bewusstsein gekommen als jetzt, da sie dieselbe vielleicht für lange meiden musste.
Gewaltsam schüttelte Josefa Burger die schwermütigen Gedanken ab, ihre Natur war zu froh und heiter, um sich vollständig unterkriegen zu lassen, sie wollte lieber an das denken, was sie erwartete. — Wie mochte die Baronin Dittborn sein und ihr Sohn, der sehr kurz und kein Wort zuviel zu schreiben pflegte.
Eigentlich hätte die Baronin doch selbst schreiben können, aber vielleicht war sie leidend. — Ach, wozu über Dinge grübeln, für die ihr alle festen Umrisse fehlten.
Sie holte sich ein Buch aus ihrer Reisetasche und begann zu lesen. Ab und zu schaute sie auch in die Landschaft hinaus. Gegen Mittag langte sie in Berlin an; dort nahm sie sich eine Kraftdroschke und liess sich nach dem Stettiner Bahnhof fahren. Der Zug, den sie von hier aus benützen musste, stand schon bereit, aber sie hatte, da es ziemlich viele Mitreisende gab, nicht wieder das Glück, allein fahren zu können, sondern musste ein Abteil besteigen, in dem bereits eine ältere Dame mit zwei jüngeren sass. Augenscheinlich Mutter und Töchter. Musternde Blicke tasteten ihren einfachen aber kleidsamen Reiseanzug ab und hingen fragend an ihrem brünetten Gesicht.
Nachdem der Zug ungefähr eine halbe Stunde unterwegs war, vermochte die ältere Dame ihre Neugier nicht mehr zu zügeln.
„Verzeihen Sie, mein Fräulein, ich irre wohl nicht, wenn ich Sie für eine Ausländerin halte?“
Josefa Burger sagte lächelnd: „Sie irren sich nicht, gnädige Frau, ich bin Österreicherin.“
Die Dame zupfte an ihren Garnhandschuhen herum.
„Ihr Äusseres lässt eher den Schluss auf Ungarn zu,“ sagte sie fragend, denn die kurze Antwort befriedigte sie keineswegs. Eine der Töchter, eine magere, sommersprossige Blondine, mischte sich ein.
„Mama findet, Sie wirken so dunkel. Hier in Deutschland findet man an einem jungen Mädchen nichts schöner, als goldenes Haar und blaue Augen.“ Sie schmachtete mit verwaschenen graublauen Augen zur Wagendecke empor und schob sich eine Strähne des fahlen, dünnen, verbrannten Haares über der Stirn zurecht.
„Meine Mutter war Kroatin,“ erklärte Josefa und dachte bei sich: Ihr seid nicht die Menschen, denen ich erzählen kann, meine Mutter ist eine schöne, wilde Zigeunerdirne gewesen, die sich der Vater ins Netz der Liebe und Ehe eingefangen und die wie ein armer, heimwehkranker Vogel gestorben ist.
„Ah, eine Kroatin war Ihre Mutter,“ die ältere Dame wiegte den knochigen Kopf, als hätte sie soeben eine äusserst erstaunliche Tatsache erfahren, und dann fuhr sie in ihrem Verhör fort: „Aber weshalb reden Sie in der Vergangenheit, Ihre Frau Mutter lebt doch hoffentlich noch?“
„Meine Eltern sind schon seit Jahren tot,“ sagte Josefa kurz und zog ihr Buch wieder hervor, um sich durch Lesen der unbequemen Fragerei zu entziehen.
„Wie traurig,“ tönte es an ihr Ohr, „da reisen Sie sicher zu Verwandten?“
Josefa sah die Frau gross an. „Ich bin nicht so glücklich, irgendeinen Verwandten zu besitzen, zu dem ich reisen könnte.“
Die Dame machte ein Gesicht wie ein lebendig gewordenes Fragezeichen.
„Aber, mein Fräulein, Sie scherzen, ein junges, elternloses Mädchen kann nur zu Verwandten reisen.“
„Oder in eine Stellung, ihr Brot verdienen,“ antwortete Josefa Burger ruhig.
„Aber so sehen Sie doch gar nicht aus,“ verwunderte sich die zweite, strohblonde Tochter.
Josefa musste wider Willen lächeln. Nein, so sah sie wohl nicht aus. Und wenn sie auch nicht im geringsten auffällig gekleidet war, so hatte Frau von Durkhardt in den drei Jahren, die sie bei ihr geweilt, immer darauf gehalten, dass sie teure, gute Stoffe trug, die sie auszusuchen und zu bezahlen pflegte. Auch trug sie am linken Handgelenk einen breiten, mit kleinen Brillanten besetzten Goldreif, den ihr die nun verstorbene Gönnerin zu ihrem letzten Geburtstage schenkte.
„Der Schein trügt zuweilen,“ sagte sie, das Lächeln verhaltend, „wie Sie mich hier sehen, bin ich nur eine arme Gesellschafterin, die eben im Begriffe ist, eine neue Stellung anzutreten.“
Die Damen sahen sich gegenseitig an und redeten miteinander, ohne Josefa Burger, die nun ihr Buch aufschlug, weiter zu beachten. Ihre Wissbegierde versprach sich wohl nichts Besonderes mehr von der Reisegefährtin, die zweiter Klasse fuhr, vornehme Kleider trug und doch nur eine Gesellschafterin war. — — —
Ab und zu sandte das junge Mädchen einen Blick zum Fenster hinaus. Wie so ganz anders hier die Gegend war als im Böhmerlande.
Sandige Felder und Kiefernwaldungen, mosige, endlose Flächen und Tannengehölz, über das ein Krähenschwarm hinstrich. Wie in tiefe, heimliche Traurigkeit eingesponnen, lag die Mark, von der Friedrich der Grosse gesagt haben soll, sie sei des Deutschen Reiches Streusandbüchse.
Eine Stunde verging und darüber. Die drei Damen, die Josefa gegenübersassen, assen Butterbrot, Birnen und Schokolade, dabei fiel es Josefa erst ein, dass sie ja seit dem frühen Morgen nichts genossen hatte. Und die gute Frau Kruschina hatte ihr doch allerlei Essbares in die Reisetasche geschoben. So ass sie denn auch, trank ein Becherlein Wein, von dem sie ein kleines Fläschchen mitführte, und machte sich dann, nachdem sie sich auf ihrer Uhr überzeugt hatte, dass sie bald am Ziele war, zum Aussteigen fertig. Damit lenkte sie abermals die Aufmerksamkeit der drei Damen auf sich.
Die Ältere fragte mit schlecht verhehlter Spannung: „Sie steigen wohl in Greifstal aus?“
„Ja, ich steige dort aus,“ gab Josefa Burger zurück und zog ihre Jacke zurecht.
Die Damen wechselten einen langen Blick, dann sagte die Ältere: „Dann wollen Sie doch nicht etwa nach Dittborn?“
Die Frage wurde, von Atemlosigkeit getrieben, gegen das junge Mädchen geschnellt.
„Sie fragen das in so seltsamen Tone, gnädige Frau. Aber ich brauche Ihnen nicht zu verschweigen, dass Sie errieten, wohin ich will. Ich bin als Gesellschafterin der Baronin Dittborn angenommen.“
Fast wurde Josefa die Fragerei wirklich zu dumm. Zunächst tat man nach dem ersten Ausfragen, als sei sie überhaupt nicht mehr vorhanden, und nun beliebte man sich wieder mit ihr zu befassen.
„Gesellschafterin der Baronin Dittborn!“ echote die Dame und wechselte abermals einen Blick mit den strohblonden Töchtern.
„Das ist ja schrecklich,“ liess sich die eine derselben vernehmen.
„Schrecklich?“ Josefa Burger richtete sich auf und band ihren Schleier zurecht. „Sie sind wohl so liebenswürdig, meine Damen, mir zu erklären, weshalb es schrecklich ist, dass ich als Gesellschafterin zur Baronin Dittborn will.“
Alle möglichen Ideen schwirrten ihr durch den Kopf. Vielleicht war die Baronin eine Schwerleidende oder ein böser Drache, denn sonst hätte das Wort „schrecklich“, in bezug auf die ihr noch Unbekannte, doch keinen rechten Sinn gehabt.
Die Damen tauschten schon wieder einen Blick.
„Sollen wir es ihr sagen?“ wandte sich die Mutter an die Töchter, und als die nur die Achseln zuckten, sprach die Dame mit geheimnisvoller Stimme: „Auf Dittborn hält es keine Gesellschafterin lange aus, denn, so komisch Ihnen das klingen mag, es spukt dort.“
Josefa Burger lachte laut auf, und bei dem Lachen sprang der hässliche Bann, der sich bei den Andeutungen der Fahrtgenossinnen um ihre Brust gelegt, wie ein zermürbtes Band.
„Es spukt,“ lachte sie, und ein kleines Spottschlänglein huschte um ihren hübschen roten Mund. Ihr fiel ein, was sie gestern in dem Heft der „Wochenwarte“ gelesen, und lustig meinte sie: „Ich fürchte mich nur vor Lebenden, wenn sie nämlich bös sind, aber vor Geistern nicht, selbst nicht vor dem Schimmel von Dittborn.“
Die ältere Dame machte ganz runde Augen. „Sie wissen?“ — stiess sie hervor.
„Alles,“ flüsterte Josefa, als berge ihr Köpfchen eine Welt düsterer Geheimnisse, und innerlich belustigte sie sich über die drei, die scheinbar noch an Spuk und solchen Zauber glaubten.
„Greifstal!“ Der Schaffner lief, die Station ausrufend, am Zuge entlang.
Josefa stieg, ihr Täschchen in der Linken, mit vergnügtem Grusse aus. Die drei Damen sahen ihr verdutzt nach; sie waren erst auf der nächsten, zehn Minuten von Greifstal entfernten Haltestelle am Ziel.
Ein grosser, vornehm aussehender Herr von ungefähr dreissig Jahren näherte sich Josefa. Er zog den weichen braunen Filzhut. „Ich habe wohl die Ehre, Fräulein Burger begrüssen zu dürfen; mein Name ist Malte Dittborn.“
Ein Diener griff bereits nach der Handtasche des jungen Mädchens.
Der Herr streckte der Angekommenen die Rechte entgegen.
„Seien Sie willkommen, und möge es Ihnen auf Dittborn gefallen.“
Josefa fühlte sich eigentümlich berührt von dem Tone, in dem das gesprochen war, fast klang es, als liefe eine Bitte durch die schlichten Worte mit.
„Haben Sie eine angenehme Reise gehabt, Fräulein Burger?“ fragte der Baron nun freundlich und ging neben ihr dem Ausgang des kleinen, kahlen Bahnhofs zu.
„Ja, ich bin zufrieden,“ versetzte sie, „bis Berlin befand ich mich ganz allein in meinem Abteil, und von Berlin nach Greifstal fuhr ich mit einer Mutter und zwei Töchtern, die scheinbar hier irgendwo in der Nähe wohnen und mich nach dem Woher und Wohin ausfragten.“
„Und erteilten Sie Auskunft über das Wohin?“ fragte er, und Josefa wollte es bedünken, dass auf dem Grunde der Frage leichte Unruhe wie ein Flackerflämmchen zucke.
„Aber natürlich, es lag doch kein Grund vor, zu verbergen, wohin ich reiste,“ erwiderte Josefa, und die dunklen Mädchenaugen blickten dabei auf den Mann, der jetzt nur nickte. Das sollte wohl eine Zustimmung zu ihrer Äusserung sein, aber dabei meinte sie um die scharfgeschnittenen, von einem kurzen Bärtchen nur wenig überschatteten Lippen plötzlich, wie hergeweht, einen kummervollen Zug zu entdecken.
„Wir leben sehr zurückgezogen und pflegen gar keinen nachbarlichen Verkehr,“ sagte Malte Dittborn.
Man trat eben aus dem Durchgang des Stationsgebäudes, und Josefa gewahrte mit Entzücken das wunderhübsche Auto, das vor dem Portal hielt, und auf dessen Tür sie eine kleine Freiherrnkrone entdeckte. Autofahren, das war ein Vergnügen, das sie bisher kaum genossen, denn im Heimatstädtchen gab es kein solches Gefährt, und nur, wenn sie mit Frau von Durkhardt eine Reise gemacht, war ihr zuweilen das Vergnügen zuteil geworden.
Sicheren Schrittes wollte sie auf das Auto zugehen.
Sie erschrak ordentlich, da die Männerstimme neben ihr sagte: „Das Auto gehört nicht zu Dittborn; dort die ungeduldig scharrenden Rappen sollen uns nach Dittborn führen.“
Jetzt erst erblickte Josefa den hübschen, bequemen Jagdwagen, der zum Darin-Platz-Nehmen einlud. Richtig, da sah sie ja auch schon ihre Handtasche, und der Diener verstaute gerade ihren Koffer, dessen Gepäckschein sie ihm vorhin gegeben.
Die Rappen schlugen mit den Hufen den Boden, das Warten war ihnen langweilig geworden.
Nachdem Josefa sich niedergelassen, fragte sie, wem denn der schöne Kraftwagen gehöre.
Ein Schatten zuckte über die herben Männerzüge.
„Einer Gutsnachbarin, der Baronin von Grettenau, einer reichen Witwe.“
Just, da er die letzte Silbe gesprochen hatte, kam aus dem Portal des Bahnhofs eine kinderkleine Dame mit rotem, dickem Lockenhaar um ein Gesicht, das wie durchsichtiges Porzellan schimmerte. Sie war mit einem blauen Kleide angetan und trug eine breite Hermelinstola um die schmalen Schultern. Wunderhübsch, aber kalt sah die reizende Dame aus.
„Das ist die Baronin Grettenau,“ sagte Malte Dittborn mit harter Gleichgültigkeit, und Josefa Burger wunderte sich, weshalb die zwei Menschen, die doch, wie der Baron eben selbst geäussert, Gutsnachbarn waren, keinen Gruss austauschten, sondern wie an leerer Luft aneinander vorbeistarrten. Seltsame Menschen sind das hier, dachte Josefa Burger, aber, da die Pferde nun anzogen und, in einen schlanken Trab verfallend, in eine gut gepflegte Landstrasse einbogen, vergass sie die Baron Grettenau sogleich wieder.
Josefa Burger beobachtete den neben ihr Sitzenden leicht von der Seite. Ein gutgeschnittenes, sehr ernstes Gesicht hatte Baron Dittborn, und das junge Mädchen dachte, er wird verheiratet sein, und seine Mutter lebt wahrscheinlich bei ihm und seiner Familie. Am liebsten hätte sie gefragt, aber das ging wohl nicht gut an.
„Ich hoffe von Herzen, die Frau Baronin mit meinen Diensten zufriedenzustellen, ich will mir wenigstens die grösste Mühe geben,“ sagte sie nach einer Weile aufrichtig.
Malte Dittborn lächelte. „Dass meine Mutter mit Ihnen zufrieden sein wird, bezweifle ich keinen Augenblick, eher schon, ob Sie mit uns zufrieden sind.“
Wie merkwürdig das klang. Unwillkürlich musste Josefa an ihre Reisegefährtinnen denken, und sie meinte deutlich den Flüsterton der Älteren wieder zu hören: Auf Dittborn hält es keine Gesellschafterin lange aus! —
Unsinn, sagte sie sich gleich darauf, irgendwelche Klatschereien hatten solch Gerede veranlasst. Vielleicht, nein wahrscheinlich, war die Baronin kränklich und beanspruchte, dass ihre Gesellschafterin sich viel mit ihr beschäftigte. Das mochte so mancher nicht gepasst haben. Nun, sie wollte schon liebenswürdig und dienstwillig für die alte Dame sein, sie war jung und würde sich in alles schicken; die Hauptsache war es für sie, wieder so etwas wie eine Heimstätte zu haben.
Die Gedanken spiegelten sich förmlich auf ihren Zügen wider und schwangen auch in ihrer Antwort: „Ob ich mit Ihnen zufrieden bin, Herr Baron, darauf kommt es doch zunächst nicht an! Ich bin glücklich, eine gutbezahlte Stellung, noch dazu in einem Schlosse, gefunden zu haben; wenn man kein Geld hat und keine Eltern und niemanden sonst auf der Erde, der einem zugehört, muss man sich in andere fügen.“
Ein rascher Blick der grauen Männeraugen traf sie.
„Was an uns, meiner Mutter und mir, liegt, Ihnen den Aufenthalt auf Dittborn angenehm zu machen, soll geschehen. Das eine aber wiederhole ich Ihnen, wir haben keinerlei Verkehr mit den Nachbarn, und Sie sind noch zu jung, um auf Frohsinn verzichten zu können.“
Josefa lächelte sicher. „Ich bin nicht vergnügungssüchtig, das Wichtigste ist meine Pflicht.“
Sie sah im Geiste eine zarte, kränkliche Dame in einem Liegestuhl und sich eifrig um sie bemüht. Sie rieb ihr die blasse, von dichtem weissem Scheitelhaar umbauschte Stirn mit Kölnischem Wasser, mischte ihr erfrischende Limonaden und las ihr aus den Klassikern vor. Auf ihren Arm gestützt, wanderte die alte Baronin durch die Parkwege, und manchmal würde sie ihr auf der Geige süsse, weiche Lieder spielen. —
Es herrschte eine Zeitlang Stille zwischen den beiden Insassen des Wagens, jeder schien mit seinem Denken beschäftigt.
„Sie kommen aus einer an landschaftlichen Schönheiten reichen Gegend, Fräulein Burger,“ begann der Baron, „unsere Mark ist dagegen gewissermassen ein Stiefkind von Mutter Natur.“ Seine Stimme ward tiefer, wärmer: „Aber es wäre ungerecht, unsere Mark hässlich zu schelten, wenn sie es auch dem oberflächlichen Beschauer scheinen mag. Sie ist reizvoll, aber ihre Vorzüge erschliessen sich nicht jedem. Man muss sie gründlich kennen, die Mark, vielleicht hier geboren sein, um sie voll und ganz zu würdigen. Ich liebe die Mark und möchte das Plätzchen darin mit keinem noch so herrlichen der Welt vertauschen.“
Josefa beobachtete mit Erstaunen, wie belebt dieses etwas kalt wirkende Männerantlitz werden konnte; viel hübscher und jünger sah es so aus.
Er sprach weiter und leicht, wie von Inbrunst durchtränkt, floss seine Rede hin.
„Unsere dunklen Tannenwälder stehen trutziger in ihrer Ruhe als die Tannen anderswo, und in den hohen Föhren harft der Wind uralte Heimatlieder. Mitten in Stille und öder Weite liegen Seen eingebettet; düster ist ihr Wasser von dem Schatten der dichten Buchen, welche die Ufer säumen. Sehnsucht nach einem Etwas, das man nie gekannt, nach etwas Unbestimmtem, Grossem und Schönem erfasst einen, und wenn die Glocken über die flache, alte, liebe Mark läuten, so klingt das wie ein Wiegengesang, der Herzensfrieden in sich trägt.“
Josefa sass mäuschenstill und lauschte. Wie der Mann das Einfache sagte, das gefiel ihr, und sie wünschte, er hätte so weitergesprochen. Schon wollte es ihr scheinen, als fühle sie den Zauber der Mark, den er





























