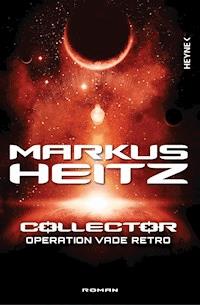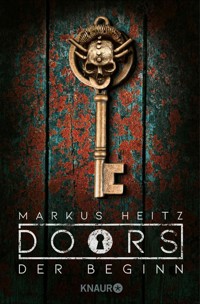10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Böse droht die Überhand auf dem Kontinent Ulldart zu gewinnen. Die eigene Machtstellung wird dem jungen Herrscher Lodrik zum Verhängnis: Unter dem Einfluss verräterischer Freunde und intriganter Berater hat er sich in einen unberechenbaren Kriegstreiber verwandelt. Seine wahren Gefährten werden verfolgt und geraten in Lebensgefahr. Doch sie geben nicht auf: In der Ebene von Telmaran stellen sie sich Lodriks Herr, und eine vernichtende Schlacht beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sei unser Held! Mach mit und erlebe die Welt der Piper Fantasy.
Neugierig? Dann auf zu www.piper-fantasy.de!
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Originalausgabe
11. Auflage Juli 2010
Erstmals erschienen: Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG,
München 2002
© Piper Verlag GmbH, München 2004
Umschlagkonzeption: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de
Umschlagabbildung: Ciruelo Cabral, Barcelona
Karten: Erhard Ringer
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-492-95049-7
ULSAR und GRANBURG
LODRIK BARDRIȻ: Kabcar von Tarpol
STOIKO GIJUSCHKA: Vertrauter des Kabcar
WALJAKOV: Leibwächter des Kabcar
IJUSCHA MIKLANOWO: tarpolischer Brojak, Freund und Vertrauter Lodriks
NORINA: Tochter Miklanowos, Brojakin
MATUC: Mitglied des Ulldrael-Ordens
BELKALA: Priesterin des kensustrianischen Gottes Lakastra
NERESTRO VON KURASCHKA: Mitglied des Ordens der Hohen Schwerter, Verehrer des Gottes Angor
HERODIN VON BATASTOIA: Vertrauter Nerestros, Mitglied des Ordens der Hohen Schwerter
TAREK KOLSKOI: tarpolischer Haraȼ
ALJASCHA RADKA BARDRIȻ: Großcousine Lodriks, Vasruca von Kostromo und Kabcara
MORTVA NESRECA: Berater des Kabcar
HEMERÒC: Handlanger Nesrecas
PAKTAÏ: Handlangerin Nesrecas
CHOS JAMOSAR: Hof-Cerêler in Ulsar
SOSCHA: Mädchen aus Ulsar
HERRSCHER und DIPLOMATEN
KÖNIG PERDÓR: Herrscher von Ilfaris
FIORELL: Hofnarr und Vertrauter Perdórs
MOOLPÁR DER ÄLTERE und VYVÚ AIL RA’AZ: kensustrianische Botschafter
SARDUIJELEC: Botschafter Borasgotans
FUSURÍL: hustrabanischer Gesandter
MERO TAFUR: Botschafter Aldoreels
PARAI BARALDINO: Commodore, Kaufmann und Botschafter Palestans
FRAFFITO TEZZA: Adjutant Baraldinos
ALANA II.: Regentin von Tersion
ARRULSKHÁN: Kabcar von Borasgotan
TARM: König von Aldoreel
TELISOR: Tarms Sohn
DIE VERBOTENE STADT
MEISTER HETRÁL: Bogenschütze und Befehlshaber der Schutzwache um die Verbotene Stadt
TARMANN NURK: Hetràls Stellvertreter
PASHTAK: Sumpfkreatur, Versammlungsmitglied
ARMEEANGEHÖRIGE
SINURED: legendärer Kriegsfürst
OSBIN LEOD VARÈSZ: Stratege Sinureds
WIDOCK: Handlanger von Varèsz
FAÏS-BAR-LAMSHADAI: Tei-Sal (Oberer Befehlshaber)
HAÏL-ER-IBADAN: Tei-Sal
J’MAAL: Anführer des tersionischen Kontingents
WEITERE
VARLA: Piratenkapitänin
TORBEN RUDGASS: rogordischer Freibeuter
FARRON und OLLKAS: zwei kensustrianische Astronome
LOM T’SHARR: Befehlshaber der Stadtwache Baiugas
L’XARR: Shadoka von Alana II.
Ulldart, Königreich Tersion, Hauptstadt Baiuga, Sommer 443 n.S.
Ungefähr in einem Abstand von fünfzig Schritt zueinander blieben die zwei Männer in den sengenden Strahlen der Sonnen stehen, sahen sich an und hoben dann ihre Hand zum Gruß.
Der eine trug ein leichtes, bewegliches Kettenhemd zum Schutz, während sein Gegenüber den stabileren, aber auch steiferen Plattenpanzer gewählt hatte. Beide Gesichter wurden von Topfhelmen verdeckt.
Jeweils links von ihnen stand ein kleines Tischchen im hellen Sand des ovalen Platzes, auf dem eine mittelschwere Armbrust und drei passende Bolzen für die Waffe lagen.
Auf ein kurzes Trompetensignal hin erwachten die Kontrahenten aus ihrer Regungslosigkeit.
Der Mann im Kettenhemd fasste nach der Fernwaffe und begann mithilfe eines Spannhebels, die Sehne Stück für Stück nach hinten zu ziehen.
Als er das erste Geschoss schwitzend in den Lauf legte und zielte, hatte sein Gegner mit dem dünnen, geflochtenen Seil gerade mal die Hälfte der Strecke bis zum metallenen Haltedorn überbrückt.
Zischend durchschnitt der Bolzen die Luft und schlug in die Schulterpanzerung ein. Ein leiser Schmerzenslaut entfuhr dem Getroffenen, kurz hielt er inne. Nach wenigen Lidschlägen setzte er aber seine Arbeit fort, während das Blut plötzlich in einer breiten, roten Bahn den linken Oberarm hinablief.
Fluchend fing nun auch wieder der Mann im Kettenhemd an, seine Armbrust zu spannen.
Zähneknirschend richtete sich der andere auf. Das Anvisieren bereitete ihm wegen der Verletzungen sichtlich Schwierigkeiten, und er musste den Lauf wieder senken. Der linke Arm zitterte zu sehr, also versuchte er sein Glück mit der anderen Seite. Sein zeitlicher Vorsprung und damit sein Vorteil schmolzen dahin.
Gleichzeitig hoben sie ihre Fernwaffen, fast synchron betätigten sie die Abzüge. Doch die Geschosse verfehlten in beiden Fällen ihre Ziele und bohrten sich wirkungslos etliche Meter weiter hinten in den hellen Sand.
Hektisch wurde nachgeladen, und erneut war der Träger des Kettenhemdes der Schnellere der beiden. Keuchend vor Anstrengung riss er den Lauf hoch, zielte und verzog durch das aufgeregte Atmen beim Feuern etwas. Sein letztes Geschoss brach durch die metallene Panzerung, der Bolzen verschwand bis zur Hälfte in der rechten Brust.
Diesmal schrie sein Gegner laut auf, die bereits gespannte Armbrust fiel in den Sand, und er musste vor Schmerzen in die Knie gehen.
Zitternd nahm er nach einer Weile die Fernwaffe in die Rechte, stützte das linke Knie auf und legte den Lauf darauf ab. Schwer atmend peilte er den Kopf seines Gegners an, der regungslos abwarten musste, bis alle Bolzen verschossen waren. Selbst wenn dieses Geschoss nicht traf, hatte sein Gegner immer noch einen letzten Versuch.
Mit einem schabenden Geräusch schnellte die Sehne nach vorne, beschleunigte das Holz und den Stahl. Nach einem kurzen Flug durchstießen die geschliffenen Kanten den ungeschützten Hals des Kontrahenten, der daraufhin gurgelnd zusammenbrach.
Nur einen Lidschlag später kippte der Mann im Plattenpanzer langsam nach hinten um und lag tot im Sand. Seine zweite Verletzung war zu schwer gewesen.
Nach einer Phase der atemlosen Spannung brüllte die Menge in der Arena auf, applaudierte, johlte und pfiff, begeistert von dem, was sie gerade für ihr Eintrittsgeld zu sehen bekommen hatte.
Fraffito Tezza, das lebende palestanische Geschenk an die Regentin von Tersion, schüttelte den Kopf und seufzte anhaltend. Er stand im Schatten einer großen Säule am äußersten Rand des Schauplatzes, stützte sich auf den Stiel seines Reisigbesens und wunderte sich täglich aufs Neue über so viel Dummheit.
Zum einen über die der Kämpferinnen und Kämpfer, die in der tersionischen Arena immer wieder gegeneinander antraten und schneller ums Leben kamen, als sie das wohl planten. Zum anderen über die der Besucher, die sich am Tod, der mal mehr, mal weniger qualvoll ausfiel, anderer ergötzten. Dass sie an den blutigen Spektakeln ihren Spaß hatten, hörte er seit fast einem halben Jahr durchgängig an der lautstarken Verzückung der Massen.
Andererseits hätte er nichts dagegen, hier Baraldino antreten zu sehen, jenen Mann, der ihn an Königin Alana von Tersion »verschenkt« hatte.
»Los«, sagte eine der Wachen, die am Eingang zur Arena standen, zu dem palestanischen Offizier und nickte in Richtung der beiden Leichen.
»Sehr wohl«, entgegnete Tezza, stakste in die Mitte des Sandplatzes, zog seinen Dreispitz und machte eine tiefe Verbeugung, wie immer formvollendet und höchst elegant.
Das Publikum liebte den Auftritt des inzwischen berühmtesten Kehrmeisters, den die Arena jemals gehabt hatte.
In seinem auffälligen Brokatrock, den Wadenhosen und weißen Strümpfen sowie mit den Schnallenschuhen an den Füßen war der Palestaner ein bunter Vogel inmitten von weißen Tauben. Selbst in der größten Hitze behielt er seine Perücke auf; und rann der Schweiß ihm auch in Strömen über das Gesicht, Fraffito Tezza behielt seine Würde. Er wusste, dass die Tersioner ihn als eine Art Hofnarr betrachteten, aber solange ihn dafür alle in Ruhe ließen, war ihm das recht.
Während ein paar Sklaven die Toten höchst unwürdig wegzerrten, scharrte der Palestaner mit dem Besen frischen Sand über die Blutflecken, bis sie nicht mehr zu sehen waren.
In einem halben Jahr würde er hier raus sein. Und egal, was ihm danach drohte, er würde seinem Vorgesetzten, Parai Baraldino, beim ersten Zusammentreffen eine Ohrfeige geben. Oder zwei. Für diese Demütigungen, die er in dem fremden Land erlitt, sollte sein Landsmann bezahlen.
Der Palestaner hatte seine Arbeit verrichtet, absolvierte einen weiteren Kratzfuß, was ihm den Applaus und das Gelächter der Besucher einbrachte, dann stelzte er zurück in den Schatten der Säule. Die Sonnen brannten gnadenlos aus dem wolkenlosen Himmel im südlichen Ulldart.
»Du sollst runter, in die Katakomben«, wies ihn die Wache an. »Die Zisterne muss sauber gemacht werden. Und die Wasserbecken sollen aufgefüllt sein, damit die Kämpfer sich nachher waschen können.«
»Sehr wohl«, sagte Tezza wie immer, schulterte sein Kehrwerkzeug und machte sich an den Abstieg in das unterirdische, kühle Reich unter der Arena.
Hier befanden sich sowohl die Käfige für die verschiedenen exotischen Tiere und Sumpfbestien, die zum Kampf eingesetzt wurden, als auch die Behausungen der Männer und Frauen, die sich wegen Geld gegenseitig ans Leben gingen. Und das mit dem abenteuerlichsten Waffensammelsurium, das der palestanische Offizier jemals gesehen hatte.
Schwerter in allen Formen und Größen, Keulen, Lanzen, Speere, Schilde, Netze und jede Menge Waffen, für die es keine Namen gab oder nur solche, die er sich nicht merken konnte. Daneben rollten alle möglichen Gefährte durch den Sand, wie Streitwagen oder Ähnliches. Durch ein Röhrensystem, das vom Hafenbecken hierher führte, konnte die Arena zudem für Schiffskämpfe geflutet werden, auch wenn diese Prozedur sehr aufwändig war. Um einen Zweikampf spannender zu machen, waren Sklaven dazu abgestellt, zusätzliche Hindernisse und Deckungsmöglichkeiten aufzubauen.
Das Prinzip war einfach: Antreten durfte in der Arena jeder. Das Gold, das es für Freiwillige zu verdienen gab, lockte einfache Bauern, ehemalige Sklaven oder Glücksritter, die aber schnell zu spüren bekamen, dass ein Kampf gegen einen der Krieger der Regentin kein Zuckerschlecken war. Gewann entgegen aller Erwartungen trotzdem einer der Wahnsinnigen, bekam er einen Lohn von zwanzig Batzen. Wagte er einen zweiten Kampf, verdiente er das Doppelte.
Neben den Freiwilligen gab es die Sklaven, denen ihre Entlassung in Aussicht gestellt wurde, wenn sie eine gewisse Anzahl von »Begegnungen« überlebten, und die professionellen Kämpfer, die sich »Shadoka« nannten und in einer Rangliste ordneten. Sie kämpften mal einzeln gegeneinander, dann im Duo oder in größeren Gruppen. Ob ein Gegner letztendlich getötet wurde, lag allein im Ermessen des Kontrahenten.
Die Regentin stellte insgesamt zehn solcher Männer und Frauen auf, hinzu kamen rund dreißig weitere Kämpfer, die von unterschiedlichen wohlhabenden Tersionern unterstützt wurden.
Jede reichere Familie sah es als eine Verpflichtung an, ihr Haus durch einen Shadoka in der Arena vertreten zu lassen. Natürlich wettete man auf den Ausgang der Kämpfe, was wiederum für zusätzliche Einnahmen sorgte.
Momentan führte ein albinohafter K’Tar Tur namens L’Xarr für Alana II. die Liste der Besten an. Seinen beiden seltsamen Schwertern war bislang kein Herausforderer gewachsen gewesen. Als Gleichwertige wurden ein unbekannter Kensustrianer mit unaussprechlichem Namen, der auf eigene Rechnung kämpfte, und ein hünenhafter schwarzer Angorjaner, den der Gemahl der Regentin mitgebracht hatte, gehandelt.
Tezza erwirtschaftete, ohne dass es jemand bemerkte, inzwischen einen ordentlichen Haufen Geld. Er beteiligte sich an den Wetten. Denn wenn jemand genaue Einblicke in die Erfolgsaussichten der Kämpfer hatte, dann war er es, weil er praktisch mitten unter ihnen lebte. Als gewiefter Kaufmann fand er durch Beobachtung und Lauschen sehr schnell heraus, wo bei dem Einzelnen die Schwächen und Vorteile lagen. Demnach war er in der Lage, den Ausgang einer »Begegnung« ziemlich gut einschätzen zu können.
Pfeifend schlenderte er durch die Gewölbegänge in Richtung der großen Zisterne, die zwischendurch immer wieder auf kleinere Verschmutzungen und ihren Wasserstand hin überprüft werden musste.
Tezza wusste genau, wer hinter welchen Türen, die er unterwegs passierte, lebte. Und je nach Status des Shadoka herrschte schon beinahe unanständiger Luxus in den Räumen. Pech hatten dagegen die Sklaven, die in Massenunterkünften ganz unten eingesperrt waren.
Die Tür des derzeitigen Listenbesten war nur angelehnt, undeutlich vernahm der Palestaner eine Unterhaltung zwischen mehreren Stimmen.
Sofort war sein kaufmännischer Geist hellwach. Vermutlich eine Kampfbesprechung. Vielleicht erfuhr er etwas, was er bei den nächsten Wetten Gewinn bringend einsetzen konnte.
Auf Zehenspitzen pirschte er sich an die Kammer heran, hielt sich das rechte Ohr zu, um sich völlig auf das linke zu konzentrieren.
Doch zu seiner Enttäuschung redete der K’Tar Tur in einer Weise, die vom Volk die »Dunkle Sprache« genannt wurde und die er, wie die meisten Menschen des Kontinents, nicht verstand. Plötzlich wechselte der Beste der Shadoka ins Ulldart.
»Ich weiß, du verstehst unsere Sprache nur sehr schlecht. Aber du bist einer von uns und wirst sie lernen müssen. Außer uns beherrscht sie niemand, daher macht es uns sicher davor, belauscht zu werden.«
Tezza grinste.
»Ich werde mich bemühen«, sagte ein für den Palestaner unsichtbarer Sprecher etwas zerknirscht. »Aber ich war nicht lange bei meiner Familie, daher …«
»Es ist gut. Wir werden es dir beibringen«, beruhigte ihn der Preiskämpfer. »Also, nun berichte.«
»Es wird erzählt, dass Sinured, unser aller Vorfahr, wieder zurückgekehrt sei.«
Im Zimmer hinter der Tür war es nach dieser Mitteilung totenstill. Dem Offizier fuhr ein Schauder über den Rücken.
»Wer erzählt das?«, wollte L’Xarr misstrauisch wissen.
»Ich komme direkt aus Tûris, und ich kann euch allen nur berichten, dass in der so genannten ›Verbotenen Stadt‹ große Dinge vorgehen. Die Kreaturen der Sümpfe sammeln sich dort zu Hunderten, säubern die Ruinen vom Bewuchs, als würden sie die Vorarbeit für etwas leisten wollen.« Der Erzähler redete schnell und aufgeregt, die Begeisterung war deutlich zu erkennen. »Und zwei Fischer haben vor der turîtischen Küste die Galeere Sinureds gesehen, wie sie aus dem Wasser emporkam. Brüder, unser Vorfahr lebt wieder! Tzulan sei Dank!«
Die anderen Männer und Frauen, die sich außerdem in der Kammer befanden, unterhielten sich leise in der Dunklen Sprache.
»Ich gestehe«, begann der Listenbeste nach einer Weile, »dass ich einen innerlichen Drang verspüre, aus Tersion wegzugehen, in Richtung Norden. Ich wusste bisher nicht, weshalb. Aber nach diesen Neuigkeiten wird mir einiges klar. Unser aller Urvater ruft uns zu sich, auf dass wir ihn unterstützen. Was auch immer er beabsichtigt.«
»Ja, lasst uns gleich aufbrechen«, fiel ihm der Neuling begeistert ins Wort. »Je eher wir bei ihm sind, desto …«
»Nicht so schnell«, herrschte ihn L’Xarr an. »Wir werden abwarten. Noch weiß keiner von uns, wo Sinured hin ist. Wir werden alle so lange in Tersion bleiben, bis uns ein Zeichen gesandt wird, das uns Klarheit verschafft. Oder wenn uns der Ruf unseres Vorfahren genauer leitet. Und überlegt: Wenn alle K’Tar Tur auf einen Schlag aus dem Land, womöglich noch aus allen anderen Reichen Ulldarts, nach Tûris marschierten, bekämen die Menschen Angst und würden sich uns wahrscheinlich in den Weg stellen wollen. Wir werden heimlich, nach und nach, verschwinden. Es darf niemandem auffallen.«
»Ob unser Vorfahr wieder so mächtig wird wie einst?«, fragte der andere leise. Hoffnung schwang mit. »Dann könnten sich die K’Tar Tur endlich für alle Schmach und Schande, die Verfolgungen und das Töten der letzten Jahrhunderte an diesem Kontinent rächen.«
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Listenbeste. »Keiner von uns weiß, was Sinured möchte. Wir haben nicht einmal eine Ahnung davon, wo er sich aufhält. Vielleicht benötigt er unsere Hilfe ja auch hier, in Tersion. Keiner ist so nahe an der Regentin wie wir, nicht wahr, T’Sharr?«
»Sie vertraut mir wie niemand anderem«, bestätigte der Kommandant der Stadt- und Leibwache und lachte. »Nicht einmal ihrem Gemahl.«
Tezza war einer Ohnmacht nahe. Dort drinnen saß einer der mächtigsten Männer des Reiches und redete durch die Blume über eine Übernahme des Throns durch die K’Tar Tur, wenn sein Vorfahr es ihm befehlen sollte.
»Also gut, Brüder und Schwestern.« L’Xarr hob seine Stimme. »Warten wir auf ein Zeichen, das uns hilft zu verstehen. Und danach lasst uns dafür sorgen, dass unser Vorfahr das erreicht, was er möchte. Wir sind seine Kinder und ihm ewig treu.« Der Schwur wurde von allen in der Kammer Versammelten wiederholt.
Erste Schritte näherten sich der Tür, und der Palestaner hüpfte das Gewölbe hinunter. Zu spät bemerkte er, dass sich in dem Gang keinerlei Möglichkeiten boten, wo er sich verstecken konnte.
Das Knarren in seinem Rücken sagte ihm, dass einer der Verschwörer hinaustrat.
Ruckartig blieb er stehen und kehrte imaginären Dreck auf dem Steinboden zusammen. Er pfiff die palestanische Nationalhymne und tat so, als würde er sich von unten den Korridor hinaufarbeiten.
Hinter sich hörte er Gemurmel, dann näherte sich jemand. Eine Hand legte sich auf seine Schulter, und Tezza spielte den Erschrockenen, was ihm nicht besonders schwer fiel.
»Oh, L’Xarr. Ich habe Euch gar nicht gehört. Ich höre nie etwas, wenn ich in meine Arbeit versunken bin. Absolut überhaupt gar nichts«, sagte er, aber sein Lächeln misslang gründlich, als er in die forschenden roten Augen des K’Tar Tur sah. Die dunkelrote Strähne im schlohweißen Haar, das Markenzeichen aller, die dem Dunklen Volk angehörten, zog seinen Blick an. »Schön, Euch in einem Stück zu sehen.«
»Tezza, wie gut, dass ich Euch hier zufällig treffe«, sagte der Listenbeste harmlos. »Ich wollte Euch fragen, was Ihr von meinem Gegner haltet, der morgen auf mich trifft. Damit ich in einem Stück bleibe.«
»Das müsste doch der Shadoka der Familie Paskalon sein, nicht wahr? Wartet einen Moment.« Der Palestaner stützte sich auf seinen Besen und überlegte. »Nun, das dürfte kein Problem für Euch werden, L’Xarr. Seine Waffen sind Keule und Dolch. Zu langsam für Euch.«
»Das dachte ich mir.« Der Listenbeste nickte und schlug dem Offizier auf das Schulterblatt, sodass der Getroffene etwas in die Knie gehen musste. »Trotzdem danke ich Euch für Eure Einschätzung.« Er betrachtete den sauberen Boden und warf sein langes Haar zurück. »Das sieht sehr rein aus. Oder wollt Ihr, dass sich die Kämpfer darin spiegeln können? Ich denke, Ihr habt woanders mehr zu tun.«
»O ja, sicher doch«, sagte der Offizier beflissen. »Ich war auf dem Weg zur Zisterne, als ich das bisschen Dreck entdeckte und mir dachte, ich könnte ein wenig fegen, wenn ich schon mal hier bin, nicht wahr?« Tezza hob den Besen und zupfte am Reisig. »Aber ich sehe lieber nach dem Wasser. Die ersten Shadoka werden bald kommen.«
»Macht das, Tezza, macht das«, entließ ihn der Listenbeste und sah dem Mann im Brokatrock hinterher, der etwas verkrampft das Gewölbe hinablief.
Als der Palestaner um die Ecke verschwunden war, stellte sich T’Sharr an seine Seite. »Er hat unser Gespräch belauscht, oder?«
»Ich fürchte es beinahe«, sagte L’Xarr nachdenklich. »Hast du Vorschläge, Bruder?«
Der Kommandant legte die Stirn in Falten. »Wir dürfen es nicht nach Vorsatz aussehen lassen. Er ist immer noch ein offizielles Geschenk, das der Regentin gehört. Und Alana sieht es nicht gern, wenn man ihre Spielzeuge absichtlich kaputt macht. Zumal Palestan nun ein Verbündeter von uns ist.«
»Ein Unfall also«, meinte L’Xarr.
Der andere K’Tar Tur nickte knapp. »Ich fürchte, einer der Käfige wird demnächst nicht richtig verschlossen sein. Und ausgerechnet, wenn unser tapferer Tezza seinen Besen schwingt, wird das böse Tier ausbrechen. Da habe ich so eine Vorahnung.«
»Tragisch, tragisch«, murmelte der Listenbeste. »Dass er so enden muss.«
»Vorsichtshalber denke ich mir noch etwas anderes aus. Man weiß nie. Und ich unterschätze ungern jemanden. Sichert man sich doppelt ab, kann nichts schief gehen. Ich denke, wenn ich Alana dazu überreden könnte, den Palestaner spaßeshalber für einen unblutigen Kampf gegen einen Sklaven in die Arena zu schicken, hätten wir alle etwas davon. Auch dabei können sich Unfälle ereignen. Unfreie tun für ihre Freiheit einiges.«
Nach der Zeit der Kämpfe folgte für unsere Welt eine Zeit des Friedens, in der sich die Menschen von den Jahrhunderte langen Kriegen und Schlachten erholten.
Die Kulturen, die Angor, Ulldrael, Senera, Kalisska und Vintera erschaffen hatten, blühten auf, trieben Handel und entwickelten sich weiter.
DIE ZEIT DES ERSTEN FRIEDENS,
Kapitel I
Ulldart, Königreich Tersion, südöstliche Grenze zum Königreich Ilfaris, Sommer 443
Von der Anhöhe herab sah der Befehlshaber, Faïs-bar-Lamshadai, auf das Lager herab, das in einer kleinen bewaldeten Talmulde aufgeschlagen worden war.
Zweitausend Mann hatten sich in den Zelten versammelt, alles kaiserliche Truppen oder angeheuerte Söldner aus Angor, wobei schärfstens darauf geachtet worden war, dass nicht ein einziger Kämpfer aus Ulldart stammte. Auch wenn man nur durch Ilfaris marschieren wollte, um nach Kensustria zu gelangen, wollten die drei Verbündeten Reiche, Palestan, Tersion und Angor, nicht einen einzigen Anlass geben, der nachträglich als Verletzung des Tausendjährigen Friedensvertrages gesehen werden konnte.
Faïs-bar-Lamshadai hatte als Tei-Sal, als Oberbefehlshaber, für den Kaiser von Angor mehr als eine Schlacht siegreich geschlagen, und sein großer Vorteil lag in der Besonnenheit, die er selbst in unübersichtlichen Situationen an den Tag legte. Mit fast fünfzig Jahren gehörte der grau melierte Mann mit der dunkelbraunen Haut und dem dünnen Schnurrbart sicherlich nicht mehr zu den Jüngsten, aber seine Erfahrung im Kampf war dem Kaiser mehr wert als alles andere. Und Erfahrung benötigte die Streitmacht, die gegen Kensustria ausrückte, dringend.
Der Befehlshaber wusste, dass er sich auf ein Abenteuer einließ. Die ausgehandelten Bedingungen besagten, dass er seine Truppen auf schnellstem Weg durch Ilfaris führen musste und dass ihm unterwegs keinerlei Hilfe gewährt würde.
Das bedeutete im Umkehrschluss, dass die Armee ihren Proviant, den sie benötigte, mitzuführen hatte, was den Tross für seinen Geschmack zu groß und zu langsam werden ließ.
Faïs-bar-Lamshadai hoffte, dass die Kensustrianer über wenig Aufklärer verfügten und die Angorjaner wenigstens ein bisschen auf das Überraschungsmoment bauen konnten, wenn sie in das Reich der Grünhaare einfielen.
Sein Auftrag sah vor, dass er die Küstenfestungen am westlichsten Punkt in seine Gewalt bringen sollte, um den wartenden angorjanischen Landungstruppen die Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Was die Armee in Kensustria allerdings erwartete, wusste niemand. Nicht einmal Perdór, der König von Ilfaris, der ansonsten über ein sehr gutes Netz von Spitzeln verfügte, wie man sich erzählte.
Der ranghöchste Offizier legte seine Hand als Sichtschutz an die Stirn und sah nach oben. Weit, weit über dem Lager kreisten vier mächtige Vögel und zogen gemütlich ihre Bahn. Solche großen Tiere hatte er noch nie gesehen, aber immerhin war er zum ersten Mal auf Ulldart, und daher wunderte er sich nicht allzu sehr über Ungewohntes. Lärm aus dem Lager ließ ihn seine Aufmerksamkeit auf die Zelte richten. Eilig schwang er sich in den Sattel seines Pferdes und ritt zurück, wo er von einem aufgeregten Soldaten empfangen wurde.
»Tei-Sal, die Grünhaare haben uns entdeckt!« Der Mann deutete den Weg entlang, der aus dem Tal in Richtung ilfaritische Grenze führte. »Dort warten sie auf uns.«
Lamshadai stieß dem Tier die Fersen in die Flanke und preschte die schmale Straße hinunter, wo er mehrere Soldaten und Offiziere erkennen konnte. Hart brachte er sein Pferd zum Stehen und sprang auf die Erde.
»Bericht«, rief er und bahnte sich einen Weg nach vorne. »Wie viele sind es? Müssen wir mit einem Angriff rechnen?«
Sofort machten die Kämpfer ihm Platz und gaben den Blick auf einen einzelnen Kensustrianer frei, der in etwa zweihundert Schritt Distanz gemütlich mit übereinander geschlagenen Beinen auf dem Boden hockte. Neben ihm lagen ein großer Bogen und ein Köcher mit Pfeilen, sein Körper steckte in einer vielgliedrigen Rüstung, die aus Metall-, Holz- und Lederstücken zusammengefügt schien. Hinter seinem Rücken ragten die Griffe von zwei Schwertern in die Luft.
»Das ist alles?« Der Befehlshaber entspannte sich ein wenig. »Ein einzelner Kensustrianer. Er wirkt nicht unbedingt sehr bedrohlich, oder?«
»Er sitzt seit wenigen Sandkörnern so da, Tei-Sal. Die Wache hat ihn bemerkt und vorsichtshalber Alarm gegeben«, meldete einer seiner Unteranführer. »Aber unternommen hat der gegnerische Soldat bisher noch nichts.«
»Leichte Bewaffnung, leichte Panzerung«, resümierte Lamshadai den Eindruck, den er gewonnen hatte. »Er sieht nach einem Späher aus. Damit ist unser Vorteil der Überraschung aller Wahrscheinlichkeit nach gestorben, wenn er seinen Leuten berichtet.«
»Sollen wir ihn fangen, Tei-Sal?«, fragte der gleiche Offizier. »Vielleicht erfahren wir mehr über das, was die Kensustrianer vorhaben.«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Wir warten ab. Wenn er eine solche Ruhe hat, warum sollten wir sie nicht auch haben? Lasst die Wachen verstärken, besetzt die Posten auf den Hügelspitzen doppelt. Niemand außer diesem Kensustrianer wird in dieses Tal gelangen. Und keiner wird hinausgelassen. Beobachtet ihn, aber greift nicht an.« Lamshadai wandte sich zu seinem Pferd und stieg auf. »Ich bin im Lager, wenn sich etwas ereignen sollte. Sitzt der Kensustrianer in einer halben Stunde immer noch dort, fangt ihn. Ich will ihn lebend.«
Der Soldat mit den grünen Haaren hatte ein wenig Reisig zusammengetragen und entzündete mithilfe eines Feuersteins eine kleine Flamme.
»Der hat vielleicht Nerven. Der brät sich was«, sagte eine der Wachen und kratzte sich unterm Helm. »Wenn ich so vielen Gegnern gegenüberstehen würde, wäre mir nicht nach Essen zu Mute.«
Ein eigenartiges Knattern, wie von Segeln in einem starken Wind, war plötzlich zu hören. Vier große Schatten huschten über die Spitzen der Bäume, und der Tei-Sal hob den Kopf. Verblüfft klappte sein Unterkiefer herab.
Das, was er vorhin für Vögel gehalten hatte, waren seltsame Flugkonstruktionen, unter denen Menschen hingen. Und als er die Farbe der Haare sah, wusste er, es waren Kensustrianer.
Zielstrebig schossen sie mit ihren Maschinen aus Leder, Holz und Pergament wie große Segelvögel über die Wipfel und steuerten das Lager an.
»Gebt Alarm!«, brüllte Lamshadai, doch er hörte schon erstes erstauntes Rufen aus der Richtung des Sammelpunkts.
Feiner Sprühnebel lag plötzlich in der Luft, der sich auch bis zur Position des Tei-Sal verteilte. Es roch intensiv nach Petroleum, gemischt mit einem anderen, beißenden Gestank.
Der Offizier verstand den Plan des Gegners. »Schießt den Kensustrianer ab!«, rief er. Aber keiner seiner Leute hatte Fernwaffen dabei.
Fluchend wendete er sein Pferd auf der Hinterhand, nahm sich den Speer eines völlig erstaunten Soldaten und galoppierte auf den Sitzenden zu.
Der Kensustrianer hatte sich mittlerweile erhoben und legte in aller Ruhe einen Pfeil auf die Sehne des geschwungenen Bogens.
»Tei-Sal, kommt zurück!«, brüllte einer der Unteranführer hinterher. »Er wird Euch abschießen, wenn Ihr in seine Reichweite gelangt.«
Kurz hielt der fremde Krieger die Spitze des Geschosses in das Feuer, um die daran befestigte Watte zu entzünden, dann zog er das geflochtene Seil weit zurück und zielte scheinbar wahllos in den Himmel.
Lamshadai stieß dem Pferd wie ein Wahnsinniger seine Stiefelabsätze in die Flanken und peitschte das Tier zum schnellsten Tempo an. Mit ein wenig Glück konnte er den Kensustrianer durchbohren, bevor er den Pfeil abschoss.
Der Abstand verringerte sich mehr und mehr, und erst im letzten Moment tauchte der Gegner mit einer sehr eleganten Bewegung unter der tödlichen Lanze weg. Während der Tei-Sal noch versuchte, eine abrupte Wendung zu vollführen, ging das kensustrianische Geschoss auf die Reise, kleine Fünkchen hinter sich herziehend.
Lamshadais Pferd verlor den Halt auf dem lockeren Waldboden und stürzte. Schwer schlug der Befehlshaber der angorjanischen Streitkräfte auf und blieb hustend liegen. Als er sich nach dem Bogenschützen umsah, war der jedoch verschwunden.
Mühsam rappelte er sich auf, seine linken Rippen schmerzten. Wie durch einen dämpfenden Schleier hörte er das Schreien seiner Männer im Lager, dichte, dunkle Qualmwolken verfinsterten die Sonnen. Dann waren die ersten Wachen bei ihm.
»Sie haben unseren Proviant angesteckt«, berichtete einer der Männer. »Fast die ganzen Lebensmittel stehen in Flammen. Wenn wir Glück haben, können wir wenigstens die Unterkünfte retten, Tei-Sal.«
Ächzend machte sich Lamshadai auf zu seinem Pferd und kletterte vorsichtig in den Sattel, um zurückzureiten. Auf eine solche technische Überlegenheit des Gegners war er nicht vorbereitet gewesen. Weder auf diese Flugapparate noch auf die enorme Reichweite der Fernwaffe.
Am Sammelpunkt herrschte ein großes Durcheinander. Verängstigte Pferde rannten umher und behinderten die verzweifelten Löschversuche. Stellenweise hatte der Wald Feuer gefangen, einzelne Zelte schwelten bereits, und die zahlreichen Vorratswagen brannten lichterloh.
»Sie kamen wie die Vögel, Tei-Sal!«, rief ein aufgeregter Offizier von weitem. »Sie flogen über uns und warfen Beutel mit einer stinkenden Flüssigkeit auf unseren Verpflegungstross. Wir konnten nichts machen, sie waren zu schnell.«
Wütend warf Lamshadai den nutzlosen Speer weg. »Rettet, was zu retten ist«, befahl er. »Sichert die Tiere, dann ziehen wir uns nach Westen zurück.«
Argwöhnisch spähte er nach oben, ob diese Gleitmaschinen nicht noch einmal zurückkehrten und ihre Ladung nun auf seine Soldaten schleuderten.
Aber es geschah nichts dergleichen. Offenbar waren die Kensustrianer nur daran interessiert gewesen, den Proviant zu vernichten.
»Das geht schon gut los«, murmelte er. Damit verzögerte sich das Vorhaben, bis neue Vorräte und Zelte herangeschafft waren.
Für einen Moment sah der Tei-Sal ein Flammeninferno, in dem alle zweitausend Mann verbrannt wären, wenn die Kensustrianer anstatt auf die Vorräte auf die Unterkünfte gezielt hätten. Doch die Grünhaare hatten den Angorjanern Schonung gewährt. Sollte dies letztlich nur eine Warnung gewesen sein?
Seine Besonnenheit riet ihm dringend dazu, das Unternehmen abzubrechen. Mit diesen seltsamen Flugapparaten war der Gegner wahrscheinlich in der Lage, jederzeit und an jedem Ort einen Angriff auf die Truppen zu starten, dem das Fußvolk schutzlos ausgeliefert wäre.
Doch seine Ergebenheit dem Kaiser von Angor gegenüber verlangte, dass er das Wagnis einging und unter Umständen alle Männer in den sicheren Tod führte.
Mit gemischten Gefühlen und einem Zwiespalt, wie er ihn selten in seinem Inneren gefühlt hatte, ordnete er erneut den vorläufigen Rückzug an, um weiter westlich der Grenze auf den Nachschub zu warten, den die Regentin Tersions liefern musste.
Er vermutete, dass das nicht die einzige Überraschung gewesen war, die die Grünhaare für die Angorjaner auf dem Weg nach Kensustria bereithielten. Und deren Erfindungsreichtum hielt Lamshadai bereits jetzt schon für äußerst erschreckend.
Ulldart, Königreich Tarpol, Hauptstadt Ulsar, Sommer 443 n.S.
Das tarpolische Reich verschaffte sich mit dem Sieg über das Hauptheer Borasgotans einen Respekt bei den anderen Ländern, der an Angst grenzte. Hatten fast alle Reiche vornehme Zurückhaltung bei dem Krieg und in den Verhandlungen davor geübt, mussten sie nun den Zorn des jungen Kabcar fürchten, der sich als fähiger Stratege darstellte oder zumindest auf fähige Köpfe zurückgreifen konnte.
Sein Vetter vierten Grades, Mortva Nesreca, der Mann mit den langen silbernen Haaren, galt als neuer Vertrauter am Hof, der dem Herrscher, Lodrik Bardriȼ, mit seinem Rat zur Seite stand, so lange Stoiko Gijuschka immer noch das Krankenlager hüten musste. Die Pfeilwunden, die er in Dujulev erhalten hatte, verheilten nur zögerlich.
Das Ergebnis des klaren Erfolgs der tarpolischen Streitmacht und ihrer Verbündeten, denen man nach wie vor nachsagte, sie stammten aus Tûris, führte dazu, dass sich in Ulsar schon vor der Rückkehr des Kabcar diplomatische Vertretungen aller Reiche, mit Ausnahme Kensustrias, einfanden, die auf eine Audienz drängten.
Doch Lodrik ließ sie zappeln, sagte eine Besprechung nach der anderen ab, verschob Termine um Tage und hielt die Gesandten mit anderen Ausreden hin, während Sinured und seine Männer die letzten Reste borasgotanischen Widerstands aus Tarpol entfernen sollten. Nach wie vor galt die Losung »Keine Gefangenen«. Lodrik statuierte auf Anraten seines Konsultanten ein Exempel für weitere mögliche Invasoren.
Das Volk feierte ihn als Helden, der das Land von einer furchtbaren Bedrohung befreit hatte.
Selten war ein Name so oft und so voller Freude in Tarpol genannt worden wie der seinige. In den Geschichten von der entscheidenden Schlacht in der Ebene von Dujulev wuchsen die Verdienste Lodriks von Erzähler zu Erzähler. Es würde nicht mehr lange dauern, bis er der angesehenste und verehrteste aller Bardriȼs geworden war, vom »TrasTadc« zum Befreier und Erneuerer des Reiches. Einen solchen Aufstieg hatte der Kontinent noch nie erlebt.
Die freie Zeit, die Lodrik hatte, verbrachte er sehr zum Erstaunen Norinas nicht mit ihr, sondern verschwand mit seinem Vetter irgendwohin, um erst nach Stunden wieder aufzutauchen. Selbst Waljakov durfte die beiden nicht begleiten. Danach war der junge Mann zu müde und zu erschöpft, um sich länger um seine Geliebte zu kümmern, was er ihr manchmal sehr ruppig klar machte.
So hatte sich für Norina noch keine passende Gelegenheit ergeben, dem Kabcar zu berichten, dass er Vater werden würde. Und je öfter Lodrik mit Mortva unterwegs war, desto mehr zweifelte sie daran, dass es eine gute Idee wäre, von dem unehelichen Kind zu erzählen.
Mehr und mehr vertraute der junge Mann seinem Verwandten mit den silbernen Haaren, zog ihn zu allen Entscheidungen hinzu und ließ sich mehr als einmal von den Meinungen des Konsultanten beeinflussen.
Norina und Waljakov hegten und pflegten in den Stunden, in denen der Kabcar verschwand, den immer noch sehr anfälligen Stoiko, der sichtliche Schwierigkeiten mit dem Gesunden hatte. Die borasgotanischen Bogenschützen hatten damals ganze Arbeit geleistet.
Einmal erzählte der hünenhafte Leibwächter der Brojakin von dem seltsamen Verhalten Mortvas, als er in Dujulev tatenlos neben den blutenden Wunden des Vertrauten gestanden hatte. Dafür berichtete Norina von dem Vorschlag, den ihr der Konsultant bei der Siegesfeier gemacht hatte. Beide waren sich einig, dass Mortva so schnell wie möglich verdrängt werden musste, zum Wohle Lodriks und damit auch zum Wohle Tarpols.
Die schwarzhaarige Brojakin zweifelte daran, dass Mortva noch lange zurückhaltend blieb. Er würde in absehbarer Zeit sein wahres Gesicht zeigen, wie er es ihr kurz offenbart hatte: intrigant, hinterhältig und vermutlich äußerst skrupellos. Damit hatte er die besten Aussichten, die Gemahlin des Kabcar auf seine Seite zu ziehen.
Denn Aljascha wartete nur auf eine Gelegenheit, den Thron des Landes besteigen zu können, alle Macht in sich zu vereinen und zu regieren, wie sie es für richtig hielt. Daraus machte sie keinen Hehl. Schon einmal hatte sie versucht, den angedrohten Selbstmord Lodriks in die Tat umzusetzen, was Waljakovs Eingreifen jedoch in letzter Sekunde verhindert hatte. Sie an der Spitze Tarpols, das musste unter allen Umständen abgewendet werden.
Einen Tag nach der Rückkehr von Dujulev hatte sich etwas ereignet, das im Nachhinein zu großer Aufregung im Palast und der Hauptstadt führte. Es war der Morgen nach der Feier, der engste Kreis um den Kabcar hatte sich zum gemeinsamen Mittagessen getroffen.
Als Vorletzter erschien ein äußerst gut gelaunter Mortva, in der Hand einen gepanzerten Kriegshandschuh haltend, den er neben sich auf seinen Platz legte.
»Seht, was ich gefunden habe«, sagte der Konsultant. »Ich vermute, so martialisch wie dieses Ding aussieht, gehört es unserem ritterlichen Freund, nicht wahr?«
Die Versammelten starrten den Mann mit den silbernen Haaren an, Waljakov musste ein bösartiges Grinsen unterdrücken.
»Mortva, das, was Ihr uns da auf den Tisch gelegt habt, gehört in der Tat unserem Ordenskrieger«, meinte Lodrik nach einer Weile und sah dabei kein bisschen glücklich aus. »Und wenn Ihr jede weitere Schwierigkeit vermeiden wollt, dann empfehle ich, bringt den Handschuh so schnell Euch Eure Beine tragen wieder dorthin, wo Ihr ihn aufgehoben habt. Zu Eurem eigenen Schutz.«
Der Konsultant lehnte sich erstaunt zurück. »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, was mein hoheitlicher Vetter mir sagen möchte. Wird denn Nerestro nicht glücklich sein, dass ich ihm sein wertvolles Rüstungsteil zurückbringe? Es wird einige Waslec gekostet haben, es anfertigen zu lassen.«
»Was der Kabcar sagen möchte«, schaltete sich Aljascha hilfreich ein, »ist, dass der Ritter damals eine Forderung an den Handschuh band. Jeder, der ihn aufhebt, befindet sich in Fehde mit ihm. Ihr solltet wirklich tun, was mein Gatte Euch rät.«
»Herzlichen Glückwunsch, Silberschopf«, murmelte der Leibwächter, und Norina lachte auf, bevor sie sich die Hand vor den Mund halten konnte.
Mortva tippte den metallenen Fingerschutz vorsichtig mit seinem Messer an. »Soll das heißen, ich muss jetzt gegen diesen Ritter einen Zweikampf bestehen? Ich?« Er sah an seinem wenig muskulösen Körper herab, der wie immer in einer tadellosen Uniform steckte.
Die Tür flog auf, und Nerestro von Kuraschka trat in den Raum, gewappnet mit Kettenhemd und Waffenrock, die aldoreelische Klinge an seiner Seite. Seine Augen verrieten, dass etwas nicht stimmte. »Ich muss mich für meine Verspätung entschuldigen, hoheitlicher Kabcar, aber jemand hat meinen Panzerhandschuh aufgenommen, ohne dass mir davon …«
Der Konsultant hob den Arm.
Nerestro wandte seinen Blick um und entdeckte das Stück vor dem Mann mit den silbernen Haaren. Er schien erleichtert zu sein. »Aha, es ist bei Euch abgegeben worden, Nesreca. Hat es der Mensch nicht gewagt, bei mir zu erscheinen, aus Angst, er müsste mit mir ein Duell austragen, was? Nun, es war wohl ein guter Zug von ihm.«
Mortva lächelte. »Um ehrlich zu sein, ich habe den Handschuh aufgehoben. Es hat keinen Zweck, es zu leugnen. Zu viele haben mich damit gesehen.«
Das Gesicht des Ritters entgleiste. »Mit Verlaub, seid Ihr wahnsinnig geworden?«
»Ich dachte, Ihr hättet den Handschuh verloren«, versuchte der Verwandte des Kabcar zu erklären. »Daher …«
»Er lag mit voller Absicht dort, Nesreca«, seufzte der Ordenskrieger. »Wer auch immer ihn aufhebt, der hat sich meine Feindschaft zugezogen. In diesem Fall trifft es dann wohl den Falschen.«
»Wer weiß«, murmelte Waljakov in seinen Bart.
Mortva legte die Fingerspitzen zusammen. Er wirkte sehr ruhig. Seine unterschiedlich farbigen Augen ruhten forschend auf dem Kämpfer. »Und wie geht es nun weiter? Wollt Ihr mich vielleicht direkt vor den Augen des Kabcar umbringen, oder wie habt Ihr Euch das vorgestellt? Ich schlage vor, da Ihr ohnehin sagtet, ich sei der Falsche, lassen wir es dabei bewenden und sagen einfach …«
»Nein«, schnitt ihm Nerestro barsch das Wort ab. »Ich bin Ordenskrieger der Hohen Schwerter, Diener des Gottes Angor, und meine Ehre lässt es nicht zu, dass ich einen derartigen Vorfall einfach auf sich beruhen lasse. Das müsst Ihr verstehen.«
»Ihr wollt wirklich einen Zweikampf?« Die Brauen des Konsultanten wanderten ungläubig in die Höhe. »Ich bin doch aber kein gleichwertiger Gegner für Euch.«
»Ihr habt meine Forderung angenommen, meinen Fehdehandschuh aufgenommen.« Der mächtige Kämpfer schüttelte den kurz geschorenen Kopf, die blond gefärbte Bartsträhne pendelte hin und her. »Da spielt es keine Rolle, wer ihn aufnimmt. Entscheidend war, dass Ihr ihn aufgenommen habt.«
»Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit?«, erkundigte sich Lodrik ein wenig ratlos. »Ich würde nur ungern meinen Vertrauten«, Norina und Waljakov zuckten bei diesem Wort zusammen, das der Herrscher bisher Stoiko vorbehalten hatte, »verlieren.«
»Nein.« Der Ritter blieb hart.
»Und wenn ich es Euch als Kabcar befehle?« Die Stimme des jungen Mannes bekam einen lauernden Unterton, die blauen Augen wurden schmal.
»Dann«, gleichmütig hielt sein Braun dem Blick stand, »müsste ich gegen Eure Anordnung handeln. Die Ehre eines Kriegers kann man nicht wegbefehlen, hoheitlicher Kabcar. Auch Ihr, der Held von Dujulev«, er klang dabei etwas amüsiert, »vermögt das nicht.«
Ein unangenehmes Schweigen breitete sich im Raum aus. Niemand griff nach den Speisen, deren Duft appetitlich in der Luft hing, jeder schien über eine Lösung des Problems nachzudenken.
»Und wenn Mortva einen Stellvertreter benennt, der für ihn gegen den Ritter antritt? Um den wäre es wenigstens nicht schade, wenn er umkommen würde«, schlug Aljascha mit Begeisterung vor. »Ich meine natürlich den Stellvertreter, der umkommt. Nicht Euch, Herr Ritter.« Eine erneute Spitze der rothaarigen Schönheit gegen den Mann, der es gewagt hatte, sie zurückzuweisen.
»Zu gütig, hoheitliche Kabcara. Darauf könnte man sich einigen«, stimmte Nerestro zögerlich zu. »Aber um einen Zweikampf werdet Ihr nicht herumkommen, Nesreca.«
»Warum hat mir denn das niemand vorher gesagt?« Der Konsultant klatschte in die Hände. »Ich hätte da jemanden an der Hand, der gegen Euch antritt und meine Ehre verteidigt. So hätten wir beide Eurem Kodex genüge getan, unsere Gesichter blieben gewahrt.«
Die Spannung im Zimmer fiel ab, die Erleichterung spiegelte sich in den Mienen der Anwesenden. Bis auf Waljakovs Antlitz, der zu gerne gesehen hätte, wie der heimtückische Berater in zwei Hälften zerfiel.
»Und wie weit soll diese Ehrenrettung gehen?«, fragte Norina. »Muss einer tot auf der Erde liegen?«
»Wir können uns auf die Regelung ›Erstes Blut‹ einigen.« Der Ordenskrieger setzte sich und legte eine Fleischscheibe auf seinen Teller. »Und wie die Bezeichnung schon sagt: Derjenige, bei dem als Erster Blut zu sehen ist, hat verloren.«
»Dabei macht es aber keinen Unterschied, ob er einen Schnitt ins Ohrläppchen erhält oder seinen Kopf verliert?« Der Konsultant beugte sich nach vorne und beobachtete interessiert, wie Nerestro begann, sein Mittagessen zu verzehren. Das Fleisch war im Inneren noch leicht roh, daher lief roter Bratensaft auf den Teller, als das Stück durchschnitten wurde.
»Nein, es macht keinen Unterschied«, antwortete der Ritter langsam und sah auf das Rot, das sich auf dem hellen Porzellan ausbreitete.
»Ich hätte noch einen Vorschlag zu machen, der Gerechtigkeit halber.« Mortva deutete mit dem Zeigefinger an die Seite des Kriegers. »Ihr seid im Besitz einer aldoreelischen Klinge, und ich selbst habe gesehen, was diese Waffe mit Menschen und Rüstungen oder Menschen in Rüstungen anstellt. Wärt Ihr bereit, bei diesem Zweikampf auf diese Besonderheit zu verzichten? Nicht, dass mein Streiter Euren ersten Hieb nicht übersteht, weil er durch Mark und Bein geht.«
Nerestro fuhr sich über die gefärbte Bartsträhne, die einen Kontrast zu dem kurzen braunen Haarspitzen auf dem Kopf bildete. »Nun gut, weil Ihr es seid und weil Ihr den Handschuh aufgehoben habt, ohne zu wissen, was Ihr Euch damit aufladet. Aber den Ort bestimme ich. Und ich wähle den großen Marktplatz von Ulsar.«
»In aller Öffentlichkeit?«, wunderte sich Lodrik. »Warum denn das, Herr Ritter?«
»Ich habe meine Ehre vor aller Augen zur Verfügung gestellt, daher muss sie vor aller Augen wieder hergestellt werden, so will es die Ordensregel«, erklärte der Mann.
»Man könnte doch ein richtig kleines Spektakulum daraus machen«, sinnierte der Konsultant. »Die Ulsarer würden sich bestimmt darüber freuen, etwas Abwechslung im eintönigen Städterleben zu haben. Gut, mein Streiter wird hoffnungslos unterlegen sein, aber er wird einen guten Kampf liefern, das verspreche ich Euch.«
Der Kabcar nickte. »Wenn Ihr einverstanden seid, Nerestro«, der Ritter neigte den Kopf, » dann lasse ich die Ausrufer durch die Straßen und Gassen ziehen. Wenn wir eine Woche als Vorbereitungszeit ansetzen, reicht das aus?«
»Ich benötige keinerlei Vorbereitung«, lehnte der Ordenskrieger verächtlich ab, aber Mortva nahm den Vorschlag auf, damit sich sein Streiter geistig auf die Begegnung vorbereiten konnte.
Waljakov und Norina tauschten schnelle Blicke aus. Sie waren sich sicher, dass der Mann mit den silbernen Haaren etwas im Schilde führte und der Ritter, ohne dass er es wusste, ihm die beste Gelegenheit zu einer Gemeinheit bot.
Jemand, der Militärgeschichte studiert hatte, musste wissen, was ein umherliegender Panzerhandschuh bedeuten konnte. Zumal es absolut sicher war, dass Nesreca schon lange vom Fehdeschwur Nerestros wusste, so gut, wie er ansonsten informiert war. Daraus ergab sich zumindest für Waljakov nur ein Schluss: Er hatte den Handschuh mit voller Absicht aufgehoben.
»Kennen wir eigentlich Euren Streiter?«, wollte Aljascha neugierig wissen. Ihre Katzenaugen hingen an den Lippen ihres entfernten Verwandten. »Ich habe Euch bisher immer nur allein gesehen. Wollt Ihr jemanden von der Wache gegen unseren Ritter schicken?«
Der Konsultant langte über den Tisch und nahm sich einen Apfel, den er mit kurzen, präzisen Bewegungen schälte. »Mein Begleiter ist ein sehr stiller, zurückhaltender Mensch, der erst vor kurzem in Ulsar eintraf. Ich kenne ihn aus meiner Zeit in Berfor.«
»Sagt ihm, ich lasse ihm die Wahl, welche Waffe er sich nimmt«, sagte Nerestro, der sich seines Sieges beinahe schon sicher war. »Ich bin nur gespannt, wie lange er durchhält.«
»Nicht sehr lange, fürchte ich, Herr Ritter«, bestätigte der Konsultant und machte ein unglückliches Gesicht. »Meine Ehre wird dahin sein. Aber ich habe sie wenigstens verteidigt.«
»Ihr habt verteidigen lassen«, meinte Waljakov verächtlich.
»Was aber erlaubt ist«, fügte Lodrik schnell hinzu, um zu verhindern, dass Mortva durch den Einwand seines Leibwächters sich doch noch dazu berufen fühlte, selbst gegen den Ordenskrieger anzutreten. »Wir alle werden unser Vergnügen haben, da bin ich mir sicher. Ich werde Tribünen errichten lassen, um dem Volk den besten Blick auf die beiden Gegner zu ermöglichen. So etwas sieht man ja nicht alle Tage.«
»Ganz recht«, sagte der Mann mit den silbernen Haaren und schob sich genüsslich ein Stück Apfel in den Mund. »So etwas hat man in Ulsar eigentlich noch nie gesehen. Es wird einmalig werden.«
Eine Woche danach erhoben sich vier quadratisch angeordnete Tribünen auf dem großen Marktplatz. Im Hintergrund wurde eifrig an den einstigen Ruinen der Ulldrael-Kathedrale gearbeitet, um ein festes Fundament für den Neubau zu schaffen.
Jeden Tag fanden sich Freiwillige ein, die zu Ehren des Gottes der Gerechtigkeit und des Wissens Hand anlegten, um für seine Hilfe gegen Borasgotan zu danken. Seit dem Sieg des Kabcar erlebte die Arbeit an dem neuen Gotteshaus einen Zulauf wie noch nie. Wenn der Obere von den Gläubigen verlangt hätte, einen Berg an dieser Stelle zu errichten, vermutlich hätten die Menschen auch das getan.
Doch im Moment genügte es dem Oberhaupt, dass die Helfer die Trümmer abgeräumt und zu einer Plattform zusammengefügt hatten. In wenigen Monaten sollten die Pläne für die neue Kathedrale fertig gestellt sein, dann würde mit der Neuerrichtung begonnen.
An diesem Tag wurden die Freiwilligen gegen Abend aus ihrer Arbeit entlassen. Die Bänke der Tribünen füllten sich zügig, ebenso die Dächer der umliegenden Häuser.
In der Ehrenloge saßen bereits der Kabcar und seine Gemahlin, sein Leibwächter, die kensustrianische Priesterin sowie die Brojaken Tarpols, die sich das Schauspiel nicht entgehen lassen wollten.
Wenn sich Lodrik richtig erinnerte, war das seit langem der erste öffentliche Auftritt seines Gegenspielers im Rat, Tarek Kolskoi. Er hatte sich seit Beginn des Krieges nicht mehr sehen lassen und die Nähe des Herrschers gemieden. Von Unternehmungen, die am Thron des jungen Mannes rüttelten, wurde nichts gemeldet. Seine Spione berichteten, dass sich der granburgische Adlige mit einer Heerschar von Leibwächtern umgeben hatte und er dubiose Gelehrte zu sich kommen ließ. Es schien, als habe irgendetwas den dürren Haraȼ außerordentlich beunruhigt.
Nun saß der vogelscheuchenhafte Mann einige Stufen unterhalb des Kabcar und starrte auf den Markplatz, wo allmählich Bewegung auszumachen war.
Nerestro von Kuraschka marschierte ein, funkelnd und glänzend in seine schwere, gravierte Rüstung gehüllt, eine Ladung kostbarer Pelze um die breiten Schultern gelegt. Der Kopf wurde von einem ebenso teuer anmutenden Helm geschützt, nur eine Aussparung ließ Augen, Nase und Mund frei, um eine bessere Atmung zu gewährleisten. Vom oberen Rand des Schutzes wölbte sich ein Metallbügel über den Nasenknochen.
Kaum trat der Ordenskrieger auf, schoss sein Banner am Fahnenmast am Rand des Platzes in die Höhe. Sein Gefolge schlug rhythmisch mit den gepanzerten Fäusten auf die Schilde.
Knappen befreiten den Ritter von den Pelzen, danach legte er in aller Ruhe seine aldoreelische Klinge ab, platzierte sie in einem eigens aufgestellten Halter und befestigte ein herkömmliches Schwert an seiner Seite. Den Dreiecksschild, den ein anderer Helfer ihm am Arm festschnallte, bewegte er mit spielerisch anmutender Leichtigkeit. Breitbeinig positionierte er sich auf dem Kopfsteinpflaster und wartete auf seinen Gegner.
Auf der gegenüberliegenden Seite erschien zunächst Mortva Nesreca, tadellos mit der grauen Uniform bekleidet, die silbernen Haare lagen wie Quecksilberfäden am Rücken. Die Fahne des Hauses Bardriȼ, etwas abgewandelt und mit dem Zeichen des Hauses Nesreca versehen, flatterte kurz darauf im Wind.
Dann trugen vier Diener, denen die Anstrengung deutlich ins Gesicht geschrieben stand, einen großen Ständer mit verschiedenen Waffen und Schilden herein und stellten ihn hinter dem Konsultanten ab. Ein erstes Raunen ging daraufhin durch die Menge. Der Gegner des Ritters schien mit einer langen Auseinandersetzung zu rechnen.
Ein schwarz gekleideter Mann trat aus dem Schatten einer Tribüne wie aus dem Nichts an Nesreca heran, deutete eine Verbeugung an und sah hinüber zu Nerestro.
Er trug eine schwarze Lederrüstung, auf die silberne Metallstücke lamellenhaft aufgebracht worden waren und deren Enden bis weit über die Knie reichten. Die Arme wurden von miteinander verflochtenen Kettenringen geschützt, die Hände steckten in Panzerhandschuhen. Schwarze, nietenbesetzte Stiefel rundeten das Bild eines äußerst unliebsamen Zeitgenossen vollständig ab.
Sein fast schon hohlwangiges Gesicht, das von einem Dreitagebart geziert wurde, war ausdruckslos. Offenes, schwarzes Haar hing wie nasses Sauerkraut vom Kopf herab und wirkte fettig. Zum Erstaunen der Menschen trug der Unbekannte einen Augenschutz, wie er normalerweise im Winter benutzt wurde, wenn lange Strecken über gleißende Schneeflächen zurückgelegt werden mussten.
»Meine Güte, wo hat mein Vetter den denn kennen gelernt?«, murmelte Lodrik etwas überrascht.
»Auf alle Fälle sieht er aus, als könnte er mit Waffen umgehen«, gab Aljascha ihre Meinung ab. Wie immer hatte sie eine Garderobe ausgesucht, die viel versprach und sich hart an der Grenze zur Erregung öffentlichen Ärgernisses befand. Ihr Haar leuchtete in den Strahlen der untergehenden Sonnen noch roter als sonst auf. Die scheuen Blicke männlicher Untertanen waren der Kabcara wieder einmal gewiss.
Norina, die eine abgewandelte granburgische Brojakentracht trug, saß in der Nähe von Waljakov, der interessiert nach unten sah. »Was überlegt Ihr?«
»Ich versuche mich zu erinnern, woher ich diese Art der Rüstung kenne«, antwortete der Hüne der jungen Frau. »Es ist ein sehr ungewöhnlicher Schutz. Wenn ich nur wüsste, woher mir diese Bauweise bekannt vorkommt.«
Ein Herold, der unterhalb der Ehrenloge gewartet hatte, schritt vorwärts, flankiert von Trompetern und Trommelspielern, die mit ihrem Instrumentenspiel auch den letzten Unaufmerksamen darauf hinwiesen, dass der Kampf gleich beginnen sollte. Abrupt endeten sie.
»Höret, höret, höret«, rief der Herold in die Stille hinein. »Nerestro von Kuraschka, Ritter des Ordens der Hohen Schwerter, Diener des Gottes Angor, steht zu meiner Rechten, um die Forderung von Mortva Nesreca, Vetter vierten Grades unseres hoheitlichen Kabcar und zugleich sein Konsultant, anzunehmen. Nesreca hat erklärt, dass Echòmer der Schwarze …«
»Der Name passt«, raunte die schwarzhaarige Brojakin Waljakov zu. »Der Unheimliche wäre aber besser.«
»… als sein Streiter an seiner statt den Zweikampf führen wird. Es sei kundgetan, dass gekämpft wird, bis erstes Blut bei einem der Gegner erscheint, um der Ehrenrettung genüge zu tun.« Das Trio machte ein paar Schritte rückwärts, um den Platz symbolisch freizugeben. »Es möge beginnen.«
Auch der Konsultant wich bis an den Rand der Aufbauten zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte, während sein Stellvertreter zum Waffenständer ging.
Der Ordensritter stapfte bis in die Mitte der improvisierten Arena, zog sein Schwert und ritzte eine Linie in den Stein. Knirschend zeichnete sich ein tiefer Kratzer ins Pflaster, danach stützte er die Hand auf den Knauf und wartete, dass sein Kontrahent zu ihm kam.
Echòmer warf einen Blick über die Schulter, schien den Ritter durch die schmalen Schlitze des Sonnenschutzes abzuschätzen, griff dann zu einem kleinen Rundschild und einem Kriegsmorgenstern, an dessen Ende drei spitzenbesetzte Kugeln baumelten. Die schlanken Dornen waren halb so lang wie ein kleiner Finger.
Prüfend ließ er die Waffe durch die Luft sausen, nickte knapp und wandte sich zu Nerestro um. Vor der Linie blieb er stehen.
»Er weiß mit Waffen umzugehen«, bestätigte Waljakov widerwillig die Einschätzung der Kabcara. »Er muss über enorme Kräfte verfügen, wenn er einen solchen Morgenstern mit einer Hand führen kann. Die Wahl lässt mich nichts Gutes für unseren Freund ahnen.«
»Ich entbiete Euch meinen Respekt, Echòmer der Schwarze«, sagte der Ritter höflich und hob das Heft seines Schwertes als Gruß vor sein Gesicht. »Ohne überheblich sein zu wollen, Ihr werdet einen schweren Stand haben, die Ehre Eures Freundes zu verteidigen.«
Regungslos stand ihm der andere gegenüber, der Morgenstern hing harmlos am ausgestreckten Arm nach unten. Leise klirrend schlugen die Kugeln aneinander.
»Wenn Ihr diesen Strich übertretet, sehe ich den Kampf als eröffnet an. Wagt Ihr …«
Ansatzlos sprang Echòmer nach vorne, rammte dem unterbrochenen Nerestro den Schild gegen die Brustpanzerung, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, und schlug einen Lidschlag später mit seiner mörderischen Waffe zu.
Krachend landeten die Kugeln auf der linken Schulter, die Eisendornen bohrten sich kreischend in das schützende Metall und steckten fest. Blut sickerte nicht hervor.
Während Nerestro noch um Standfestigkeit rang, ließ sein Gegner den Schild fallen, umfasste den Griff seiner Waffe mit beiden Händen, um daran zu reißen und zu zerren. Dabei stellte er sich so, dass der Ritter mit seinem Schwert nicht an ihn herankam.
Die Ulsarer schrien auf, die einen aus Schreck, die anderen aus Begeisterung über den unkonventionellen Stil des Fremden.
Belkala war aufgesprungen, die Hände ineinander verkrampft, die Brust hob und senkte sich schnell. Ihre Angst um den Geliebten war deutlich ablesbar.
Mortva hob den Kopf und sah zu der Priesterin. Das Lächeln wich nicht aus seinem Gesicht.
Echòmer begann, den Ordensritter wie einen störrischen Hund an einer Leine im Kreis um sich herumzuziehen, Nerestro taumelte und stolperte hinterher. Zu groß war die Kraft, die in den Armen des Gegners steckte und die er niemals vermutet hätte.
Mit einem wütenden Schrei schlug der Angor-Gläubige nach Echòmer, der zwar unter der Klinge wegtauchte, den Griff aber loslassen musste.
»Das«, keuchte Nerestro aufgebracht, »war weder ritterlich noch ehrenhaft. Benehmt Euch wie ein Recke!«
Der Kämpfer in der schwarzen Rüstung trabte zu seinem Waffenständer, um sich einen Dreiecksschild und einen Streitkolben zu nehmen.
Nun folgte ein Schlagabtausch, wie er dem Ordenskrieger zu gefallen schien, erkennbar an seinem grimmigen Lachen. Im ehrlichen Kampf schien Echòmer der Unterlegene zu sein, der sich mehr und mehr auf die Verteidigung beschränkte, als dem Ritter zuzusetzen.
Waljakov dagegen hatte den Eindruck, dass der Stellvertreter Nesrecas ein Spielchen spielte.
Es war ihm aufgefallen, dass sich der Unbekannte immer weiter zurückfallen ließ, immer weiter weg von dem Halter mit der aldoreelischen Klinge. Vielleicht setzte der Mann auch darauf, dass dem Ritter dank der schweren Rüstung die Kraft ausging.
Echòmer ließ die gegnerische Schneide einen Moment aus den Augen, und schon traf die Klinge in seinen Arm, durchbohrte das Kettengeflecht und drang, nur für den Ritter sichtbar, ein wenig in das blasse Fleisch ein.
Sofort machte Nerestro einen Schritt rückwärts. »Ich habe Euch getroffen, Echòmer der Schwarze. Damit ist meinem Ehranspruch genüge getan worden.« Die Menge verstand nicht genau, weshalb der Ritter seine Angriffsserie unterbrach. »Dankt mir nicht für meine Milde.«
Sein Kontrahent sah auf die Stelle, an der aber kein Blut austrat.
Mortvas Krieger lächelte kurz, dann zuckte der Arm mit dem Schild nach oben. Mit einem scheppernden Geräusch schlug die untere Kante des Schutzes gegen den Helm, Nerestros Kopf schnappte durch den Aufschlag neunzig Grad zur Seite. Benommen wankte er nach links und brach scheppernd in die Knie.
Echòmer kam auf ihn zu; die Deckung weit offen, und benebelt stocherte der Ritter nach dessen Beinen. Auf Grund des Widerstands, den er spürte, war sich Nerestro sicher, dass er den Mann ein zweites Mal verwundet hatte. Als er jedoch auf sein Schwert sah, fehlte erneut jede Spur von Lebenssaft.
Hart landete dafür die Stiefelsohle seines Gegners mitten in seinem Gesicht, und der Ordenskrieger fiel auf das Kopfsteinpflaster.
Belkala schrie auf und machte sich auf den Weg nach unten. Auch die Ulsarer brachen in aufgeregtes Gemurmel aus.
Waljakov wandte sich zu Lodrik, der mit Besorgnis die Vorgänge verfolgte.
»Herr, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe den Eindruck, dass Nesrecas Stellvertreter den Ritter umbringen möchte«, sagte er leise, aber bestimmt ins Ohr des Kabcar. »Unterbrecht das, bevor Nerestro stirbt.«
»Das glaube ich nicht«, sagte der junge Mann, klang aber nicht sicher. »Ich meine, warum sollte er das tun?«
»Weil er für Euren Vetter antritt und Euer Vetter den Ritter aus irgendeinem Grund nicht leiden kann, Herr«, erklärte der Leibwächter lauter als beabsichtigt. Lodrik wandte sich erstaunt zu Waljakov um und wollte etwas entgegnen.
»Ach, Unsinn«, schaltete sich die Kabcara in diesem Augenblick samtweich ein. »Er wird ihm nur eine Lehre erteilen wollen. Der Mann ist für meinen Geschmack etwas zu anmaßend, und ein wenig Prügel dürften ihm nicht schaden. Wo er doch als echter Krieger des Gottes Angor so viel einstecken kann. Schaut nach unten: Er blutet nicht einmal.«
Der Herold hatte sich mittlerweile vorsichtig zu dem Ritter begeben, um nach dem Rechten zu sehen. Nerestro erhob sich schwankend.
»Kein Blut«, berichtete der Ausrufer tatsächlich, und inspizierte auf Wunsch des Ritters auch Echòmer. »Kein Blut«, rief er ein zweites Mal. »Der Kampf geht weiter. Oder möchte einer der beiden aufgeben?«
Der Ordenskrieger schüttelte den Kopf. Sein Gegner nahm als Antwort einen ovalen, beinlangen Schild, an dem jeweils rechts und links lange, dünne Spitzen hervorstanden, aus dem Ständer. Mit beiden Händen fasste Echòmer die Griffe, dann ließ er die Kombination aus Schutz und Waffe in atemberaubender Geschwindigkeit um die eigene Achse kreisen.
Nerestro wusste inzwischen, dass mit seinem Gegner etwas nicht in Ordnung war.
Beim ersten Mal hätte er sich vielleicht noch täuschen können, aber das ungeschützte Bein dieses Echòmer müsste nach dem Schwerthieb bluten. Was es aber immer noch nicht tat.
Und er ahnte, dass er nicht mehr um seine Ehre, sondern um sein Leben kämpfte.
Nesreca hatte absichtlich darauf bestanden, dass er die aldoreelische Klinge ablegte. Warum das herkömmliche Schwert bei seinem Kontrahenten nicht wirkte, darüber machte er sich nicht wirklich Gedanken. Er musste nur irgendwie an seine kostbare Waffe, die am anderen Ende des Platzes stand, kommen, um Echòmer zu verwunden, bevor er tot auf das Kopfsteinpflaster fiel. Diesen Triumph wollte er dem Konsultanten nicht gönnen. Danach würde er sich ihn vorknöpfen.
Der Kämpfer in der schwarzen Rüstung stand so, dass er Nerestro den Weg zu seiner angestammten Waffe versperrte. Nach Lidschlägen der Regungslosigkeit, begann der Ordenskrieger mit seinen Angriffen, die nur dazu dienen sollten, Echòmer zur ständigen Parade zu zwingen.
Doch dieser seltsame Schild mit den Metallspitzen an den Enden, den sich der Mann ausgesucht hatte, war eine hervorragende Wahl gewesen und machte aus jeder Abwehr durch eine kleine Bewegung des Arms einen Gegenangriff.
Nerestro warf seinen Schild zur Seite, nahm das Schwert mit beiden Händen und drosch auf den Kontrahenten so schnell ein, dass Echòmer nur noch dagegenhalten konnte. Darauf hatte der Ritter gewartet.
Bei seinem letzten wuchtigen Hieb zog er das gepanzerte Knie nach oben und beförderte die Kante der gegnerischen Verteidigung gegen den Augenschutz, der daraufhin verrutschte.
Sofort ließ der Mann den Schild fallen, riss die Arme nach oben und versuchte, seine offensichtlich für Licht anfälligen Pupillen vor den Sonnen zu schützen.
Der Ordenskrieger lief los, so schnell es ihm sein schwerer Panzer und sein dröhnender Kopf erlaubten, um die aldoreelische Klinge zu erreichen. Die Ulsarer riefen und feuerten den Mann an.
Als er bei dem Schwert angekommen war und es aus der Scheide zog, traf ihn ein Schlag in den Rücken, der ihn gegen den Halter warf. Aber mit seiner Waffe in den Händen fühlte sich Nerestro sicherer als vorher.
Schwungvoll drückte er sich von dem Ständer ab und schlug aus der Drehung zu. Von schräg unten drang die Schneide in Höhe des Rippenansatzes in die Panzerung Echòmers ein, glitt ein paar Zentimeter in den Körper. Und steckte fest.
Fassungslos starrte Nerestro auf seine Waffe, während ein unmenschliches Gebrüll aus dem Mund seines bisher stummen Widersachers drang.
Reflexartig setzte der Ritter dem Getroffenen den Fuß auf den Bauch und stieß ihn nach hinten weg.
Knirschend kam die Klinge zum Vorschein, an der weiterhin kein Blut klebte. Normalerweise hätte sein Gegner in zwei Hälften zu Boden fallen müssen.
Aus den Augenwinkeln bemerkte er, wie der Herold mit blassem Gesicht angerannt kam. Die Ulsarer hatten sich von den Tribünen erhoben.
»Angor beschütze mich«, flüsterte der Ordenskrieger, und vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben spürte er tiefe Furcht.
Dann drang die Metallspitze seines Gegners mit immenser Wucht vollständig in seine linke Brust ein, wurde ruckartig herausgerissen, gefolgt von einem dicken Schwall Blut, das aus dem Loch schoss.
Ein warmes Gefühl breitete sich in seinem Oberkörper aus, seine Finger wurden kraftlos, die Knie gaben nach, und er stürzte der Länge nach zu Boden. Entfernt hörte er das triumphierende Geheul Echòmers, das immer leiser wurde.
Nerestro spürte, wie man ihn auf den Rücken drehte, dann sah er undeutlich grüne Haare, ein geliebtes Gesicht und ein paar bernsteinfarbene Augen, die ihn entsetzt ansahen.
»Der Ring, den Angor mir gegeben hat, Belkala«, sagte er kaum vernehmlich und zuckte mit der linken Hand. »Zerschlag ihn. Schnell.«
Seine Linke wurde angehoben, etwas knirschte, dann glitt er in eine grüne Dunkelheit.
Mortva neigte den Kopf ein wenig zur Seite und lächelte zufrieden, als er den Ritter zu Boden gehen sah. »Nein, wie furchtbar«, rief er laut und machte sich auf den Weg, um sich unter die Schaulustigen zu mischen.
Immer mehr Menschen kamen auf den Marktplatz geeilt, um nach dem Getroffenen zu sehen. Wachen strömten herbei, um das Volk zurückzudrängen, auch die restlichen Ritter mit ihrem Gefolge sorgten dafür, dass die Ulsarer nicht zu nahe an den Verletzten heranliefen.
Als der Konsultant die Mauer aus Menschenrücken durchbrochen hatte, sah er Belkala neben Nerestro knien, ein dunkelgrünes Leuchten umgab den Körper des Verwundeten. Die Menge an Blut, das wie ein kleiner Brunnen rhythmisch aus dem Loch in der Rüstung spritzte, verringerte sich in kürzester Zeit.
Der Mann mit dem Silberhaar beugte sich zu dem Ordenskrieger herab. »Nerestro, hört Ihr mich? Sagt doch etwas?« Seine Hand legte sich an die Lebensader am Hals des Kriegers. Fast unmerklich pulsierte das Herz. Seine Enttäuschung darüber verbarg er meisterlich.
Das Grün, in das er mit den Fingern eingetaucht war, nahm er als Kribbeln wahr. Aus dem Prickeln wurde plötzlich ein schmerzhaftes Stechen, ruckartig zog er die Hand zurück und massierte sie. Was auch immer dem Ritter das Leben bewahrt hatte, es griff ihn an.
»Verschwindet, Nesreca!«, fauchte die Kensustrianerin, ihre Iris glühte giftgelb auf. Wie ein Tier, das seinen Nachwuchs beschützt, kauerte sie halb über dem Mann.
Mortva war für einen Sekundenbruchteil verunsichert. »Wenn Ihr meine Hilfe nicht wollt, dann lasst wenigstens einen Cerêler holen«, sagte er leise. »Was ist das für ein Leuchten um ihn herum?«
»Sein Gott hat ihn gerettet«, knurrte sie und zeigte dem Mann ihre langen Reißzähne. »Euer Mann hätte ihn ansonsten getötet. Absichtlich.«
»Es war wohl so eine Art Kampfrausch. Darüber reden wir ein anderes Mal«, lenkte Mortva ab und erhob sich. Der Konsultant winkte die Eskorte mit dem kleinwüchsigen Heiler zu sich.
Der Hof-Cerêler, Chos Jamosar, warf einen kurzen Blick auf den Ritter. »Da kann ich nicht viel machen. Die Magie hat bereits gewirkt. Wir müssen warten, bis sie ihre Kraft verloren hat, erst danach kann ich mit einer Weiterbehandlung beginnen.«
»Ich habe keinen Cerêler in seiner Nähe gesehen außer Euch«, meinte der Mann mit den silbernen Haaren nachdenklich, aber der kleinwüchsige Mensch mit dem übergroßen Kopf deutete auf einen Ring, dessen Stein zersplittert neben der Hand Nerestros lag.