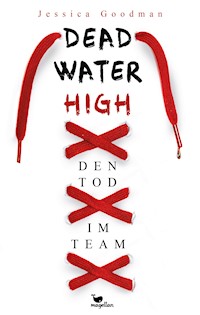
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Magellan Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Crosslaufen – mehr haben die Schwestern Stella und Ellie Steckler nicht gemeinsam. Denn im Gegensatz zur ehrgeizigen, in sich gekehrten Stella will Ellie neben dem Training auch einfach mal Spaß haben. Als die neue Mitschülerin Mila Keene auftaucht, sehen die Schwestern in ihr zunächst bloß eine sportliche Konkurrentin. Aber bald schon kann Ellie sich nicht gegen Milas warme, charmante Art wehren. Endlich hat sie wieder jemanden, mit der sie ihre Geheimnisse teilen kann. Stella wiederum merkt mehr und mehr, wie ähnlich Mila und sie sich sind. Mila ist klug und stark – eine, die Stella wirklich versteht. Dadurch macht Stella einen Fehler: Sie lässt sich ablenken. Dabei ist der Druck hoch, denn es stehen wichtige Wettkämpfe an. Für beide Schwestern geht es um alles. Auf keinen Fall dürfen sie das für eine Freundschaft aufs Spiel setzen. Genau da verschwindet Mila nach einem Morgenlauf plötzlich spurlos. Niemand weiß, was passiert ist, und alle Augen richten sich auf die Steckler-Schwestern. Ein packender psychologischer Thriller, der einfühlsam über eine komplexe Schwesternbeziehung erzählt und dabei den Konkurrenz- und Leistungsdruck in Sport und Gesellschaft unter die Lupe nimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Für Halley –Wir werden immer die Goodman-Girls sein.
STELLA
ICH HASSE ES, wie meine Schwester Ellie atmet. Sie schnauft und schnaubt nicht, röchelt und keucht nicht. Nein, Ellies Atem geht ganz ruhig und stetig, immer gleich. Selbst dann, wenn sie bergauf läuft, und selbst dann, wenn sie die letzten hundert Meter sprintet. Nach Ellies Atem kann man seine Uhr stellen.
Außerdem hasse ich es, dass sich nie auch nur ein Härchen aus ihrem Pferdeschwanz löst. Und dass sie schweigend laufen kann, ohne sich nach einer Weile eigenhändig das Hirn zerquetschen zu wollen. Wie ist es möglich, dass meine kleine Schwester so viele tatsächlich erwünschte Gedanken im Kopf hat?
Ich dagegen … Ich würde am liebsten alles aussperren. Darum laufe ich. Um die Welt hinter mir zu lassen. Um frei zu sein. Ich will schneller sein als alle anderen. Das Brennen tief in meinen Lungen und Oberschenkeln spüren. Ich will gewinnen. Egal, in welche Richtung ich laufe, auf welcher Strecke. Das Einzige, was zählt, ist, dass mein Hirn zur Ruhe kommt. Komplett. Und das klappt nur, wenn alles stimmt, wenn ich in andere Sphären aufsteige und Rekorde breche, wenn ich renne, renne, renne.
Nur beim Laufen kann ich den ganzen anderen Kram vergessen – dass mein widerspenstiges dunkles Haar sich nur mit diesen extrastarken medizinischen Gummibändern zähmen lässt oder, wie Julia Heller damals in der Neunten rausgefunden hat, dass ich immer noch nicht meine Tage hatte, und mir den Spitznamen »Sterile Stella« verpasst hat. Ich kann vergessen, dass meine Eltern sich andauernd um Geld und unser viel zu großes Haus sorgen. Dass Mom mal Alkoholikerin war und jetzt zwar trocken ist, uns aber jederzeit mit einem einzigen Schluck aus unserem mühsam gefundenen Gleichgewicht bringen könnte. Und dass Dad uns ständig ermahnt, nur ja nichts zu tun, was sie vielleicht aus der Bahn wirft. Ich kann vergessen, warum ich hier bin, das Entsetzen und die Schuldgefühle, die in mir hochgeschäumt sind, als ich das Geräusch des brechenden Knochens hörte. Und ich kann sogar das Schlimmste von allem vergessen: dass Ellie genauso schnell ist wie ich – manchmal sogar schneller.
Mist. Und schon bin ich wieder mittendrin, wie jedes Mal, wenn meine Gedanken in diese Richtung abdriften. Erst fange ich an aufzuzählen, was ich an meiner Schwester nicht leiden kann, und dann schaltet mein Hirn plötzlich einen Gang höher und führt mir alles vor Augen, was an mir nicht stimmt.
Das geht so lange, bis mir irgendwann etwas einfällt, was Mom mal gesagt hat: Ein bisschen Selbsthass hat noch keinem geschadet. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Okay, sie war damals betrunken und ich erst fünf. Aber für mich klingt es immer noch logisch.
Wieder und wieder bete ich mir dieses Mantra vor, während ich die finalen achthundert Meter in Angriff nehme. Die Sonne knallt erbarmungslos auf mich runter, und ich frage mich, ob mein Lockenwust wohl einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut verhindert. Ellies feines, seidiges Haar wäre dafür jedenfalls nicht zu gebrauchen.
»Letzte Runde, Steckler! Du packst das!«, ruft Coach Reynolds vom Rand der Bahn, leise zwar, aber ich kann sie trotzdem hören. Ich mag es, Steckler genannt zu werden. Das passiert mir in Edgewater nie, weil es da nun mal zwei von uns gibt.
Ich lege mich in die Kurve auf der Innenbahn. Die Ziellinie kommt näher. Meine Beinmuskeln brennen. Kein Wunder, ich bin hier ja auch über hundert Kilometer pro Woche gelaufen. Ganz wie in der Broschüre des Breakbridge-Trainingslagers versprochen. Okay, neben einer handfesten Aggressionsbe-wältigungstherapie. Aber im Ernst, ich habe noch nie so gut geschlafen, bin jeden Abend mit schmerzenden, pulsierenden Muskeln ins Bett geplumpst. Ich lag nicht wach, um im Kopf meine Statistiken durchzugehen, mir Vorwürfe wegen des verlorenen Stipendiums zu machen oder mir das entsetzte Aufkeuchen der Zuschauer beim Zusammenprall der beiden Körper in Erinnerung zu rufen. Stattdessen … bin ich einfach eingeschlafen. Sollte das etwa mein Normalzustand sein? Gut ausgeruht und zufrieden?
Nur noch hundert Meter und ich spüre, wie jede einzelne Runde, jeder einzelne Sprint meine Muskeln in Stahl verwandelt hat. Seit Juni habe ich merkliche Fortschritte erzielt. In den letzten acht Wochen sind meine Zeiten wie verrückt zusammengeschrumpft. Ein paar Atemtechniken habe ich auch gelernt, die mir helfen sollen, den Kopf frei zu kriegen, und Methoden, um nicht ständig in irgendwelche Dauerfrustspiralen zu verfallen. Ellie wird beim nächsten Wettkampf nie im Leben mit mir mithalten können. Ein Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus, als ich mir die Wut in den eisblauen Augen meiner Schwester vorstelle, wenn ich ihr den Sieg vor der Nase wegschnappe.
Dieses letzte Rennen ist eigentlich gar kein echtes. Damit schlage ich bloß ein bisschen Zeit tot, bis meine Eltern mich abholen kommen. Wieder denke ich daran, was ich diesen Sommer alles erreicht habe. Mein erster Sommer ohne Ellie. Der erste, den ich woanders als in Edgewater verbracht habe. Nie habe ich mich freier gefühlt als hier. Nicht mal beim Laufen im Wald oder um den See zu Hause, oben am Ellacoya Resort. Endlich, endlich war ich mal allein. Mann, habe ich das genossen.
Fast geschafft. Meine Augen werden schmal, als ich plötzlich auf der Zielgeraden bin. Mühelos und ohne das geringste bisschen langsamer zu werden, renne ich über die Linie. Am liebsten würde ich einfach weiterlaufen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass Mom und Dad vorne schon ungeduldig warten. Sie wollen zurück nach Hause, zu Ellie und den Landschaftsgärtnern und in ihr Büro. Meine Eltern verkaufen Immobilien an naive Yuppies, die nach einem Zweitwohnsitz in der Nähe von Manhattan suchen, am Fuß der idyllischen Catskill Mountains.
Oder zumindest bemühen sie sich, Immobilien zu verkaufen. Zu der Zeit, als unser Städtchen als »Deadwater« durch die Medien ging, sind sie jedenfalls kaum was losgeworden. Damals wurden innerhalb eines einzigen Jahres drei junge weibliche Crosslauf-Talente als vermisst gemeldet und wenig später ermordet auf dem von Dornengestrüpp gesäumten Trail oben am Oak Tower aufgefunden. Die Todesursache war jedes Mal dieselbe: stumpfe Gewalteinwirkung, keine Anzeichen sexueller Gewalt. Jedes der Mädchen hat sich nach Kräften gewehrt, aber unsere absolut inkompetente Polizei konnte den Täter nie dingfest machen.
Inzwischen ist das längst Schnee von gestern. Seit zehn Jahren ist in Edgewater niemand mehr verschwunden. Zumindest wenn man Shira Tannenbaum nicht mitzählt, was sowieso keiner tut. Heute kommen Touristen aus drei Bundesstaaten in unsere Stadt, zum Äpfelpflücken, Keramikshoppen und Kajakfahren auf dem See. Deadwater ist nur noch ein Mythos. Ein Albtraum, den wir alle durchlebt haben und zu vergessen versuchen.
»Neue Bestzeit, Steckler.« Coach Reynolds joggt auf mich zu und legt mir den Arm um die Schultern. »Dieses Jahr zeigst du es zu Hause allen.« Sie schenkt mir ihr breites, strahlendes Lächeln, das ich so mag – und ich mag im Allgemeinen nicht sonderlich viel. Ihr graublonder Dutt sitzt schief über ihrem neongelben Sonnenschild und ihre rundlichen Wangen sind gerötet. Ein bisschen erinnert sie mich an Grandma Jane.
»Danke.« Ich bin nicht mal richtig außer Atem.
»Deine Eltern sind da.«
»Dachte ich mir schon.«
»Brauchst du noch Hilfe mit deinen Sachen?«
»Nein«, sage ich. »Ist alles gepackt.«
Schweigend gehen wir nebeneinander her, bis die Holzhütten in Sicht kommen. Dahinter liegen die Berge. Dutzende atemberaubend spitze Gipfel, die bis hoch in die Wolken ragen. Von hier oben wirken sie noch schöner als zu Hause. Größer. Näher am Himmel. Aber ich bin rastlos und will los, will endlich alles hinter mir lassen. Will nicht mehr daran denken, was letztes Jahr passiert ist. Stattdessen werde ich mich voll und ganz auf die kommende Saison konzentrieren und mir mein Unistipendium zurückholen. Das ist nämlich der einzige Weg, es aus Edgewater rauszuschaffen. Nicht dass unsere Stadt kein guter Ort zum Leben wäre. Es ist halt bloß nicht der einzige Ort.
»Da kommt ja unsere Stella!«, schallt Moms gurrende Stimme über den Sportplatz und durch die Bäume. Sofort verspannen sich meine Schultern.
»Ich werd verrückt!«, ruft Dad. »Die haben ja ein richtiges Muskelpaket aus dir gemacht.«
Moms hübsches Gesicht verzieht sich zu einem übertrieben mitleidigen Schmollen und sie streicht sich ihr dunkles Haar hinter die Ohren. Es ist lang und seidig, genau wie Ellies. »Bist du traurig, dass es jetzt wieder nach Hause geht, Schätzchen? Ich weiß, was für ein toller Sommer das gewesen sein muss. Wie unglaublich lehrreich.« Mit beidem hat sie recht, auch wenn ich das nie zugeben würde.
»Das will ich aber auch hoffen bei dem Preis.« Dad lächelt, trotzdem verflüchtigt sich nun auch noch der letzte Rest meiner Entspannung, und meine Wangen glühen, als mir einfällt, dass Coach Reynolds alles mithört.
»Ich hole nur noch kurz meine Sachen, dann können wir los«, sage ich hastig.
»Möchtest du nicht noch duschen? Die Fahrt ist ziemlich lang.« Mom hält sich die zierliche Nase zu, als wäre die Anspielung noch nicht deutlich genug gewesen: Stella, du stinkst.
»Nein«, stoße ich durch zusammengebissene Zähne hervor. »Nicht nötig.«
»Wie du meinst.« Dad wirkt nervös. »Wollen wir dann?«
Alle nicken und wir schlagen den Weg zum Auto ein. »Stella hat diesen Sommer riesige Fortschritte gemacht«, berichtet Coach Reynolds. Mom und Dad heben hoffnungsvoll die Köpfe, als hätten sie nur auf diese Bestätigung gewartet, dass ich es immer noch draufhabe. Dass ich immer noch gut genug bin, um die nächste Staatsmeisterschaft zu gewinnen und mir dadurch mein Stipendium für die Georgetown University zurückzuholen, damit ich kostenlos dort studieren kann. Coach Gary zu Hause in Edgewater hat gesagt, wenn ich meinen persönlichen Rekord – meinen PR, wie wir es nennen – um eine volle Minute breche, dann hätten die von der Georgetown gar keine andere Wahl, als mich wieder in Betracht zu ziehen. Dann könnten sie es sich schlicht nicht leisten, mich weiter zu ignorieren. Genau genommen hat er das nicht gesagt, sondern geschrien, mit Schaum vor dem Mund, während eines seiner Millionen-Dezibel-Wutausbrüche. Aber es stimmt nun mal. Bei der Staatsmeisterschaft im November muss ich diesen Rekord einfach knacken. Und bis dahin hängt alles weiter in der Schwebe.
ELLIE
HEUTE KOMMT STELLA aus dem Crazy-Camp zurück. So nennen es zumindest die anderen aus dem Cross-Team. Arschlöcher. Ich hab denen gesagt, sie sollen die Klappe halten, aber es ist nicht leicht, Stella zu verteidigen, wenn sie so heftigen Scheiß anstellt, dass sie deswegen an einen Ort wie Breakbridge geschickt wird.
Anstatt über meine große Schwester nachzugrübeln, sollte ich wohl lieber meinen letzten Tag in Freiheit genießen, bevor die Vorsaison losgeht. Ich bin im Garten und lehne mich in meinem Liegestuhl zurück, spüre, wie sich die Kunststofflatten in meine Haut pressen. Aus dem Lautsprecher neben mir dröhnen Popsongs und eine Schweißperle rinnt mir übers Brustbein.
Ich spanne meine Bauchmuskeln an, die dank meines Sommerferienjobs als Rettungsschwimmerin am Sweetwater Lake straff und fest sind. Doch sobald ich daran denke, kommt mir unweigerlich Noah Brockston in den Sinn. Mein lieber, süßer, starker Noah. Heute war unser letzter gemeinsamer Arbeitstag und damit auch der letzte Tag, an dem wir wir sein konnten. Bis er endlich mit Tamara Johnson Schluss macht.
Gestern auf unserem Mitternachtsspaziergang haben wir noch darüber geredet, nachdem er mir eine Ausgabe seines Lieblingsbuchs »Unterwegs« in die Hand gedrückt hatte. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, dass ich es schon letztes Jahr gelesen habe und total blöd fand. Nicht nach dem, was er für mich in den Einband geschrieben hatte: Für alles, was wir sind, und alles, was wir sein könnten. Unterzeichnet nur mit einem N. Das war auch der Grund, warum ich die Sache noch mal ansprechen musste: Dieses Wir.
»Warum muss denn bloß alles so kompliziert sein?« Ich seufzte, griff nach seiner Hand und drückte sie fest. Wir waren auf dem Oak Tower Trail, der seit den Morden eigentlich gesperrt ist. »Gesperrt« bedeutet in diesem Fall eher »nur noch von Leuten benutzt, die nicht gesehen werden wollen«. Das Einzige, was einen davon abhalten soll, den Weg zu betreten, ist ein wackeliger Maschendrahtzaun, der kein wirkliches Hindernis darstellt. Der Mond stand hell am Himmel und beleuchtete den überwucherten Pfad bis zu der großen Lichtung. In deren Mitte liegt ein wuchtiger Felsen, hinter dem es steil bergab geht, bis zu einer tiefen Grube. Noah kletterte auf den Felsen und bedeutete mir, mich neben ihn zu setzen. Er schlang den Arm um meine Schulter und zog mich an sich. Am Himmel tanzten die Sterne, und es war, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Hier oben gibt es keinen Handyempfang und man hört keine Wandergruppen lachen. Hier gibt es nichts als Stille.
»Nach allem, was passiert ist, will ich einfach nur ganz normal mit dir zusammen sein«, sagte ich.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Worte ihn abschrecken würden. Nach allem, was passiert ist. Als wäre das, was zwischen uns war, bloß Zufall gewesen und kein lebensverändernder Einschnitt. Aber es schien nicht so. Er legte die Hand unter mein Kinn.
»Ich weiß, Ell«, raunte er leise. Sein Atem traf warm auf mein Ohr. »Du musstest eine Menge durchmachen.« Er streichelte mir übers Haar, wie um mich in den Schlaf zu lullen, und ich schmiegte mich enger an ihn und verbarg das Gesicht an seiner Brust. Warum konnten wir so was nicht immer tun, am helllichten Tag und ohne fürchten zu müssen, erwischt zu werden und einander das Leben zu ruinieren? »Ich hab einen Plan«, fuhr er fort. »Sobald Tamaras Dad in Princeton angerufen hat, sage ich ihr, dass es aus ist. Wenn ich mich vorher von ihr trenne, war alles umsonst.«
Ein Kribbeln überlief mich bei dieser Beichte. Es ist kein Geheimnis – zumindest nicht für mich –, dass er hauptsächlich mit Tamara zusammen ist, weil sie Beziehungen zu seiner Traumuni hat. Fast fühlte ich mich geschmeichelt, dass er mir so was anvertraute. Als wollte er mir seine schlimmste Seite offenbaren: dass er dazu fähig war, jemanden derart auszunutzen. Dabei sind wir das doch alle. Die meisten von uns geben es bloß nicht zu. Auch wenn ich nicht begreife, warum er es nicht aus eigener Kraft nach Princeton zu schaffen meint oder warum es unbedingt diese eine Eliteuni in New Jersey sein muss und keine andere.
Aber ich sagte nichts mehr, wollte ihn nicht drängen. Nicht nach der Sache im August, nach der schlagartig alles anders geworden war, so ernst und beängstigend. Seitdem habe ich einfach nur versucht, ihn bei mir zu halten, habe mich an ihn und jeden verbliebenen Fetzen Normalität geklammert. Statt es auf einen Streit ankommen zu lassen, hielt ich also den Mund, während er das Thema auf ein Buch von William S. Burroughs brachte, das er gerade gelesen hatte. Noah ist bekennender Fan von verschachtelten Kauderwelschtexten über irgendwelche Typen, die schleichend den Verstand verlieren. Aber nach einer Weile hörte ich gar nicht mehr zu. Meine Lider wurden schwer und meine Gedanken schweiften ab zu meiner eigenen Zukunft. Wenn ich Glück hatte, würde die irgendwo weit weg stattfinden, in Texas oder Florida, Oregon oder Ohio, wo niemand wusste, dass es zwei Steckler-Schwestern gab. Wo ich einfach »Steckler« war, nicht »Mini-Steckler«. Wo »Ellie« nicht immer erst nach »Stella« kam.
Letztes Jahr schienen meine Möglichkeiten noch unendlich. Aber nachdem Stella als »aggressiv« und »unvermittelbar« eingestuft wurde, hat sich alles geändert. Ich komme jetzt in die zehnte Klasse, daher werden die College-Scouts anfangen, sich auch für mich zu interessieren, und mir fällt die Aufgabe zu, meiner Familie das Vollstipendium zu sichern, nachdem Stella es verbockt hat.
Aber darüber kann ich ein andermal nachdenken. Morgen oder nächsten Monat. Nicht jetzt.
Ich lege mir mein T-Shirt übers Gesicht, um mich vor der grellen, heißen Sonne zu schützen. Wenn Bethany noch hier und nicht nach Michigan gezogen wäre, wüsste sie sicher Rat. Sie würde mich verstehen. Mit ihr konnte ich immer über alles reden. Aber seit sie mir an den Kopf geworfen hat, ich wäre die totale Klette, gerade als ich sie am dringendsten brauchte, muss ich mich wohl damit abfinden, dass ich keine beste Freundin mehr habe.
Etwas klatscht mit voller Wucht vor mir in den Pool, und ich zucke zusammen, als mich ein Schwall Wasser trifft.
»Na, hast du mich vermisst?« Stella legt prustend den Kopf schief und schwimmt auf der Stelle. Sie trägt einen kobaltblauen Sport-BH mit dem Aufdruck »EDGEWATER CROSSLAUF« und weiße Meshshorts. Ihre dunklen Locken sind zu einem hohen Messy Bun gebunden und Wasser trieft ihr über das herzförmige Gesicht.
»Blöde Kuh«, schimpfe ich und schirme mit der Hand meine Augen ab. »Wie ist deine Zeit?« Diese Frage kann ich ihr immer stellen, die eine Frage, die wichtiger ist als der ganze andere Mist.
»Das wirst du morgen selbst rausfinden.« Mit einem verschmitzten Grinsen taucht Stella wieder ab, schlägt einen Unterwasserpurzelbaum und kommt luftschnappend wieder nach oben.
»Echt jetzt?«, stöhne ich.
»Sagen wir einfach, ich habe mich verbessert.«
Plötzlich nervös, lehne ich mich wieder zurück. »Wusste ich’s doch, dass ich diesen Sommer besser mit dir hätte trainieren sollen.«
Dabei wissen wir beide, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, weil Mom und Dad es sich nun mal nicht leisten können, uns beide in ein Leichtathletikcamp zu schicken, das gleichzeitig eine psychiatrische Einrichtung ist. Genauso wie sie es sich nicht leisten können, uns beide aufs College zu schicken. Die andere muss auf ein Sportstipendium hoffen, von dem wir dachten, Stella hätte es längst in der Tasche. Jetzt hängt alles an mir.
Stella paddelt ans andere Ende des Pools und wieder zurück, ihre Schwimmzüge im Takt zu dem Song aus meiner Box. »Und, was war in den letzten Wochen so in Edgewater los? Gibt’s irgendwas Neues?«
Ich könnte ihr von Noah erzählen, davon, wie anders ich mich heute fühle, von der Scham, die wie eine kleine Kugel tief in meinem Herzen vergraben ist. Aber irgendwas hält mich davon ab. Ich weiß, dass sie es nicht weitertratschen würde, trotzdem will ich ihr gegenüber keine Schwäche zeigen. Außerdem ist es ihr sowieso völlig egal, was in Edgewater los ist. Stella hasst die Sommer hier, wenn sich die Einwohnerzahl vervierfacht, weil die vielen reichen Besucher sich für ein paar Wochenenden im Jahr in ihre Ferienhäuser zurückziehen und ein bisschen Landleben spielen. Sie hasst das Ellacoya Resort, das Fünf-Sterne-Luxushotel ein Stück die Straße rauf, wo die meisten Leute in unserem Alter jobben. Aber wem mache ich hier eigentlich was vor? Mir geht es schließlich genauso, zumindest seit der Sache mit Noah. Das Hotel gehört nämlich Tamara Johnsons Familie.
»Hast nichts verpasst«, antworte ich. »Bloß einen Haufen Partys, auf die du eh keine Lust gehabt hättest. Und außer Raven Tannenbaum hat auch niemand viel trainiert. Die hab ich fast täglich um den See laufen sehen. Als würden sich die Scouts dadurch endlich für sie interessieren.«
Stella kichert. »Aber echt. Die hat doch vor allem und jedem Schiss – mit so einem Mindset kommt man jedenfalls nicht weit.« Sie hüpft im Wasser auf und ab. »Hast du mal was von Bethany gehört? Wie geht’s ihr in Michigan?«
Bei der Erwähnung meiner ex-besten Freundin packt mich die Wut und ich schüttele den Kopf. »Keine Ahnung. Ganz gut, glaub ich.«
Stella sagt nichts. Sie hat Bethany nie sonderlich gemocht. Wahrscheinlich wäre sie hocherfreut, wenn sie wüsste, dass Bethany mich seit ihrem Umzug mehr oder weniger ignoriert.
»Wann fängt das Training morgen an?«, erkundige ich mich.
»Sieben.«
Wir schweigen. Ich drehe das Gesicht zur Sonne und frage mich, was Stella wohl gerade durch den Kopf geht. Sie ist jetzt in der Elften, kann sein, dass das ihre letzte Chance ist, bei den Wettkämpfen zu glänzen und sich einen Platz an der Georgetown zu sichern, aber ich muss mich vor allem um mich selbst kümmern. Mit ein bisschen Glück bekomme ich bis zum Ende der Saison ein Stipendiumsangebot. Das ist das ultimative Ziel, der große Traum. Erst recht nach diesem Sommer, der mir vor Augen geführt hat, wie meine Zukunft aussehen könnte, wenn ich zulasse, dass mir alles entgleitet.
»Kleine Runde heute Abend?«, frage ich, bemüht, nicht zu verzweifelt zu klingen. »Ein paar Kilometer ums Resort?«
»Nee.« Stella dreht sich auf den Rücken und lässt sich treiben. »Ich muss mich ausruhen.«
Ich würde zu gern wissen, welche Taktik Stella fährt und wie stark sie sich tatsächlich in Breakbridge verbessert hat. Aber so ist das einfach mit Stella. Sie lässt sich von niemandem in die Karten gucken, und manchmal habe ich den Verdacht, sie weiß nicht mal selbst, welche sie als Nächste ausspielen will.
STELLA
»GUCK EINER AN, die Steckler-Schwestern.« Coach Gary verschränkt die Arme über der kräftigen Brust und baut sich breitbeinig vor uns auf. Er hat eine blaue Edgewater-Kappe auf dem kahlen Kopf, und seine Beine haben einen dunklen Bronzeton angenommen – vermutlich hat er die letzten drei Monate zum allergrößten Teil draußen verbracht. Als eine Windböe den Rand seiner Shorts anhebt, sehe ich seine milchweißen Oberschenkel oberhalb der Bräunungslinie.
»Na, Coach, haben Sie uns vermisst?«, witzelt Ellie und wird gleich darauf knallrot, als hätte sie für einen Moment vergessen, mit wem sie hier redet – nämlich mit dem Typen, den alle nur noch »Gary den Giftigen« nennen, seit er letztes Jahr ein paar Neuntklässlerinnen zum Weinen gebracht hat. Aber sein Erfolg spricht nun mal für ihn und was anderes interessiert sowieso niemanden. Mich mit eingeschlossen.
»Euch beide? Als ob«, steigt er auf Ellies Frage ein. Dann verengen sich seine dunklen Augen und er nickt mir zu. »Und, hat Breakbridge was gebracht?«
Ich nicke zurück.
»Hoffen wir’s«, sagt er. »Du hast dieses Jahr einiges zu beweisen.«
Ich straffe die Schultern und halte seinem Blick stand. »Ich weiß.«
Er lässt seinen Kaugummi knallen. »Kannst gleich mal zeigen, was du draufhast.« Er wirft einen Blick über meine Schulter Richtung Tribüne und ich drehe mich um. In der ersten Reihe sitzt eine zierliche, grauhaarige Frau mit Sonnenbrille und einem Klemmbrett in der Hand. Sie trägt ein Poloshirt und Wandershorts. Wenn sie ein Scout ist, kenne ich sie zumindest nicht.
»Von welcher Uni ist die denn?« Mein Magen zieht sich ängstlich zusammen. Die Scouts kommen normalerweise nicht zu einem ganz normalen Training. Wir können ja schon von Glück reden, wenn sie sich bei den Wettkämpfen blicken lassen.
»Gar keiner«, brummt der Coach. »Sondern von der Schulbehörde, die offenbar meint, nach der Geschichte letztes Jahr ein Auge auf uns haben zu müssen.«
Ellie stöhnt auf.
»Klappe, Mini-Steckler«, schnauzt er sie an. »Für diesen Mist hab ich keine Zeit. Ihr seid mein Team. Meine Mädels. Ich muss denen einfach nur beweisen, dass ich euch noch im Griff habe.«
Ellie schließt den Mund und starrt zu Boden. Bevor wir noch etwas sagen können, ertönt hinter uns lautes Gejohle. Ich drehe mich zum Parkplatz um, wo gerade Tamara Johnson, Raven Tannenbaum und Julia Heller aus einem roségoldenen SUV mit »Ellacoya Resort«-Aufkleber steigen. Als Erstes posieren sie in ihren Trainingsklamotten für ein Selfie und lachen über irgendeinen Insiderwitz, den natürlich niemand außer ihnen kapieren würde. Dann kommen sie auf uns zu. Tamara lächelt und lässt ihre Braids schwingen. Ravens blasse, sommersprossige Arme hängen runter wie schlaffe Seile und sie starrt die ganze Zeit Tamara an in der Hoffnung auf Anerkennung. Julia hat ihre glatten aschblonden Haare zu einem so straffen Pferdeschwanz gebunden, dass mir schon vom Hingucken die Kopfhaut wehtut.
Oh Mann, diese drei machen mich fertig. Julia und Tamara sind schon seit dem Kindergarten beste Freundinnen, nachdem die Hellers nach Edgewater gezogen sind, um eine weitere Filiale ihrer noblen Sportartikelkette zu eröffnen. Ein paar Jahre später stieß dann Raven dazu – zu deren Riesenglück, weil nämlich nach der peinlichen Nummer ihrer Schwester Shira erst mal niemand mehr was mit den Tannenbaums zu tun haben wollte. Außer Tamara und Julia. Die hielten fest zu Raven, was zugegebenermaßen echt anständig war. Das macht allerdings die Tatsache nicht wett, dass Julia mich immer noch »Sterile Stella« nennt und sich insgesamt einfach mega-arschig verhält. So gute Zeiten laufen sie und Tamara nun auch nicht. Raven dagegen könnte vielleicht was reißen, aber dann vergeigt sie es doch jedes Mal wieder.
Der Coach beachtet sie nicht. »Stella, du leitest das Stretching«, kommandiert er stattdessen. »Schließlich bist du Co-Kapitänin.« Er bleckt die Zähne und zieht herausfordernd die Augenbrauen hoch. Letztes Jahr nach meiner Suspendierung ist mir dieser Posten beinahe aberkannt worden, aber der Coach hat die Schulleitung davon abgebracht, unter der Bedingung, dass ich mir den Mannschaftsvorsitz mit jemandem teile. Wenig überraschend stimmte das Team für Tamara.
Hocherhobenen Hauptes jogge ich in die Mitte des Rasens und warte, dass der Rest des Teams sich um mich versammelt. Dieses Jahr sind wir zu fünfzehnt, wenn man die Neulinge mitzählt, die diese Woche ihr Probetraining absolvieren. Die Truppe macht einen guten, fitten Eindruck. Dass ich es in die Auswahl für die Staatsmeisterschaft schaffe, steht sowieso außer Frage, aber wenn diese Doofnüsse sich mal ein bisschen zusammenreißen, können wir uns vielleicht sogar als Mannschaft platzieren.
»Hi, Stella«, sagt Tamara und wirft ihre Braids über die Schulter. »Wie wär’s, wenn wir ’ne kleine Motivationsansprache halten?«
»Kannst du gerne machen«, antworte ich. »Aber erst nach dem Dehnen.«
Sie lächelt so breit, dass man ihre Backenzähne sieht, und nickt dann Raven und Julia zu, die etwas seitlich stehen. »Los geht’s, Mädels!«, ruft sie.
Ich hüpfe ein paarmal auf und ab und setze mich auf den Boden. Die anderen tun es mir nach.
»Linkes Bein«, kommandiere ich und strecke das Bein aus. Meine Muskeln spannen sich kurz an und geben wieder nach, das vertraute Gefühl von Dehnung und Lockerung.
»Und wechseln.«
Doch als ich den Kopf hebe, merke ich, dass keiner mehr aufpasst. Alle gucken in dieselbe Richtung, zum Parkplatz, wo Coach Gary steht und unruhig mit seinem Kugelschreiber auf sein Klemmbrett tippt. Bei ihm ist ein hochgewachsenes Mädchen mit ausgeprägten Wangenknochen. Sie trägt graue Spandexshorts und ein schwarzes Lauftop mit gekreuzten Rückenträgern. Ihr dunkler Pferdeschwanz hängt ihr lang und wellig über den Rücken und ist mit einer Schleife in Edgewater-Blau verziert.
»Wer ist das denn?«, fragt Tamara und zupft an einem ihrer Braids – ein nervöser Tick von ihr.
»Keine Ahnung«, antwortet Julia.
»Ach du Scheiße, ich weiß es«, murmelt Raven. Natürlich – Mrs Tannenbaum, ihre Mom, arbeitet schließlich im Schulsekretariat, darum weiß sie alles.
»Raus damit«, fordert Julia.
»Das ist Mila Keene. Ich glaube, sie ist im Sommer hergezogen.«
»Nie gehört«, kommentiert Julia.
Mir rutscht das Herz in die Hose. Ich habe nämlich schon von Mila gehört. Wie so ziemlich jeder im Nordosten der USA, der sich ernsthaft mit Crosslauf beschäftigt. Letztes Jahr hat sie als Zehntklässlerin die Staatsmeisterschaft in Connecticut gewonnen, und es heißt, dass sie mit den Scouts von Harvard im Gespräch ist. Aber was zum Teufel macht sie hier?
»Wechseln, hab ich gesagt«, rufe ich genervt. Warum ist mir bloß plötzlich so heiß? Als ich meinen linken Knöchel auf den Oberschenkel lege, merke ich, wie mein Bein zittert.
»Ihre Eltern haben sich getrennt«, flüstert Raven. »Ich glaube, ihre Mom hat einen Job hier im Krankenhaus bekommen, darum sind sie aus der Nähe von New York City hergezogen. Ihr Vater wohnt noch in Connecticut.« Sie beugt sich über ihr Knie. »Zumindest meinte das meine Mom.«
»Warum ist sie nicht einfach dageblieben?«, will Julia wissen.
»Keine Ahnung«, erwidert Raven gedämpft. Sie wickelt sich das Ende ihres roten Pferdeschwanzes um die Finger.
»Psst«, zischt Tamara. »Sie kommen her.«
Ich sehe hoch und, tatsächlich, der Coach und Mila joggen auf uns zu. Wieder lässt er seinen Kaugummi knallen, während er sich im Laufen Milas Trainingstasche auf die Schulter hievt. Milas Bewegungen sind elegant und anmutig. Verdammt, und sie trägt lila Nikes – die lila Nikes. Schon von Weitem sehe ich ihre in die Enden der Schnürsenkel eingestickten Initialen. Mein Herz rutscht noch tiefer. Ich habe die gleichen Schuhe, seit Nike letztes Jahr die jeweils fünf besten Läuferinnen und Läufer jedes Bundesstaats damit ausgestattet hat. Warum habe ich meine heute bloß nicht angezogen? Stattdessen trage ich meine blöden Trainings-Asics, die nicht mal Spikes haben.
Coach Gary räuspert sich. »Mädels«, bellt er. »Das hier ist Mila Keene.«
Alle heben die Köpfe und lächeln, zuckersüß und künstlich. Falls Mila die Scharade durchschaut, lässt sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Sie steht einfach ganz locker und entspannt da und lächelt, fummelt sich weder an den Haaren rum, noch tritt sie verlegen von einem Fuß auf den anderen. Sie scheint sich aufrichtig zu freuen, dass sie hier ist. Wie macht sie das bloß?
»Hey!«, sagt sie und winkt kurz.
»Mila ist gerade aus Hadbury in Connecticut hergezogen, aber so clever, wie ihr seid, wisst ihr das wahrscheinlich längst. Sie kommt in die elfte Klasse und wird sich außerdem unserem Team anschließen. Passt lieber gut auf, sonst rennt sie euch davon.« Der Coach grinst mich direkt an. »Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie herzlich aufnehmt, okay?«
Allgemeines Nicken. Raven erhebt sich als Erste und streckt Mila die Hand hin. »Willkommen im Team!« Ich muss mich zusammenreißen, um nicht die Augen zu verdrehen. Klar, Raven ist supernett, das war sie schon immer, aber auf dieselbe Weise, wie Vanilleeis nett ist – und man würde eben viel lieber Cookie Dough mit Schokosplittern essen.
Tamara folgt Ravens Beispiel, und schon bald ist Mila umringt von Mädchen, die ihr Fragen stellen und ihre Nikes bestaunen.
Ich bleibe als Einzige auf dem Boden sitzen und strecke die Beine vor mir aus. Beuge mich vor, bis mein Kopf meine Knie berührt, atme tief ein und genieße das Ziehen in den Oberschenkelrückseiten.
Als ich mich schließlich wieder aufrichte, muss ich blinzeln. Die Sonne ist jetzt schon furchtbar grell, und wenn wir nicht bald in die Gänge kommen, zerfließen wir beim Training vor Hitze.
Erst dann merke ich, dass außer mir nur noch Ellie auf dem Boden sitzt und weiter Dehnübungen macht. Sie sieht mich an, und in ihren Augen erkenne ich dieselbe Wut, die auch ich spüre.
Wir sind bereit zum Kampf.
ELLIE
SELBST NACHDEM ICH mir die Bettdecke über den Kopf gezogen habe, höre ich Stella noch in ihrem Zimmer ächzen. Sie macht Kniebeugen oder Liegestütze oder sonst irgendwas, was nicht explizit von uns verlangt, aber natürlich sehr begrüßt wird. Ich verkrieche mich noch tiefer, um auch den letzten Rest Sonnenlicht auszusperren, taste dann nach meinem Handy und durchsuche meine Nachrichten nach denen, die Noah letzte Nacht geschickt hat.
Ich würde dich so gerne morgen abholen und mit dir zusammen hinfahren hat er geschrieben. Wie ein richtiges Paar.
Ein dumpfer Schmerz pocht in meiner Brust, und ich rufe mir nachdrücklich ins Gedächtnis, dass er mich wirklich will. Dass ich ihm wichtig bin. Dass wir bald zusammen sein können.
Gedankenverloren streiche ich mit dem Zeigefinger über das schmale rote Bändchen an meinem Handgelenk. Im Grunde besteht es aus nicht viel mehr als ein paar Garnresten, geflochten und zusammengeknotet. Noah hat es mir an einem verregneten Tag im Juli geschenkt, als wir in der Rettungsschwimmerhütte festsaßen und darauf warteten, dass das Unwetter vorbeizog. Irgendwann hat er es aus seinem Rucksack gekramt und mir umgebunden.
»Hab ich für dich gemacht«, erklärte er verlegen. Ich versuchte, mir vorzustellen, wie er mit konzentriert gerunzelter Stirn dasaß und ein Freundschaftsarmband bastelte.
»Ich find’s toll«, lobte ich und drehte das Handgelenk, um sein laienhaftes Werk zu bewundern. Und ich meinte es ernst. Es war perfekt.
»Das kannst du dir immer anschauen, wenn du mal das Gefühl hast, ich hätte dich vergessen und mein Herz wäre ganz woanders«, sagte er. »Dann weißt du wieder, dass ich am liebsten bei dir sein will.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, gab er mir einen Kuss auf die Handfläche, die Finger, die Innenseite meines Unterarms. Und dann presste er die Lippen auf meine, fest und leidenschaftlich.
Dieses kleine Armband erinnert mich daran, dass alles, was ich diesen Sommer durchgemacht habe, einen Sinn hatte. Dass Noah und ich irgendwann zusammen sein können, wenn er erst in Princeton angenommen ist und Tamara schonend beigebracht hat, dass zwischen ihnen Schluss ist. Wenn ich noch ein bisschen länger durchhalte, kann aus uns etwas Echtes werden, das weiß ich einfach, selbst wenn es bedeutet, dass ich ein paar Monate nur »die andere« bin. Wozu ist das Ganze sonst gut gewesen?
Seufzend werfe ich die Decke vom Bett. In einer Stunde fängt der erste Tag des neuen Schuljahrs an. Ich schlüpfe in Jeansshorts und ein weißes, fließendes Oberteil und schüttele meine Haare aus, sodass sie mir in sanften Wellen um die Schultern fallen. Dann mustere ich mich im Spiegel und überlege, ob ich mich seit Juni äußerlich genauso sehr verändert habe wie innerlich. Letztes Jahr habe ich mich noch gefreut, als die Schule wieder losging. Ich hatte neue Hefter, eine neue Frisur und ich hatte Bethany. Dieses Jahr habe ich nichts außer einem Geheimnis und der Angst, die mir die Kehle zuschnürt, sobald ich auch nur daran denke, es mit jemandem zu teilen.
Ich schiebe die Gedanken beiseite und gehe nach unten, um mir einen grünen Smoothie zu machen. Zum Glück konnte Stella Mom davon überzeugen, dass wir unbedingt diesen Vierhundert-Dollar-Monstermixer brauchen, der Grünkohl in neonleuchtende Flüssigkeit verwandelt. Als Köder brauchte sie unseren Eltern bloß ihr mögliches Stipendium unter die Nase zu halten, und schon haben sie ihr alles gekauft, was sie wollte. Ich dagegen muss schreien, damit sie mir überhaupt mal zuhören. Oder zumindest war das so, bis Stella ihre Chance auf die Georgetown verpatzt hat. Mittlerweile fragen Mom und Dad immer häufiger nach meinen Zeiten, meinen Statistiken, meinen Aussichten. Im Sommer ging es los, mit ein paar beiläufigen Kommentaren, dass man doch langsam mal ein paar College-Trainer kontaktieren könne, aber als Mom dann anfing, mich wegen meines PRs zu löchern, hätte ich mich am liebsten eingeigelt und mir die Ohren zugehalten. Vielleicht ist es doch ganz schön, wenn man nicht permanent im Rampenlicht steht.
Der Mixer kreischt auf, als ich ihm Ingwer, Staudensellerie, eine halbe Karotte und eine Handvoll Grünkohl in den Rachen werfe. Kurz darauf habe ich eine grüne, grasig schmeckende Pampe im Glas.
»Bereit?« Stella erscheint auf dem oberen Treppenabsatz. Sie hat sich das nasse Haar zum Pferdeschwanz gebunden und trägt einen Edgewater-Trainingsanzug, der raschelt, als sie die Stufen runterläuft. Geht’s noch uncooler?
Ich seufze. »Kannst du dir nicht wenigstens für den ersten Schultag was halbwegs Nettes anziehen?«
Und da ist er. Der Blick.
»Wo ist mein Anteil?«, fragt sie.
Mittlerweile weiß ich: Was mir gehört, gehört auch Stella, was hingegen Stella gehört, gehört nur Stella. Ich reiche ihr einen Thermobecher. Sie nimmt ihn mit einem Grunzen entgegen, und wir gehen nach draußen zu unserem schrottreifen marineblauen Subaru Outback, den Grandma und Grandpa uns zu Stellas Führerschein geschenkt haben. Sie haben ihn den ganzen Weg von Arizona herbringen lassen. Dorthin sind sie umgezogen, kurz bevor bei uns die dunklen Jahre anfingen, wie Dad die Zeit nennt, in der wir in einem Airstream-Wohnwagen in Bethel gehaust haben, den meine Eltern für ziemlich cool hielten.
Auf den ersten Blick schienen sie genau wie alle anderen einfach ein Stück vom Leben in den Bergen abbekommen zu wollen, bevor die Brooklyner Yuppies alle Grundstücke aufkauften. Doch die Winter dort waren oft lang und kalt und der Gin aus den kleinen Brennereien billig, besonders wenn man mit sämtlichen Produzenten befreundet war. Mom und Dad hielten sich mit Destillerieführungen über Wasser oder kutschierten Touristen durch die Gegend und schwatzten so lange auf sie ein, bis ein ordentliches Trinkgeld dabei raussprang. Eigentlich das perfekte Leben, bis Mom mit Stella schwanger wurde und die beiden anfingen, sich über Geld und Moms Sauferei und die Zukunft zu streiten und … überhaupt alles.
Mehr haben sie mir bis jetzt nicht erzählt über die Zeit. Das mit dem schlimmen Autounfall, bei dem Stella auf dem Rücksitz saß, habe ich irgendwann anhand eines alten Zeitungsartikels rausgefunden. Es muss in den vierzehn Monaten vor meiner Geburt passiert sein.
Ich kann mich kaum erinnern, wie es war, bevor Mom in die Reha kam. Nur dass Stella immer, wenn es richtig schlimm wurde, die Tür zu unserem winzigen Kinderzimmer geschlossen und mir Bilderbücher vorgelesen hat. Und dazu hat sie ganz laut den Oldiesender auf unserem Mini-Radio aufgedreht. Dadurch war mir nie wirklich klar, wie nah wir am Rand einer Katastrophe standen. Aber Stella schon. Und all diese Erfahrungen hat sie im Laufe der Zeit zu einem Schutzwall um sich aufgeschichtet.
Als ich vier war, kamen Grandma Jane und Grandpa Hal aus Sedona und zogen vorübergehend bei uns ein. Sie zwangen Mom, sich in Behandlung zu begeben, und auch Dad hörte auf, ständig Party zu machen, und blieb zu Hause, wo unsere Großeltern ihm zeigten, wie man ein guter Vater war. Sie brachten ihm bei, Gemüse fürs Abendessen zu dünsten, unsere Haare zu entwirren und uns in den Schlaf zu singen. Auch davon weiß ich nicht mehr viel. Nur dass irgendwann zu dieser Zeit meine Nachtangst einsetzte. Ich schlafwandelte draußen im Garten und weinte, wenn ich im Dunkeln erwachte. In den meisten Nächten landete ich am Ende in Stellas Bett, rollte mich ganz klein neben ihr zusammen und ließ mich von ihren gleichmäßigen Atemzügen beruhigen. Alles andere habe ich verdrängt.
Irgendwann kam Mom zurück, gut erholt und braun gebrannt, hatte für jede Lebenslage ein Mantra parat und tanzte durchs Haus. Auch Dad wirkte unbeschwerter, hoffnungsvoller und zielstrebiger, und so verliebt in Mom wie nie zuvor. Beide fanden wieder zu ihrem Glauben zurück, nachdem sie ihm jahrelang den Rücken gekehrt hatten. Bald traf man uns regelmäßig in der örtlichen Synagoge an, wo die Gottesdienste von Akustikgitarrenklängen begleitet wurden und die Rabbis Gebetsmäntel mit Batikmuster trugen. Stella und ich gingen einmal pro Woche in die Talmudschule und lernten für unsere Bat Mizwas. Mom und Dad bekamen ihre Maklerlizenzen und wurden innerhalb eines Jahres ihre erste Millionenvilla los. Sie waren die geborenen Verkäufer, einfach weil sie eine so vertrauenswürdige Ausstrahlung hatten. Das sagte jeder. Irgendwann ist sogar mal ein kleiner Artikel über sie im Reiseteil der »New York Times« erschienen, in dem es hieß, Edgewater sei endlich dabei, seinen schrecklichen Spitznamen Deadwater abzulegen, und entwickle sich immer mehr zu einem lohnenden Ziel für Touristen.
»VON KALTBLÜTIGEN MORDEN ZUM SOMMER-HOTSPOT!«, verkündete die Schlagzeile. Darunter war ein Foto von Mom und Dad zu sehen, die strahlend und entspannt vor einem renovierten Farmhaus in der Nähe vom Ellacoya Resort posierten.
Okay, als ich in der Fünften war, hatte Mom einen Rückfall, aber nur einen kleinen. Sie hat ihn überstanden. Und niemand hat je davon erfahren. Wir Stecklers wissen, wie man Geheimnisse bewahrt.
Auf Grandma Janes Beerdigung vor ein paar Jahren weinte Mom bitterlich, wiegte sich vor und zurück wie in Trance und weigerte sich, auch nur den kleinsten Bissen von den Platten aus dem örtlichen Feinkostladen zu essen. Als ich sie umarmte, drückte sie mich so fest an sich, dass ich dachte, mein Brustkorb würde explodieren.
»Sie hat euch gerettet«, flüsterte Mom immer wieder. »Sie hat euch gerettet.«
Ich dachte, sie meinte, ihre Mutter hätte uns während der dunklen Jahre als Familie zusammengehalten. Aber als ich Moms weit aufgerissenen Augen folgte, waren sie auf Stella gerichtet.
»Sie hat euch gerettet.«
Ich habe Noah nicht mehr gesehen, seit er mir am Oak Tower das Buch gegeben hat, und als ich jetzt zu Chemie gehe, unserem einzigen gemeinsamen Kurs, überläuft mich ein Kribbeln. Ich kann es kaum erwarten, ihm wieder nahe zu sein, selbst wenn ich nicht die Wärme seiner Haut spüren oder mit dem Daumen über die feinen Härchen in seinem Nacken streichen darf. Ich bin extrafrüh da, um uns einen Tisch ganz hinten zu sichern, damit wir das ganze Jahr über Laborpartner sein können. Pünktlich zum Klingeln kommt er hereingejoggt.
Mir bleibt fast das Herz stehen, als er den Blick über das Schulanfangsgewühl in der Klasse schweifen lässt und schließlich meinen findet. Ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, bevor er sich durch die Tischreihen zu mir durchschlängelt und sich neben mich setzt. Sein blondes Haar fällt ihm in die Augen und er streicht es nach hinten.
»Hey«, flüstert er und fährt sachte mit dem Zeigefinger über meinen nackten Arm. Ich erschaudere.
»Hi.«
Mein Herz rast wie verrückt und ich versinke regelrecht in seinen großen grünen Augen. Starre auf seine Bizepsmuskeln, die zum Vorschein kommen, als er seine Kapuzenjacke auszieht. Noah verschränkt die Arme und presst unter dem Tisch sein Knie gegen meins. Ich stehe kurz vor der Ohnmacht.
»Hab dich vermisst«, sagt er.
»Ich dich auch. Wenigstens hab ich das hier.« Ich hebe mein Handgelenk.
Noah zieht die Stirn kraus und guckt sich erneut im Raum um. Dann beugt er sich zu mir rüber. »Hm, ja. Darüber hab ich noch mal nachgedacht. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, wenn du das weiter trägst, Ell. Könntest du es vielleicht lieber in die Tasche stecken oder so? Ich meine nur, was, wenn es jemand sieht?«
Mein Gesicht fühlt sich plötzlich heiß an. »Wieso das denn?«, frage ich, bemüht, meine Stimme ruhig zu halten. »Ist ja wohl nicht so, als stünde da ›Geschenk von Noah Brockston‹ drauf.«
»Man kann halt nie wissen. Ich mache mir bloß ein bisschen Sorgen.« Noah dreht sich weg und ein Teil von mir empfindet Mitleid mit ihm. Ich weiß ja, dass das alles für ihn auch nicht leicht ist. Ein anderer Teil von mir dagegen ist stinksauer.
Ich will protestieren, aber Noah schiebt die Unterlippe vor. »Komm schon, Ell. Ist ja nicht mehr für lange.«
Ich werde weich, gegen ihn bin ich einfach wehrlos. »Okay«, sage ich und fange an, den Knoten aufzuzupfen. Noah beobachtet erleichtert, wie ich das Armband in meiner Shortstasche verschwinden lasse.
»Ellie Steckler?«, ruft Mr Darien. Er steht mit der Anwesenheitsliste in der Hand vor der Klasse, und sein langer weißer Kittel erinnert mich an den Arzt, bei dem ich gewesen bin, im gut hundert Kilometer entfernten Newburgh, wo mich ganz sicher niemand erkennen würde. Nachdem ich ihm mein Anliegen erklärt hatte, tätschelte er mir liebenswürdig die Hand. »Das wird schon wieder«, sagte er, während ich mir die Tränen von den Wangen wischte. Das alles ist erst ein paar Wochen her, aber es kommt mir vor, als wären seitdem Jahre vergangen.
»Hier«, sage ich, in der Hoffnung, dass man den Kloß in meinem Hals nicht hören kann.
In den nächsten vierzig Minuten konzentriere ich mich mit aller Kraft auf Mr Dariens Geleier, aber es fällt mir schwer, an irgendwas anderes zu denken als Noahs Knie, das sich noch immer an meins presst. Als es zum Ende der Stunde klingelt, ist es, als würde ein Bann gebrochen.
Noah packt hastig seine Sachen. »Ich muss kurz ins Büro vom Coach, aber wir sehen uns in der Mittagspause, okay?«
»Okay«, antworte ich, ohne ihn darauf hinzuweisen, dass Tamara auch dort sein wird. Für einen einzigen kleinen Moment gestatte ich mir, so zu tun, als wären wir ein echtes, ganz normales Paar.
»Bis später, Babe.« Bevor er aufsteht, drückt er mir kurz den Oberschenkel. Ich spanne sämtliche Muskeln an, als könnte ich das Gefühl so in mir konservieren.
»Bis später«, flüstere ich ihm hinterher.
Als ich in die Cafeteria komme, haben sich die Cross-Leute schon im hinteren Bereich versammelt. Letztes Jahr durfte ich noch nicht mit am Haupttisch sitzen, obwohl ich es als einzige Neuntklässlerin in die erste Mannschaft geschafft hatte. Jetzt jedoch, nachdem ich bei der Staatsmeisterschaft unter den ersten Zehn war und bewiesen habe, dass ich, oh Wunder, ein eigenständiger Mensch und nicht mit Stella zusammengewachsen bin, gehört einer dieser Plätze mir. Und wer weiß, vielleicht könnte sich sogar Noah, der frisch gekürte Kapitän der Jungenmannschaft, neben mich setzen. Vielleicht.
»Ey, Mini-Steckler, fang!« Ich lasse mein Tablett auf den Tisch knallen und hebe die Hände, in denen ein feuchtes, schweres Stoffknäuel landet.
»Was ist das, Bader?« Ich halte das Knäuel hoch.
»Meine verschwitzten Boxershorts.« Todd Bader ist einer von Noahs besten Freunden und ein Sportler-Vollidiot, wie er im Buche steht, komplett bescheuert und tittenfixiert. Zu seinem Glück ist er mit goldenen Surferlocken, strahlend weißen Zähnen und einem Sixpack gesegnet, den er beim Training für meinen Geschmack allerdings ein bisschen zu oft präsentiert. Echt schade, dass er so ein Arschloch ist.
»Igitt!« Angewidert lasse ich die Unterhose auf den Boden fallen. »Hat jemand Desinfektionsspray?«
Raven Tannenbaum reckt die Faust mit einem kleinen Plastikfläschchen in die Höhe. »Hat er heute schon bei uns allen gemacht«, erklärt sie. Raven zeigt Bader über den Tisch hinweg den Stinkefinger, woraufhin er zwei Finger zum V formt und die Zunge dazwischen wackeln lässt. »Bah«, macht Raven und schüttelt sich. »Willst du dich setzen, Ellie?«
So langweilig Raven sein mag, für ihre Nettigkeit kann man sie wirklich nur bewundern. Stella nennt sie gern ›die Raufasertapete in Menschengestalt‹, der ultimative Diss, aber in der Talmudschule fand ich sie damals immer superlieb. Außerdem gibt sie beim Training alles.
Dabei hat sie es echt alles andere als leicht. Ihre große Schwester Shira war in der ganzen Stadt beliebt, bis sie vor ein paar Jahren – wir gingen zu dem Zeitpunkt noch auf die Junior High – plötzlich verschwand. Die Polizei setzte alles daran, sie zu finden, und durchkämmte im Umkreis von mehreren Kilometern das Gelände. Wie es schien, war nun auch Shira dem Mörder zum Opfer gefallen, der Edgewater den Namen Deadwater eingebracht hatte und offenbar zurückgekehrt war. Eine Ausgangssperre wurde verhängt. Keine Fahrradtouren, keine Spaziergänge zum Diner. Keine Joggingrunden um den See. Nirgends durfte man mehr allein hin – also, als Mädchen. Die Jungs konnten weiterhin machen, was sie wollten.
Einen Monat später tauchte Shira dann plötzlich wieder auf, im Schlepptau den älteren Typen, der auf dem Bauernmarkt den Stand mit dem Ziegenjoghurt betrieb. Sie hatte einen Ring am Finger und erklärte, sie beide seien nach Atlantic City durchgebrannt, um dort zu heiraten. Sie habe gewusst, dass ihre Eltern dagegen gewesen wären, und daher ihren achtzehnten Geburtstag abgewartet, versuchte sie, sich zu rechtfertigen. Sie habe einfach mal eine Pause von allem gebraucht. Vom Lernen für die Abschlussprüfungen, den Cross-Turnieren und ihren Eltern, die sie ständig damit nervten, dass sie sich endlich um ein gutes College kümmern müsse. Verziehen hat ihr niemand. Wie auch? Alle waren sauer, dass die Polizei so viel Zeit und Geld für die Suche nach ihr verschwendet hatte und Edgewater durch ihre Schuld gleich noch mal in die Schlagzeilen geraten war, als Gruselort, der Touristen und Immobilieninteressenten vergraulte und Mörder anlockte.
Am Ende zog Shira nach Philadelphia, um das ganze Theater hinter sich zu lassen, und ihre Eltern, die mit dem Medienrummel nicht klarkamen, trennten sich. Raven und ihre Mutter mussten aus ihrem wunderschönen Farmhaus in ihr heutiges Mini-Apartment über der Pizzeria ziehen. Von ihrem Vater hat niemand je wieder gehört. Raven konnte nicht mehr mit uns ins Trainingscamp fahren und trug nur noch billige Sportklamotten aus dem Secondhandshop anstatt der schicken aus dem Laden von Julias Eltern. Eine Zeit lang tratschten hinter ihrem Rücken alle über sie, auch wenn Tamara und Julia weiter zu ihr hielten. Mittlerweile ist das Ganze fünf Jahre her und Raven redet nie darüber. Oder zumindest nicht mit mir.
Jetzt guckt sie mich erwartungsvoll an. »Hier ist noch Platz«, sagt sie und deutet neben sich.
»Danke«, erwidere ich. »Aber ich muss was für Stella freihalten.« Raven wendet sich wieder ihrem Putensandwich zu, aus dem ein welkes Salatblatt hängt.
Ich gehe um den langen Tisch herum und setze mich schließlich ganz ans Ende der Bank, wo auch Stella noch hinpasst. Als ich jedoch entdecke, wer es sich dort schon gemütlich gemacht hat, stöhne ich unwillkürlich auf.
»Mila Keene.« Ihr Name kommt aus meinem Mund wie eine Feststellung, keine Begrüßung.
Mit großen Augen sieht sie zu mir hoch.
»Äh, hi. Ich bin Ellie Steckler«, schicke ich schnell hinterher, um wenigstens einigermaßen wie ein normaler Mensch rüberzukommen. »Ich bin auch in der Mannschaft. Hatte beim Training gar keine Gelegenheit, Hallo zu sagen.«
Milas Gesicht hellt sich zu einem fröhlichen Grinsen auf, während sie ihr Mittagessen auspackt. »Schön, dich kennenzulernen. Ich bin gerade erst hergezogen.«
Ich verkneife mir ein »Ich weiß« und dann ist plötzlich Stella da. »Ellie, wir dürfen nicht vergessen, nachher noch neue Wärme…« Als sie Mila sieht, unterbricht sie sich. »Oh. Hallo.«
»Hi!« Milas Lächeln verflüchtigt sich beim Anblick von Stellas gerunzelter Stirn. »Ich kann mich auch woandershin setzen, wenn das hier dein Platz ist.«
Ich verdrehe die Augen. »Quatsch. Wir rücken einfach ein bisschen zusammen.«
Stella schäumt vor Wut. Vermutlich würde sie am liebsten die Nägel in meine Haut schlagen und mich blutig kratzen. Das hat sie sogar schon mal gemacht. Na ja, ich ja genauso. Aber jetzt mal im Ernst: Mila ist neu hier und hat noch keine Freundinnen. Da können wir doch wohl wenigstens eine Mittagspause lang nett zu ihr sein.
»Wann genau seid ihr denn hergezogen?«, erkundige ich mich.
»Letzte Woche.« Mila beißt von ihrem ziemlich professionell gerollten Burrito ab und kaut.
Stella neben mir stößt ein wissendes Brummeln aus. »Stress zu Hause?«
Ich versetze ihr einen Tritt unter dem Tisch. Wie kann es sein, dass diese Blödbirne mit ihren siebzehn Jahren noch immer kein Fitzelchen Sozialkompetenz hat? Aber Mila lacht nur.
»Kann man so sagen. Also, Stress mit meinem Dad. Mom und ich haben zusammengehalten, und jetzt lassen sie sich scheiden, blabla, immer dasselbe Drama. Spannend, was?« Sie nimmt noch einen Bissen.
»Bin schon halb weggedöst«, erwidere ich.
Mila schluckt und lacht erneut, herzhaft und tief aus dem Bauch. Ziemlich sympathisch.
Von Stella kommt kein Ton außer diesem nervigen Knacken, mit dem sie ihre Babykarotten kaut.
»Und, was hältst du bis jetzt von Edgewater?«, frage ich.
»Ist ganz okay.« Sie sieht sich in der Cafeteria um. »Also, alle sind nett und so, aber irgendwie finde ich’s trotzdem ein bisschen gruselig hier.«
»Ah, dann hast du also von den Mordfällen gehört.« Ich stecke mir eine Weintraube in den Mund.
Sie nickt. »Wenn ich erzählt habe, dass wir hierherziehen, war das immer das Erste, was den Leuten einfiel.« Mila mustert mich neugierig. »Habt ihr eigentlich keine Angst, dass der Täter zurückkommt?«
Ich zucke mit den Schultern. »Eigentlich redet kaum mehr jemand davon.« Ich beuge mich vor. »Erst recht nicht Raven Tannenbaum gegenüber. Ein paar Jahre nach dem letzten Mord ist ihre Schwester verschwunden, und alle dachten, sie wäre das nächste Opfer. Aber dann stand sie plötzlich wieder auf der Matte. Ein Riesenzirkus.«
Mila zieht die Augenbrauen hoch. »Krass. Aber mittlerweile ist alles okay?«
»Scheint so«, sage ich. »Oder, Stella?«
Stella jedoch starrt an mir vorbei und steht abrupt auf. »Noah.« Sein Name klingt rau und laut aus ihrem Mund, ganz anders als bei mir. Bei ihr wird er zu Lärm.
Noah kommt auf uns zu und bleibt direkt hinter mir stehen, sodass ich seine Körperwärme spüre. Am liebsten würde ich ihm mitten hier in der Cafeteria um den Hals fallen.
»Hi, Stella.« Er wirkt genervt, als wäre es eine Tortur, auch nur mit meiner Schwester reden zu müssen.
»Wir sollten uns mal über den Herbstempfang unterhalten«, sagt sie.
Noah stützt sich auf meine Stuhllehne und ich würde gern die Hand auf seine legen. Ich setze mich auf meine Finger, um mich davon abzuhalten.
»Der Coach hat die Sporthalle reserviert und Catering bestellt«, antwortet Noah. »Tamara kümmert sich um die Deko. Also brauchen wir uns nur noch über das Programm Gedanken zu machen.«
Stella verschränkt die Arme. »Na schön. Morgen? Da hab ich die erste Stunde frei.«
»Zu Befehl, Ma’am.« Noah salutiert. »Hauptsache, Stella die Große ist zufrieden.« Bader und ein paar der anderen Jungs lachen, und ich beiße mir auf die Zunge, um nicht mit einzufallen. Noah führt sich in der Öffentlichkeit oft auf wie einer von seinen Bros, aber irgendwie macht ihn das sogar noch liebenswerter.
»Geht’s hier um den Empfang?« Tamara ist neben Noah aufgetaucht. »Die Transparente, die ich bestellt habe, sind heute angekommen.«
»Ist ja toll, Babe«, lobt Noah. »Du bist einfach super in so was.« Er schenkt ihr ein strahlendes Lächeln, und in mir gerät alles ins Stocken, als er ihr erst einen Schmatzer auf die Wange und dann auf die Lippen drückt. Sie legt die Hand auf seine Brust, und es kostet mich erhebliche Mühe, nicht aufzuspringen und die beiden auseinanderzureißen, als sie einander die Zunge in den Hals stecken.
Ich wende mich wieder meinem Essen zu und nehme mir vor, Noah zu bitten, nicht mehr vor meinen Augen mit seiner verdammten Freundin zu knutschen. Dabei weiß ich, dass es keinen Sinn hat. Noah Brockston macht einfach, was er will. Aber meistens bin das, was er will, nun mal ich.
Nach dem Abendessen, als ich mir gerade auf der Couch das Knie kühle und »Real Housewives« gucke, klingelt es an der Tür. Ein Hoch auf diese dämliche Serie, die mich wunderbar davon ablenkt, dass Noah mich während des Mittagessens kaum beachtet hat. Das Schlimme ist, dass ich mich nicht mal bei irgendwem darüber beklagen kann, jetzt, wo Bethany auf meiner schwarzen Liste steht (die genau einen Namen umfasst). Außerdem versuche ich, nicht daran zu denken, dass ich heute beim Training bei den Squat Jumps zu hart gelandet bin, weswegen mir jetzt das Knie wehtut. Sogar Coach Gary ist mitten im Anweisungenbrüllen kurz zusammengezuckt. Eine Pause durfte ich trotzdem nicht machen, dabei hab ich genau mitgekriegt, dass er es gemerkt hat.
»Ellie, kannst du mal aufmachen?«, schreit Mom aus ihrem Arbeitszimmer.
Ich quäle mich von der Couch hoch und lasse meinen tröpfelnden Eisbeutel in die Spüle fallen. Als ich endlich durch den Flur humpele, kommt Stella gelaufen. »Hau ab, ich geh schon«, kommandiert sie.
»Sehr wohl, Majestät«, murmele ich.
Stella reißt die Tür auf. »Coach Gary«, sagt sie, als hätte sie ihn erwartet.
»Da ist sie ja!«, ruft er und breitet die Arme aus. Er trägt noch immer seine Trainerklamotten und sieht aus, als hätte er die letzten Stunden damit verbracht, sich im Büro Videos vergangener Wettkämpfe anzusehen und Übungen auszudenken.
Mom kommt förmlich angesprintet. »Coach! Was verschafft uns die Ehre?« Sie faltet so andächtig die Hände, als wäre der Rabbi persönlich zum Fastenbrechen nach Jom Kippur erschienen. »Kann ich Ihnen was anbieten? Wasser? Limo? Kaffee?«
Der Coach hebt die Hände. »So herzlich wie bei Ihnen wird man ja in ganz Edgewater nicht empfangen. Aber nein danke, ich bin auch gleich wieder weg. Wollte nur kurz mit Stella über ein paar Mannschaftsangelegenheiten sprechen. In Ordnung, wenn wir uns solange hier breitmachen?« Er deutet auf die Barhocker an der Küchentheke.
»Aber klar doch!«, quietscht Mom. Sie scheint nicht mal auf die Idee zu kommen nachzuhaken, ob diese Unterhaltung nicht auch in der Schule hätte stattfinden können oder seit wann Coach Gary unangemeldete Hausbesuche abstattet. Wie immer stellt niemand seine Entscheidungen infrage. Schließlich hat er das Team in den fünf Jahren, seit er im Amt ist, jedes Mal zur Staatsmeisterschaft geführt. Seine Mädels landen Jahr für Jahr auf dem Siegertreppchen, darum sind die Leute ihm dankbar. Für das, was er für das sportliche Ansehen unserer Stadt tut, aber auch dafür, dass er auf uns aufpasst.
Jetzt jedoch, nach dem Vorfall zwischen Stella und Allison Tarley, steckt sein Kopf in der Schlinge. Warum sonst hätte ihm die Schulbehörde einen Anstandswauwau zugeteilt, der ihn beim Training beobachtet?
Stella und der Coach nehmen Platz, und ich bleibe stehen, für den Fall, dass auch meine Anwesenheit gefragt ist. Doch der Coach wendet sich zu mir um. »Könntest du uns kurz allein lassen, Ellie?«
Ich schlurfe zurück ins Wohnzimmer, aber dank der offenen Bauweise unseres Hauses, die Mom so liebt, bekomme ich immer noch fast alles mit. Ha!
Der Coach wartet, bis er mich außer Hörweite glaubt. Er gehört zu den wenigen Leuten, die einen guten Draht zu Stella haben – oder zumindest bildet er sich das ein. Seine Methoden sind allerdings eher speziell: bedrängen und anschreien. Und was bei meiner großen Schwester zu funktionieren scheint, ist für manch andere der reinste Horror. »Hör mal, Stella. Wir bewegen uns dieses Jahr beide auf dünnem Eis«, fängt er an. »Die Schulbehörde hat ein Auge auf uns, darum dürfen wir uns keinen einzigen Fehltritt mehr erlauben.«
Unwillkürlich spanne ich die Schultern an, genau wie vermutlich Stella. Ich dachte, diese Sache wäre erledigt. Das hatte der Coach uns zumindest versprochen.
»Du musst dich wirklich zusammenreißen«, fährt er fort. »Und nachdem Mila zu uns gestoßen ist, ist dein Platz als unsere Nummer eins keineswegs mehr so sicher wie bisher. Gar nichts ist sicher, da mache ich dir nichts vor.«
Stella rammt die Fersen gegen die Beine ihres Hockers und ich spüre ihre Wut bis hierher. Der Coach provoziert sie, will, dass sie an sich, ihrem Talent und ihrer Kraft zweifelt. Das habe ich schon millionenmal miterlebt. Normalerweise allerdings nur Raven gegenüber oder anderen, die nicht so tough sind wie Stella.
»Du musst dich auf einen knallharten Konkurrenzkampf mit Mila einstellen. Aber das könnte durchaus sein Gutes haben, glaub mir.«
Stella stöhnt auf. Sie wirkt nicht überzeugt.
»Ihr zwei werdet einander anspornen und zu Höchstleistungen motivieren. Bestimmt wirst du noch das eine oder andere von ihr lernen, zum Beispiel, wie du dich besser unter Kontrolle hältst und diese ganze überschüssige Energie kanalisierst.« Er wird ernst. »Vergiss nicht, dass das hier ein Mannschaftssport ist, Stella. Ich kann das Team mit oder ohne dich zur Staatsmeisterschaft bringen, aber lieber hätte ich dich natürlich dabei. Du musst den Scouts bloß zeigen, dass du weißt, was sportliche Fairness bedeutet, und dass du belastbar bist. Meinst du, das kriegst du hin?«
»Klar«, erwidert Stella knapp. Sie klingt, als stünde sie kurz vor einem Tobsuchtsanfall.
»Ich weiß, dass du das kannst«, pflichtet der Coach ihr bei. »Ich kenne dich.«
Am liebsten würde ich mich jetzt umdrehen, um ihrer beider Gesichter zu sehen, aber mein hämmerndes Herz hält mich davon ab.
»Ich frage mich nur, warum Sie mir nicht erzählt haben, dass Mila herzieht«, beschwert sich Stella. »Das hat mich echt kalt erwischt.«
Der Coach lacht und tätschelt ihr die Schulter. »So war es doch viel interessanter, findest du nicht?«
»Nein.«
»Ach komm. Du hast schon immer die besten Leistungen abgeliefert, wenn du unter Druck stehst.«
»Ich mag keine Überraschungen«, beharrt sie. »Das wissen Sie ganz genau. So was bringt mich nur durcheinander.«
Erstaunt ziehe ich die Augenbrauen hoch. Solche Sachen hätte Stella noch vor einem Jahr niemals zugegeben. Vielleicht hat der Aufenthalt in Breakbridge ja tatsächlich was gebracht.
»Tja, damit musst du aber umzugehen lernen«, erwidert er. »Und Ellie ist dir inzwischen auch dicht auf den Fersen.« Mir wird heiß, als ich meinen Namen höre. »Pass lieber auf, deine Schwester ist eine Kämpferin mit einer ordentlichen Portion Talent. Die will den Sieg, das spüre ich.«
Stella sagt nichts. In meinem Magen macht sich eine Mischung aus Stolz und Angst breit. Das wird sie bloß noch weiter aufpeitschen und die Kluft zwischen ihr und mir vergrößern. Was dem Coach ganz genau bewusst ist.
»Allein holst du bei der Regionalmeisterschaft locker den ersten Platz, vielleicht sogar bei der Staatsmeisterschaft. Aber würdest du nicht auch gern den Mannschaftstitel gewinnen? Dabei kann Mila dir helfen. Und Ellie auch. Du musst den Scouts beweisen, dass du Teamgeist hast. Auf so was legen Collegetrainer Wert.«
Stella schweigt einen Moment, und ich merke, wie sehr sie sich bemühen muss, ruhig zu atmen. »Okay«, sagt sie schließlich.
»Du musst zu hundert Prozent fokussiert sein.«
»Ich bin immer zu hundert Prozent fokussiert, es sei denn, Sie bringen mich aus dem Konzept.«
»Stella«, blafft der Coach so unvermittelt, dass selbst ich zusammenzucke. Dann höre ich nur noch unverständliches Gemurmel und schließlich das Scharren der Barhocker über die Fliesen. Kurz darauf steht der Coach neben meiner Couch. Seine Arme sind vor der Brust verschränkt, die so rund und breit ist wie ein Fass. »Tschüss, Ellie. Bis morgen.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:

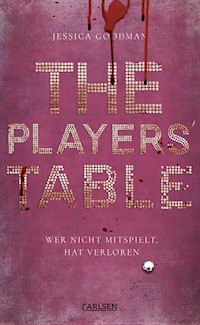













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













