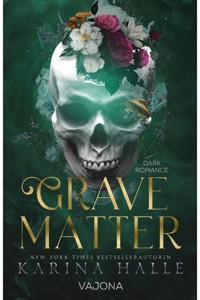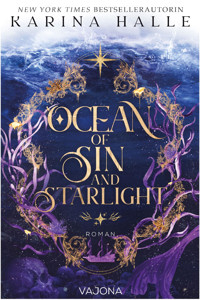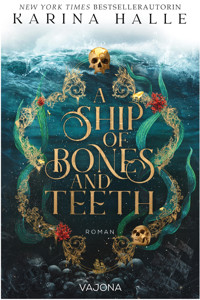9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dumont-Saga
- Sprache: Deutsch
Wenn du die Frau triffst, für die du alles ändern würdest …
Keiner der Dumont-Sprösslinge genießt so einen Ruf wie Pascal: arrogant, eiskalt und ein Playboy. Jetzt steht er an der Spitze des Luxus-Modeimperiums und braucht eine neue Hausangestellte. Als Gabrielle, die früher mit ihrer Mutter für die Familie gearbeitet hat, nach Paris zurückkehrt, stellt er sie ein. Sie fasziniert ihn wie keine Frau zuvor. In ihrer Nähe spürt er ein verzehrendes Verlangen, das Gabrielle erwidert. Aber sie lässt ihn so viel mehr fühlen, sie berührt in ihm eine längst verloren geglaubte Seite. Kann er sich für Gabrielle ändern und ein besserer Mensch werden? Was Pascal nicht ahnt: Auch sie verbirgt etwas vor ihm – und das kann die Dumont-Dynastie zu Fall bringen.
Das dramatische Finale der »Dumont«-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem TitelDisavow bei Montlake Romance, Seattle.
Auch wenn einige Schauplätze real existieren, sind alle handelnden Personen und die Handlung in dieser Ausgabe frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
© 2020 by Karina Halle Deutsche Erstausgabe © 2021 für die deutschsprachige Ausgabe by MIRA Taschenbuch in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with the author c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A. Coverabbildung von Rashchektayev, Jingjing Yan, Great Kit,tomertu / Shutterstock E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783745752632
www.harpercollins.de
TRIGGERWARNUNG
Triggerwarnung: Dieser Roman enthält Szenen körperlicher und sexueller Gewalt.
PROLOG
PROLOG
Gabrielle
»Du hast keinen Grund, dich vor mir zu fürchten«, erklärt er.
Ich erstarre. Ich habe ihm den Rücken zugekehrt, ich dachte, in der Küche, wo uns jeder sehen kann, wäre ich sicher. Aber natürlich stimmt das nicht.
In diesem Haus ist es nirgendwo sicher.
Besonders um diese Zeit nicht.
»Gabrielle.« Er sagt meinen Namen. Diesmal klingt seine Stimme sanfter und daher noch gemeiner. In den vergangenen Jahren hat er diese Stimme so oft bei mir eingesetzt. Einst, als ich kleiner und somit tabu war, bekam ich lediglich ein Lächeln. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie viel Bosheit sich hinter diesem Lächeln verbarg.
Ich will mich nicht umdrehen, doch natürlich muss ich das. Ich will nicht, dass er mich überrumpelt, wie er es schon so oft getan hat.
Ich drehe meinen Oberkörper und schaue über die Schulter. »Kann ich Ihnen helfen, Monsieur?«
»Ich hätte gern eine Flasche 1986er Bordeaux auf mein Zimmer. Und ich möchte, dass du mir Gesellschaft leistest und ein Glas mit mir trinkst.«
Ich kenne diese Tour. Ich habe schon versucht, Nein zu sagen, allerdings funktioniert das nie. Es macht ihn nur wütender. Es macht das Leiden schlimmer.
»Ich weiß nicht, ob Ihrer Frau das gefallen würde«, sage ich langsam, und mir wird im gleichen Moment klar, dass das ein Fehler war.
Hinter mir ist Stille, angespannte Stille, wie sie vielleicht in einem Wald herrscht vor einem Vulkanausbruch, der jeden Baum verbrennen wird.
Ich drehe mich um und entdecke ihn im Türrahmen stehen. Seine Silhouette zeichnet sich vor dem Licht aus dem Flur ab, sein Gesicht ist nicht zu erkennen. Das macht ihn jedoch nicht weniger Furcht einflößend.
»Du solltest sie besser nicht erwähnen«, meint er, und seine Stimme trieft vor Gehässigkeit.
Mein Herz hämmert mir in den Ohren, immer schneller, wird zum Trommelwirbel, und der Schmerz, den ich in den letzten Tagen mit mir herumgeschleppt habe, bringt mich fast dazu, dass ich mich krümme. Ich kämpfe dagegen an und drücke die Fingernägel in die Handflächen. Ich fühle nichts außer Narbengewebe, weil ich das schon so oft gemacht habe.
Ich habe eine Scheißangst.
Ich kann das nicht schon wieder durchmachen.
»Tut mir leid, Monsieur«, sage ich leise, obwohl das nicht stimmt. Mir tut nur leid, dass ich nicht schnell genug war. Ich hätte auf mein Zimmer rennen sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Allerdings kann ihn nichts aufhalten, wenn er entschlossen ist.
Er seufzt laut und richtet sich auf. »Es spielt keine Rolle, sie ist ohnehin nicht hier. Niemand ist hier. Du kannst nicht in Schwierigkeiten kommen, Gabrielle.«
»Ich … ich fühle mich nicht gut«, wispere ich, seinem Blick ausweichend. »Ich war gerade beim Arzt.«
»Ach ja? Weswegen denn? Bist du etwa krank?«
Ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen. Es würde ihn entweder in Rage bringen oder stolz auf mich machen, und ich weiß nicht, was schlimmer wäre.
»Es geht mir gut«, lüge ich.
Mir wird es nie wieder gut gehen.
Nicht nach allem, was er getan hat.
Was er mir angetan hat.
Was ich tun musste.
Ehe ich begreife, was geschieht, ist er plötzlich nicht mehr auf der anderen Seite der Küche, sondern bei mir und drückt mich mit dem Rücken gegen die Arbeitsfläche. Mit einer Hand hält er mich gepackt und drückt mich herunter, bis sich alles in mir schmerzhaft zusammenzieht.
»Weißt du was?«, zischt er; sein Gesicht befindet sich ganz nah vor meinem. »Ich denke, du lügst. Ich glaube nicht, dass du beim Arzt warst. Du wolltest nur einen freien Tag. Du wolltest ein bisschen faulenzen, nicht wahr, Gabrielle?«
Ich kann kaum atmen. Meine Hand tastet auf der Arbeitsfläche, auf der Suche nach irgendetwas, womit ich mich verteidigen kann. Er mag es hart, aber ich lebe mit der Angst, er könnte zu weit gehen – weiter, als er ohnehin schon gegangen ist.
Ich traue ihm zu, ohne Reue zu töten.
Sein Griff an meinem Hals wird fester, seine Finger graben sich in mein Fleisch, wie zum Beweis für meine Vermutung. Ich starre in seine Augen, schreckliche, dunkle Augen, in denen sich nur das blaue Leuchten der Digitaluhr neben der Mikrowelle spiegelt. Sie glitzern wie Eisfeuer.
»Du denkst, du bist etwas Besseres als ich?«, raunt er mit rauer, eiskalter Stimme. »Du hältst dich für etwas Besonderes, Gabrielle? Glaubst du etwa, dass ich etwas für dich empfinde? Das tue ich nicht. Du bist nichts für mich, nur etwas, womit ich mich vergnüge, bis du mich langweilst. Und wenn ich genug von dir habe, entsorge ich dich.« Er beugt sich so nah über mich, dass ich den Alkohol in seinem Atem riechen kann. »Aber wann das ist, entscheide nur ich allein, nicht du. Und wenn ich dir sage, dass du mir eine verdammte Flasche 1986er Bordeaux bringen sollst, dann tust du das verdammt noch mal auch!«
Ich versuche zu sprechen, aber ich kann nicht. Ich bekomme keine Luft.
Sein Griff wird fester und fester, und alles um mich herum wird schwarz.
»Miststück«, stößt er knurrend hervor, lässt mich los und tritt zurück.
Ich schnappe nach Luft, krümme mich, atme keuchend. Mein Hals brennt. Ich fühle die Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen, wahrscheinlich Blut. Es erinnert mich daran, dass ich auf keinen Fall mit in sein Zimmer gehen werde, egal, was passiert.
Wenn er versucht, mich hier zu vergewaltigen, dann ist es eben so.
Ich werde bereit sein.
Der Gedanke weckt das letzte bisschen Kraft, das ich noch habe.
Langsam richte ich mich auf und blicke aus dem Augenwinkel zu der Schublade mit den Messern. Sie ist ganz nah, aber ich weiß nicht, ob ich herankomme, ohne ihn misstrauisch zu machen.
»Und jetzt reiß dich zusammen und hol den Wein!«
Der Wein ist im Keller, in den ich schon normalerweise nicht gern gehe. Doch heute Abend erfüllt mich nackte Angst. Dort unten kann er alles tun. Wenn ihm danach ist, kann er mich einsperren. Tot oder lebendig. Geschlagen oder nicht. Würde jemand es bemerken? Meine Mutter vielleicht?
Das ist meine größte Furcht. Dass sie nicht einmal mitbekäme, wenn ich fort wäre. Dass sie so blind ist vor Pflichterfüllung und Ergebenheit, so taub von seiner Gehirnwäsche, dass es sie nicht weiter kümmern würde.
Ich nicke, sammle mich und versuche, den Gang in den Keller hinauszuzögern. »Ich hole erst einen Korkenzieher und Gläser«, sage ich und gehe zur Schublade. Ich ziehe sie auf und sehe die Messer, doch er ist schon hinter mir. Ich nehme den Korkenzieher und knalle die Schublade zu, versuche seitlich zu fliehen, aber er streicht mir die Haare über die Schulter und presst seine Lippen auf meinen Nacken.
Es kostet mich enorme Anstrengung, mich nicht zu schütteln und meine Abscheu zu verbergen.
»Du trägst dein Haar nie offen«, murmelt er, während sich meine Hand fest um den Korkenzieher schließt. »Vielleicht sollte ich eine Vorschrift daraus machen.«
Ich sage nichts. Meine Augen sind geschlossen, und ich bete, er möge zurückweichen.
Stattdessen drückt er sich an mich, sodass ich seine Erektion spüren kann.
»Wenn ich es mir recht überlege, brauchen wir den Wein gar nicht«, sagt er, packt plötzlich meine Haare und zerrt meinen Kopf nach hinten. Ein scharfer Schrei entweicht mir. »Wir gehen nirgendwohin.«
Ich höre den Reißverschluss seiner Hose und fühle seine freie Hand, die sich an meinen Beinen hinaufbewegt, mein Kleid hochschiebt, während er mit der anderen meinen Kopf nach hinten reißt, sodass ich fürchte, mir das Genick zu brechen.
»Nein«, sage ich, wie schon viele Male zuvor, rau und keuchend. »Nehmen Sie Ihre verdammten Hände von mir!«
Der letzte Teil ist neu. Das habe ich noch nie gesagt.
Ich habe solche Angst, dass ich sie nicht mehr spüre. Als hätten die Furcht und das Wissen um das, wozu dieses Monster fähig ist, sich in etwas verwandelt, das größer ist als meine Angst.
Es will Gerechtigkeit.
Es will Rache.
Es wird das hier nicht länger hinnehmen.
Unvermittelt lässt er meine Haare los, wirbelt mich herum und schlägt mir ins Gesicht. Das Geräusch ist laut. Ich bin benommen, alles dreht sich, und ich kippe zur Seite, mit schmerzhaft glühender Wange. Ich kann mich nur knapp an der Arbeitsfläche festhalten.
Aber ich halte den Korkenzieher nach wie vor in der Hand.
Erneut geht er auf mich los, und diesmal schreie ich. Meine Stimme ist hoch und schrill, und ich schreie meinen Schmerz und mein Entsetzen heraus, während ich ihm den Korkenzieher in den Unterarm ramme, als er mich zu packen versucht. Ich drehe ihn so tief in sein Fleisch, wie es geht.
Er brüllt markerschütternd, und ich nutze die Gelegenheit für einen Fluchtversuch.
»Du verdammtes Miststück!«, flucht er und greift nach mir.
Aber ich bin schnell genug und schaffe es bis zur Terrassentür, die hinaus in den Garten führt.
Gerade als ich sie aufschließe und öffne, sehe ich meine Mutter auf der anderen Seite. Sie trägt ihren Pyjama und starrt mich an.
»Ich habe einen Schrei gehört!«, erklärt sie, nachdem ich die Tür geöffnet habe. Sie betrachtet mich rasch von Kopf bis Fuß, ehe sie mich praktisch zur Seite schubst und hinein und auf ihn zugeht. »Was ist passiert?«
Er steht vornübergebeugt da und hält sich den blutenden Arm. Der Korkenzieher liegt auf dem Boden. »Sie hat mich angegriffen!«
Meine Mutter erschrickt und sieht zu mir. »Gabrielle!«
»Er ist ein Monster!«, schreie ich sie verzweifelt an. Mein Gesicht wird heiß, mein Herz hämmert. »Er hat mir wehgetan!« Ich halte inne und versuche zu Atem zu kommen, denn die nächsten Worte fallen sogar mir schwer. »Er … er hat mich vergewaltigt, maman.«
Ihre Augen weiten sich, und sie betrachtet mich genauer, als falle es ihr schwer, mir zu glauben, als hätte ich mich ihr nicht gerade geöffnet, in all meiner Verwundbarkeit, ihr die tiefsten Verletzungen zeigend, die sich in die Seele eingraben und nie wieder verheilen.
»Sie lügt!« Gautier schnappt sich ein Küchenhandtuch, um es auf seinen Arm zu pressen. »Seit dem Tag, an dem du sie hierher gebracht hast, versucht sie, mich zu verführen.«
»Nein!«, widerspreche ich entsetzt und fasse sie am Arm, damit sie mich anschaut und mir zuhört. Wir haben mit meinem Vater so viel durchgemacht – erkennt sie denn nicht, dass es wieder geschieht? »Bitte, maman, hör mir zu! Du musst mir glauben! Siehst du denn nicht, was er mit uns macht? Er versucht, dich gegen mich aufzubringen! Er hat dir eingeredet, er sei dein Retter, aber das ist er nicht. Er wird dein Ruin sein. Mich hat er bereits zerstört …«
»Wenn du deiner Mutter weiterhin diese Lügen auftischst, werde ich euch beide feuern und dafür sorgen, dass keine von euch mehr irgendwo arbeitet«, unterbricht er mich schneidend. »Ist es das, was du willst, Gabrielle? Ist es das, was du für deine Mutter willst?«
»Sie Hurensohn!«, schreie ich ihn an.
»Entgegen der gängigen Meinung war meine Mutter eine nette Frau. Zumindest für meinen Bruder Ludovic«, erklärt er. »Wenn du mich beleidigen willst, versuch es mit etwas anderem.« Er kommt auf uns zu.
Wie grauenhaft arrogant er aussieht! Als wüsste er, dass er gewonnen hat.
Denn das hat er.
Ganz gleich, was meine Mutter glaubt oder nicht, ganz gleich, ob sie sich für ihn entscheidet statt für mich, ganz gleich, ob sie damit Verrat an mir begeht – ich werde sie nicht verraten. Ich werde sie nicht den Job kosten, auch wenn dieser Job sie eines Tages vielleicht umbringt.
Mir bleibt keine andere Wahl, als zu gehen.
Ich kann nicht einen Tag länger hierbleiben.
Ich würde es nicht überleben.
»Nun, Gabrielle?«, fragt Gautier. »Wirst du deiner armen Mutter weiterhin ins Gesicht lügen? Oder wirst du dich bei mir entschuldigen, weil du mit diesem verdammten Korkenzieher auf mich eingestochen hast?«
Ich starre ihn hasserfüllt an, und es ist, als würde ich in einen Abgrund blicken. Nur dass ich diesmal einen Entschluss fasse.
Plötzlich fühle ich mich mutig, und ein warmes Gefühl durchströmt meinen Körper. »Es tut mir leid, dass ich mit einem Korkenzieher auf Sie eingestochen habe«, erwidere ich mechanisch, und die Worte kommen so klar und geschliffen heraus, dass ich mich frage, ob ich bereits in eine neue Rolle geschlüpft bin.
»Oh, warum, um Himmels willen, hast du das getan, Gabby?«, jammert meine Mutter wie ein kleines Kind. Gautiers Nähe scheint sie stets einige Jahre zurückzuwerfen. »Warum hast du Monsieur Dumont das angetan, wo er doch immer so gut zu uns ist?«
Ich versuche, den Backstein in meinem Hals herunterzuschlucken, doch das gelingt mir nicht. »Offenbar stehe ich in letzter Zeit neben mir«, erwidere ich.
Ich sehe ihn noch einmal an, in der Gewissheit, dass die Freiheit greifbar ist und ich keine Angst mehr habe zu gehen.
Und ich werde nie mehr zurückkehren.
KAPITEL EINS
KAPITEL EINS
Pascal
Sieben Jahre später
Alles an dem Brief schreit Erpressung. Vom Umschlag ohne Absender bis zu den rätselhaften getippten Worten auf dem Zettel darin.
Die Welt wird erfahren, was du getan hast.
Ich muss lachen, obwohl da eine leise Furcht in meinem Herzen erwacht. Wer immer das geschickt hat, schaut sich zu viele Filme an. Wer immer das geschickt hat, will mir Angst machen und weiß nicht wie. Es ist nicht einmal eine Drohung beigefügt. Es ist nur angebliches Wissen.
Was habe ich getan? Ich habe viele Dinge getan. Nichts davon war im reinsten Sinne des Wortes gut – zumindest nicht für irgendwen außer für mich.
Aber trotz der Theatralik des Briefes ist mir klar, dass ich ihn ernst nehmen sollte.
Denn tief in mir weiß ich genau, was gemeint ist.
Was mir unterstellt wird.
Vor knapp einem Jahr ist mein Onkel Ludovic Dumont bei unserem jährlichen Maskenball zusammengebrochen. Die Ärzte diagnostizierten einen Herzinfarkt, obwohl ihm erst wenige Wochen zuvor beste Gesundheit bescheinigt worden war. Manche Menschen, darunter meine Cousine Seraphine und mein eigener Bruder Blaise, gaben meinem Vater die Schuld. Sie warfen ihm vor, Ludovic kaltblütig ermordet zu haben, um die Firma übernehmen zu können.
Man kümmerte sich um die beiden. Blaise und Seraphine ließen die Vorwürfe für eine neue Existenz in Dubai fallen. Wären sie nicht darauf eingegangen, hätten sie es möglicherweise mit ihrem Leben bezahlen müssen. Es war nie ein Geheimnis, dass mein Vater rücksichtslos ist und vermutlich mehr Verbrechen begangen hat, als ich mir auch nur annähernd vorstellen kann. Aber mir war nicht klar, dass er derartig auf Familienmitglieder losgehen würde. Er hätte meine Cousine eher umgebracht, als sie ihre Version der Wahrheit verbreiten zu lassen.
Ich nehme an, Seraphine hat das nicht vergessen, weshalb dieser Brief verwirrend ist. Sie und Blaise halten sich seit fünf Monaten in Dubai auf. (Ich freue mich für sie, obwohl ich die Tatsache, dass sie zusammen sind – auch wenn sie nicht blutsverwandt sind –, ziemlich geschmacklos finde.) Warum sollte sie wieder mit diesen Anschuldigungen anfangen, wenn für sie so viel auf dem Spiel steht? Und warum auf eine derartig abgedroschene Weise, wo sie doch vorher nie ein Problem damit hatte, es uns ins Gesicht zu sagen?
Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
Ich stehe vom Schreibtisch auf und schaue zur Tür hinaus. Der Flur ist leer. Im Haus ist es still, bis auf das leise Gemurmel des Fernsehers im Zimmer meiner Mutter im anderen Flügel.
Das Château Dumont ist ein besonderes Gebäude. Ich bin in dem weitläufigen Anwesen aufgewachsen. Mir ist klar, dass viele Leute sich fragen, warum ich, ein Einunddreißigjähriger, noch immer hier wohne, obwohl ich mehrere Apartments in Paris und Immobilien überall auf der Welt besitze. Abgesehen davon, dass ich mich hier am wohlsten fühle, ist das Haus ein Schloss. Ich bewohne den Ostflügel, mit eigenem Arbeitszimmer, Schlafzimmer und privatem Seiteneingang, außerdem habe ich hier genug Privatsphäre.
Zumindest hatte ich die.
Nachdem Blaise gegangen ist, wurde mein Vater immer misstrauischer mir gegenüber, als würde ich ihn als Nächstes mit Anschuldigungen konfrontieren. Es würde mich nicht überraschen, wenn sich irgendwo in meinem Arbeitszimmer eine Wanze befände. Genau deshalb begebe ich mich nach nebenan ins Schlafzimmer, um zu telefonieren.
Ich setze mich auf die Couch und wähle, obwohl es schon spät ist und in Dubai noch später. Es klingelt und klingelt am anderen Ende, und ich will schon auflegen, als Blaise sich doch noch meldet.
»Was willst du?«, fragt er müde. Ich muss ihn aufgeweckt haben.
»Begrüßen wir uns neuerdings auf diese Weise?«, frage ich zurück.
Schweigen. Dann: »Was willst du, Pascal?«
Blaise und ich standen uns noch nie besonders nah. Wir sind Brüder, zusammen aufgewachsen und altersmäßig nicht weit auseinander, aber das war’s auch schon. Die Distanz zwischen uns wurde im vergangenen Jahr mehr als deutlich, und seit er nach Dubai gegangen ist, ist sie fast unüberbrückbar. Nicht, dass es mich allzu sehr kümmert. Ich wäre nicht so weit im Leben gekommen, hätten mir die Menschen so viel bedeutet, wie sie sollten.
»Ich habe einen Brief erhalten«, erkläre ich.
Erneutes Schweigen.
»Ich glaube, Seraphine hat ihn geschickt«, fahre ich fort.
Er räuspert sich. »Ein Brief? Was steht drin?«
»Frag Seraphine! Sie liegt doch bei dir im Bett, oder?«
»Was steht drin, Pascal?«, wiederholt er, und ich kann im Hintergrund hören, wie Seraphine überrascht meinen Namen sagt.
»Darin steht: Die Welt wird erfahren, was du getan hast. Hat Seraphine ihn geschickt oder nicht?«
Bitter lacht er auf. »Ich muss sie nicht erst fragen, um zu wissen, dass sie es nicht war. Glaubst du etwa, sie spielt ›Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‹?«
Sein Lachen ärgert mich. »Ich weiß, dass diese Nachricht theatralisch ist«, sage ich genervt. »Deshalb vermute ich ja, dass sie von ihr ist.«
»Was ist los?«, höre ich Seraphine fragen. »Sprecht ihr über mich?«
»Nichts, was dich beunruhigen müsste«, erklärt Blaise. »Pascal hat einen Brief bekommen, und er dachte, er wäre von dir. Eine vage Drohung. Möglicherweise glaubt jemand, dass er etwas mit dem Mord an deinem Vater zu tun hat.«
»Ich hatte nichts damit zu tun«, erinnere ich ihn.
»Und doch stellst du meine Wortwahl nicht infrage. Wie lebt es sich in dem Haus des Schreckens, in dem Wissen, wozu Vater fähig ist? Wie kommt dein Gewissen damit klar?«
»Du weißt doch, dass ich keines habe«, erwidere ich sarkastisch und weigere mich, seine Worte näher an mich heranzulassen.
»Natürlich nicht.«
»Du schwörst also, dass weder du noch Seraphine den Brief geschickt habt?«
»Ich schwöre dir gar nichts, lieber Bruder, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass Seraphine dir keinen Brief geschickt hat. Was würde es auch bringen?«
»Nichts, es sei denn, er war für unseren Vater gedacht.«
»Ist er an dich adressiert?«
»Es steht kein Vorname dabei, nur ›Monsieur Dumont‹«, antworte ich und betrachte nachdenklich die Adresse auf dem Umschlag. Er ist mit einer französischen Briefmarke versehen.
»Dann ist er wahrscheinlich für Vater bestimmt, nicht für dich«, meint er gähnend. »Offenbar bleibt die Wahrheit nicht lange verborgen. Viel Glück damit, Pascal! An deiner Stelle würde ich den Brief als Zeichen deuten, um zu verschwinden.«
»Denkst du, ich könnte tun, was du getan hast, und in ein anderes Land fliehen? Wie ein Feigling?«
»Auf Wiederhören!«, sagt er, und bevor ich die Gelegenheit bekomme, mich danach zu erkundigen, wie es ihm geht, beendet er das Telefonat.
Ist auch egal. Je weniger ich von den beiden weiß, umso besser.
Ich lege ebenfalls auf und bin beunruhigter als zuvor. Ich wusste, dass Seraphine es nicht war, hoffte es aber nichtsdestotrotz, um die Sache abhaken zu können.
Ich muss versuchen herauszufinden, von wem der Brief stammt. Als ich von der Arbeit nach Hause kam, lag er zusammen mit der übrigen Post auf dem Boden vor dem Briefschlitz. Meine Mutter und mein Vater waren zum Essen ausgegangen und hatten ihn daher nicht gesehen.
Ich muss mich allerdings fragen, ob es davor schon einen Brief gegeben hat. Falls ja, dann haben entweder mein Vater oder meine Mutter ihn geöffnet und mir nichts davon erzählt.
Ich sollte Charlotte fragen. Dieser Gedanke kommt mir in den Sinn.
Aber Charlotte, die Hausangestellte, hat vor zwei Wochen wütend gekündigt. Angeblich weil ich grausam und herzlos bin, was ein eigenartiger Vorwurf ist von jemandem, an den ich kaum je einen Gedanken verschwendet habe. Sie war bloß eine Angestellte.
Dummerweise war sie jemand, den ich brauchte. Da Blaise und Seraphine nicht mehr für die Firma arbeiten, musste ich mich um sämtliche Neueinstellungen kümmern und dafür sorgen, dass alle und alles effizient zusammenarbeiten. So ungern ich es zugebe: Wenn ich das Rückgrat des Unternehmens bin, waren Blaise und Seraphine die lebenswichtigen Organe, die die Marke Dumont zum Überleben brauchte.
Als Konsequenz bin ich jetzt die halbe Nacht in der Firma. Ich brauche wirklich dringend jemanden, der sich um meine täglichen Bedürfnisse kümmert, wenn ich nach Hause komme. Genau das hat Charlotte im vergangenen Jahr getan. Rückblickend ist mir durchaus bewusst, wie verrückt und emotional sie war, aber zumindest verstand sie sich auf ihren Job.
Mein Problem liegt darin, dass ich wählerisch und vielbeschäftigt bin, ich habe also keine Zeit, mich darum zu kümmern. Die passende Kandidatin muss diskret und professionell sein. Und sie darf nicht gleich in Tränen ausbrechen, wenn ich mal etwas laut werde. So jemand ist nicht leicht zu finden.
Obwohl es schon spät ist, gehe ich über den Flur zu Mutters Zimmer. Porträts der Dumonts blicken mich von den Wänden an. Blaise meinte immer, er fühle sich taxiert von ihren Blicken, aber ich stelle mir lieber vor, dass sie neidisch sind.
Die Tür zum Zimmer meiner Mutter ist nur angelehnt, und ich klopfe leise an.
Es kommt keine Antwort, daher öffne ich die Tür weiter und spähe hinein.
Sie sitzt auf der Couch, die Augen geschlossen, der Kopf ist nach hinten gelehnt, neben ihr steht eine leere Flasche Gin. Der Fernseher taucht ihre Gestalt in wechselndes Licht.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ich sie so weggetreten vorfinde, und ich habe nicht die Absicht, eine schlafende Bestie zu wecken. Ich will die Tür wieder zumachen, als sie sich plötzlich aufsetzt. »Was gibt’s, Pascal?«, fragt sie, während sie auf den Fernseher starrt.
Meine Mutter kann verdammt unheimlich sein.
»Ich wollte dich nicht stören.«
»Du bist mein Sohn. Ich kann deine Gegenwart überall spüren«, erwidert sie und schaut mich endlich an. Noch immer unheimlich. »Komm rein. Was gibt es denn nun?«
Ich trete ein. Ich fand es nie seltsam, dass meine Eltern, seit ich denken kann, getrennte Zimmer haben. Ihr Raum hat weiße Wände mit goldenen Akzenten, mit prunkhaften Kunstwerken und sogar einer Kopie der Venus von Milo neben dem Bad. Sie hat hier alles, was sie braucht, und das Beste für sie: Mein Vater ist nicht da.
»Ich brauche deine Hilfe«, erkläre ich und zucke innerlich über diese Worte zusammen. Meine Mutter ist nicht anders als mein Vater, und jedes Geständnis von Schwäche weckt ihre Raubtierinstinkte.
Sie neigt den Kopf zur Seite und setzt sich gerader, als müsste sie jemanden beeindrucken, ungeachtet der Tatsache, dass ihr Mascara unter den Augen verschmiert ist. »Meine Hilfe?«, wiederholt sie. »Wobei?«
»Ich brauche eine neue Hausangestellte. Charlotte hat vor zwei Wochen gekündigt.«
»Das ist mir bekannt. Ich musste sie zum Bahnhof fahren, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Was hast du nur mit ihr gemacht?«
»Ich habe gar nichts mit ihr gemacht. Sie kam nur mit dem Druck nicht zurecht.«
Sie zieht die Augenbrauen hoch.
»Das stimmt«, fahre ich fort. »Und ich habe keine Zeit, jemand Passenden zu finden. Seit Blaise und Seraphine weg sind, habe ich einfach zu viel um die Ohren. Die neuen Mitarbeiter sind allesamt unfähig.«
»Du hast sie eingestellt.«
»Bessere gab es nicht. Jetzt muss ich jemanden finden, auf den ich mich verlassen kann und der damit klarkommt, für mich zu arbeiten. Jemanden, der belastbar ist. Eine, die mehr kann, als mein Klo zu putzen und das Bett zu machen.«
Angewidert verzieht sie das Gesicht. »Also wirklich, Pascal!«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich bin wenigstens ehrlich.«
Sie schaut skeptisch drein, und ihre Nasenflügel weiten sich beim Einatmen. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt noch eine Mimik hat, bei der Menge Botox, die sie sich spritzen lässt.
»Wie der Zufall es will«, sagt sie langsam und mit einem Anflug von Selbstzufriedenheit im Blick, »kenne ich tatsächlich jemanden, der perfekt für dich geeignet wäre. Perfekt für diese Familie.«
Ich schaue erwartungsvoll, damit sie weiterspricht.
»Gabrielle.«
Der Name kommt mir zwar bekannt vor, aber ich muss trotzdem erst in meinem Gedächtnis kramen.
»Gabrielle Caron«, erklärt sie, doch der Nachname sagt mir nichts. »Jolies Tochter.«
Jolie. Die Haushälterin meines Vaters und meiner Mutter, die seit vierzehn Jahren in der Familie ist. Fast hätte ich vergessen, dass Gabrielle bis vor sieben Jahren zusammen mit ihrer Mutter im Gästehaus gewohnt hat. Dann war sie plötzlich verschwunden.
»Sie ist hier?«, frage ich. »Woher weißt du das?« Ich habe sie jedenfalls nicht gesehen, andererseits verbringe ich die meiste Zeit in der Firma.
»Jolie hat es mir neulich erzählt.«
»Und ist Gabrielle hier, um ihren Job zurückzubekommen?« Ich war siebzehn, als Gabrielle mit ihrer Mutter zu uns kam. Ich vermute, damals war sie elf oder zwölf. Ein schlaksiges Mädchen mit großen Zähnen und noch größeren Augen. Blieb für sich. Ich sah sie kaum, bis sie sechzehn wurde und anfing, zusammen mit ihrer Mutter zu arbeiten. Ich erinnere mich, dass ich sie mochte, wie ich jeden anderen mochte. Wenigstens erfüllte sie ihre Aufgaben und hatte eine freundliche, aber professionelle Art an sich. Sie wurde die persönliche Hausangestellte meines Vaters. Schien das ganz gut hinzukriegen, vielleicht, weil mein Vater sich ihr gegenüber ziemlich nett verhielt. Dann, eines Tages, ging sie weg und kam nie wieder.
Bis jetzt.
»Ich weiß nicht, warum sie wieder da ist«, erklärt meine Mutter. »Jolie sagt, sie war in New York und hat dort studiert, Wirtschaft, glaube ich. Sie war sehr klug, wenn ich mich recht entsinne.«
»Ich erinnere mich ja kaum ans Personal«, erwidere ich, »aber ich weiß noch, dass Gabrielle für uns gearbeitet hat, obwohl sie sich mehr auf die Schule hätte konzentrieren sollen. Ein Wirtschaftsstudium ist ein ziemlicher Sprung.«
Meine Mutter gähnt und steht auf, wobei sie ihren Seidenbademantel rafft. »Du hast mich gebeten, dir jemanden zu suchen, und ich habe dir eine Möglichkeit genannt. Ich werde Jolie morgen fragen.«
»Ich werde sie selbst fragen«, erwidere ich. »Und ich werde ein vernünftiges Einstellungsgespräch mit Gabrielle führen.«
»Wie du willst. Ich gehe ins Bett.«
Sie steht auf und bewegt sich mit einer Mischung aus betrunkenem Schwanken und dem übertriebenen Versuch, genau das nicht zu tun, mit dem Ergebnis, dass sie hocherhobenen Kopfes hin und her wankt. Ich höre einen Korken ploppen und nehme an, dass sie sich einen weiteren Schlummertrunk gönnt.
Ich schüttele den Kopf, und für einen kurzen Moment empfinde ich Mitleid mit meiner Mutter. Alles zu haben und es doch nur mithilfe von Alkohol genießen zu können. Ein Leben derartig zu verschwenden.
Aber solche Gefühle habe ich nie lange. Ich mache mich auf den Rückweg zu meinem Trakt, und sie lösen sich auf wie Staub.
Am nächsten Tag erwache ich mit einer gewaltigen Erektion. Ich kann mich an meine Träume nicht erinnern, aber Bilder von einer langbeinigen Blondine, die ich im Stehen an der Wand meines Arbeitszimmers vögele, flirren mir durch den Kopf. Das ergibt durchaus Sinn; in letzter Zeit habe ich so viel zu tun, dass ich nicht mal Zeit für Sex hatte.
Das werde ich heute Abend ändern, sage ich mir. Ich werde in meinem Handy nach einem Model suchen. Ich sollte wohl auch etwas gegen diese Erektion unternehmen, aber als mir all die Dinge einfallen, die ich heute zu erledigen habe, verschwindet sie rasch von selbst.
Da ist die Arbeit, natürlich. Aber da wäre auch noch Gabrielle.
Ich hasse es, Leute einzustellen, und ich bezweifle bereits, dass sie gut genug sein wird.
Ich dusche und ziehe mich an, einen eleganten schwarzen Dumont-Anzug mit eisblauer Krawatte, von der ich weiß, dass sie meine Augen zur Geltung bringt. Möglicherweise muss ich heute ein bisschen charmant sein, da kann das nicht schaden.
Anschließend gehe ich nach unten und schaue in der Küche vorbei, wo Jolie den morgendlichen Espresso für meine Mutter zubereitet. Mein Vater ist wahrscheinlich schon aufgebrochen. Er kann es sich nicht erlauben, von mir überflügelt zu werden. Er ist stets der Erste in der Firma, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass er dort nicht viel macht. Alle Veränderungen des Unternehmens lasten auf meinen Schultern.
»Jolie«, meine ich, während ich meine Manschettenknöpfe richte. Sie schaut überrascht von ihrer Arbeit auf. Ich spreche sie selten an oder schenke ihr Aufmerksamkeit.
Ich bin sicher, das hätte ich getan, als sie jünger war. Sie ist wohl nach wie vor eine attraktive Frau, wenn sie nur nicht so dünn wäre und so verhärmt aussähe. Sie ist groß, mit gekräuselten blonden Haaren, die sich nie bändigen zu lassen scheinen, obwohl sie zurückgebunden werden. Ihre Augen wechseln ständig zwischen unheimlicher Ausdruckslosigkeit und reiner Furcht, als könnte sie sich nicht entscheiden, in welchem Zustand sie leben will.
»Ja, Monsieur Dumont?«, sagt sie aufhorchend.
»Pascal«, erwidere ich. Ich hasse es, Monsieur Dumont genannt zu werden.
Sie nickt nur kurz und wartet darauf, dass ich weiterspreche.
»Ich habe gehört, Ihre Tochter ist wieder in Paris«, sage ich.
Ein angespanntes Lächeln erscheint auf ihrem Gesicht. »Ja, das ist sie.«
»Ist sie hier, um zu arbeiten? Denn ich habe vielleicht einen Job für sie.«
Ihre Miene verändert sich nicht. Vielleicht hat sie darauf gewartet, dass jemand fragt, oder meine Mutter hat schon etwas zu ihr gesagt.
»Ich kann nicht für sie sprechen, aber ich glaube, das wäre wunderbar«, erwidert sie.
Ich nicke und schaue in mein Handy, wie mein Terminplan aussieht. »Wo wohnt sie? Kann sie morgen Mittag zu Dumont kommen?«
»Ich glaube, sie wohnt im Hotel.« Sie macht eine Pause. »Sie hielt es für unangebracht, bei mir im Gästehaus zu wohnen. Ich kann ihr eine Nachricht schicken und sie informieren. Morgen Mittag in Ihrem Büro.«
»Tun Sie das. Danke.«
Danach steige ich in meinen Audi und fahre zur Arbeit. Der Verkehr kann höllisch sein, und wir leben ein wenig außerhalb von Paris. Aber ich habe nichts gegen die Zeit allein im Wagen, in der ich nachdenken kann.
Natürlich fällt mir der Brief wieder ein.
Und ich muss an meinen Vater denken.
Und an das, was Blaise gestern Abend gesagt hat.
Wie lebt es sich im Haus des Schreckens, in dem Wissen, wozu Vater fähig ist? Wie kommt dein Gewissen damit klar?
Die Wahrheit lautet: Ich verdränge es. Auf diese Weise komme ich damit klar. Damit schafft man es durch alles im Leben, egal, wie schrecklich, unmoralisch oder entsetzlich es ist. Denk einfach nicht daran.
Tu so, als existiere es nicht.
Tu so, als gäbe es keine Wahrheit.
Und doch … irgendetwas regt sich in mir. Vielleicht ist es die Wahrheit. Vielleicht ist es die Erkenntnis, dass, je mehr Tage verstreichen und je enger ich mit meinem Vater zusammenarbeite, ich umso mehr wie er werde.
Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich mir nicht sicher, ob ich das will.
Zugleich kann ich mir nicht vorstellen, wie jemand anderes zu werden.
Bei Dumont angekommen, stürze ich mich ins tägliche Getümmel. Ludovics Tod liegt bald ein Jahr zurück, und obwohl alle Mitarbeiter neu sind – mit Ausnahme von Nadia, der Rezeptionistin –, hat es so lange gedauert, bis die Firma wieder Fahrt aufgenommen hat. In gewisser Hinsicht ist es wahr: Ludovic wurde verehrt und bewundert für sein Festhalten an moralischen und ideellen Werten, wenn es um das Label Dumont ging. Er war gegen die Zusammenarbeit mit Künstlern, gegen einen Onlineshop, gegen Sale. Er hielt um jeden Preis an der Tradition fest.
Als mein Vater und ich die Firma übernehmen konnten, änderten wir alles. Wir bauten das Unternehmen komplett um, damit es in diesem Jahrhundert konkurrenzfähig ist. Ludovics Beharrlichkeit und altmodische Neigungen mochten ja ganz nett gewesen sein, aber nun konnten wir die Marke endlich auf das nächste Level bringen.
Die Verkaufszahlen steigen, insgesamt und in jedem einzelnem Bereich. Sicher, ich weiß, dass wir mit unserem Sale zweimal pro Jahr einen Treffer gelandet haben. Eine eingeschworene Dumont-Gemeinde hat sich zwar beklagt, wir seien nicht mehr so exklusiv wie früher. Einige behaupten, wir hätten uns verkauft.
Aber Ausverkäufe bringen Geld, und letztlich ist das alles, was für unsere Familie zählt. Geld ist unser Vermächtnis. Gier ist unsere Stärke.
Und ich bin wirklich ausgezeichnet darin zu bekommen, was ich will.
Momentan will ich eine neue Angestellte, und deshalb werde ich auch ein bisschen ungehalten, als es Mittag wird und Gabrielle nicht auftaucht. Ich schreibe meiner Mutter, dass sie mit Jolie reden soll, und tadele mich dafür, mir nicht selbst Jolies Nummer besorgt zu haben. Nachdem ich erfahren habe, wo Gabrielle wohnt, verlasse ich die Firma.
Natürlich besteht durchaus die Chance, dass sie unterwegs ist und sich nur verspätet hat, aber meine Textnachricht erreicht sie nicht (vielleicht weil sie noch eine New Yorker Nummer hat). Ich weiß nur, in welchem Hotel sie wohnt.
Überraschenderweise wohnt sie in einem guten Hotel. Nicht das Dumont natürlich, das meinem Cousin Olivier gehört, aber definitiv nicht in einem billigen, wie ich vermutet hätte. Ich dachte, jemand, der zurückkommt, weil er Arbeit braucht, hätte eher kein Geld übrig.
Noch überraschender ist allerdings, dass ich die Dame am Empfang kenne.
Ihr Name fällt mir nicht ein, dafür erinnere ich mich umso besser an ihre sinnlichen Lippen, die mir einen Blowjob geben.
»Pascal«, begrüßt sie mich lächelnd und klimpert mit den falschen Wimpern. »Lange nicht gesehen.«
Rasch werfe ich einen Blick auf ihr Namensschild. »Hallo, Aurelie«, erwidere ich. »Ich muss dich um einen Gefallen bitten.« Ich senke meine Stimme und werfe ihr diesen Blick zu, voller Verheißungen, die ich nie einlösen werde.
»Ein Gefallen?«, fragt sie gut gelaunt. Sie schaut zu den anderen Mitarbeiterinnen an der Rezeption, die versuchen, nicht auf uns zu achten. Oder, besser gesagt, nicht auf mich. Da ich das Gesicht von »Red« bin, dem Herren-Eau-de-Toilette von Dumont, und die Werbung dafür in der ganzen Welt erschienen ist, werde ich entsprechend oft erkannt. Sie beugt sich näher zu mir herüber. »Warum sollte ich dir einen Gefallen tun, wo du mich nie zurückgerufen hast?«
Hoppla.
Ich grinse sie an. »Du kannst mir doch nicht übelnehmen, dass ich so viel um die Ohren hatte.«
Sie richtet sich auf und schürzt die Lippen. »Hmmm.«
Vielleicht wird es doch schwieriger, als ich dachte.
Zum Glück verstehe ich mich auf Verhandlungen.
»Was hältst du davon, wenn ich dich Freitagabend zum Essen einlade?«, schlage ich vor. »Du darfst das Restaurant aussuchen.«
Ihre Miene hellt sich auf, und ich fahre fort: »Ich wette, du bekommst hier besondere Konditionen, aber der Ort, an dem ich dich verwöhnen werde, wird diesen Laden wie eine Jugendherberge aussehen lassen.«
Bei diesen Worten weiten sich ihre Augen, und sie beißt sich auf diese sinnlichen Lippen. Prompt meldet sich meine Erektion zurück und drückt gegen die Vorderseite meiner Anzughose. Ich brauche wirklich dringend Sex.
Ich kann das Gemurmel der Angestellten und Gäste hören, denen meine Bemerkung offenbar nicht entgangen ist, aber das ist mir egal. Ich setze mein charmantes Lächeln auch für sie auf.
Alle wenden den Blick ab, errötend, und ich sehe Aurelie erwartungsvoll an. »Wie steht’s mit dem Gefallen?« Sie schluckt hart und nickt. Ich beuge mich zu ihr. »Ihr habt einen Gast hier, Gabrielle Caron«, flüstere ich ihr ins Ohr. »Ich muss wissen, in welchem Zimmer sie wohnt.«
Sie versteift sich und weicht mit einem Ausdruck von Eifersucht in den Augen zurück.
»Keine Sorge, sie ist eine ehemalige Angestellte«, stelle ich klar. »Sie ist hier, um ihre Mutter zu besuchen.«
»Eine Hausangestellte, und sie wohnt hier?«, fragt sie leise und runzelt ungläubig die Stirn.
Ich zucke mit den Schultern. »Vielleicht putzt sie als Gegenleistung die Zimmer. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe heute einen Termin mit ihr, nur ist sie nicht aufgetaucht. Sie geht auch nicht ans Handy. Wenn du also …«
Aurelie scheint einen Augenblick zu überlegen, dann nickt sie. »Okay. Aber ich könnte Ärger bekommen.«
Wieder beuge ich mich über den Tresen und berühre ihr Ohrläppchen mit meinen Lippen. Sie schmeckt nach Vanille, und wenn ich mich recht entsinne, mochte sie den Sex schlicht. Na ja.
»Es wird sich für dich lohnen.«
Sie atmet bebend aus und sucht in ihrem Computer nach Gabrielle. »Zimmer 512«, sagt sie leise.
»Danke.«
»Und das Essen?«, fragt sie.
»Ich rufe dich an«, verspreche ich, dann eile ich durch die weitläufige Lobby zu den Fahrstühlen. Wahrscheinlich werde ich mein Wort halten, bis Freitag sind es allerdings noch ein paar Tage, und ich muss dringend vorher jemanden vögeln.
Ich fange an, über Gabrielle nachzudenken. Sie müsste inzwischen fünfundzwanzig sein. In meiner Erinnerung sehe ich sie allerdings nur als Elfjährige. Obwohl sie ungefähr achtzehn gewesen sein muss, als sie fortging, ist sie für mich völlig unscheinbar geblieben.
Ich fahre in das Stockwerk, finde ihr Zimmer, klopfe an.
Ich warte.
Höre nichts.
Klopfe erneut an ihre Tür.
Presse mein Ohr daran.
Aus irgendeinem Grund sehe ich dieses verrückte Bild von einem Zimmer voller Blut, mit einer Leiche am Boden, die blonden Haare aufgefächert.
Die Tür wird einen Spaltbreit geöffnet, so weit, wie die Kette reicht.
Die größten und intensivsten blauen Augen sehen mich an. Mit einer solchen Wildheit, dass ich für einen Moment völlig perplex bin. Ich habe vergessen, warum ich hier bin und wo ich bin.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt sie, und mir wird allmählich klar, dass es sich weder um eine Nymphe oder Märchenprinzessin mit wallenden blonden Haaren handelt, sondern um Gabrielle.
Sie muss es sein.
»Gabrielle?«, frage ich also.
»Pascal Dumont«, stellt sie kühl fest und mustert mich von Kopf bis Fuß. »Was machen Sie hier?«
Ich stutze. »Nun, wir hatten eine Verabredung, und da Sie nicht aufgetaucht sind, habe ich beschlossen, Sie aufzuspüren.«
Sie kneift die Augen ein bisschen zusammen, gerade genug, um den Bann zu brechen. Ich schwöre, sie hypnotisierte mich. »Stalken Sie Leute zum Vergnügen? Was, wenn ich nicht aufgespürt werden wollte?«
Verständnislos schaue ich sie an. »Entschuldigung? Wir hatten einen Termin.«
»Nein«, erwidert sie kühl. »Sie haben versucht, über meine Mutter einen Termin zu vereinbaren, die natürlich in meinem Namen zugesagt hat. Die Wahrheit aber ist, ich mag Sie nicht und hege nicht den Wunsch, für Sie oder die Dumonts zu arbeiten, egal in welcher Funktion. Schönen Tag noch.«
Dann knallt sie mir die Tür vor der Nase zu.
KAPITEL ZWEI
KAPITEL ZWEI
Pascal
Ich starre die Tür an. Frauen haben mir schon öfter die Tür vor der Nase zugeschlagen, aber diesmal fühlt es sich anders an. Zum einen sollte es eine berufliche Begegnung sein, nur dass es sich stattdessen privat anfühlt. Und zum anderen war sie gar nicht zornig, sondern kühl und ruhig, als stünde ich unter ihr.
Ich – unter einer Hausangestellten! Wie sie auf diese Idee kommt, ist mir schleierhaft. Diese Frau muss wohl daran erinnert werden, wer ich bin!
Ich atme tief durch die Nase ein, versuche mich und mein Ego zu beruhigen und klopfe erneut.
Die Tür wird umgehend geöffnet.
Gabrielle sieht mich mit hochgezogenen Brauen an.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so … anziehend gewesen wäre. Ich weiß nicht einmal, ob sie früher schon das Potenzial, schön zu werden, in sich trug, doch jetzt scheint sie entweder all ihre Eigenschaften voll entwickelt oder enormes Selbstbewusstsein erworben zu haben. Sie besitzt eine absolut faszinierende, beinah übernatürliche Ausstrahlung.
»Sonst noch was?«, fragt sie.
Ich könnte schwören, dass da ein übermütiger Ausdruck in ihren Augen ist, doch das kann reines Wunschdenken von mir sein, denn verdammt, allein ihr Anblick erregt mich.
Ich räuspere mich, versuche das abzuschütteln und konzentriere mich auf die vor mir liegende Aufgabe.
»Ich bin nur ein wenig verwirrt«, sage ich schließlich.
»Ich dachte, die Dumonts sind nie verwirrt«, kontert sie. »Auf diese Weise habt ihr doch euer Imperium errichtet. In dem Glauben, dass ihr recht habt, koste es, was es wolle.«
Worauf, zur Hölle, will sie hinaus?
»Wollen Sie den Job oder nicht?«, platze ich heraus, seltsam beunruhigt.
Sie verkneift sich ein Lächeln. »Nein. Ich dachte, das sei klar, als ich abgelehnt und anschließend die Tür zugemacht habe. Und das werde ich gleich wieder tun …«
Sie fängt an, die Tür zu schließen, aber ich stelle meinen Fuß dazwischen.
»Ich will doch nur einen Moment mit Ihnen reden«, erkläre ich und zwänge meine Schulter in den Türspalt. Mir ist klar, dass bitten wohl nicht hilft – so wenig wie bei mir –, daher wechsle ich die Taktik. »Sie hätten heute Morgen mal das Gesicht Ihrer Mutter sehen sollen, als ich sie nach Ihnen gefragt habe. Ihr Gesicht hellte sich auf, und sie schien so glücklich bei der Vorstellung, Sie könnten wieder mit ihr zusammenarbeiten.«
Ich betrachte ihr Gesicht genau und registriere die geringsten Emotionen in ihren Augen. Zuerst erkenne ich Schuld oder Scham, doch dann erscheint ein bitterer oder harter Ausdruck darin. Nicht gerade das, worauf ich abgezielt habe.
»Es geht hier nicht um sie«, erklärt sie knapp und reckt das Kinn vor.
»Um was geht es dann? Warum sind Sie wieder hier? Wenn Sie nicht für mich arbeiten wollen, schön. Aber Sie haben mal mit mir zusammengelebt, also was ist verkehrt daran, sich ein bisschen über alte Zeiten auszutauschen?«
Sie lacht unvermittelt. »Sie nehmen mich auf den Arm! Erstens habe ich nie mit Ihnen zusammengelebt, Pascal. Ich habe mit meiner Mutter in der Angestelltenunterkunft gewohnt.«
»Es handelt sich um ein Gästehaus«, unterbreche ich sie, »noch dazu ein sehr schönes. Und weil es das Gästehaus meiner Familie ist und Sie in meinem Haus verkehrten, bedeutet das, Sie haben mit mir zusammengelebt.«
»Sie haben mir nie die geringste Beachtung geschenkt. Sie haben mich wie alle Ihre Angestellten behandelt oder wie diejenigen, die Sie als unter Ihnen stehend betrachteten, wozu so ziemlich jeder zählt.«
»Ich fühle mich beleidigt«, beklage ich mich augenzwinkernd.
»Oh, na klar! Sie sind wohl eher stolz darauf.«
»Das entspräche nicht meinem Ruf.«
»Das ist eine weitere Sache, auf die Sie stolz sind«, entgegnet sie scharf. »Ihr Ruf! Sie sind arrogant, frauenfeindlich, sexbesessen, eitel, gierig, unmoralisch und nicht ganz bei Trost.«
»Nicht ganz bei Trost?«, wiederhole ich und bemühe mich, nicht die Augen zu verdrehen. »Glauben Sie bloß nicht alles, was Sie hören!«
»Wenn Sie denken, ich habe das aus den Boulevardblättern, irren Sie sich. Ich kenne Sie. Ich habe es selbst erlebt.«
»Ich dachte, wir hätten nicht zusammengewohnt.«
»Es war nah genug. Man lernt viel mehr über jemanden, wenn man hinter ihm aufräumen muss. Und das genügt mir, um zu wissen, dass ich nicht für Sie arbeiten will.«
Verdammt. Sie ist stur und streitlustig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so gewesen ist, als sie jünger war, aber ich muss gestehen, es gefällt mir.
»Und was ist die zweite Sache?«, frage ich.
»Die zweite Sache?«
»Sie meinten, zum einen hätten Sie nie mit mir zusammengelebt. Was eine eigenwillige Interpretation der Wahrheit Ihrerseits ist, aber darüber können wir hinwegsehen. Was ist der andere Punkt?«
Ich habe sie wohl überrascht, denn sie scheint zu überlegen. »Sie sind nicht der Typ, der sich mit irgendwem über alte Zeiten austauscht«, sagt sie schließlich.
»Nein?« Ich hebe die Hand. »Ich glaube, Sie haben mich gerade eitel genannt, arrogant, sexbesessen, gierig, unmoralisch und … wie haben Sie es formuliert? Nicht ganz bei Trost?«
»Vergessen Sie frauenfeindlich nicht.«
»Wie kommen Sie denn eigentlich darauf?«
»Hängt mit der Sexbesessenheit zusammen«, erwidert sie trocken. »Mal ganz abgesehen davon, dass Sie meine Tür blockieren.«
»Zum Glück liegt ja noch die Kette vor.«
Sie kneift die Augen zusammen. »Drohen Sie mir etwa?«
Ich nähere mich ihr, soweit ich kann. Immerhin weicht sie nicht zurück, das muss ich ihr lassen. »Oh, nein, meine kleine Elfe, ich drohe nur selten. Ich tue, was getan werden muss. Warum soll ich Sie vorwarnen und mich um das Überraschungsmoment bringen?« Ich grinse, bis sie den Blick abwendet. »Wie dem auch sei, Sie haben mir vieles zugeschrieben, doch Sie halten mich nicht für den Typ Mann, der sich über frühere Zeiten austauscht. Und? Wollen wir?«
Sie zieht die Augenbrauen hoch. »Wollen wir was?«
»Lassen Sie sich zum Lunch einladen«, schlage ich vor. »Dann können wir uns unterhalten. Über früher. Ich habe Sie seit Jahren nicht gesehen.«
Sie gibt einen spöttischen Laut von sich und schüttelt leicht den Kopf, wobei sie meinem Blick nach wie vor ausweicht. »Sie tun so, als hätten wir eine gemeinsame Vergangenheit. Haben wir aber nicht. Ich war eine Angestellte, und Sie waren der verwöhnte reiche Sohn.«
»Wir waren zwei verwöhnte reiche Söhne.«
»Tja, aber Sie waren schlimm.« Sie macht eine Pause und sieht kurz zu mir her. »Fast so schlimm wie er.«
Anspannung erfasst mich, und ich bekomme plötzlich feuchte Handflächen. »Fast so schlimm wie wer?«
Sie winkt ab. »Was passiert, wenn ich nicht mit Ihnen zu Mittag esse?«
»Ich werde nicht lockerlassen.«
»Sie sind mittlerweile der Chef von Dumont, daher bezweifle ich, dass Sie Zeit dafür haben.«
»Ich würde es einrichten. Ich kümmere mich immer um das, was wichtig ist.«
»Es macht Ihnen Spaß, so penetrant zu sein.«
Ich ziehe eine Schulter hoch. »Ach, was soll ich sagen? Ich mag die Jagd, und ich denke, dass die meisten Frauen an mir interessiert sind.«
»Wenn ich mit Ihnen essen gehe, lassen Sie mich dann in Ruhe?«
Ich grinse. »Versprochen.«
Vermutlich weiß sie, was sie von meinen Versprechungen halten kann.
Sie neigt den Kopf zur Seite, sodass ihr die blonden Haare ins Gesicht fallen. Es reizt mich, sie hinter ihr Ohr zu streichen, aber dann würde sie wohl die Tür zuknallen.
»Okay.«
»Okay«, wiederhole ich. »Soll ich hier oder unten in der Lobby warten?«
»Sie meinen jetzt?«, fragt sie verblüfft.
»Ja, jetzt«, antworte ich nickend. »Sie sehen großartig aus. Schnappen Sie sich Ihre Handtasche, und auf geht’s.«
Seufzend schließt sie die Tür. »Geben Sie mir eine Minute.«
Ich lehne mich an die Wand des Flurs und frage mich, ob sie mich hereingelegt hat, aber dann höre ich schon die Kette, und die Tür geht auf.
Gabrielle tritt heraus.