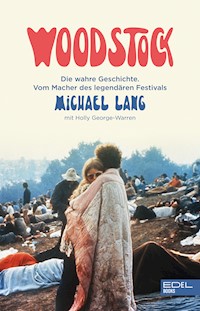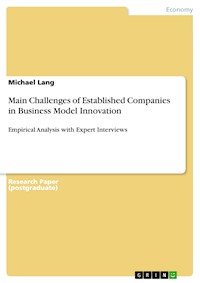Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Odenwald-Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Idylle des lieblichen Tales der Gersprenz wird gestört: Ein spektakulärer Fund in der Reichelsheimer Kelterei Kabel ruft Kriminalhauptkommissar Karl Kunkelmann und seinen Kollegen Heiner Ehrenreich auf den Plan. Steckt ein perfider Mord dahinter? Hängt der Fall mit der mysteriösen Erkrankung einiger Rinder in diesem Landstrich zusammen? Fragen, die Kunkelmann schlaflose Nächte bereiten. Doch eine Lösung scheint in weiter Ferne. Bis in die österreichischen Alpen strecken die Ermittler ihre Fühler aus, um auf die Spur des Täters zu kommen. Auch in seinen zweiten Kriminalroman packt Michael Lang knisternde Spannung, schaut in die Seele des Odenwalds und beschreibt dessen Bevölkerung mit beeindruckendem Scharfsinn. Der Autor würzt seine packende Geschichte mit der aus seinem ersten Krimi "Der Seelensammler vom Odenwald" bekannten Schrulligkeit des ermittelnden Kommissars, einem hintergründigen Humor und einem deutlichen Fingerzeig auf negative Auswüchse unserer Gesellschaft. Witzig, fesselnd und lebensklug.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Lang
Der Apfelweinfürst vom Odenwald
Kriminalroman
eISBN 978-3-948987-92-3
Copyright © 2023 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Olaf Tischer
Cover-Motiv: © Michael Lang
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Vorbemerkung
Dies ist ein Roman, alle Figuren sowie die komplette Handlung sind frei erfunden und der Fantasie des Autors entsprungen. Sollten Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen bestehen, ist dies entweder Zufall oder Absicht.
Mittlerweile ist das Dosenpfand bei uns angekommen und damit der Müll beträchtlich weniger geworden. Natürlich sind durch zerkleinerte Dosen im Tierfutter schon vereinzelt Nutztiere in Deutschland zu Schaden gekommen. Das kann man nachlesen. Im Odenwald jedoch sind mir solche Fälle nicht bekannt. Die gehäckselten Dosen waren aber ein guter Aufhänger für die vorliegende Geschichte. Diese ist ein Lokalkrimi, möchte als reine Fiktion die Leserinnen und Leser unterhalten und niemanden brüskieren. Fazit: Man muss nicht alles glauben, was man liest.
Um sämtliche Zusammenhänge lückenlos einordnen zu können, ist es zwar nicht zwangsweise notwendig das Buch „Der Seelensammler vom Odenwald“ aus demselben Verlag zu lesen, doch es erleichtert die Sache ungemein. Man beachte außerdem die Erkenntnis aus dem Deutschunterricht: „Der Autor ist nicht der Erzähler!“
Michael Lang, Michelstadt, den 10.6.2023
Autor
Michael Lang, 1962 geboren, lebt im Odenwald. Der Germanist und gelernte Deutschlehrer schreibt für mehrere Zeitungen und betreut die Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Roten Kreuzes in der Region.
Veröffentlichungen: „Wunderplunder“ (humorvolle Gedichte im Selbstverlag). „Neues aus der Schwatzhaft“ (Glossen aus dem Odenwälder Echo). „Der Seelensammler vom Odenwald“ (Kriminalroman, mainbook Verlag, 2020).
„Wir sehen in anderen Menschen nicht Mitmenschen, sondern Nebenmenschen. Das ist der Fehler.“
(Albert Schweitzer)
„Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt.“
(Mark Twain)
Für meine liebe Frau Sylvia, die keine Krimis mag.
Inhalt
Vorbemerkung
Autor
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Epilog
Dankeschön
Prolog
Manchmal schrie sie wie von Sinnen. Weit aufgerissene Augen und ein panischer Blick, als sehe sie gerade den Leibhaftigen. Dann wieder schien Linda in stoischer Apathie zu versinken. Sie nahm kaum noch etwas zu sich und wurde immer schwächer. Nur zögerlich bediente sie sich an der reichen Palette des Angebotes. Alle Varianten einer stützenden Ernährung hatte er ihr gebracht. Heu, Mais, den Mix aus proteinreichem Getreide. Doch Lindas Zustand verschlechterte sich zusehends. Klee und frisches Gras verschmähte sie vollkommen. Auch bei der Wasseraufnahme verhielt sie sich zögerlich, das Wiederkäuen hatte sie eingestellt. Zudem hatte sie massiv abgenommen und ihre Milchproduktion ließ nach. Er machte sich große Sorgen.
Linda war die beste Kuh im Stall von Bauer Hans Vierheller aus Beerfurth. Auf dem jährlichen Viehmarkt in Beerfelden hatte sie ihrem Besitzer stets satte Preise eingefahren, an der Wohnzimmerwand reihten sich die Medaillen. Sie war eine echte Holsteinerin, schwarz-bunt gescheckt, großrahmig und zirka 650 Kilogramm schwer. Hinzu kamen die ästhetischen Werte, denn Linda hatte ein Gesicht wie gemalt und für ein Rindvieh einen eleganten Gang. Eine ganze Zeit lang war ihr Konterfei das oft bewunderte Werbefoto auf den Milchtüten, Käseschachteln und Joghurtbechern der lokalen Molkerei gewesen. Sie konnte eben Eindruck schinden und war Hans Vierheller ans Herz gewachsen.
Auch heute machte er sich Sorgen. Der trübe Blick und die schnelle Atmung ließen ihm keine Ruhe. Er bestellte den Tierarzt auf den Hof. Mit Peter Röder war er gemeinsam zur Schule gegangen, doch sie kannten sich bereits vom Kindergarten. Er erreichte den Veterinär auf dem Handy und dieser sicherte ihm zu, sich sofort auf den Weg zu machen. Nach einer halben Stunde, die Vierheller zwischen Bangen und Hoffen wie ein halber Tag vorgekommen war, hörte er, wie sich der alte VW-Bus des Freundes die steile Anfahrt zum Aussiedlerhof hinaufquälte. Peter Röder war wie immer unrasiert, die lederne Joppe schlenkerte um die schmalen Schultern und die Füße steckten in Gummistiefeln.
Der Mann war bei den Landwirten zu Hause, mit erkälteten Kanarienvögeln und depressiven Fischen konnte er nichts anfangen. Schon während des Studiums wusste er, dass sein Fachgebiet das Großvieh der regionalen Bauern sein würde. Viele Kollegen scheuten diesen Schritt, denn man wusste ja nie genau, wann ein Pferd Koliken entwickelte oder eine Kuh sich entschloss zu kalben. Meistens war dies nachts der Fall. Außerdem war die Arbeit mit Rindern und Gäulen oft mit Anstrengung verbunden. Nicht jeder konnte oder wollte seinen Arm bis zur Schulter in der Vulva einer Kuh versenken. Dann doch lieber Katzen impfen und den Zwergkaninchen die Krallen schneiden.
„Was hat denn die Gute?“, fragte der Mediziner mit beruhigendem Lächeln und einem begleitenden Klaps auf Vierhellers Schultern.
„Das wirst du hoffentlich gleich herausfinden. Mir schwirrt bereits der Kopf. Die Linda frisst nix mehr, säuft kaum und ist auffallend unruhig, dann wieder vollkommen apathisch.“
„Komm, lass uns mal gucken gehen“, sprach der Doktor und drückte seinen Schulfreund sanft vorwärts. Linda stand zitternd in ihrem Stall. Zärtlich kraulte der Arzt die Stirn seiner Patientin und redete beruhigend auf sie ein. Dann bat er Hans ihren Schwanz hochzuhalten, damit er rektal Fieber messen konnte. Sanft führte er das zuvor mit Gleitgel behandelte Thermometer in Lindas After ein. „In dieser Hinsicht nichts Besonderes. Die Normalwerte liegen zwischen 38,3 und 38,5 Grad. Linda ist leicht drüber. 38,9 zeigt mir das Teil an. Aber irgendwie ist die Kuh symptomatisch. Da hast du recht. Mir gefällt das nicht.“ Röder setzte das Stethoskop in Herzhöhe auf und sagte: „Erhöhte Frequenz. Das Tier hat Stress. Warte mal.“ Jetzt wanderte das Hörrohr Richtung Magen. „Die Verdauungsgeräusche lassen auf nichts Besorgniserregendes schließen. Das typische Gurgeln ohne längere Pausen. Das passt aber nicht zu Lindas Zustand. Ich nehme mir jetzt den Darm vor.“
Röder griff in seine Arzttasche und holte einen der armlangen Handschuhe hervor, den er mit Gleitgel einrieb. Auf den üblicherweise benutzten frischen Kuhdung verzichtete er, um das Ergebnis besser beurteilen zu können. Während Vierheller der Kuh den Kopf tätschelte, schob der Tierarzt die rechte Hand ganz langsam in Lindas Anus. Konzentriert arbeitete er sich bis zum Ellbogen vor und befühlte die Innenwand des Enddarmes, doch er konnte keinen alarmierenden Tastbefund feststellen. Als er den Arm mit dem Handschuh langsam zurückzog, betrachtete er diesen genau. Unter den üblichen Anhaftungen von Kot waren rötlich durchzogene Schleimspuren zu erkennen. Der Arzt überlegte. Dann bückte er sich, zerrieb ein wenig von Lindas letzter Hinterlassenschaft zwischen Daumen und Zeigefinger und stutze.
„Was ist?“, fragte Hans Vierheller.
„Siehst du diese kleinen Splitter da auf meiner Hand?“
„Ja, sind das unverdaute Reste von mitgefressenen Wurzelresten?“
„Nein, das ist Metall.“
1
Die Kelterei Kabel in Reichelsheim wurde bereits 1844 gegründet. Johann Kabel, der erste Arbeitgeber in der Apfelwein-Dynastie der Familie, war stolz darauf, im Jahr des Aufstandes der Weber und der darauf folgenden Revolution angefangen zu haben. In den Büroräumen des Betriebes prangte die Kopie eines Briefes, der von seiner Bekanntschaft mit Ludwig Bogen, dem Kopf der Revoluzzer aus dem Odenwald, zeugte. Denn auch der alte Kelterer Kabel war demokratisch eingestellt, wetterte über den geografischen Flickenteppich und sprach sich öffentlich für ein geeintes Deutschland aus. Die Tradition der Toleranz hatte sich unter seinen Nachkommen fortgesetzt und Mitbestimmung war einer der hochgehaltenen Werte im Unternehmen.
Dieses wurde mittlerweile in der vierten Generation von Gerhard Kabel und dessen Frau Anette geführt. Viele schmerzhafte Investitionen erlaubten es dem Unternehmer, auch die dürren Zeiten durchzustehen, ohne Entlassungen vornehmen zu müssen. Denn gerade in den frühen 1990er Jahren war Apfelwein als Getränk der Bauern ein wenig verpönt. Man verbannte die Bembel in die Küchenschränke oder nutzte sie als schmucke Blumenvasen. Auch die braunen Literflaschen verzeichneten einen Rückgang. Bier hatte den heimischen Most abgelöst. Jetzt mussten neue Strategien her.
Kabel, der vor der Übernahme des elterlichen Betriebs eine solide Lehre beim ortsansässigen Gastronomen und Spitzenkoch Armin Keusch abgeschlossen hatte, hatte die Idee seines ehemaligen Chefs aufgegriffen, der durch seine Kreativität bekannt war und mit sortenreinen Apfelweinen experimentierte. „Warum sollte der Apfel in seiner Verwendung nicht mit der Traube gleichgestellt werden? Bei den Winzern klappt es schon seit Jahrtausenden, aus einer Rebsorte ein geschmackvolles Getränk herzustellen!“, belehrte er die Kollegen und wurde anfangs leise belächelt. Die Maische für Apfelwein müsse aus gut durchmischten Sorten bestehen. Boskoop, Schafsnase und Bohnäpfel seien die besten, denn für den erwünschten herben Geschmack komme es auf die Säure an, bekam er zu hören. Doch der Gastronom widersprach: „Wer weiß denn, ob sortenreine Erzeugnisse nicht schmecken? Es hat ja noch niemand probiert!“ Die Erfahrungen gaben ihm recht. Mittlerweile servierte er zum feinen Menü erfolgreich sanfte Weine aus Champagner-Renette oder Goldparmäne.
Hier sah Gerhard Kabel seinen Weg, um dem Dilemma mit den schwindenden Absätzen zu entkommen. In Rundbriefen bat er die Landwirte auch sortenreine Lieferungen zu bringen und versprach dafür eine etwas bessere Entlohnung. „Wer Erfolg haben will, muss erstmal in die eigene Tasche greifen“, war sein Wahlspruch. Über dem Einfahrtstor zur Kelterei versprach das große Transparent: „Ein guter Schoppen lässt sich nicht stoppen!“ Natürlich musste man Konzessionen machen, Kompromisse eingehen und die Gewohnheiten einer modernen Zeit respektieren. Ausschließlich mit dem herben Apfelwein als Begleiter zu Handkäs mit Musik ließ sich kein Staat mehr machen. Der Handkäs wurde bei der Jugend vom Burger abgelöst und die Musik mied man sowieso, da der Zwiebelgeruch und die entstehenden Darmgase mit heftigen Reaktionen in der Partnerschaft verbunden waren.
Nun setzten Kabels auf milden Sortenreinen, fügten dem aus gemischten Äpfeln bestehenden Wein Cola oder Kirschsaft hinzu und konnten so ihren Betrieb aufrechterhalten. Fesche Jungs und Mädels auf den Etiketten lösten den prostenden Bauern in der Lodenjoppe ab. Apfelwein 2.0 hatte einen richtigen Lauf, auch wenn diese Mixturen die Geschmacksnerven ihres Herstellers schwer beleidigten. „Was sein muss, muss sein“, gestand sich Gerhard Kabel schweren Herzens ein. Das Konzept funktionierte. Sukzessive erweiterte er seinen Betrieb, modernisierte die Abfüllanlage, installierte ein weiteres Sortierband und stellte einen dritten großen Edelstahltank für die Lagerung des Rohsaftes auf. Auch die alte Waage für die Apfelannahme wurde durch eine größere, ebenerdige ersetzt. Dies erleichterte den Bauern die Anlieferung. Bald kam noch eine neue Kühlhalle hinzu. Die knappen Überschüsse spendete die Kelterei für ökologische Projekte zur Erhaltung der Streuobstwiesen in der Region. Dieses Jahr war ein gutes Jahr. Die Ernte florierte und die Traktoren standen vor dem Tor fast täglich Schlange. Gerhard Kabel atmete die frische Herbstluft ein und begab sich zum Freilager für die Äpfel, um einen Blick auf den Füllstand zu werfen.
2
Mittlerweile hörte man auch von den umliegenden Höfen, dass Kühe im Stall erkrankt waren und mit ähnlichen Symptomen kämpften wie Linda von Hans Vierheller. Im nahen Reinheim, das zum Landkreis Darmstadt-Dieburg zählte, hatte es einen Landwirt besonders hart getroffen. Ihm waren zwei Kühe eingegangen. Auch hier hatte man zuvor Metallsplitter im Verdauungstrakt nachgewiesen und versucht, diesem Zustand mit dem Einbringen von Magneten habhaft zu werden. Manchmal kam es vor, dass Kühe kleine Nägel oder sonstige sich auf der Weide befindlichen Eisenteilchen verschluckten. Mit dieser Methode hatten die Tierärzte, oder in schlimmen Fällen die Kliniken, manchmal Erfolg. Letzteres kam jedoch kaum infrage, da sich die Rechnungen exorbitant gestalteten.
Rinder waren das Kapital der Landwirte und man musste dreimal überlegen, welchen Weg man einschlagen wollte. So pflasterte manch Verlust den Weg der eh schon durch die niedrigen Milchpreise geschlagenen Bauern. Viele hatten bereits auf den Anbau von Futtermitteln umgestellt, im Vollerwerb wirtschaftete kaum einer mehr. Ein Zubrot erbrachte die Anstellung bei einem nahen Zulieferer der Automobilbranche oder man fuhr zu Merck nach Darmstadt. Dort wurden auch für Ungelernte annehmliche Gehälter gezahlt und man war unabhängiger von den darbenden Einnahmen des heimatlichen Hofes in den an Landwirten langsam ausblutenden Dörfern des Odenwaldes.
Direktvermarktung hin und her, reich wurde mit der ehrbaren Scholle niemand. In den Rindermägen wurden immer häufiger Metallsplitter gefunden, gegen die auch ein noch so starker Magnet keine Chance hatte. Denn Aluminium blieb an ihnen nicht haften. So wurde dieses Thema zum richtigen Problem und auf den monatlichen Versammlungen der Kollegen im Brensbacher Gasthaus „Zum Ochsen“ heftig diskutiert:
„Das hängt alles mit dem gnadenlos vorangetriebenen Odenwald-Tourismus zusammen. Die Damen dieser Gesellschaft aus Michelstadt verbiegen sich doch förmlich, um auch noch den letzten Mohikaner hier in die Gegend zu bekommen. Ob digital oder analog, unser Landstrich muss auf Gedeih und Verderb vermarktet werden. Koste es, was es wolle. Rücksichtnahme auf die Natur ist denen ein Fremdwort. Hinz und Kunz traben durch die Landschaft, belegen mal über ein Wochenende die Hotelbetten und ziehen wieder die Reißleine. Sie merken nämlich, dass der Odenwald weder die Alpen noch das Allgäu ist. Diese Schönfärberei habe ich satt“, monologisierte Herbert Jäger aus Fränkisch-Crumbach und erzeugte ein allgemeines Brummeln im Auditorium.
„Jetzt mach aber mal halblang“, entgegnete Schorsch Eitenmüller aus Brombachtal. „Die lassen ja auch ein bisschen was hier!“
„Ja, ihren Abfall und anderen Schrott“, pflichtete der Bio-Bauer und gelernte Metzger Fritz Hubinger aus Böllstein diesem bei.
„Wie seid ihr denn drauf?“, fragte Hans Vierheller.
„Würdest du mit offenen Augen über deine Wiesen und Weiden gehen, würdest du merken, dass im hohen Gras immer häufiger Dosen zu finden sind. Die Mähwerke unserer Schlepper können die natürlich nicht erkennen und zerkleinern den Kram mit dem Klee und dem Gras. Ist das Futter dann zu Ballen gepresst, hat man keine Chance das Zeug zu finden. Bis es dann unseren Rindern die Mägen aufreißt und die Därme aufschlitzt“, holte Hubinger aus und öffnete die rechte Hand.
In dieser befanden sich Späne und Splitter von Alu-Dosen, die er in den letzten Wochen auf seinem Land gesammelt hatte. „Alles Dreck dieser verwanzten Touristen und der ach so netten Dorfjugend, die ihren Abfall über die Seitenscheibe des Autos entsorgt und munter in unsere Felder pfeffert. Feine Herren, sage ich da nur!“
„Die Damen nicht vergessen oder Herr*innen mit kurzer Sprechpause zwischen erster und zweiter Silbe. Ohne brav zu gendern, machst du dich angreifbar“, flachste Erich, der Wirt, der gerade eine neues Tablett mit Bieren brachte.
„Ach, hör auf. Zum Scherzen ist dieser Missstand wirklich nicht“, klagte der momentane Wortführer der Diskussion.
Hans Vierheller wurde hellhörig. In seinem Kopf sammelten sich Überlegungen, die eine für ihn noch nicht greifbare, aber mögliche Ursache der Zunahme jener Vorfälle begründen könnten. Kaum wollte er die Gedankenschnipsel fassen, entglitten sie ihm wieder. Plötzlich jedoch schien er die Ursache des Übels zu verstehen. Er zahlte, schnappte sich seine Jacke und verließ den Raum.
3
„Die Zeichen der Zeit werden auch Sie nicht ignorieren können. Es sei denn, Sie planen Ihren betriebswirtschaftlichen Untergang und möchten auf eine Insolvenz zusteuern“, analysierte Alexander Mittenberger von der Firma Aluclever in Gerhard Kabels Büro. „Sie glauben doch wohl nicht, dass Ihr momentaner Erfolg mit den Mixgetränken ein Dauerbrenner sein wird? Ich verspreche Ihnen hier in die Hand, dass Sie in spätestens einem Jahr pleite sind, wenn Sie nicht reagieren. Flaschen sind ein Auslaufmodell. Sie verzeihen das kleine Wortspiel. Heute will keiner mehr Scherben aufkehren. Auch die Rückgabe ist rückläufig. Keiner, außer ein Penner vielleicht, ist auf das Pfand heutzutage angewiesen. Die Gesellschaft wird immer schnelllebiger und bequemer. Zeit ist Geld. Auch für Sie“, insistierte der Vertreter des Unternehmens. „Überdenken Sie unser Angebot. Wir klopfen nicht zweimal an!“
Das mussten sie auch nicht. Gerhard Kabel war von der Idee einigermaßen angetan und übertrug die weiteren Verhandlungen mit Aluclever seinem neuen Geschäftsführer Frank Schneider, einem vorausschauenden und zielorientiert denkenden Angestellten, der schon so manche Schieflage wieder gerichtet hatte. Als studierter Betriebswirt und modern denkender Mensch hatte er das nötige fachliche Fundament und bis dato stets die richtige Nase für wegweisende Entscheidungen bewiesen.
Natürlich war es ein Vorteil, diese Dosen mit den praktischen Aufreißlaschen ins Sortiment zu nehmen. Kein Glasbruch mehr, das geringe Eigengewicht, weniger Kosten für die Spülanlagen der Flaschen und man sparte Wasser. Auch der Umweltgedanke war ins Konzept eingebettet. Zudem war der hervorragende Lichtschutz ein unschlagbares Argument. Gut, man konnte die angefangene Dose nicht wieder verschließen, aber dies animierte nur zum zügigen Austrinken des Gebindes. Der Apfelwein dümpelte nicht mehr über Tage in der Flasche. Die Frische wurde zum Faktor der Vermarktung.
Es sollte die 0,5er Variante werden, denn der Durst der Dorfjugend schloss das 0,33er Döschen von vornherein aus. „Apfelwein gilt von Gesetzes wegen als Wein und die ihn enthaltenden Dosen sind von der Pfandpflicht befreit. Das ist zwar doof, aber kein Desaster“, erläuterte Schneider seinem Chef in den Vorgesprächen. „Es gibt immer etwas, das die Katz nicht frisst. Und in geregelte Vorgaben sollte man nicht zwangsweise eingreifen. In den USA wird schließlich schon seit 1933 Bier in Dosen angeboten. Kompakte Verpackung, leichter Transport. Stöffche zum Stapeln in Steigen, das ist eine prima Sache. Zudem lassen sich die leeren Dosen wunderbar pressen. Klein und fein in den Abfall hinein.“
Aluclever freute sich über den Abschluss und die Maschinen zur Erzeugung der Dosen für den Kelterer aus dem Odenwald liefen heiß. Brav purzelten die Becher in die Kisten. „Die Verträge sind gemacht!“, zitierte Frank Schneider jubilierend aus dem Song von Marius Müller-Westernhagen. Und zum Jubel bestand aller Anlass. Nachdem ein gewiefter Werbetexter den Spruch „Brieh in de Bix“ kreiert hatte, kletterten die Absatzzahlen der Kelterei Kabel gewaltig in die Höhe. Nicht nur der Odenwald schluckte eifrig „Brieh in de Bix“. Bis nach Hamburg, München und Berlin ließen sich die Verkäufe verfolgen. Ja selbst in den USA, in China und in Australien waren die flüssigen Äpfel aus Südhessen zu haben.
Man schrieb eine Erfolgsgeschichte, die in dieser Gegend ihresgleichen suchte. Mehrere Millionen verkaufter Dosen weltweit wiesen die Bilanzen aus. Gerhard Kabel aber blieb bescheiden, denn er wusste aus der Geschichte der Kelterei, wie kurzlebig Erfolg sein konnte und dass alles von den Gewohnheiten der Kunden abhing. Und die konnten sich schnell ändern. Anette bezeichnete ihn als Schwarzmaler, der alles erstmal madig machen müsse. Sie hielt dem Geschäftsführer, der seinen 2CV gegen einen Porsche eingetauscht hatte, stringent die Stange und arbeitete emsig am Fortkommen des prosperierenden Unternehmens mit: „Ein guter Schoppen lässt sich noch toppen!“
4
Vierhellers Weg führte ihn zuerst in den Kuhstall, um einen Blick auf Linda zu werfen. Als ob sie einen bestimmten Punkt an der Wand fixiere, starrte sie vor sich hin, die Beine hielten den schweren Körper aufrecht, zitterten aber ein wenig. Das Bangen um das Tier hatte noch kein Ende. Hoffen und Harren waren die einzigen Maßnahmen, die Hans Vierheller ergreifen konnte. Denn die Kosten für eine Behandlung in der fernen Tierklinik nahe Frankfurt würden die Mittel des Bauern deutlich überschreiten. Auch Peter Röder meinte, dass nun alles vom Schicksal und der Konstitution der Kuh abhinge. Ambulant konnte er dem Tier nicht mehr helfen, seine Möglichkeiten waren erschöpft.
Mit einer Mischung aus Trauer und Wut stapfte Vierheller nun ins Futterlager, riss eine Mistgabel aus der Halterung und begann wie ein Berserker auf die gepressten Heuballen einzustechen. Wie von der Tarantel gestochen, portionierte er das getrocknete Gras in einzelne Häufchen, warf die Gabel zur Seite und begann zu wühlen. Als ob er die Stecknadel im Heuhaufen suche, klaubte er die Büschel auseinander und inspizierte jeden einzelnen davon mit detektivischer Akribie. So ging dies eine gefühlte halbe Stunde, bis er plötzlich stutzte. In seiner Hand hielt er einen Splitter aus Metall, zirka fünf Zentimeter lang und ungemein spitz. Die Ränder des Spanes waren leicht gezackt und gefährlich scharf. Nach weiteren Minuten erwischte er wieder ein paar dieser unsäglichen Teile.
Dann ging er in die kleine Werkstatt nebenan und holte einen Magneten. Nichts tat sich. Er hatte Dosenblech in den Händen, Dosenblech aus Aluminium. Die Gedankenschnipsel aus der Gaststätte formten sich in zusammenhängende, logische Stränge und Vierhellers Geist begann eine Erklärung der unschönen Vorkommnisse im Stall zu stricken. Umgehend rief er Fritz Hubinger in Böllstein an und berichtete von den fatalen Funden im Heu.
„Was hast du denn gedacht? Wäre das Zeug magnetisch, könntest du Material für ungezählte neue Dosen liefern. Ich habe bei mir auch schon vereinzelt solche Teile gefunden, wie ich dir ja im ‚Ochsen‘ gesagt hatte, aber unser Hof liegt etwas weit abseits. In dieser Hinsicht ist dies ein großer Vorteil. Da kommt an den Wochenenden nicht ständig dieses feiernde Volk vorbei und nutzt meine Weiden als Müllkippe. Eine Schande ist das. Wir müssen etwas dagegen unternehmen!“, echauffierte sich der Biobauer.
„Aber was?“, fragte Vierheller kleinlaut.
„Das weiß ich noch nicht, doch diese Zustände müssen ein Ende haben. Sonst verreckt uns noch das komplette Vieh. Und alles nur wegen diesen neokapitalistischen Strukturen eines einzelnen Unternehmers. Hauptsache Profit. Alles andere scheint diese Burschen nicht zu interessieren. Die nachlässige Jugend ist doch nur die Folge dieses Ausbundes an Verantwortungslosigkeit“, tobte der Gesprächspartner.
„Aber die Verwendung von Dosen ist doch nicht verboten. Ich schätze, wir haben da keine Chance. Wir werden mit dieser Entwicklung klarkommen müssen.“
„Nein, das werden wir nicht. Würde per Gesetz endlich ein Pfand auch auf Apfelweindosen erhoben werden, wie dies seit 2006 allgemein üblich ist, bestünde Hoffnung. Schließlich hortet das Partyvolk doch jeden Heller, um am folgenden Wochenende wieder neu loslegen zu können. Wein und Weinmischgetränke mit einem Weinanteil von mindestens 50 Prozent sind aber von der Pfandregel befreit. Das ist doch der Hammer. Wo soll das hinführen? Ich sage es dir: bei unseren Rindern in den sicheren Tod! Und die saubere Kelterei Kabel steht mit in der Verantwortung. Mitgegangen, mitgehangen. Wenn die nur wollten, könnten sie sicher Einfluss nehmen. Aber wie gesagt: Das könnte ja dem Umsatz schaden! Dieser Schneider ist dort die treibende Kraft. Der Gerhard hat nicht mehr viel zu melden, seit sein Geschäftsführer die Fäden in der Kelterei zieht.“
Vierheller verstand und begann zu grübeln. Da hörte er ein ungewöhnliches Geräusch. Schnell drückte er den Biobauern weg und hastete aus dem Haus. Im extra für sie eingerichteten Krankenstall lag Linda. Sie hatte ihr Leben ausgehaucht.
5
Der Raum war nicht groß. Kein ausgewachsener Mann konnte darin stehen, denn es waren vorwiegend Frauen, die ihn früher nutzten. Wie ein Stollen für den Bergbau war er in den Hang gehauen. An den Wänden aus Lehm schlug sich Feuchtigkeit nieder, die Decke war mit Spinnennetzen überzogen und auf dem Boden tummelten sich Asseln. Als Lager für Gemüse und Obst wurde er früher genutzt. Die konstante Temperatur garantierte eine gleichbleibende Frische der Lebensmittel. Kühlschränke hatte es noch nicht gegeben. Im Dorf war der alte Lagerkeller in Vergessenheit geraten. Er kannte ihn aber noch. Schließlich wurde dieses Gelass, als er noch Kind war, von der Großmutter gerne genutzt, um ihr Überangebot an Gelee und Latwerge unterzubringen. „Wenn du nicht brav bist, kommst du auch hier hinein!“, drohte sie dann und wann schmunzelnd.
Der angerostete, schwere Eisenschlüssel passte, als er die Örtlichkeit nach diesen langen Jahren wieder inspizieren musste. Ein Hauch von Moder und Schimmel schlug ihm entgegen. Doch das machte ihm nichts aus. Die Kühle stimmte ihn zuversichtlich. Die Ware würde schön frisch bleiben, auch nach mehreren Tagen, wenn er mit seiner Arbeit fertig war, sollte kein Geruch nach außen dringen. Da war er sich sicher.
Der Knebel im Mund der auf dem nackten Boden liegenden Person war von Speichel durchnässt. Die Anstrengung ihn loszuwerden, schob ihn immer ein Stückchen weiter nach vorne. Doch es war sinnlos. Der Lappen war im Genick fest verknotet. Er hatte an alles gedacht. Die Messer, die Tranchierzange, die Säge und der Hammer lagen bereit. Auch die Haken und das Fleischbeil reihten sich ein. Und natürlich die in kleine Dreiecke mit spitzen Winkeln geschnittenen Aluminiumdosen.
Hände und Füße der Person waren an mit Widerhaken versehenen Bodenankern fixiert, die sich mit dem Hammer leicht ins Erdreich hatten treiben lassen. Die Beine waren gespreizt. Vom Knebel abgesehen, war die Person unbekleidet. Sein Geschlecht hatte sich in der Kälte gekrümmt und beinahe vollkommen in die Schambehaarung zurückgezogen. Auch die Hoden schienen die Flucht nach oben ergriffen zu haben. Mit einem der scharfkantigen Dosensplitter eröffnete er das Skrotum und fahndete nach den abwesenden Teilen.
Die Schreie des Gefangenen erstickte der Knebel, es blutete nur dezent. Die beiden Matratzen vor dem Eingang dämpften alle Geräusche, die vorbeischlendernden Wanderer eventuell hätten hören können. Nun setzte er einen kleinen Haken ein und schob ihn unter gelegentlichem Drehen in Richtung Schambein. Nein, so wurde das nichts. Sollten die verdammten Eier doch bleiben wo sie wollten, benutzen können würde der Typ seine Keimdrüsen sowieso nicht mehr.
In die Bauchdecke grub er mit einem der scharfkantigen Dosensplitter großflächig das Wort „Bix“, wobei der erste Buchstabe die meisten Schwierigkeiten machte. Irgendwie wollten die Haut und das Fettgewebe den notwendigen Rundungen nicht folgen. Die handwerklichen Probleme zeigten sich auch am Pulsschlag des Mannes, den er am Hals beobachtete. Je grober er fuhrwerkte, desto schneller hoben und senkten sich die Gefäße.
Vorbildlich wusch er das austretende Blut ab und träufelte Salz in die Wunden. So schuf er ein bleibendes Andenken, das auch eine gewisse Haltbarkeit versprach. Jetzt waren die Fußnägel dran. Unter jeden einzelnen Zeh drückte er einen Dosensplitter, wobei er mit dem Hammer nachhalf. Dann hebelte er die Nägel nach oben und zog sie mit der Zange heraus. Auch hier fand das mitgebrachte Salz seine Anwendung. Minimalinvasive Eingriffe nannte er diese Maßnahmen.
Als er das Interesse verlor, legte er die Werkzeuge beiseite, nahm einen Schluck vom mitgebrachten Getränk und nickte zufrieden. Aus dem Geschlecht des Gefangenen tropfte rötlicher Urin. Scheinbar hatte der Haken die Blase verletzt. Das war nicht tragisch, das ließ sich richten. Aufräumen war nicht nötig, er würde bald wiederkommen.
6
Dem Aufruf der Landwirte waren viele Leute gefolgt. Nicht nur sämtliche Bauern der Gegend, auch Umweltschutzgruppierungen, wie der NABU und der BUND, ließen es sich nicht nehmen, mit ihrer Anwesenheit das Anliegen zu unterstützen. Allen voran die Ortsgruppe von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN. Deren Frontmann wollte sowieso zur nächsten Bürgermeisterwahl kandidieren und setzte sich gleich an die Spitze des Protestzuges.
Die Demonstration war ohne Einwände genehmigt worden und verlief gewaltfrei. Die beiden zum Wochenenddienst verpflichteten Polizeibeamten Thomas Linn und Helge Ostermann standen sich die Beine in den Bauch, wenn sie nicht gerade mit Warnblinker und blitzendem Blaulicht dem Zug der Demonstranten im Standgas hinterherzuckelten. Vereinzelt waren rote Fahnen zu sehen, denn auch die seit Jahrzehnten sich in einem Dörfchen im Nachbarkreis behauptende DKP sah wieder eine Chance in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Die Leute von ATTAC liefen neben der Ortsgruppe des DGB, die wieder nur aus deren Protagonisten Martin Baier und Dirk Daub bestand. Baier trug wie immer sein rotes Hemd, Daub die pflichtgemäße Fahne und den entschlossenen Blick des gewerkschaftlichen Kämpfers.
„Wenn die bunten Fahnen wehen …“, sang Linn leise.
„…fällt der Abschied uns nicht schwer“, fiel Ostermann zart ein. Doch die beiden mussten bleiben. In der Menge machten sie auch jenen stämmigen jungen Mann aus, der erst kürzlich reichlich Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, weil an der Wand seines Hauses in Brensbach ein halber Ford Granada hing. Er hatte ihn als Kunstwerk dort angeschraubt, was bei den Bürgern auf geteiltes Echo gestoßen war. „Brieh in de Bix, das taugt nix!“ war auf einem der Transparente zu lesen. Ein anderes verkündete „Im Gras versteckte Aluscherben lassen unsre Kühe sterben!“ Vor dem Tor der Kelterei machte der Zug halt und formierte sich in die zusammengehörenden politischen Grüppchen. „Macht doch Kabel endlich zu, danken werden Mensch und Kuh!“, skandierte die Menge. Auf Differenzierung wurde kein Wert mehr gelegt.
Lediglich ein Sprecher des Magistrats führte in langen Satzgirlanden aus, dass man sich die Verwendung von Aluminiumdosen doch reiflich überlegen solle, denn dies könne einen Zwist, wenn nicht gar den Abbruch der Beziehungen zu den Landwirten zur Folge haben, wo man doch auf diese angewiesen sei, da sie ja die Äpfel für die Produktion des Betriebes lieferten.
Dummerweise hatte man sich für die Demo den Samstagmittag ausgeguckt, wo niemand im Betrieb war. Lediglich Gerhard Kabel hatte im Büro etwas zu erledigen. Er stand hinter dem Vorhang seines Bürofensters und schämte sich. Seinen Geschäftsführer Frank Schneider hatte er schon vor ein paar Tagen in den Urlaub verabschiedet.
7
Heute hatte er die Säge eingeplant. Er setzte das Blatt unterhalb der linken Kniescheibe an, straffte mit der freien Hand die Haut in Richtung des Oberschenkels und begann mit der Arbeit. Bald hatte er die Knorpelscheibe freigelegt und verfüllte den klaffenden Spalt mit reichlich Salz. Denn Salz hatte auch die Großmutter verwendet, um die eingelegten Bohnen zu konservieren. Zudem wurde das Schweinefleisch von ihr damit eingepökelt und somit schmackhaft und haltbar gemacht. „Salz auf unserer Haut“, das bekannte Buch von Benoîte Groult, kam ihm in den Sinn. Er hatte es erst kürzlich gelesen.
„Wie lange ist dieser Drecksack wohl haltbar?“, fragte er sich. „Gepökeltes Arschloch am Spieß!“, schleuderte er nun dem Gefangenen wütend entgegen. Der Spieß würde noch kommen, das Arschloch wartete schon darauf. „Warum hast du das angerichtet? Hättest du nur einen Funken Moral in deinem Hirn, wäre dir bewusst geworden, dass man so etwas nicht tut. Das Vieh erleidet unendliche Qualen. Doch dir ist das egal, lediglich dein Ego und deine Gier nach persönlichem Erfolg interessieren dich. Andere Menschen benutzt du als Werkzeug für dein schmutziges Fortkommen. Und was aus diesen Existenzen wird, ist dir gleich. Du gehst über Leichen. Ich auch.“
Jetzt war der Hammer dran. Mit regelmäßigen Schlägen auf die Schädeldecke traktierte er den vor ihm liegenden und leise wimmernden Menschen unablässig in immer schneller werdender Frequenz. Dann knackte es, als ob jemand einen trockenen Ast zerbräche. „Das könnte deine Schädelbasis gewesen sein“, raunte er dem beinahe Bewusstlosen ins Ohr.
Auf dessen Kopf konnte er deutlich die Delle sehen, die das Schlagwerkzeug hinterlassen hatte. Nach kurzer Zeit bildete sich eine blutverklebte Beule, die er als ungemein hübsch empfand. „Siehst du, jetzt nimmt dein Gehirn doch noch an Masse zu“, lachte er und schnitt mit einer Dosenscherbe hinein, um eine Art Druckentlastung zu erreichen. Ihm wurde etwas schwindelig. Die Luft im Verlies war zum Schneiden dick. Außerdem schien der Mensch etwas Übelriechendes ausgeschieden zu haben.
Er stand auf und japste nun förmlich nach Sauerstoff. Obwohl es tiefschwarze Nacht war, wollte er ein Öffnen des alten Tores vermeiden. Wer weiß, wer da gerade vorbeischlich. Mit zwei fleckigen Matratzen hatte er den Keller lichtdicht bekommen. Die Kerzen in der Mitte flackerten bedrohlich.
Er stellte sich auf den hölzernen Stuhl und inspizierte den kleinen Kamin, der nach draußen führte und unscheinbar auf einer Wiese seinen verrosteten Ausgang präsentierte. Das schlichte Rohr war mit Unrat verstopft. Dies zeigte ihm die Inspektion mit der Taschenlampe. Er schnappte sich die Eisenstange und stach mehrmals hindurch. Langsam schienen sich die Luftverhältnisse im Erdbunker zu verbessern. Schließlich brauchte er ihn ja noch. Der Frevel war noch lange nicht gesühnt und Strafe musste sein.
Minutenlang ohrfeigte er den Gefangenen nun, da dieser den Boden mit dem Inhalt seines Darmes beschmutzt hatte. Das sollte nicht wieder vorkommen. Er schob die Eisenstange durch die Exkremente und versuchte sie im Anus des Menschen zu platzieren. Wegen der Fußfesseln war dies nicht einfach und losbinden mochte er ihn nicht. Die Verletzungen, die er erzeugt hatte, bluteten stark. Scheinbar hatte er wichtige Gefäße verletzt. Durch die permanenten Quälereien war der Typ nun endgültig bewusstlos geworden. Hauptsache, er lebte noch. Schließlich wartete das Beil noch auf seinen Einsatz.
8
Vorbei an der neuen Waage schlenderte Gerhard Kabel gemütlich über das weitläufige Gelände der Kelterei. Vor seinem geistigen Auge sah er große Teile des Areals in ihrem Zustand vor wenigen Jahren. Unwirtliche Feuchtwiesen und nutzlose Brachen, auf denen sich das Unkraut breitmachte. Der Vater hatte mit der Urbarmachung begonnen und das Land von der Gemeinde erworben, um langsam aber sicher zu expandieren. Man besann sich wieder auf die lokale Trinkkultur und Apfelwein war zwar noch nicht in aller Munde, stahl sich jedoch ganz allmählich aus dem Nischendasein eines vergessenen und überholten Getränks der Landbevölkerung davon.
Anteil daran hatte, wie an so vielen Entwicklungen derzeit, die Rückbesinnung auf die wirklichen Werte natürlicher Erzeugung und das neue Bewusstsein eines aufkommenden ökologischen Denkens. Kabels konnten hier guten Gewissens mitgehen, denn ihr Erzeugnis war ja ein reines Naturprodukt. Ohne künstliche Zusätze und Konservierungsstoffe. Zudem war der Kaloriengehalt etwas niedriger als beim Bier und das berühmt gewordene Wort des Alleinstellungsmerkmals durfte auch benutzt werden. Abgesehen von Südhessen musste man nämlich schon recht weit suchen, um einen anständigen Schoppen zu bekommen.
Es nieselte leicht und Kabel schloss den Reißverschluss seiner Jacke. Die alten Lampen schickten ihr spärliches Licht auf den nassen Asphalt des Hofes und erzeugten verzerrte Spiegelungen, die sich harmonisch in diesen nebligen Herbstabend einfügten. Vom Dorf her, wo die Familien schon vor den Fernsehern saßen, wehte der Geruch der vertrauten Holzfeuer, der sich mit dem Duft der angelieferten Äpfel zu einem Gefühl von Geborgenheit mischte.
An dem neuen Stahltank blieb er stehen und schaute nach oben. Der matte Glanz des wuchtigen Behälters weckte Vertrauen in die tadellose Technologie, die sich hier breitgemacht hatte und erinnerte Gerhard Kabel, warum auch immer, an die Trutzhaftigkeit einer uneinnehmbaren Burg. Er betrat die Produktionshalle und roch den gärenden Most. Ein Sinneseindruck, mit dem er groß geworden war. Die gewaltigen Pressen ruhten und warteten auf ihre Befüllung in der kommenden Arbeitswoche. Die Abfüllmaschine war vor dem Wochenende gesäubert worden und glänzte im Licht der Neonröhren. Die sündhaft teure Apparatur, die für das neue Segment der Dosen zuständig war, füllte sein Herz auch diesmal wieder mit einer Mischung aus Zweifel und Stolz.
Das große Wasserbad zur Reinigung des Keltergutes gähnte ihn in trostloser Leere an. Auch dies würde sich am Montag ändern, wenn die Belegschaft wieder emsig durch die Halle wuselte. Zwölf Mitarbeiter standen bei ihm in Lohn und Brot, während der Saison kamen noch Aushilfen hinzu, darunter mancher Schüler, der hier in den Herbstferien jobbte.
Das offene Lager für die angelieferten Äpfel war wahrscheinlich übervoll, denn die Traktoren mit ihren geräumigen Anhängern drängelten sich förmlich in diesem Jahr. Eine Förderschnecke transportierte die runden Roller in diese riesige Wanne aus abgedichtetem Beton. Später wurden diese am laufenden Band auf ihre Verwendbarkeit hin sortiert. Entgegen der landläufigen Meinung wollte man kein übermäßig faules Obst, keine Zweige und Blätter oder gar völlig unreife Früchte im Gut haben. Dass dies den Geschmack verbessern solle, hielt Gerhard Kabel für eine Mär.
Mit prüfendem Blick schaute er auf die bunte Schüttung. Grüne Bohnäpfel mit ihren rötlichen Bäckchen, bewundernswerte Trierer Weinäpfel, grüne Jakob Lebels, aber auch Reichelsheimer Weinäpfel gesellten sich zum Stelldichein und warteten auf ihre Verflüssigung. Ein Bild, wie es prachtvoller nicht sein konnte. Nur eines störte das bunte Allerlei des ruhenden Obstes. Vom Rande des Beckens schlecht auszumachen, hatte sich wohl ein Fremdkörper in diese Harmonie eingeschlichen. Manchmal kam es vor, dass welke Blätter mit in den Behälter gerieten. Gerhard Kabel schaute nach und beugte sich vor. Blattwerk war das nicht. Als ob sie nach ihm greifen wollte, streckte eine leichenblasse Hand ihre Finger nach ihm aus.
9
Kriminalhauptkommissar Karl Kunkelmann, der ausnahmsweise einem Wochenenddienst zugestimmt hatte, wurde von der Telefonzentrale über den Fund in Reichelsheim informiert und dachte sofort an die geniale Metzgerei Kaffenberger in Nieder-Kainsbach. Diese bot einen geräucherten Schwartenmagen an, wie man ihn im ganzen Odenwald nicht finden konnte. Lediglich das Landlädchen Marquardt aus Ober-Ostern konnte hier geschmacklich mithalten. Genau dort würde sein Weg zum Fundort langführen, obwohl die Strecke über Rohrbach kürzer war. Nun verfluchte er diesen späten Samstag, der ihm den Zutritt zum Laden verwehrte.
Auch fiel ihm beim Thema Schwartenmagen wieder der Ärger mit seiner Frau Lena ein. Als diese gerade seinen Sohn Thomas im Erbacher Krankenhaus auf die Welt gebracht hatte, lancierte Kunkelmann im Odenwälder Echo eine Geburtsanzeige, die das Erscheinen des Buben ob seines stolzen Gewichtes als wohl geratenen Presskopf ankündigte. Die Gattin und die komplette Verwandtschaft waren stinksauer. Sie hatten eben keinen Humor. Nur dem kleinen Buben machte dies nichts aus. Kunkelmann musste über diesen Vorfall schmunzeln.
„Karl, wo bist du denn mit deinen Gedanken?“, fragte etwas ungehalten sein Kollege Heiner Ehrenreich. „Wenn jemand zwischen Äpfeln eine Leiche findet, ist das nicht lustig!“
„Ich hatte nur eben an etwas denken müssen“, entgegnete Kunkelmann leicht verlegen. Ehrenreich war überraschend fit, denn er hatte einen zweifelhaften Entzug hinter sich gebracht und im täglichen Kognak den Tee entfernt. Die ewigen Ermahnungen und guten Ratschläge hatten nichts gebracht, aber er war ein ungemein feiner Kerl und hielt sich im Dienst aufrecht und wacker. Die stets mitgeführten Pfefferminzbonbons erledigten den Rest.
Als sie im Hof des Präsidiums den zivilen Opel bestiegen hatten und losfuhren, beschwerte sich Karl über den lahmen Anzug des Wagens und meinte, dass sich die Technik das Auto mal vornehmen müsse, wahrscheinlich laufe die Kiste nur auf drei Töpfen. Heiner behob das Problem, indem er die Handbremse löste. Nachdem sie den Funk eingeschaltet hatten, hörten sie, dass die uniformierten Kollegen Linn und Ostermann zu einem Auffahrunfall unterwegs waren. „Siehst du Karl“, meinte dessen Beifahrer entspannt, „mit solcherlei Kleinkram haben wir nix zu tun.“
„Dem Himmel sei Dank, aber nie mehr werde ich in meinem Alter freiwillig einen Dienst am Wochenende übernehmen. Müsste ich auch nicht, hat Big Boss Wagenknecht gesagt. Ich habe das nur gemacht, weil der Müller unbedingt mit seiner kleinen Tochter in irgendeinen Freizeitpark fahren wollte. Freitag gegen Abend hat er mich darum gebeten, stell dir das mal vor. Und ich gutmütiges Schaf habe zugesagt.“
„Du warst eben schon immer ein prima Kollege“, lobte Ehrenreich.
„Wieso warst?“, stutzte der Mann am Steuer.
„Das sagt man halt so!“, meinte sein Gegenüber und ließ die Cognac-Fahne wehen. Sprachliches Feingefühl war noch nie Kunkelmanns Stärke gewesen, was innerfamiliär häufig zu Spötteleien führte. „Wahrscheinlich stehen wir gleich vor einem Betriebsunfall, weil ein Arbeiter zu viele Schoppen geschnappt hat und in diesen Apfelbehälter gestürzt ist“, mutmaßte Karl.
„Und dann hat er sich mit Äpfeln zugedeckt, damit man ihn nicht findet. Er wollte nämlich Verstecken spielen. Unter der Last des Obstes ist er dann jämmerlich erstickt, weil er zu besoffen war, um sich wieder herausquälen zu können.“
„Stimmt, das ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht aber hat ihn ein anderer mit den Äpfeln zugedeckt?“
„Warten wir doch einfach ab, bis wir da sind, dann werden wir den Toten oder die Getötete ja wahrscheinlich sehen.“
„Wahrscheinlich? Das ist unsere ureigene Aufgabe als Ermittler!“
„Karl, auch dies habe ich lediglich so dahingesagt. Leg doch nicht jedes Wort in die Waagschale!“
„Jetzt punkte aber ich, denn es heißt in diesem Fall nicht Waagschale, sondern Goldwaage“, lachte Kunkelmann und rieb sich freudig die Hände.
Als sie das Tor mit dem Banner Ein guter Schoppen lässt sich nicht stoppen‘ passiert hatten, wartete vor dem Verwaltungsgebäude der Kelterei bereits ein uniformierter Kollege.
„Kennst du diesen Blaumann da?“, fragte Ehrenreich.
„Nein, aber vom Alter her kann es kein ganz Junger sein“, orakelte Karl Kunkelmann.
„Hallo Kollegen“, grüßte der Wartende und tippte mit dem Zeigefinger an die Dienstmütze. „Ich bin Erik Hach aus Dieburg, wir haben übernommen, da die Erbacher bei einem Unfall sind und auch die Streife aus Höchst sich bereits im Einsatz befindet.“
„Das wundert mich, normalerweise kriegt die vom Fernseher doch keiner fort“, flachste Ehrenreich und fing sich einen tadelnden Seitenblick seines Vorgesetzten ein.
„Der Wagen steht direkt beim Apfellager, dort ist auch der Bastian Brecht, mein Schichtpartner“, sagte Hach und stapfte los.
Das unvermeidliche Blaulicht zuckte und gab der Szenerie schon jetzt den Anschein eines Verbrechens. Brecht stand wie ein abgestellter Wachsoldat vor der riesigen Wanne mit Äpfeln und fühlte sich sichtlich unwohl, worauf seine blasse Gesichtsfarbe schließen ließ. Das gut gefüllte Becken war von ihm mit dem rot-weißen Flatterband der Polizei abgesperrt worden und wartete auf eingehende Inspektion durch die Fachleute. Im Streifenwagen saß der Keltereibesitzer Gerhard Kabel und zog vollkommen fertig und zittrig am Stummel einer Zigarette. Ehrenreich und Kunkelmann stiegen die kleine Leiter hoch und blickten im Licht des grellen Scheinwerfers auf eine Lage rotbackiger und grüner Äpfel, in der sie sich erst orientieren mussten. Doch schnell hatten sie die aus dem Obst herausragenden Finger gesehen.
„Tja, eindeutig. Das ist eine Hand“, stellte Karl Kunkelmann fest und beauftragte seinen Kollegen, die Spurensicherung zu informieren.
Verbrechen oder Arbeitsunfall, das Opfer musste vorschriftsmäßig geborgen werden. Kunkelmann wendete sich dem abwesend wirkenden Mann im Streifenwagen zu und stellte sich als leitender Ermittler vor. „Machen Sie sich keinen Kopf, Herr Kabel. Bis jetzt ist das nur Routine. Wahrscheinlich entpuppt sich dieser Fund als skurrile Folge eines Arbeitsunfalls. Dumme Frage, aber können Sie vielleicht sagen, wer unter den Äpfeln liegen könnte?“
„Nein, Herr …?“
„Ach so, Kunkelmann von der Kripo in Erbach.“
Gerhard Kabel warf die Kippe weg. „Ich habe meinen abendlichen Rundgang gemacht und wollte sehen, ob das Lager gut gefüllt ist. Dann habe ich dieses Etwas entdeckt, das ich im schlechten Licht zuerst für grünliche Zweige gehalten hatte, die ins Keltergut geraten waren. Das kommt vor. Ich wollte sie rausnehmen und bin näher ran an den Beckenrand. Als ich registriert hatte, was da lag, ist mir schwindelig geworden.“
„Das kann ich gut verstehen. Wird hier am Wochenende gearbeitet?“
„Ja, heute Morgen waren die Leute bis gegen 13 Uhr da. Es ist ja schließlich Hochsaison und die Bauern wollen ihre Ernte loswerden.“
„Gibt es jemanden, der sich jetzt etwas um Sie kümmern kann?“
„Normalerweise meine Frau, aber die ist gerade für ein paar Tage auf Kurzurlaub nach Österreich zu ihren Eltern gefahren. Ich möchte sie auch nicht anrufen und mit der Sache hier behelligen. Sofort würde sie die Zelte abbrechen und herkommen. Danke, es geht schon.“, beschwichtigte Gerhard Kabel.
Bei den abgebrochenen Zelten dachte Karl Kunkelmann zuerst an einen Camping-Ausflug, verwarf diesen abstrusen Gedanken aber sofort wieder. „Wo wohnen denn die Eltern Ihrer Frau? Sie müssen wissen, ich liebe Österreich. Besonders die Gegend um Seefeld herum und natürlich die Konditorei Heidegger in Innsbruck. Da gibt es riesige Granatsplitter!“
Kabel schaute etwas konsterniert drein und wunderte sich über die Sätze seines Gegenübers, sagte aber nichts. „Gleich hinter der Grenze bei Reutte lebt die Familie. Die haben dort einen kleinen Bauernhof.“
Automatisch begann es in Kunkelmanns Kopf zu summen: Kennst du die Perle, die Perle Tirols? Das Städtchen Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein am grünen Inn! Und im Geiste legt er sich die Griffweise zum Lied auf der Steirischen Harmonika zurecht.
„Hallo, Herr Kunkelmann?“
„Äh, ja. Ich war gerade etwas abgeschwiffen, denn dort hatte ich mal einen Kurs zum Erlernen des Spiels auf der Ziehharmonika besucht. Ja, äh, dann müssen wir jetzt auf die Spurensicherung warten. Sie können zurück in Ihr Büro, bis wir hier fertig sind.“
10
Nach gefühlten 30 Minuten kam im VW-Bus Marco Wiesemann, Chef der Kriminaltechniker, mit seinem Trupp gefahren. Er musste froh sein, diesen Job noch zu haben. Schließlich hatte er sich in einem zurückliegenden Fall als Kriminalbeamter betätigt, der er ja definitiv nicht war. Die Männer und Frauen in den weißen Ganzkörperkondomen waren hoch spezialisierte Fachleute und meist Angestellte des Landes Hessen, selten jedoch Landesbeamte. Da der Streifenpolizist Hach wusste, was jetzt folgen würde, hatte er parallel zu den Spurensuchern schon mal die Pietät Kring informiert, deren beiden Mitarbeiter nun in situationsgemäßer Entfernung ihres Einsatzes harrten und den grauen Kunststoffsarg bereitgestellt hatten.
„Hallo Karl, du hier? Am Wochenende?“, grüßte Wiesemann den leitenden Ermittler.
„Grüß dich, Marco. Das ist nur, weil ein Kollege mit seiner Tochter … Na ja, ist ja auch egal. Schau dir an, was sich da unter den Äpfeln befindet. Die Hand schaut schon heraus. Wenn ihr gemeinsam kräftig zieht …“
„Lass mal gut sein. Wir kriegen das schon hin. Du kannst ja inzwischen einen Granatsplitter vertilgen. Quasi als Trost dafür, dass du nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen kannst“, witzelte Wiesemann, kniff das linke Auge zu und bedeutete seiner Mannschaft, sich zum Apfelbecken zu begeben. Der beleibte Hauptkommissar liebte Granatsplitter über alles und besorgte sich diese meist in der Zeller Bäckerei Strasser, die seines Erachtens die besten buk. Wehmütig sehnte er den Montag herbei, um seinen Vorrat aufzufüllen.
Jetzt stapften Wiesemanns Spürnasen Hans Deckert und Klaus Thalstädt in ihren blauen Überschuhen los und konnten nicht umhin, das Becken zu betreten, da sich der zu bergende Körper genau in dessen Mitte befand. Um Deckerts Hals baumelte die Nikon, mit der er das Geschehen dokumentierte. Das Betreten der Apfellagen verursachte ein dezentes Quietschen und einige der runden Roller barsten unter dem Gewicht der Männer. Deckert bückte sich und machte ein Foto der aus den Äpfeln herausragenden Hand. Sie schien unversehrt. Jetzt sammelten die beiden alle Früchte um das Objekt herum ab und gaben viele davon in Plastiktüten, die Wiesemann bereithielt. Karl Kunkelmann erinnerte dies an das Apfellesen in seiner Jugend, wo er auf den Obstwiesen um Bad König herum oft mit dabei war, wenn die Kumpels die Früchte aufklaubten und in die mitgebrachten Säcke stopften. Schon während dieser anstrengenden Tätigkeit freuten sie sich auf den Lohn, den sie in Form von frischem Apfelsaft dafür bekamen. Später war es die Vorfreude auf die zahlreichen Schoppen guten Apfelweins, die sie im Gasthaus ‚Zur schönen Aussicht‘ in Begleitung besten Handkäses und des ebenfalls dort gebackenen Brotes in der Wirtsstube sich einverleiben würden.
Bis zum nackten Unterarm hatten die Jungs sich vorgearbeitet und man konnte aufgrund dessen starker Ausprägung und dichten Behaarung sagen, dass unter den Früchten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Mann liegen musste. Olfaktorisch machte ihnen die Arbeit keine Probleme, da die Kühle der Lokalität Gerüche zurückhielt. Zudem trugen sie ihre Masken. Dies erschwerte zwar das Atmen, verhinderte aber das Einbringen eigener DNA. Immer wieder klickte die Kamera und Deckert musste mehrmals das Objektiv von Saftspritzern reinigen. Stück für Stück kam man der Leiche näher.
Karl Kunkelmann war gespannt, ob er den armen Kerl vielleicht vom Sehen kennen würde, denn im letzten Jahr hatte auch er mit einem kleinen am VW-Käfer hängenden Wägelchen ein paar Säcke Keltergut zu Kabels gebracht. Den Süßen ließ sich seine Gattin Lena schmecken, er aber wartete darauf, bis die Gasblasen gehörig blubberten und verschwand mehrmals in der Woche im Keller. Lena bemerkte dies und trug ihrem Mann, da er ja nun häufiger im Untergeschoss als in der Wohnung zu finden war, gleich das Aufräumen desselbigen auf. Daraufhin beschloss Karl lediglich einmal pro Woche das Fortschreiten des Gärvorganges zu testen und sich in Geduld zu üben.
Schließlich hatte er ja immer einige Flaschen Weißbier im Kühlschrank, die ihm die langen Abende nach Dienstschluss belohnten. Manchmal landete er auch bei rassigem Rotwein, doch das mochte Lena ungern sehen, denn stets machte sie, nachdem er sich ein Fläschchen hatte schmecken lassen, rote Ränder des Weinglases auf dem Beistelltischchen aus, weil Karl nie einen Untersetzer nahm. Er wusste schlicht nicht, wo sich diese in der unergründlichen Geografie des Küchenschrankes aufhielten. Auch war Lena das ständige Entfernen der Flecken aus den Hemden des Gatten leid, da es ihm immer gelang, etwas von den guten Tropfen auf seinem beachtlichen Bauch zu verschütten. Frau Kunkelmann hatte andere Hobbys. Entweder war sie in irgendeinem Yoga-Kurs oder sie las in ihren dicken Wälzern. Kriminalromane von Henning Mankell oder Arne Dahl verschlang Karls Gattin am liebsten.