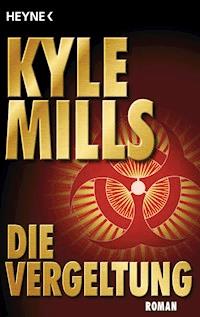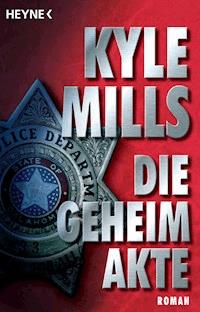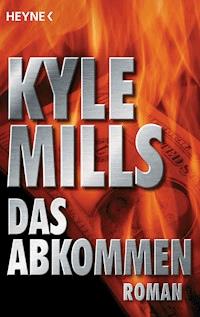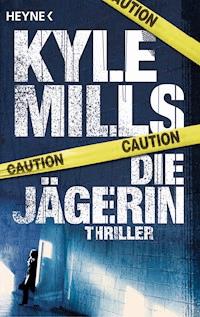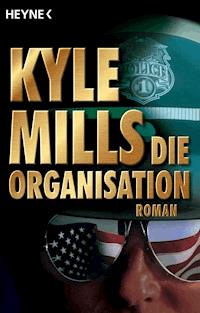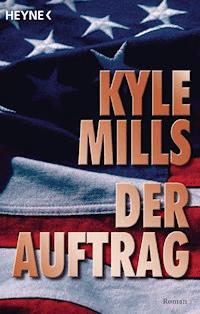
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mark Beamon
- Sprache: Deutsch
Special Agent Mark Beamon ist nicht nur ein Querkopf und Einzelgänger, sondern auch der brillanteste Ermittler des FBI. Von höchster Stelle wird er mit einem hochbrisanten Fall beauftragt. Eine rechtsextreme Terrorgruppe verfolgt einen teuflischen Plan, der schon Tausende Opfer gefordert hat.
Mit diesem Roman ist New York Times-Bestsellerautor Kyle Mills der atemberaubende Auftakt einer neuen großen Thriller-Serie gelungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kyle Mills
Der Auftrag
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
Das Buch
Reverend Simon Blake ist ein vermögender und einflussreicher Fernsehprediger, der zusammen mit dem Leiter seines Sicherheitsdienstes, dem ehemaligen Bundesagenten und Vietnamveteranen Hohn Hobart, einen extremen Plan zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs in den USA entwickelt: Hobart soll ein Team zusammenstellen, das größere Mengen von Drogen mit einem tödlichen Gift versetzt. Durch die abschreckende Wirkung erhoffen sie sich, den Drogenkonsum einzuschränken. Hobart gründet eine Organisation, die sich Comittee-for-a-Drug-Free-Society (CDFS) nennt.
In kürzester Zeit sterben mehr als 24000 Menschen an den Folgen des Giftes. Da die CDFS weite Zustimmung in der Bevölkerung genießt, fällt es dem Präsidenten schwer, die Gruppe als Terroristen zu brandmarken. In dieser brenzligen Lage greift das FBI auf den wegen seines eigenwilligen Ermittlungsstils nach El Paso strafversetzten Special-Agent Mark Beamon zurück, der hinter den Kulissen ermitteln soll. Bald gerät er zwischen die Fronten aus rechtsextremer Politik, religiösem Fanatismus und knallharten Mafiainteressen.
Der Autor
Kyle Mills, geboren 1966, lebt in Jackson Hole, Wyoming, wo er sich neben dem Schreiben von Thrillern vor allem dem Skifahren und Bergsteigen widmet. In den USA ist Kyle Mills mit seinen Romanen regelmäßig auf den Bestsellerlisten zu finden und gilt neben Tom Clancy, Frederick Forsyth oder David Baldacci als Erneuerer des intelligenten Politthrillers. Der Auftrag
Titel der Originalausgabe
RISING PHOENIX
erschien bei HarperCollinsPublishers, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Wilhelm Heyne Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright © 1997 by Kyle Mills Copyright © dieses E-Books by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagillustration: © corbis/DiMaggio/Kalish
Für meinen Vater,
Es gibt nichts Schwierigeres, kein gefahrvolleres Unterfangen und nichts Unsichereres im Erfolg,
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
Washington, D.C. 15. Oktober 1997
Es sah eigentlich gar nicht übel aus für Wile E. Coyote. Seine raketenbetriebenen Rollerskates spuckten Feuer, als er durch die grellbunte Wüstenlandschaft flitzte. Trotzdem war klar, dass er am Ende doch verlieren und wie immer von diesem durchtriebenen Roadrunner ausgetrickst werden würde.
Leroy Marcus verstand den Kojoten. Er wusste, wie es war, wenn man sich etwas wünschte und es nie bekam. Und obwohl er gerade erst fünfzehn geworden war, verstand er, was Enttäuschung war.
Er drückte den Lautstärkeknopf der Fernbedienung, um das unablässige Husten seiner Mutter zu übertönen. Es sah aus, als sei der Kojote kurz davor, mal wieder spektakulär auf die Nase zu fallen, und er liebte diesen speziellen Pfeifton, der dabei immer ertönte.
»Leroy, hol deiner Mama was Süßes.«
Er reagierte nicht, sondern stellte den Ton noch lauter.
»Leroy, hast du nicht gehört? Ich brauch was Süßes!«
Die stille Verzweiflung in ihrer Stimme war sogar durch das Kreischen der ACME-Rocketskates zu hören.
Er musste an die Zeit denken, als seine Mutter von der Arbeit heimgekommen war und gerufen hatte, sie wolle was Süßes haben. Er und sein älterer Bruder waren dann zu ihr gerannt und hatten ihre Gesichter in ihrem Rock vergraben, und sie hatte gelacht und ihnen liebevoll die Köpfe gestreichelt.
Aber sein Bruder war seit fast einem Jahr tot, und seine Mutter hetzte nicht mehr jeden Morgen aus dem Haus, voller Sorge, dass sie womöglich zu spät kam. Wenn sie jetzt nach was Süßem verlangte, wollte sie mehr als einen Kuss. Sie wollte ihren Stoff.
»Leroy!«
Langsam wandte er den Kopf und spähte um den dicken Polstersessel, in dem er fast versank. Seine Mutter saß kraftlos am Küchentisch und starrte ihn aus wässrigen Augen an.
Der Fernseher plärrte noch lauter, diesmal ganz von selbst. Die Zeichentrickfilme waren vorbei, und nun pries ein kleiner Kobold irgendwelche supertollen Cornflakes an. Er wandte sich wieder um und zog seine Knie an die Brust.
»Worauf wartest du, Junge?«
Zögernd senkte er seine Füße auf den Boden und bahnte sich einen Weg durch die abgenutzten, kaputten Spielsachen, die seine fünfjährige Schwester überall verstreut hatte. Einen Moment lang blieb er stehen und schaute seine Mutter an. Sie wich seinem Blick aus und griff nach dem Päckchen Zigaretten.
Seine Schwester tauchte aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter auf und kam zu ihm gerannt. Er kniete sich hin und strich ihr übers Haar.
»Was hast du denn getrieben, Diedre? Dein Zopf fällt ja schon ganz auseinander. Dabei hab ich heute Morgen eine halbe Stunde gebraucht, um dich so hübsch zu machen.«
Sie biss sich kichernd auf die Fingerknöchel.
»Ich muss mal kurz weg, okay? Du bist brav und ärgerst Mama nicht, ja?«
Sie nickte. Wenn sie ihn anlächelte, vergaß er jedes Mal, wer er war. Er kümmerte sich um sie – und dadurch war er genauso wichtig wie irgendein reicher Weißer. Vielleicht sogar noch wichtiger.
»Also, ich bin in einer Stunde wieder da. Wenn du brav bist, mach ich dir einen neuen Zopf. Wenn nicht, musst du für den Rest des Tages zerzaust rumlaufen.«
Sie wandte sich um und rannte zurück ins Schlafzimmer. Er schaute ihr nach, bis sie verschwunden war, und drückte dann die Wahlwiederholung auf seinem Handy.
Der kräftige Wind, der in den letzten zwei Tagen ständig durch die Straßen gefegt war, hatte sich endlich gelegt; stattdessen war ganz Washington jetzt in kalten Nebel gehüllt. Leroy musterte vom Eingang des Wohnblocks aus den düsteren Himmel. Seit seiner Geburt lebte er schon hier. Bei Regen war das Viertel besonders deprimierend. Sicher, in der Sonne sahen der abblätternde Verputz und die aufgesprungenen Gehsteige noch schäbiger aus, aber dann herrschte wenigstens überall Leben. Kinder tobten auf den asphaltierten Spielplätzen; Teenager trafen sich an den Straßenecken, rauchten, tranken und lachten miteinander. Selbst der üble Geruch, der bei Sonnenschein in der Luft hing, war besser als dieser Regen, in dem alles aussah wie ein verblichenes Schwarzweißfoto.
Er schob die Hände in seine Baggyjeans und zog sich die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf. Langsam tappte er die Stufen hinunter, wandte sich nach rechts und ging die Straße hinauf. Durch den Nebel konnte er eine einsame Gestalt erkennen, die in einem beängstigend schiefen Türrahmen stand. Als er näher kam, erwachte die Gestalt zum Leben und schlenderte auf ihn zu. »Tek! Was liegt an?«
Leroy hatte sich seinen Spitznamen vor etwas mehr als einem Jahr durch seinen ausgiebigen, wenn auch alles andere als geschickten Gebrauch einer Tec-9-Maschinenpistole verdient. Ohne diese Waffe machte er seither keinen Schritt mehr.
»Nichts Besonderes, Twan. Kommste mit?« Die feuchte Luft schien jedes Geräusch zu verschlucken.
»Klar, Mann. Nicht viel los heute.«
Wortlos gingen sie weiter, bis sie nach knapp zehn Minuten ein kleines weißes Haus erreichten. Sie blieben auf dem Bürgersteig stehen und schauten sich um, ob von irgendwoher Gefahr drohte.
Das Dach des Hauses sah aus, als könne es jeden Moment zusammenbrechen. Die dicken Bretter vor den Fenstern schienen das einzig Solide zu sein, das bei seinem Bau verwendet worden war. Es gab keinen Hof, der diesen Namen verdient hätte, nur nassen Abfall zwischen wucherndem Unkraut. Für Außenstehende wirkte das Haus verlassen. Sie wussten es besser.
Twan blieb am Straßenrand stehen, während Tek lässig zur Haustür schlenderte und den Drang unterdrückte, um sich zu schauen. Er klopfte dreimal, machte eine Pause und pochte dann noch zweimal mit der Handkante gegen die Tür.
»Wer ist da?«, fragte eine gedämpfte Stimme.
»Tek, Mann. Mach schon auf, hier draußen schifft es!« Die Tür wurde zuerst nur einen Spalt breit, nach einem kurzen Zögern dann aber ganz geöffnet.
»Wer ist das?«
Der Mann, der auf seinen Freund deutete, sah aus wie ein Berg.
»Er gehört zu mir«, erklärte Tek schlicht und versuchte erfolglos, sich an dem Koloss vorbeizuzwängen, um aus dem Regen zu kommen.
»Du kannst rein. Er bleibt draußen.«
Tek winkte seinem Freund rasch zu. Twan erwiderte regungslos seinen Blick durch die dunkle Panorama-Sonnenbrille, die im Lauf der Jahre auf seinem Gesicht festgewachsen zu sein schien.
Eine einzige Lampe ohne Schirm, die in der Ecke stand, erhellte das düstere Zimmer, in das durch die bretterverschlagenen Fenster kaum Tageslicht drang. Das Innere des Hauses wurde von einer Wand in zwei Hälften geteilt, wodurch es für Tek von seinem Standort an der Tür aus unmöglich war, in den Nebenraum zu schauen. Möbel gab es anscheinend nirgends, obwohl er sich vorstellte, dass hinter der Mauer ein ganzer Tisch voll mit dem Zeug stand, weswegen er hier war.
Ein großer Mann mit fleckiger Haut erschien aus dem Nebenzimmer. Tek hatte ihn schon zweimal getroffen und kannte ihn nur mit seinem Straßennamen – DC.
»Tek, Mann! Wie steht’s?« Angesichts des übertrieben freundlichen Lächelns wurde Tek irgendwie mulmig.
DC wandte sich kurz zu dem riesigen Kerl um, der sich in der entgegengesetzten Ecke des Zimmers aufgebaut hatte. »He, Split – das ist mein Kumpel Tek. Er versorgt die Waring-Siedlung – und zwar ganz allein.« Split nickte nur. Falls er beeindruckt war, dass jemand in Teks Alter schon solch einen wichtigen Bezirk kontrollierte, ließ er es sich nicht anmerken.
»Was können wir für dich tun?«, fragte DC beinahe fröhlich.
»Ich bräuchte ein bisschen Crack. Hab Probleme mit meinem Lieferanten und dachte, wir könnten ins Geschäft kommen.«
»Liebend gern, Mann, liebend gern. Wie viel?«
»Hab einen Tausender. Was krieg ich dafür?«
»Einen Tausender! Scheiße, vielleicht kann ich dir da unseren Mengenrabatt für Vorzugskunden geben. Gestatte mal kurz, dass ich mich mit meinen Partnern bespreche.« Er verschwand im Nebenzimmer, und Tek war allein mit Split, der ihn misstrauisch beäugte.
Ein paar Minuten vergingen, ehe DC um die Mauer schaute. Tek fühlte sich immer unbehaglicher, so schutzlos mitten in diesem leeren Zimmer zu stehen.
»Du willst jetzt gleich kaufen?«
Tek nickte ungeduldig. Warum sonst wäre er wohl hier?
DC kam mit einem übertriebenen Ausdruck der Enttäuschung zurück in den Raum. »So viel haben wir nicht da, aber das ist weiter kein Problem. Weißt du was – lass einfach das Geld hier, und ich schick Split in ein paar Stunden vorbei; der bringt dir dann, was du brauchst.«
Teks Herz begann heftig in seiner Brust zu schlagen, doch er ließ sich nichts anmerken. DC wusste verdammt gut, dass er jemandem, mit dem er noch nie Geschäfte gemacht hatte, nicht so einfach tausend Dollar hinblättern würde.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie Split langsam die Arme sinken ließ. Hastig überlegte er, wobei es ihn beruhigte, das Gewicht der Maschinenpistole unter seinem regendurchweichten Sweatshirt zu spüren.
Er hatte keine andere Chance, hier rauszukommen, als sich den Weg freizuschießen. Dass Twan ihm beispringen würde, stand außer Frage, aber der Koloss hatte vorhin die Tür hinter ihm abgeschlossen. Es würde also darauf ankommen, die zwanzig Sekunden zu überleben, die sein Freund brauchte, um zum Haus zu rennen und das Schloss aufzuschießen.
»Schon recht, Mann«, hörte er sich murmeln. »Aber ich komme später noch mal her und hol es selbst.« Er schaute DC direkt an, während er sprach, doch in Wirklichkeit konzentrierte er sich aus den Augenwinkeln ganz auf Split.
»Mann, ist doch überhaupt kein Problem. Split macht das wirklich gern. Nicht wahr, Split?«
Der Koloss nickte, sah aber nicht sonderlich begeistert aus.
DCs Worte bestätigten Teks ersten Eindruck. Reden war reine Zeitverschwendung. Besser war’s, gleich die Knarre zu ziehen und damit wenigstens im Vorteil zu sein.
Tek ging unauffällig ein Stück von der Tür weg, auf die Twan hoffentlich in ein paar Sekunden schießen würde. Mit einer raschen Bewegung griff er unter sein Sweatshirt und richtete die Maschinenpistole auf Splits Brust. Die beiden waren tatsächlich völlig überrumpelt. Um sein unverhofftes Glück auch auszunutzen, drückte er ohne weiteres Zögern ab.
Durch das Mündungsfeuer sah Tek, wie sein Opfer nach der Knarre tastete, die er in der Hose stecken hatte. DC hechtete ins Nebenzimmer und griff dabei unter seine Jacke.
Split hatte endlich die Waffe aus der Hose gefischt und wollte auf Tek anlegen, als sie ihm aus der Hand flog. Eine zweite Kugel prallte in seine Brust und riss ihn herum. Er schlug mit dem Gesicht gegen die Mauer und hing dort einen Moment lang, eingerahmt von frischen Kugellöchern.
Tek beobachtete gleichgültig, wie Splits lebloser Körper die Mauer hinunterrutschte und in der Ecke zusammensackte. Es gab Wichtigeres, was ihn beschäftigte. DC war nicht wieder aufgetaucht, und Tek verharrte einige Sekunden lang angespannt. In der plötzlichen Stille dröhnten ihm förmlich die Ohren, und er glaubte schon, dass heute sein Glückstag sei und DC längst durch die Hintertür geflüchtet war.
Aber gerade als er sich zur Haustür umwandte, fing jemand an, wild durch die Trennwand zu schießen – wie es klang, mit irgendeinem vollautomatischen Maschinengewehr. Tek warf sich zu Boden und schoss zurück. Hinter ihm flogen Splitter der Haustür durch die Luft, da Twan mittlerweile erbarmungslos das Schloss unter Beschuss genommen hatte.
Die Wand war inzwischen so mit Kugellöchern durchsiebt, dass er allmählich jede Bewegung auf der anderen Seite erkennen konnte. Voller Panik wurde ihm klar, dass er hier keine weiteren fünfzehn Sekunden mehr überleben würde. Das Gefühl der Unsterblichkeit, das man in seinem Alter praktisch von Natur aus besaß, war ganz plötzlich verschwunden, und zum ersten Mal konnte er sich vorstellen, tot zu sein.
Es fiel ihm schwer zu atmen und allmählich noch schwerer, etwas zu sehen. Die Lampe in der Ecke hatte DCs erste Salve nicht überlebt. Rauch, Mörtelstaub und kleine Gesteinspartikel trieben in der Luft, dass seine Augen brannten und er fast erstickte. Tek ließ die leere Pistole fallen und warf sich auf den Bauch. Der Schimmelgestank im Teppich vermischte sich mit dem durchdringenden Pulvergeruch.
Er musste irgendwie hier raus. Durch die Bretter vor dem Fenster drangen ein paar spärliche Lichtstrahlen, die rasch von der dicken Luft verschluckt wurden. Mit angehaltenem Atem rappelte er sich auf, rannte geduckt zum Fenster und sprang mit dem Kopf voran dagegen. Er rechnete fest damit, entweder jeden Moment erschossen zu werden oder halb bewusstlos auf dem Boden liegen zu bleiben. Doch die Bretter waren so verfault und durch die Schüsse noch mürber geworden, dass sie zu seiner eigenen Überraschung nicht mehr Widerstand boten als Glas.
Er landete in dem mit Müll übersäten Hof neben dem Haus. Mühsam schaffte er es, sich aufzurappeln und um die Ecke zu humpeln. Twan stand mit seiner Uzi in der Tür, die inzwischen offen war, ballerte wild in den Raum und brüllte dabei wüste Beschimpfungen.
»Los, weg hier!«, rief Tek.
Trotz der knatternden Gewehrschüsse hörte ihn sein Freund, und sie liefen Seite an Seite den Weg zurück, den sie gekommen waren. Tek riss Twan die Waffe aus der Hand und gab blindlings einige Schüsse ab, um jeden abzuschrecken, der etwa auf die Idee kam, sie zu verfolgen.
In einem der Nachbarhäuser schlief Katerina Joy Washington in einem voll gestopften Wohnzimmer auf einer Couch. Schüsse waren für sie nicht ungewöhnlicher als ein Lachen oder das Brummen von Automotoren, und sie regte sich kaum. Gestern war ihr dritter Geburtstag gewesen, und sie hielt noch immer die Puppe umklammert, die ihre Mutter ihr geschenkt hatte. Sie hatte sie den ganzen Tag über nicht aus den Händen gelassen.
2. Kapitel
Greenbelt, Maryland 15. Oktober
Unruhig lief Reverend Simon Blake unter den grellen Scheinwerfern auf und ab und spürte, wie ihm der Schweiß den Rücken hinunterrann. Er blieb kurz stehen und wischte sich über die Stirn.
»Es gibt etwas Wichtiges, über das ich mit euch reden will. Es ist etwas, das unsere Familien bedroht, unser Land – ja, sogar Christus selbst«, vertraute er den fünftausend eifrigen Gesichtern an, die zu ihm aufschauten. Er hielt das Mikrofon dichter an seine Lippen, während er wieder auf und ab zu laufen begann.
»Es ist Satans größte Waffe. Sein größter Fluch – Drogen.«
Der wöchentliche Gottesdienst näherte sich langsam dem Ende. Neben seinen Predigten hatte es zwei Stunden lang mitreißende Musik gegeben, Interviews mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und neue erbauliche Geschichten. Die Show wurde in drei Sprachen übersetzt und in sieben Länder ausgestrahlt. Ein achtes Land würde nächste Woche hinzukommen, falls seine Anwälte ihre unverschämt hohen Gehälter wert waren.
Hoch ragten die Wände seiner Kirche über ihm auf; trotzdem wirkte er darin nicht klein und verloren. Im Gegenteil, er schien eins zu sein mit dem gewaltigen Gebäudekomplex aus Beton und Glas. Eins mit der wachsenden Erregung seiner Gemeinde.
Bei seinen Worten, die dank einer supermodernen PA-Anlage durch die Kirche hallten, horchte die Menge merklich auf. Wenn es um Sex und Drogen ging, konnte man sich immer ungeteilter Aufmerksamkeit sicher sein.
Vor fünfzehn Jahren hatte er in seinen Predigten noch von Gottes Liebe und Erlösung gesprochen und geglaubt, er könne von seiner kleinen Kapelle im westlichen Maryland aus die Welt mit einer schlichten Botschaft der Hoffnung verändern. Damals war er noch so naiv gewesen.
Im Lauf der Jahre hatte sich alles verändert. Zitate aus der Bibel waren ersetzt worden durch Zitate von prominenten Politikern, und statt von allumfassender Liebe und vom Frieden predigte er heute eine ultrakonservative politische Haltung.
Das riesige Gotteshaus war vor knapp zehn Jahren vollendet worden und hatte fast zehn Millionen Dollar gekostet. Je mehr sich seine Einstellung und die Botschaft, die er verkündete, verändert hatte, desto weniger hatte ihm die kleine Kapelle und die treue Gemeinde genügt, die in seiner Jugend so wichtig für ihn gewesen war. Er hatte es leichten Herzens aufgegeben, alle Gesichter zu kennen, die zu ihm aufschauten, um stattdessen über Seelen auf der ganzen Welt zu gebieten.
»Der Herr hat mir immer und immer wieder aufgetragen, unsere Kinder zu retten – denn sie sind die Zukunft!« Seine Gemeinde bekundete lebhaft ihre Zustimmung.
»Er hat mir gesagt, dass Satan jeden von uns haben will, doch vor allem will er unsere Kinder. Das Böse schmiedet unablässig seine finsteren Ränke und denkt immer an die Zukunft.«
Er verstummte, blieb regungslos stehen und schaute fast eine Minute lang über die Menge hinweg, während seine Lippen sich im stillen Gebet bewegten. Es war einer seiner bevorzugten dramatischen Kunstgriffe, den Eindruck zu erwecken, als schicke ihm Gott höchstpersönlich gerade eine vertrauliche Botschaft – hier und jetzt. Die Menge reagierte, wie sie es stets tat. Das Stimmengewirr schwoll in dem höhlenartigen Kirchenraum immer stärker an, bis es ihn traf wie eine Flutwelle. Blake stand mit ausgestreckten Armen da und spürte, dass die Herzen und Köpfe der Gläubigen offen für ihn waren, damit er sie mit seiner Weisheit fülle. Der Weisheit Gottes.
»Wisst ihr, was seine Waffen sind?«, sagte er mit ruhiger Stimme ins Mikrofon. Die Gemeinde verstummte so rasch, dass es schien, als sei plötzlich eine durchsichtige Wand vor der Bühne niedergelassen worden. Er wiederholte seine Worte für all diejenigen, die ihn wegen des Lärms nicht gleich verstanden hatten.
»Wisst ihr, was Satans Waffen sind?« Er beantwortete seine Frage selbst. »Die Drogen.«
Erneut bekundete die Menge laut ihre Zustimmung.
Vor Jahren hatte ihn der wachsende Rauschgiftkonsum – besonders bei Jugendlichen – beunruhigt. Jetzt war er von diesem Thema geradezu besessen. Überall gab es Süchtige – sogar in seiner Kirche. Er konnte sie direkt wittern, diese Sonntagsfrömmler, wie er sie nannte, die in seine Gemeinde kamen, um unterhalten zu werden und ihr schlechtes Gewissen zu beschwichtigen. Anschließend gingen sie nach Hause und vergaßen Gott bis zum nächsten Sonntag. Daheim trieben sie Unzucht, tranken, rauchten Marihuana oder begingen noch schlimmere Sünden. Diese scheinheiligen Heuchler würden für ihre Lasterhaftigkeit bezahlen und bis in alle Ewigkeit in den Flammen der Hölle brennen, das wusste er; aber vorher würden sie noch andere mit sich ins Verderben reißen. Und der Herr hatte ihm den Auftrag erteilt, dem ein Ende zu machen.
Blake marschierte zum Ambo und nahm eine abgegriffene Bibel, die er vor vielen Jahren von seinem Vater bekommen hatte. Er hob sie hoch über seinen Kopf.
»Schon die Bibel warnt uns vor den Übeln hochprozentiger Getränke«, rief er zornig. »Aber Satan hat es nicht beim Alkohol belassen. Nein, er erfand noch heimtückischere Dinge, um die Menschheit zu versklaven. Heute haben wir Marihuana. Wir haben Kokain. Wir haben Heroin. Und glaubt nur nicht, dass es das in eurer Nachbarschaft, in den Schulen eurer Kinder nicht gibt. Es ist überall!«
Schweißtropfen und Speichel flogen durch die Luft, während er auf der Bühne hin und her rannte und weiter ins Mikrofon brüllte.
»Dass die Regierung euch vor dieser Pest schützt, braucht ihr gar nicht erst zu hoffen. Die Liberalen behaupten zwar gern, sie stünden auf der Seite des kleinen Mannes, aber ich kenne die Wahrheit.« Er deutete mit einer dramatischen Geste in die Menge. »Wir alle kennen die Wahrheit!«
Blake legte die Bibel zurück und fuchtelte heftig mit der freien Hand durch die Luft.
»Ihnen geht es nur darum, bloß keinen Drogendealer zu kränken.« Mit einer lächerlich tiefen Stimme tat er, als spräche er zu einer imaginären Frau neben ihm. »Es tut mir ja aufrichtig Leid, dass Sie gestern überfallen worden sind, Mrs. Smith, aber wir möchten die Täter lieber nicht bestrafen – das könnte schließlich gegen ihre Bürgerrechte verstoßen.«
Blake lachte leise und schüttelte den Kopf. Die Menge lachte mit ihm. Er hatte immer schon gewusst, dass eine gute Predigt einer Achterbahnfahrt glich. Nur wenn sich Eindringlichkeit und Ernst auch mal mit einem kleinen Scherz oder einem lockeren Spruch abwechselten, erreichte man die größtmögliche Wirkung. Andernfalls ermüdete man die armen Kreaturen lediglich.
»Es gibt etwas, das ich euch allen sagen muss«, fuhr er in seinem vertraulichen Ton fort und seufzte. »Lasst mir nur zuerst einen Augenblick, um mich zu fassen.«
Er setzte sich und schaute wieder in die Menge. Trotz der grellen Scheinwerfer konnte er die besorgten Gesichter in den ersten Reihen erkennen. Er gab dem Leiter des Chors ein Zeichen, der sich umdrehte und »The Old Rugged Cross« anstimmte. Als der Chor einfiel, gestattete sich Blake ein trauriges Lächeln. Es war ein Lied, das ihn stets besonders berührte.
Wenn er auf seinem Platz saß, dem Chor lauschte und den Blick durch seine Kirche schweifen ließ, verspürte er stets ein wenig Bedauern. Es war unbestreitbar, dass sie funktional gebaut war. Sie bot Platz für Tausende, war akustisch perfekt, es gab genügend Parkplätze, und die gesamte Technik zur Bild- und Tonübertragung war raffiniert versteckt. Was ihn störte, war die Atmosphäre. Er hatte sich eine eher gotische Kirche vorgestellt, mit Buntglasfenstern und kunstvoll verziertem Mauerwerk. Bekommen hatte er dagegen ein sprödes Zeugnis des menschlichen Intellekts und kein Monument des menschlichen Geistes, wie er es erhofft hatte. Die schroffen Winkel und die kahlen Wände kündeten von nüchterner Mathematik und berührten weder Herz noch Seele.
Die Architekten, mit denen er sich immer noch vor Gericht herumstritt, wehrten sich mit der Behauptung, dass sie ihm die Zeichnungen in jedem Stadium des Entwurfs vorgelegt und er sie alle genehmigt hätte. Aber was verstand er schon von Aufrissen und Konstruktionsplänen? Er war ein Mann Gottes.
Mit der Vollendung seiner Kirche hatte Blakes Vorherrschaft auf dem heiß umkämpften Markt der Fernsehprediger begonnen. Sein Unternehmen war rasch expandiert, womit er von Anfang an gerechnet hatte, und sein Bekanntheitsgrad war stetig größer geworden durch eine endlose Reihe von Büchern, die Ghostwriter für ihn geschrieben hatten, durch eine kleine Hochschule in Tennessee und dank einer kontinuierlich wachsenden Gruppe mächtiger politischer Verbündeter. Wenn der Herr nicht für die Seinen sorgte, gab es genug Kongressabgeordnete, die es stattdessen taten, das hatte Blake schon frühzeitig in seiner Karriere entdeckt. Um sein gutes Verhältnis zu den Männern an der Macht zu festigen, spendete er regelmäßig namhafte Summen für diverse Wahlkämpfe und unterstützte seine Verbündeten nachhaltig mit sämtlichen Medien seines immer weiter expandierenden Konzerns.
Natürlich waren diese Verbündeten genauso gottlos wie Schwerverbrecher in der Todeszelle. Lasterhafte Männer, denen es lediglich darum ging, die eigene Macht, den eigenen Einfluss zu mehren. Huren. Doch der Herr hatte ihn gelehrt, dass es gerade diese Schwächen waren, durch die sie so lächerlich leicht zu manipulieren waren. Er ignorierte einfach, dass in ihren finsteren Herzen nur Gier und Lüsternheit hausten. Ihre Interessen waren belanglos – sie waren lediglich Werkzeuge. Und durch ihn waren sie, ohne es zu wissen, zu Gottes Werkzeugen geworden.
Als die letzte Strophe von »The Old Rugged Cross« durch die Kirche hallte, ging Blake mit gesenktem Kopf zurück zu dem Ambo. Er holte tief Atem, was in der ganzen Kirche deutlich zu vernehmen war.
»Es bekümmert mich so sehr, dass ich nicht weiß, wie ich es in Worte kleiden soll«, begann er. »Ein Kind unserer Gemeinde ist letzte Woche ermordet worden.«
»Nein!«, schrien einige. »Herr, rette uns!« Blake hob eine Hand und forderte Ruhe.
»Bobby McEntyre war sechzehn. Er war in der Footballmannschaft seiner Highschool. Er war ein guter Student und aktiv in seiner Kirche tätig.« Blakes Augen wurden feucht, und eine Träne lief über seine Wange. Er strich sich mit dem Ärmel seines dunklen Anzugs übers Gesicht und wischte sie weg. Die Gemeinde bekundete murmelnd ihre Anteilnahme.
»Bobby wollte mit ein paar Freunden zu einem Supermarkt in East Baltimore fahren.« Blake zuckte heftig die Schultern. »Es war ein ganz gewöhnlicher Mittwochabend – nicht spät – ungefähr acht Uhr. Bobbys Freunde begriffen erst gar nicht, was geschehen war, als ihre Windschutzscheibe zersprang.« Er machte eine Pause. »Die Polizei sagt, ein paar Drogendealer seien in Streit geraten, und diese guten christlichen Jungen waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort.« Blake wandte sich um und schaute auf zu der großen Skulptur des gekreuzigten Jesus vor den Orgelpfeifen im Bühnenhintergrund. »Zur falschen Zeit am falschen Ort«, wiederholte er, an den Erlöser gewandt, mit brechender Stimme.
Das war das Stichwort für die Techniker in der Kabine, ein Video einzuspielen, das einen lachenden Bobby McEntyre zeigte, der mit seinem jüngeren Bruder ausgelassen Football spielte. Als diese Bilder auf den Monitoren in der Kirche und gleichzeitig auf den Fernsehschirmen von Millionen Zuschauern erschienen, begann eine Frau im Publikum laut zu weinen. Er ging zum Rand der Bühne und blinzelte ins Scheinwerferlicht.
»Mr. und Mrs. McEntyre, kommen Sie bitte zu mir.« Er streckte seine Hand aus, um einer pummeligen Frau Anfang vierzig auf die Bühne zu helfen. Ihr Ehemann folgte ihr. Beide hatten Tränen in den Augen. Blake nahm sie fest in seine Arme und drehte sie herum, sodass sie ins Publikum und in die Kameras schauten.
»Ich wollte, dass die McEntyres zu mir heraufkommen, damit wir alle unser Mitgefühl bekunden und ihnen sagen können, dass wir sie in unsere Gebete einschließen.« Die Gemeinde murmelte zustimmend. »Außerdem wollte ich ihnen sagen, dass ich in Bobbys Namen ein Stipendium für die Lord’s Baptist University gestiftet habe.«
Die McEntyres umarmten Blake, drückten unter Tränen ihre Dankbarkeit aus und stammelten, wie glücklich ihr Sohn darüber gewesen wäre. Einige in der Menge applaudierten. Blake schaute den McEntyres hinterher, als man sie zu ihren Sitzplätzen in der ersten Reihe zurückführte.
»Ich weiß, dass Bobby nun im Paradies ist, doch in seinem Herzen muss große Traurigkeit herrschen, dass er so eine wundervolle Familie verlassen musste.«
Ein Mann am Bühnenrand gab ihm ein Zeichen, dass nur noch fünf Minuten Sendezeit übrig waren. Blake sah es aus den Augenwinkeln, nickte kaum merklich und ging zurück zum Ambo. Man musste darauf achten, dass die Realitäten des Fernsehens nicht die Spannung zerstörten und die Gläubigen aus dem Gefühl rissen, die Gegenwart Gottes zu spüren.
»Ich will, dass jeder in dieser Kirche und jeder, der uns daheim zuschaut, sich an dem erbitterten Kampf des Herrn gegen die Drogen beteiligt. Schreibt an euren Kongressabgeordneten! Schreibt eurem Senator! Schreibt dem Präsidenten! Sagt ihnen, dass wir die Nase voll haben!« Blake schlug mit der Faust aufs Pult, was über die PA-Anlage wie eine Explosion klang.
»Wartet nicht bis morgen – schreibt noch heute«, drängte er. »Wir können Amerika von den Dealern zurückerobern, aber wir müssen endlich damit anfangen! Ich will nicht noch mehr Eltern in meiner Gemeinde so leiden sehen wie die McEntyres.«
Er ging zurück zur Bühnenmitte, wo er beide Arme hoch in die Luft hob.
»Gott segne euch alle«, rief er. Dank der Mikrofone und der fast perfekten Akustik des Gebäudes drang seine Stimme in alle Winkel. Es war seine übliche Schlussformel, die das Ende des Gottesdienstes einleitete.
Der Chor stimmte sein letztes Lied an, während Blake durch eine unauffällige Tür im Bühnenhintergrund verschwand.
Dort wartete bereits sein Chauffeur auf ihn. »Direkt zurück ins Büro, Reverend?«
»Ja. Schaffen wir es bis halb zwei dorthin?«
Carl schaute auf seine Uhr und runzelte die Stirn. »Hängt vom Verkehr ab, aber ich tue mein Bestes.«
Fast lautlos glitt die große schwarze Limousine durch den leichten Nachmittagsverkehr, was dem Mann hinter dem Steuer zu verdanken war. Blake saß auf dem Rücksitz, nippte an einer Cola und blätterte durch die Washington Post. Die New York Times und die LA Times lagen unberührt neben ihm auf dem weichen Ledersitz.
Auf der Titelseite der Post prangte das Bild eines jungen Farbigen. Es war unverkennbar ein altes Schulfoto. Man sah dem Jungen förmlich an, wie unbehaglich er sich mit ordentlich gekämmtem Haar und blütenweißem Kragen fühlte. Blake überflog den Artikel und zog eine Grimasse, als er die ersten Absätze las.
Der Bericht handelte von einem Jungen, der im Zentrum Washingtons lebte und sich wiederholt geweigert hatte, Drogen zu probieren, trotz des wachsenden Drucks seiner Freunde. Seine Haltung hatte die Drogendealer der Gegend derart provoziert, dass sie auf die Idee verfallen waren, ihn mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Blake blätterte um und fand auf der nächsten Seite ein weiteres Bild. Es zeigte den Jungen im Krankenhaus, von oben bis unten bandagiert. Das einzige sichtbare Stückchen Haut war ein kleiner Fleck auf der rechten Schulter. Seine Augen waren verdeckt mit dicken runden Kompressen, die aussahen wie Schwämme, mit denen man Autos polierte. Durchsichtige Plastikschläuche liefen von seiner Nase aus zu einer komplizierten Apparatur neben dem Bett.
Angewidert riss Blake den Artikel heraus und stopfte ihn in seine Aktentasche. Zu schade, dass der Junge kein Weißer war – eine solche Geschichte würde garantiert eine Rekordkollekte einbringen.
Blake rutschte etwas zur Seite, damit er das Gesicht seines Fahrers sehen konnte. »Haben Sie von dem Jungen in Washington gelesen, den man angezündet hat?«
»Hab ich, Reverend. Bricht einem das Herz, was?«
»Warum passiert so was? Kann man denn gar nichts tun, um diese Kinder von Drogen fern zu halten?«
Carl war einer der wenigen Farbigen, die Blake gut kannte. Er ging davon aus, dass die Farbigen eine homogene Gemeinschaft bildeten und sein Chauffeur ihr Sprecher war.
»Ich weiß nicht, Reverend. Die meisten Kids, die ich kenne, haben zu Hause kaum so was wie ein Familienleben. Und selbst wenn sie es hätten, würde es nichts nutzen. Der Druck, cool zu sein, Drogen zu nehmen und dieser ganze Kram – der ist ziemlich stark, wissen Sie? Und irgendwann kommt die Zeit, wo die Kids nicht mehr länger auf ihre Eltern hören wollen. Es ist einfach das alte Problem – die Kids wollen erwachsen sein, sich wichtig fühlen.«
Blake schmunzelte. Carl hatte wirklich ein gottgegebenes Talent zur Vereinfachung. »Ich erinnere mich noch an meine Kindheit und wie wichtig es war, dazuzugehören«, räumte er ein. »Aber ich erinnere mich nicht, dass man die unbeliebten Kinder kurzerhand angezündet hätte.« Er rutschte wieder zur Mitte des Sitzes und schaltete einen kleinen Fernseher ein, um zu signalisieren, dass das Gespräch vorüber war.
Der Verkehr wurde dichter, als der Highway in die zweispurige Straße überging, die durch Baltimore führte. Carl fuhr weiter nördlich am neuen Baseballstadion von Camden Yards vorbei und nahm eine Nebenstraße zum Parkhaus unter dem Gebäude, das die Verwaltungszentrale der Kirche beherbergte. Blake sprang so eilig aus dem Wagen, dass er fast seine Aktentasche vergessen hätte. Rasch ging er durch das dunkle Parkdeck zum Fahrstuhl. Seine Uhr zeigte 13.35, und er wusste, dass John Hobart seit exakt fünf Minuten wartete. Unpünktlichkeit gehörte nicht zu Hobarts Schwächen.
Für seine Verwaltungszentrale hatte Blake den gesamten vierzehnten Stock eines rund neuntausend Quadratmeter großen Bürogebäudes gemietet, das im Inner Harbor von Baltimore bereits als Wolkenkratzer galt. Jeder, der zufällig in dieser elegant eingerichteten Etage landete, würde wahrscheinlich zunächst glauben, er sei in einer großen Anwaltskanzlei. Der beigefarbene Teppichboden war ebenso luxuriös wie die massive Holztäfelung und die antiken Mahagonitische, auf denen Kristallvasen mit Trockenblumen standen, und an den Wänden hingen Gemälde, denen man ansah, dass es sich um Originale handelte. Die Angestellten trugen dunkle Anzüge und die Sekretärinnen Röcke in gedeckten Farben und frisch gestärkte weiße Blusen. Nur die leise geistliche Musik, die aus unsichtbaren Lautsprechern kam, deutete auf die wahre Natur der Firma hin.
Blake schritt eilig am Empfang vorbei, ohne den Gruß der jungen Frau zu erwidern, die dort hinter dem Schreibtisch saß. Als er in sein Vorzimmer kam, machte ihm die Sekretärin ein Zeichen, dass bereits jemand auf ihn wartete. Blake warf seinen Mantel aufs Sofa und ging durch die offene Tür ins Büro.
»Tag, John. Entschuldigung, dass ich zu spät bin.«
»Kein Problem, Reverend, ich bin auch gerade erst gekommen«, erwiderte John Hobart und schaute von dem Notizblock auf, der auf seinem Schoß lag.
Blake setzte sich ihm gegenüber und zog einen Stift aus der Tasche. Er spürte, dass Hobart ihn beobachtete, doch er vermied es, seinen Blick zu erwidern. Hobarts Augen wirkten stets irgendwie starr und leblos, als sähe er alles, was man lieber verbergen würde, und nur Menschen, die sich in ihrer Macht unangreifbar fühlten, hielten diesem Blick stand; jeder andere reagierte unwillkürlich mit einem nervösen Lachen.
Nachdem Blake eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens geworden war, hatte er gemerkt, dass er Personenschutz brauchte und einen professionellen Sicherheitsdienst für seine Kirche. Aus diesem Grund hatte er vor fünf Jahren John Hobart angeheuert, der beste Referenzen vorzuweisen hatte. In Vietnam hatte er bei einer Einheit der Special Forces gedient und war mit hohen Orden ausgezeichnet worden. Nach seiner Rückkehr hatte er seinen Abschluss als Wirtschaftsprüfer gemacht und war erfolgreich in einem großen Unternehmen tätig gewesen, doch die langweilige und belanglose Arbeit als Buchhalter hätte ihn mit der Zeit zermürbt, wie er Blake erklärt hatte, deshalb war er Ende der siebziger Jahre in die Drug Enforcement Administration, die amerikanische Bundesdrogenbehörde, eingetreten.
Blake hatte ihn bei ihrer ersten Unterredung nicht besonders sympathisch gefunden – sein Sohn würde vermutlich sagen, dass John ein Fiesling sei – und zunächst weiter nach einem Sicherheitsberater gesucht. Wochenlang hatte er Bewerbungsgespräche mit Leibwächtern geführt, die mit Steroiden voll gepumpt waren, mit heruntergekommenen Privatdetektiven und drittklassigen Ex-Polizisten. Anschließend hatte er sich noch einmal Hobarts Lebenslauf vorgenommen, obwohl man ihm bereits eine höfliche Absage geschickt hatte, und ihn zu einem zweiten Gespräch bestellt. Blake hatte zwar seine Meinung über ihn nicht geändert – bis heute nicht –, aber letzten Endes hatte es ausgesehen, als sei Hobart die beste Wahl.
Er hatte noch keinen Grund gehabt, seine Entscheidung zu bereuen. Hobart hatte einen Sicherheitsdienst auf die Beine gestellt, vor dem sogar der Mossad Respekt hätte. Dass er kein besonders umgänglicher Mensch war und nicht sehr religiös zu sein schien, war für Blake zweitrangig im Vergleich zu seiner persönlichen Sicherheit und der seiner Familie.
Außerdem hatte er mit der Zeit auch Hobarts Kenntnisse als Wirtschaftsprüfer bei gewissen finanziellen Transaktionen schätzen gelernt. Der Reverend hielt sich zwar für einen grundehrlichen Menschen, hatte sich aber an die angenehmen Dinge des Lebens gewöhnt und war zunehmend süchtiger geworden nach politischer Macht, was nun einmal seinen Preis hatte. Seine Spenden an verschiedene Regierungsmitglieder erfolgten nicht immer über hundertprozentig legale Wege, was für etliche Leute äußerst peinlich werden könnte, doch Hobart hatte zu diesem Zweck etliche Scheinfirmen gegründet und Auslandskonten eingerichtet, die selbst bei gründlichster Überprüfung absolut einwandfrei aussahen.
Blakes Sekretärin schaute zur Tür herein. »Tut mir Leid, dass ich störe, Reverend, aber Senator Haskins ist auf Leitung eins.«
Blake stand auf und ging zu seinem Schreibtisch. »Danke, Terry.«
Hobart beugte sich wieder über seinen Block und drehte mit einem unterdrückten Grinsen seinen Stuhl so, dass er seinem Chef den Rücken zuwandte.
Der Senator und der Fernsehpfarrer, die beide ständig über die guten alten Werte predigten.
Blake hatte in den letzten fünf Jahren beträchtliche Summen in Kampagnen gesteckt, mit denen eine ›Rückkehr zu den alten Werten‹ gefördert werden sollte. Eine schändliche Geldverschwendung, wie Hobart fand. Der Reverend stammte aus einer netten, weißen Familie der Mittelschicht im westlichen Maryland; Dad war Prediger, Mom blieb zu Hause, buk Pasteten und kümmerte sich um ihre statistischen 2,5 Kinder. Blake schien zu denken, dass Menschen, die von dieser göttlichen Norm abwichen, das aus freien Stücken taten. Er glaubte, man könne jeden davon überzeugen, dass ein gesundes, erfülltes Familienleben wichtiger sei als alles andere, und jeder, den man überzeugt hatte, wäre sofort bekehrt.
Hobart wusste es besser. Er war in einer armen Arbeiterfamilie in New York aufgewachsen, und ein größerer Kontrast zu Blakes idyllischer Kindheit war kaum denkbar.
Für seinen Vater war der kleine John eine einzige Enttäuschung gewesen, und nach ein paar Drinks hatte schon der bloße Anblick seines Sohnes ihn in heftige Wut versetzt. Wie die meisten Männer hatte er gehofft, sein Stammhalter würde eine jüngere Version seiner selbst werden. Er hatte sich einen sportlichen, kräftigen Jungen gewünscht, aus dem einmal ein trinkfester, raubeiniger Mann werden würde. Doch sein Sohn war sehr viel kleiner als seine Mitschüler, blass und dünn wie eine Bohnenstange, wofür er John die Schuld zu geben schien, als habe der Junge das Wachsen nur eingestellt, um ihn zu ärgern. Für Sport interessierte John sich überhaupt nicht. Über alles liebte er Schach, ein Spiel, das sein Vater mit seiner beschränkte Intelligenz nicht einmal begriff.
Ein paar Tage nach Hobarts fünfzehntem Geburtstag war seine Mutter wie jeden Dienstag mit Einkäufen beladen heimgekommen. Als sie um die Ecke bog, sah sie zwei Streifenwagen mit blitzendem Blaulicht vor ihrem Haus parken. Sie hatte sofort ihre Taschen fallen lassen und war losgerannt. Ihr Mann verprügelte sie und John nach seinen Sauftouren regelmäßig und war mit der Zeit immer gewalttätiger geworden. Sie war überzeugt, dass ihr Sohn tot war.
In Panik stürzte sie zur Tür herein. John saß auf einem Küchenstuhl, baumelte mit den Beinen und lutschte an einem Eis. Ein Polizist kauerte neben ihm und redete ihm leise zu. Er berichtete ihr, es habe einen Unfall gegeben. Ihr Ehemann sei die Treppe hinuntergefallen und habe sich das Genick gebrochen.
Sie war wie erstarrt gewesen, doch mehr als der Tod ihres Mannes hatte sie der vollkommen emotionslose Ausdruck auf dem Gesicht ihres Sohns entsetzt. Der Polizist war ihrem Blick gefolgt und hatte erklärt, er habe wahrscheinlich einen Schock. Sie hatte sich zu ihm gekniet und in seine Augen geschaut. Und dort hatte sie gesehen, was in Wahrheit an diesem Tag geschehen war.
Dieser Vorfall hatte John Hobarts gesamte Lebenseinstellung geprägt. Die meisten Probleme der Menschheit wurzelten in jahrhundertealten, oft widersprüchlichen moralischen Vorschriften. Für einen Mann, der genug Intelligenz und Entschlossenheit besaß, sich über diese unsinnigen Kategorien von Richtig und Falsch hinwegzusetzen, gab es kein Problem, das nicht rasch und für immer gelöst werden konnte. Obwohl es so simpel war, hatte Hobart noch nie jemanden getroffen, der diese Erkenntnis ebenfalls erfasst und die innere Stärke gehabt hätte, danach zu leben. In Vietnam hatte es ein paar Männer gegeben, die angefangen hatten, es zu verstehen, aber alle waren süchtig nach dem Töten geworden – süchtig nach dem Gefühl absoluter Macht, durch das sie vorübergehend ihre Schuldgefühle und ihr Entsetzen vergessen konnten. Für Hobart war das Töten lediglich ein Mittel zum Zweck, und er gebrauchte dieses Mittel gedankenlos, zielstrebig und ohne Skrupel.
»Tut mir Leid«, entschuldigte sich Blake und legte den Hörer auf. »Was steht heute auf der Tagesordnung?«
Hobart stand auf und schloss leise die Bürotür. »Nichts Besonderes, Reverend. Ich wollte nachfragen, ob Senator Haskins das Geld, das er verlangt hat, inzwischen bekommen hat – aber das scheint ja der Fall zu sein.« Er deutete zum Telefon. »Außerdem wollte ich Ihnen mitteilen, dass ich wegen des neuen Lifts verhandelt habe, als wir unseren Mietvertrag verlängert haben. Anfang nächster Woche haben Sie einen Schlüssel zum Fahrstuhl ganz rechts. Außer in Notfällen wird keiner der anderen mehr in dieses Stockwerk fahren. Es hat mich doch etwas beunruhigt, dass man so leicht Zutritt zu Ihrem Büro hat. Irgendein verrückter Drogensüchtiger könnte ohne weiteres hier heraufspazieren und unsere Sekretärin überfallen.«
Blake nickte. Er war nicht besonders begeistert davon, in seinem eigenen Büro regelrecht eingesperrt zu sein, aber von solchen Sachen verstand sein Sicherheitsberater mehr als er. Sie mochten notwendig sein, doch ihn beschäftigten wichtigere Dinge.
»Haben Sie heute den Artikel in der Post gelesen über diesen Jungen, den man angezündet hat, weil er keine Drogen nehmen wollte? Ich hab ihn mir auf der Fahrt hierher angeschaut.«
John stieß ein kurzes Lachen aus. »Es ist eine verrückte Welt, Reverend«, meinte er gleichgültig und blätterte zur nächsten Seite seines Blocks. Blake sah anhand der Überschrift, dass Hobart wohl über irgendwelche Offshore-Konten mit ihm reden wollte, doch ihm gingen im Moment ganz andere Zahlen durch den Sinn.
»Wie viel gibt die USA für den Kampf gegen Drogen aus?«
Hobart blickte automatisch auf seine Uhr, und Blake ärgerte sich wie jedes Mal über diese Angewohnheit, bei einem Gespräch ständig auf die Uhr zu schauen.
»Nun?«, fragte er hörbar gereizt.
Hobart legte frustriert den Block auf den Tisch. »Jährlich? An die fünfzehn Milliarden Dollar, schätze ich.«
»Und wie viel haben wir als Kirche im letzten Jahr Politikern gespendet, die für Recht und Ordnung sorgen wollen?«
Hobart überlegte einen Moment. »Schwer zu sagen, Reverend. Wir listen das nirgends gesondert auf.«
»Schätzen Sie.«
»In etwa zwei Millionen. Geben Sie mir ein paar Tage, dann nenne ich Ihnen genaue Zahlen.«
ENDE DER LESEPROBE