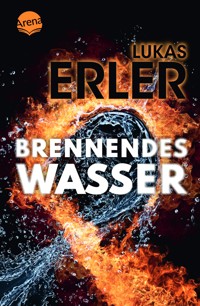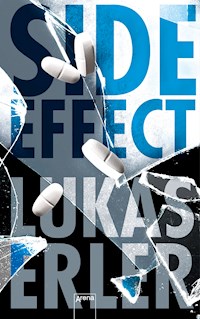9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Krimiserie um den blinden Ermittler Cornelius Teerjong
- Sprache: Deutsch
Ein brisanter Fall für Kunstprofessor Cornelius Teerjong: Ein berühmtes Gemälde Leonardo da Vincis ist aus der Villa eines Kunstmäzens gestohlen worden. Die Diebe bieten das Kunstwerk für eine üppiges Lösegeld zum Rückkauf an. Einzige Bedingung: Teerjong soll das Lösegeld übergeben. Doch der Deal endet in einem mörderischen Fiasko. Bei der Übergabe in einem Amsterdamer Hotelzimmer wird Teerjong niedergeschlagen, als er aufwacht, sind die Diebe tot. Und auf der Tatwaffe sind seine Fingerabdrücke...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch:
Ein brisanter Fall für Kunstprofessor Cornelius Teerjong: Ein berühmtes Gemälde Leonardo da Vincis ist aus der Villa eines Kunstmäzens gestohlen worden. Die Diebe bieten das Kunstwerk für ein üppiges Lösegeld zum Rückkauf an. Einzige Bedingung: Teerjong soll das Lösegeld übergeben. Doch der Deal endet in einem mörderischen Fiasko. Bei der Übergabe in einem Amsterdamer Hotelzimmer wird Teerjong niedergeschlagen, als er aufwacht, sind die Diebe tot. Und auf der Tatwaffe sind seine Fingerabdrücke …
Zum Autor:
LUKASERLER, geboren 1953 in Bielefeld, wurde mit seinen Romanen »Ölspur« und »Mörderische Fracht« für den Friedrich Glauser-Preis nominiert. Für seinen ersten Jugendroman erhielt er 2015 die »Segeberger Feder«. »Der blinde Samurai« ist nach »Auge um Auge« der zweite Fall für den blinden Ermittler Cornelius Teerjong. Lukas Erler lebt mit seiner Familie in Nordhessen.
Lukas Erler
DER BLINDE SAMURAI
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe September 2019 Copyright © 2019 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Arcangel Images/Hayden Verry
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
cb · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-22024-2V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
»Everybody has a plan – until they get punched in the face.«
(Mike Tyson)
Warming up
Boston, im Oktober 2015
Alles läuft wie geschmiert.
Er hört es, wenn ein Tresor besiegt ist. Schon bevor die Safe-Tür wirklich aufschwingt, bevor er sehen kann, was sich dahinter verbirgt, weiß er, dass er gewonnen hat. Der Tresor stirbt mit einem unhörbaren Ächzen, und das entschädigt ihn für die stundenlange Anspannung, den Schweiß und die Angst. Es ist ein guter Tresor. Ein Trident der Sicherheitsstufe 6, dem weder Schweißbrenner noch Stemmeisen etwas anhaben können und der jeden Diamantbohrer alt aussehen lässt. Nachgerüstet mit einem elektronischen Tastenkombinationsschloss und eingemauert in die Wand der Bibliothek, war er ein würdiger Gegner. Und jetzt ist er erledigt.
An der ganzen Ostküste gibt es niemanden sonst, der dieses Monster hätte öffnen können. Jedenfalls nicht in drei Stunden und vier Minuten.
Aber alles ist glattgegangen. Von Anfang an hat er bei dieser Sache ein gutes Gefühl gehabt. Die Beschreibung des Hauses in Beacon Hill stimmte, der Weg durch den Garten war leicht zu finden und die Alarmanlage an der Kellertür ein Witz. Sehr ungewöhnlich für einen der reichsten Stadtteile von Boston.
In seinem Rücken hört er ein leises Hüsteln und dreht sich um. Stevie grinst und reckt anerkennend den rechten Daumen. Dann tippt er mit dem Zeigefinger auf das Zifferblatt seiner Armbanduhr und schaltet die Stablampe aus. Reglos verharren sie in der Dunkelheit und hören, wie draußen die Bullen in die Straße einbiegen. Alle sechzig Minuten umrundet ein Streifenwagen des Boston Police Department das Anwesen mit dem riesigen, parkähnlichen Garten. Auch das hat der Informant vorausgesagt. Genauso wie er gewusst hat, dass nur zwei weibliche Angestellte im Haus sein würden. Die Köchin und eine Haushälterin liegen jetzt gefesselt und geknebelt in einem der Schlafzimmer. Stevie hat sich um sie gekümmert. Hoffentlich nicht zu sehr. Er ist manchmal ein bisschen extrem, aber man kann sich seine kleinen Brüder nicht aussuchen.
Hauptsache, der Plan funktioniert.
Die Stablampe wird wieder angeschaltet. »Jetzt mach schon«, sagt Stevie. »Hol das Ding raus!«
Der Kleine hat recht. Vollkommen geräuschlos öffnet sich die Tresortür, und vor ihnen liegt das Paket. Vielleicht fünfzig mal siebzig Zentimeter groß, zehn Zentimeter hoch, eingeschlagen in festes Packpapier. Es wird sie reich machen. So unglaublich reich, dass sie nie wieder einen Finger rühren müssen. Vorsichtig hebt er es mit beiden Händen heraus, dreht sich dabei zu Stevie um, der ihn erwartungsvoll anlächelt. Und dann sieht er den alten Mann.
Er steht in der Tür zur Bibliothek und starrt fassungslos in den Raum. Von einer Sekunde auf die andere ist er aufgetaucht. Ein dicker, kahlköpfiger Typ, dessen Unterlippe vor Aufregung zittert. Wie ist das möglich? Zwei Personen sind im Haus, hat der Informant gesagt. ZWEI! Scheiße, Scheiße, Scheiße, der Alte öffnet jetzt seinen Mund zu einem gellenden Schrei, und dann ist Stevie bei ihm, reißt ihn herum und hat plötzlich ein Messer in der Hand.
Auf dem Hals des Mannes erscheint ein roter, höhnisch grinsender zweiter Mund, der immer breiter wird und dann aufklappt. Und statt eines Schreies schießt eine unvorstellbare Menge Blut heraus. Der alte Mann ist tot, bevor Stevie ihn auf den Parkettboden fallen lassen kann.
»Großer Gott, warum hast du das getan?«
Sein Bruder schaut ihn kühl an und wischt das Messer an der Jacke des Toten ab. »Reiß dich zusammen«, sagt Stevie. »Alles läuft wie geschmiert!«
Eins
Frankfurt, 22. Januar 2016
Lavendel!
Der Geruch der Finsternis war plötzlich da. Ganz schwach konnte er ihn wahrnehmen. Ihn herausfiltern aus einer Vielzahl von Gerüchen, die sich teils vermischten, teils in Schichten zu überlagern schienen. Ein Duft, der nur seinem Kopf entsprang. Heute, jedenfalls. Damals in Frankreich war er real gewesen. Als er die Ränder der violetten Felder plötzlich verzerrt sah und begriff, dass die Zeit der Dunkelheit begonnen hatte. Das war lange her.
Reiß dich zusammen. Hier gibt es nur Schweiß und Adrenalin.
Nichts davon war gefährlich, und er war gut vorbereitet. Er wippte auf den Fußballen und spürte das leichte Nachgeben der Matte. Die Geräusche um ihn herum, das Stampfen und Aufschlagen der Körper und das unterdrückte Stöhnen waren verstummt. Er hatte die ungeteilte Aufmerksamkeit des Dojos.
»Ippon-Seoi-Nage!«, sagte der Mann, der rechts von ihm am Mattenrand stand. »Cornelius ist Tori. Abstand eine Armlänge. Hajime!«
Cornelius Teerjong verbeugte sich. Tori zu sein bedeutete, dass er angreifen musste. Er machte einen raschen Schritt nach vorn, streckte beide Arme aus und krallte seine Finger in die Jacke seines Gegenübers. Er spürte, wie umgekehrt dessen Hände nach ihm griffen und ihn zurückdrängten. Kuzushi, dachte er, brich das Gleichgewicht! Die Stimme des alten Trainers hämmerte in seinem Kopf. Wenn du geschoben wirst, dann zieh – wenn du gezogen wirst, dann schiebe! Cornelius verstärkte die Vorwärtsbewegung seines Gegners, indem er sich ein wenig nach hinten fallen ließ, drehte dann lehrbuchmäßig ein, umfasste mit der Linken dessen rechtes Handgelenk, glitt mit der rechten Hand unter der Achsel seines Trainingspartners hindurch, bekam den Stoff der Jacke in Oberarmhöhe zu fassen und warf den neunzig Kilo schweren Mann über die rechte Schulter zu Boden. Einen kurzen Moment blieb er, nach vorn gebeugt und die Hände auf die Knie gestützt, stehen und brachte seinen Atem wieder unter Kontrolle. Dann richtete er sich auf und verbeugte sich. Ein überwältigendes Triumphgefühl durchströmte ihn. Dieser Wurf war fantastisch. Jedes Mal, wenn er spürte, wie sein Gegner vom Boden abhob, sich scheinbar gewichtslos in eine Flugbahn drehte und dann mit jenem typischen Klatschen auf der Matte landete, hätte er vor Begeisterung schreien können.
Ein starker Anfang, aber es war noch nicht vorbei. Konzentrier dich!
Er wandte sich dem Trainer zu und verbeugte sich in dessen Richtung. Gerade noch rechtzeitig.
»Tai-Otoshi, Ko-Soto-Gari, Ko-Soto-Gake und Ko-Uchi-Gari! In dieser Reihenfolge«, sagte der Alte. Cornelius verbeugte sich erneut, ging in die Ausgangsstellung und vergewisserte sich, dass auch sein Partner wieder in Position war. Seine Nervosität war verflogen. Er hatte alle Würfe in den letzten Monaten bis zur Erschöpfung trainiert. Die Bewegungsabläufe waren automatisiert und sein körperliches Selbstbewusstsein so stark wie nie.
Tatsächlich gab es keine nennenswerten Probleme. Sein Trainingspartner verteidigte sich energisch und effektiv, aber Cornelius gelang es jedes Mal, sein Gleichgewicht zu brechen und den Wurf durchzubringen. Die Kleine Innensichel musste er wiederholen, weil er seinen Fuß zu hoch angesetzt hatte, aber am Ende waren alle zufrieden.
»Die Prüfungen für den Gelb-Orange-Gurt finden am Freitag statt. Cornelius ist dabei«, sagte der Trainer und löste mit dieser Feststellung ein diszipliniert erfreutes Gemurmel aus. »Nicht schlecht für einen blinden alten Professor«, sagte sein Trainingspartner mit einem breiten Lächeln in der Stimme. Am äußeren Rand der Halle applaudierte jemand langsam und rhythmisch, und obwohl es ihm unangenehm war, musste Cornelius grinsen. Beifallsbekundungen dieser Art waren im Dojo nicht üblich, aber Jenny Urban hatte sich noch nie um irgendwelche Konventionen gekümmert. Einer der vielen Gründe, warum er sie liebte.
Als sie sich zwanzig Minuten später vor dem Sportzentrum trafen, war sie immer noch aufgekratzt und bester Laune. »Das war großartig! Du hast dich in den letzten Monaten enorm verbessert. Jordan Mouton wäre stolz auf dich.«
Seit Cornelius mit dem Training begonnen hatte, war Jenny ein Fan der blinden amerikanischen Judoka, deren unglaubliche Technik in zahlreichen Internet-Videos zu bewundern war.
Cornelius grinste. »Vielen Dank! Ich dachte mir, ich fliege im Sommer nach Houston und nehme Unterricht bei ihr! Sie soll sehr gut aussehen!«
Für Cornelius war es völlig bedeutungslos, dass Menschen irgendwie aussahen, und natürlich wusste Jenny das, aber manchmal konnte er einfach nicht widerstehen, sie mit ihrer Eifersucht aufzuziehen. Es funktionierte nach viereinhalb Jahren Beziehung immer noch zuverlässig. Er registrierte, dass sie einen winzigen Moment stutzte, und trat sicherheitshalber einen Schritt zur Seite. Dennoch landete ihr Ellenbogen ungebremst und schmerzhaft in seinen Rippen. Dann schlang sie ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn. »Kannst du das nicht ein Mal lassen?«
»Ab morgen. Ab morgen lasse ich es!« Er hakte sich bei ihr ein, und gemeinsam gingen sie zu dem Parkplatz, auf dem Jennys Auto stand. Cornelius stieg auf der Beifahrerseite ein, Jenny schob eine Joe-Cocker-CDin die Stereoanlage des alten Golfs, und mit You can leave your hat on glitten sie langsam durch den dichten Frankfurter Abendverkehr.
»Wollen wir noch irgendwo was trinken?«
»Machen wir zuhause«, sagte Cornelius. »Was hältst du von einem Vollbad mit viel Schaum und einem Gläschen Champagner?«
»Mmmhh, heißt das, du musst nicht noch was arbeiten? Durchlesen? Vorbereiten? Irgendwen anrufen?«
»Definitiv nein!«
»Gut«, sagte Jenny gedehnt, und Cornelius hörte an dem leicht angerauten Stimmklang, in welche Richtung ihre Fantasie sich bewegte. »Wir sind gleich da.«
Sie fuhr in die ruhige Seitenstraße im Nordend, die er wie immer an den Schlaglöchern und einem typischen Geräusch des Straßenbelages erkannte, und bog dann nach links in eine Kieseinfahrt ab, die zu dem etwa fünfzig Meter zurückliegenden Haus führte, das Cornelius von seinen Eltern geerbt hatte. Jenny hielt vor dem Garagentor, stieg aus, um es zu öffnen, und ließ den Motor währenddessen laufen. Cornelius wollte ebenfalls aussteigen, drückte den entsprechenden Hebel an der Innenseite der Beifahrertür herunter und musste feststellen, dass die Tür sich keinen Millimeter bewegte. Jenny öffnete inzwischen das Garagentor. Trotz des im Leerlauf schnurrenden Motors hörte er deutlich das leicht kreischende Geräusch, als es nach oben schwang.
Und dann einen schrillen Schrei, der nur den Bruchteil einer Sekunde andauerte. Jenny!
Erneut suchten seine Finger den Hebel, dieses Mal drückte er kräftig mit der Schulter gegen die Tür, zunächst erfolglos, dann wurde sie plötzlich aufgerissen. Er landete mit dem Oberkörper auf dem Kiesweg, jemand zog ihn ganz aus dem Auto und riss seinen Kopf an den Haaren hoch. Als sein Mund sich zum Schreien öffnete, schob sich ein kaltes, rundes Stück Metall hinein.
»Hey, Blindfisch«, sagte eine leise Stimme mit osteuropäischem Akzent. »Kannst du schmecken, was das ist?«
Cornelius war außerstande, sich zu bewegen. Sein Herzschlag schien kurz auszusetzen und dann mit einem brutalen Hämmern den Brustkorb sprengen zu wollen. Die Angst und der Revolverlauf im Mund nahmen ihm den Atem, und seine Lunge brannte. Dann schrie Jenny ein zweites Mal. Der Lauf wurde tiefer in seinen Mund gerammt, und er begann heftig zu würgen. Noch einmal beugte der Mann sich zu ihm hinunter. »Denk nicht mal dran, dich zu bewegen. Sie wird jetzt ruhig sein!«
Der letzte Teil der Drohung brachte Cornelius dazu, sie in den Wind zu schlagen. Er umfasste mit der Linken das Handgelenk des Mannes, riss den Revolver aus seinem Mund und bäumte sich auf. Seine rechte Hand griff dorthin, wo er die Beine des Angreifers vermutete, und bekam ein Knie in einer weiten Baumwollhose zu fassen. Er ballte die Finger zur Faust und stieß sie an der Innenseite des Beines entlang nach oben in den Schritt des Mannes. Der gab einen unterdrückten Schrei von sich und schlug ihm mit der schweren Waffe auf den Kopf. Es war, als ob eine Granate unter seiner Schädeldecke explodierte. Der Schmerz war so heftig, dass er nach vorn kippte und mit dem Gesicht über den Kies der Einfahrt schrammte. Sechs Monate Training und nicht der Hauch einer Chance. Das hier war kein sportlicher Kampf, sondern ein Albtraum aus Demütigung und Todesangst. Einen kurzen Augenblick lang verlor er das Bewusstsein, dann trat der Angreifer mit seinem vollen Gewicht auf Cornelius’ Finger, und der Schmerz holte ihn zurück. Wenn jemand denkt, er hat die Oberhand,dann brich sie ihm! Wer hatte das gesagt? Der Mann schien sich zu entfernen, offenbar war er auf die Fahrerseite des Wagens gewechselt und öffnete die Autotür. Ein vertrautes quietschendes Geräusch.
Jennys alter Golf knatterte immer noch im Leerlauf. Trotz des lauten Motors konnte Cornelius jetzt aufgeregte Stimmen aus den Nachbarhäusern hören. Dann knirschende Schritte auf dem Kiesweg, die sich rasch näherten. Der zweite Mann, der in der Garage Jenny angegriffen hatte, riss die Beifahrertür auf und trat Cornelius beinahe beiläufig in den Magen. Die Tür wurde zugeknallt, dann setzte der Golf rückwärts aus der Einfahrt auf die Straße und verschwand mit aufheulendem Motor. Die Stimmen aus den Nachbarhäusern klangen jetzt lauter, jemand rief nach der Polizei. Cornelius richtete den Oberkörper auf und schrie vor Schmerz, als er versuchte, sich mit der verletzten linken Hand abzustützen. Völlig unmöglich. Er konnte sie nicht benutzen, hielt den Arm weit von sich gestreckt und bewegte sich auf den Knien mit der rechten Hand über den Kies tastend vorwärts. Wo genau war er? Tausend Mal war er in den letzten Jahren diese Einfahrt entlanggegangen, aber dabei war er auf den Beinen gewesen und hatte seinen Stock benutzen können. Sich auf Knien zu orientieren war etwas völlig anderes. Außerdem war ihm entsetzlich übel. Der wütende Schmerz in seinen Eingeweiden trieb seinen Mageninhalt nach oben, und die heftiger werdenden Explosionen in seinem Kopf torpedierten jeden klaren Gedanken.
Er krallte seine Finger in den Kies, nahm einen Stein auf und warf ihn mit einer weit ausholenden Bewegung nach vorn. Der Kiesel traf die Hauswand mit einem leisen Klacken, und Cornelius versuchte aus dem Geräusch auf die Entfernung zum Haus zu schließen. Doch die Echoortung funktionierte nicht wie sonst. Vielleicht war er zu nah am Boden. Er warf einen zweiten Stein, dann einen dritten, der das Badezimmerfenster traf. Das Geräusch war heller, prägnanter. Drei oder vier Meter, dachte er, mehr nicht. Er kroch jetzt schneller, versuchte verzweifelt die Vorwärtsbewegung seiner Knie in Schrittlängen umzurechnen und erreichte die Hauswand. Nun nach links und dann nach rechts. Wenige Augenblicke später roch er die Garage. Öl, Benzin und ein leicht erdiger Geruch, der von den nachlässig gereinigten Gartengeräten an den Wänden ausging. Wo war Jenny? Seine rechte Hand glitt an der Hauswand entlang, bis sie die zementierte Einfassung der geöffneten Garagentür erreichte, und fuhr dann über den rauen Betonboden.
»Jenny?!« Er schrie in die Garage hinein. Keine Antwort. Dafür wurden die Stimmen der Nachbarn in seinem Rücken lauter. Jemand rief nach der Polizei. Von irgendwoher näherte sich eine Sirene, die hoffentlich zu einem Notarztwagen gehörte. Sie musste hier sein. Verletzt oder tot. Cornelius setzte sich wieder in Bewegung, rutschte auf den Knien vorwärts und tastete mit der rechten Hand den Garagenboden ab. Seine Finger gerieten in eine schmierige Substanz, die sich dennoch körnig anfühlte, und da wusste er, wo genau er war. Vor zwei Wochen hatte der Golf in der Garage über Nacht Öl verloren. Jenny hatte die große Lache mit Sägemehl bestreut und ihm ausführlich erklärt, wo sie sich befand. Im vorderen Drittel der Garage, ziemlich genau in der Mitte. Versuche einfach, nicht durchzulatschen.
»Scheiß drauf!«, sagte er laut und kroch weiter. Dann fand er sie. Trotz der Angst und der starken Gerüche in der Garage konnte er auf einmal ihre körperliche Präsenz vor sich auf dem Boden wahrnehmen. Seine Hände berührten die Sohlen ihrer Stiefel, glitten hoch zum Oberkörper und zum Handgelenk. Der Arm war schwer und leblos, die Hand kalt. Er beugte sich weiter vor, strich mit den Fingern über ihr Gesicht und tastete nach ihrer Halsschlagader. Nein, das war nicht möglich, großer Gott … Jetzt nichtdurchdrehen! Cornelius zwang sich zur Ruhe, brachte sein Ohr nahe an Jennys Mund und Nase, legte es dann auf ihre Brust und konzentrierte sich. Keine Atmung! Wieder fuhren seine Finger an ihrem Hals entlang, wussten, wo sie zu suchen hatten, doch da war nichts. Kein Atem. Kein Puls. Jennys Herz stand still.
Zwei
Eli Weidmann beobachtete den Mann, der das Gaspedal durchtrat und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fuhr. Er trug einen dunklen Trainingsanzug und eine graue Wollmütze, die er tief in die Stirn gezogen hatte. Sein hartes, verschlossenes Gesicht war von zahlreichen Narben gezeichnet, die auf eine lange Karriere als Schläger und Messerkämpfer schließen ließen. Er würde heute Nacht noch nach Rostock fahren und morgen früh um sieben Uhr auf einer Fähre nach Lettland sein. Weidmann hatte ihn über seine Kontakte in Ventspils und Riga angeheuert und sorgfältig darauf geachtet, jemanden zu finden, der noch nie mit irgendwelchen Geheimdienstaktivitäten in Berührung gekommen war. Der heutige Abend hatte nichts mit dem Mossad zu tun, und es gab nichts, was ihn mit dem Letten in Verbindung bringen würde. Gut so, dachte er. Er war froh, ihn nicht töten zu müssen. Er lotste den Mann zu einem Parkplatz in der Nähe des Eschenheimer Turms und bedeutete ihm den Motor abzustellen.
»Den Taser«, sagte er. Der Lette reichte ihm den Elektroschocker und bekam dafür zweitausend Euro in einem Briefumschlag und den Schlüssel für einen alten Toyota Corolla, der drei Reihen weiter geparkt war. »Der Wagen hält bis Rostock durch. Stellen Sie ihn einfach am Hafen ab, und seien Sie pünktlich bei der Fähre.«
Der Mann nickte wortlos, stieg aus und stapfte davon. Weidmann wartete, bis der Toyota den Parkplatz verlassen hatte, rutschte dann auf die Fahrerseite und startete den Golf. Er fuhr Richtung Museumsufer und warf den Taser bei einem türkischen Imbiss, der sich auf einem Boot befand und in den Wintermonaten geschlossen war, in den Fluss.
Was für ein beschissener Job. Ausgerechnet er hatte die Botschaft aller Terroristen und Stalker dieser Welt überbracht: »Ihr werdet niemals sicher sein!«
Eli Weidmann ging zurück zum Auto und rief eine Nummer in Antwerpen an. Schon nach dem zweiten Läuten war jemand am Apparat.
»Ihre Vorspeise wurde zugestellt. Das ganze Menü kann jederzeit ausgeliefert werden.«
»Ich lasse Sie den Termin wissen«, sagte eine trockene kultivierte Männerstimme. »Behalten Sie ihn im Auge.« Dann war die Verbindung unterbrochen.
Drei
Sie ist tot.
Wenn du nichts tust, ganz sicher!
Cornelius stemmte sich gegen die heranrollende Panik und versuchte sich zu erinnern, was er gelernt hatte.
Herzdruckmassage.
Mit nur einer Hand?
Einen winzigen Augenblick lang dachte er daran, die Linke mit einzusetzen, aber er hatte Angst, vor Schmerz ohnmächtig zu werden. Er riss Jennys Bluse auf, platzierte den rechten Handballen auf der Mitte des Brustkorbes, spreizte die Finger und streckte den Arm durch. Dann beugte er sich so weit vor, dass seine Schulter sich senkrecht über dem Brustbein befand und er sein Körpergewicht einsetzen konnte.
Seit er in Frankfurt arbeitete, hatte er jedes Jahr an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. Die Stimme des ruppigen Notarztes, der die Kursteilnehmer regelmäßig anfuhr, wenn sie zu zimperlich waren, lärmte in seinem Kopf: Nicht wie ’n Mädchen, verdammt! Drücken Sie das Brustbein fünf Zentimeter nach unten. Haben Sie keine Angst, ein paar Rippen zu brechen. Wenn der Mensch überlebt, wird er Ihnen dankbar sein. Wenn nicht, sind die Rippen auch egal. Kennen Sie noch das Lied »Staying Alive« von den Bee Gees? Laden Sie sich den Song auf Ihr Handy! Er gibt den richtigen Takt vor: 100 Beats pro Minute. Das ist genau Ihr Tempo! Legen Sie los!
Cornelius begann nach einer Minute zu keuchen. Bei den Übungen an den Dummys hatten sich die Kursteilnehmer alle zwei Minuten abwechseln können. Wie lange würde er das hier durchhalten? Whether you’re a brother or whether you’re a mother, you’re staying alive, staying alive … er hatte nicht nur die Taktfrequenz, sondern auch den bescheuerten Text noch im Kopf, aber schon jetzt war er völlig fertig. Schweiß umgab ihn wie eine feine Wolke, und in seinem rechten Schultergelenk begann ein dumpfer Schmerz zu wüten. Er schaffte es nicht. Verdammte Bee Gees. Einhundert Beats in der Minute war viel schneller, als er gedacht hatte. Einundzwanzig – zweiundzwanzig – dreiundzwanzig: in diese Zeile gehörten sechs Herzmassagen. Mit einem Arm? Er konnte, trotz des Einsatzes seines Körpergewichtes, nicht mehr genug Kraft aufbringen.
Drücken Sie das Brustbein fünf bis sechs Zentimeter runter.
Unmöglich.
Wissen Sie, was passieren kann, wenn Sie zu schwach sind?Dann reicht der Druck nicht aus, um das Gehirn zu durchbluten.
Ruhig jetzt, um Gottes willen!
Sie kriegen vielleicht das Herz wieder in Gang, aber im Kopf kommt nichts an. Dann haben Sie einen Hirntoten mit ’nem prima Herzschlag!
Halt die Klappe, Arschloch!
Er hielt einen Augenblick inne, tastete nach Jennys Halsschlagader, nichts …
Reiß dich zusammen!
Ich kann nicht mehr.
Hören Sie nicht auf, bis professionelle Hilfe eintrifft.
Wo blieb der Notarztwagen? Es musste eine Ewigkeit her sein, seit er die näher kommende Sirene gehört hatte. Und wo waren die verdammten Nachbarn? Life goin’ nowhere, somebody help me, I’m staying ali-i-i-i-ive … Wissen Sie, was passiert, wenn Sie zu schwach sind?
Bin ich nicht!
In seinem Rücken war ein Geräusch, das er so noch nie gehört hatte, aber er wusste sofort, was es war. Ein Auto fuhr mit derart hoher Geschwindigkeit die Einfahrt hoch, dass der Kies wegsprang, und kam mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Türen wurden aufgerissen und zugeknallt, drei Stimmen, zwei Männer und eine Frau: »In der Garage!«
Jemand fasste ihn an den Schultern und schob ihn unsanft beiseite. »Ich mache für Sie weiter. Gehen Sie weg von ihr.« Eine ruhige, souveräne Frauenstimme, die offenbar das Sagen hatte. »Lars, kümmere dich um den Mann! Kann mal jemand Licht machen?!«
Cornelius kroch auf den Knien nach rechts und spürte, dass ihm eine Decke über die Schultern gelegt wurde. Die Notärztin hatte die Herzdruckmassage wiederaufgenommen. Er konnte sie einen schnellen Viererrhythmus zählen hören.
»Defibrillator!«
»Ist bereit«, sagte einer der Männer.
»Platzieren! Abstand halten! Und los!«
Cornelius registrierte, wie sich die Stimmen von ihm entfernten. Der über einen langen Zeitraum irrsinnig hohe Adrenalinspiegel blockierte seine Wahrnehmung und riss ihn hinab in einen Strudel aus Erschöpfung und Verzweiflung. Die Stimmen wurden schwächer, obwohl die Frau einen zornigen Schrei auszustoßen schien. »Scheeeiiiiße!«
»Adrenalin?«
»Noch mal, Defi!«, kommandierte die Notärztin. »Abstand! Und los!«
»Wir verlieren sie!«
Die Ärztin antwortete etwas Wütendes, das Cornelius nicht verstand. Er hörte ihren keuchenden Atem leiser werden, und dann gab etwas in seinem Kopf nach, und um ihn herum wurde es still.
Vier
»Wir verlieren sie!«
Wen? Jenny hörte Worte, ohne deren Sinn zu begreifen.
»Kommt nicht infrage«, entschied eine Frau. Atemlos und angestrengt, aber sachlich. »Wie heißt sie?«
»Jenny Urban.«
Die Antwort kam von einer verzerrten, halb erstickten Männerstimme, die sie kannte.
»HEY,JENNYURBAN!«, blaffte die Frau. »BLEIBENSIEBEIMIR!«
Nicht so laut. Das tat weh. Alles tat weh. Jeder einzelne Muskel ihres Körpers schmerzte, als habe man sie in Stücke gerissen. Und auf ihrer Brust tobte ein Ungeheuer, das auf und nieder sprang und ihr die Luft aus der Lunge … Aufhören …
»Ich hab sie«, rief die Frauenstimme. »Sie ist wieder da! Her mit der Trage und Anruf im St. Elisabeth: Patientin mit Zustand nach Reanimation. Alle zusammen! Auf drei!«
Jenny wurde hochgehoben und wieder abgelegt. Sie schnappte nach Luft, gierig und voller Angst. Das Monster war von ihrer Brust verschwunden, aber was sie einatmete, roch nach Benzin, Erde und Schweiß. Sie musste husten. Über ihr flackerte eine Neonröhre, die sie blendete. Eine Frau mit kurzen dunklen Haaren beugte sich über sie und leuchtete ihr zu allem Überfluss in die Augen. »Adrenalin bereithalten! Und Abmarsch!«
»Ich will mit!« Noch einmal die vertraute Männerstimme. Aufgeregt, aber nicht mehr so verzweifelt. Cornelius war da.
»Natürlich! Lars, hilf ihm! Können Sie laufen? Und Sie bleiben wach, Frau Urban! Hören Sie mich?«
Als Jenny noch einmal kurz zu sich kam, registrierte sie, dass ein Auto mit aufheulendem Motor startete und sie sich irgendwie darin befand. Jemand hielt ihre Hand. Cornelius?
»Sauerstoff und Zugang legen!«
Meinetwegen, dachte Jenny. Sie fühlte einen Stich im Arm und eine wohlige Wärme, die sich unversehens in lodernde Hitze verwandelte. Zu heiß, das war viel zu heiß, sie würde in diesem Auto verbrennen … würde … Dann tauchte sie in den See.
Die schräg einfallenden Sonnenstrahlen ließen das Wasser smaragdgrün schimmern. Es war ein glühend heißer Augusttag, und Jenny war eben noch an der Wasseroberfläche gewesen, inmitten des übermütigen Gelächters ihrer Freundinnen, mit denen sie hier rausgefahren war. Jetzt bewegte sie sich mit kräftigen Zügen und dennoch geräuschlos nach unten. Sie sah sich selbst durch das Wasser gleiten, eine sehr junge und dünne Jenny, die sich hier unten anmutiger bewegte als an Land. Wie lange würde es dauern, bis ihre Abwesenheit bemerkt wurde? Bis diese blöden Gänse begriffen, dass sie vielleicht ertrunken war? Und alle rumheulten und anfingen, sich Vorwürfe zu machen, dass sie sie so mies behandelt hatten?
Zeit, wieder aufzutauchen und das Ufer anzusteuern. Sie musste Luft holen. Ein Meter bis zur Oberfläche. Höchstens. Die Sonnenstrahlen bildeten einen Korridor aus Licht, der sich unter ihr in einem undurchdringlichen Grau verlor. Sie machte zwei Züge in Richtung Wasseroberfläche, stieß sich kräftig mit den Beinen ab, stieg aber nicht auf. Ihr Fuß hatte sich in etwas verfangen. So heftig sie konnte, trat sie danach, versuchte es mit dem anderen Fuß abzustreifen, aber der unbarmherzige Griff um ihren Knöchel lockerte sich nicht. Das war keine Schlingpflanze oder irgendein anderes Gewächs. Nicht so weit weg vom Grund des Sees. Lieber Gott, bitte …! Die Luft wurde knapp. Unter ihr war etwas, das nicht wollte, dass sie nach oben kam. Etwas, das sie umklammerte und in die Tiefe zog.
Es gibt keine Monster!
Ach nein?
Noch einmal trat sie wild um sich und ruderte verzweifelt mit den Armen, während sie sank und das Licht sich entfernte. Ihre Lunge brannte, sie musste atmen, endlich den Mund öffnen und …
»Mehr Sauerstoff!«
Die Frau, die das Kommando hatte, zog sie zurück an die Oberfläche.
Fünf
»Frau Urban ist stabil und ansprechbar, aber extrem erschöpft. Sie ist noch auf der Intensivstation.«
»Was genau ist passiert?« Cornelius riss sich zusammen. Die atemlos und gehetzt wirkende Sprechweise des jungen Stationsarztes ging ihm auf die Nerven, aber er war heilfroh, überhaupt Informationen zu bekommen.
»Wir haben zwei typische kleine Verletzungen im Brustbereich gefunden und glauben, dass sie mit einer Elektroschockwaffe angegriffen wurde. So ein Ding verschießt zwei kleine Pfeile, die an langen dünnen Drähten hängen. Nachdem die Pfeile in die Haut eingedrungen sind, schickt die Waffe 50.000 Volt starke Spannungsimpulse hinterher. Das holt auch den stärksten Mann von den Beinen. Bei empfindlichen Menschen kann so ein Taser durchaus Kammerflimmern oder einen Herzstillstand bewirken. Aber es geht Frau Urban eigentlich schon wieder einigermaßen gut. Wir haben ihre Körpertemperatur heruntergekühlt, um eventuellen zerebralen Schädigungen vorzubeugen, und kontrollieren fortwährend Atmung, Kreislauf und Blutzucker. Sie ist hier optimal versorgt. In einer halben Stunde können Sie kurz zu ihr. Danach nehmen wir Sie ebenfalls stationär auf. Nur zur Beobachtung.«
Cornelius nickte. Er saß auf einer unbequemen Pritsche in einem überheizten Behandlungsraum und war zu müde, um zu antworten. Natürlich hatten sie auch ihn untersucht und seinen Kopf, die Hand und den Brustkorb geröntgt. Obwohl sein ganzer Körper nur aus Schmerz zu bestehen schien, war er offenbar in den Augen des munteren jungen Unfallchirurgen nicht besonders schwer verletzt. »Sie haben eine Gehirnerschütterung, Ihre Hand ist übel zugerichtet, aber nicht gebrochen, und die Rippen sind auch okay. Ihre rechte Schulter ist massiv gezerrt. Das alles wird noch ziemlich lange wehtun, aber unterm Strich haben Sie Glück gehabt. Etwa in einer Stunde will die Polizei mit Ihnen sprechen. Schaffen Sie das?«
Cornelius nickte erneut.
»Ich lasse Sie jetzt kurz allein. Es kommt gleich jemand, der Sie zu Frau Urban bringt. Dann kriegen Sie auch was Stärkeres gegen die Schmerzen. Laufen Sie nicht weg.« Der Arzt entfernte sich in Richtung Tür, überlegte es sich dann offenbar anders und kam noch einmal zurück. »Sie sind wirklich vollständig blind? Keine Sehreste?«
»Nein.«
»Die Notärztin hat mir erzählt, was Sie getan haben. Mit einem Arm. Das war sehr cool. Meine Kollegin sagt, Sie haben Ihrer Freundin das Leben gerettet.«
»Ich hätte keine Minute länger durchgehalten. Wenn sie nicht gekommen wäre …«
Der Arzt schwieg einen Augenblick und schien Cornelius anzustarren. »Nein, das glaube ich nicht«, sagte er schließlich. »Sie hätten länger durchgehalten. Viel länger. Und irgendwann hätten Sie Ihre Linke mit dazugenommen und auf den Schmerz geschissen!«
Er drehte sich um, und Cornelius hörte, wie sich die Zimmertür hinter ihm schloss. Die Luft in dem kleinen Raum wurde immer wärmer und stickiger. Stimmte es, was der Arzt gesagt hatte? Er hätte es gerne geglaubt, aber als er seine linke Hand vorsichtig bewegte, tat das so weh, dass ihm unmittelbar übel wurde. In einer Stunde will die Polizei mit Ihnen sprechen. Schaffen Sie das? Nicht ohne Schmerzmittel.
Was sollte er den Beamten erzählen? Zumindest, was die unmittelbaren Ereignisse an diesem Abend betraf, konnte er problemlos bei der Wahrheit bleiben. Schwieriger wurde es, wenn sie wissen wollten, ob er hinsichtlich der Täter einen Verdacht hatte. Selbstverständlich hatte er den, aber abgesehen davon, dass es nicht den Hauch eines Beweises gab, wäre es sehr dumm gewesen, den Bullen zu erzählen, was in Antwerpen vor einem Jahr geschehen war. Zum Beispiel, dass er den gänzlich unschuldigen Diamantenhändler Coen Malinsky mit einem gefälschten Beweisfoto gezwungen hatte, seine Geheimdienstverbindungen zum Aufspüren von Marten Rykers spielen zu lassen. Und dass er Malinskys Informationen bedenkenlos benutzt hatte, um Jenny aus der Hand ihres Entführers zu befreien, wohl wissend, dass dieser Handel zur Ermordung des ehemaligen Blauhelmsoldaten führen sollte. Er hatte sich für die Polizei damals eine komplizierte Lügengeschichte ausgedacht, die der BKA-Beamte Leonard keinen Augenblick lang geglaubt hatte. Und dieser Polizist hatte ihr letztes Gespräch mit einem Satz beendet, den Cornelius nicht vergessen hatte: Wenn sich herausstellt, dass Sie mich verarscht haben, bringe ich Sie in den Knast. Und es kümmert mich einen Dreck, dass Sie blind sind.
Sechs
»Das Bett rechts von Ihnen. Sie haben fünf Minuten.« Jenny war wach, als die junge Krankenpflegerin Cornelius in den Raum schob, und erschrak bei seinem Anblick.
Er sah nicht gut aus. Das Gesicht mit dem kurzen rotblonden Bart war sehr blass, und die Anstrengungen und Schmerzen der letzten Stunden hatten ihm ein paar tiefe neue Falten beschert. Sein linker Arm ruhte angewinkelt in einer Schlinge, die Hand war grün-schwarz verfärbt und glänzte ungesund. Er führte den Teleskopstab wie immer in der rechten Hand, aber die Tastbewegung am Boden war zögernd und unsicher, und sie begriff, dass er auch den rechten Arm nur unter Schmerzen bewegen konnte. Cornelius setzte sich zu ihr auf die Bettkante, und Jenny streichelte vorsichtig mit den Fingerspitzen über seine rechte Hand. »Hast du Schmerzen?«
»Ich krieg gleich was dagegen. Wie ist es mit dir?«
»Die haben mich sauber abgeschossen. Ich spüre gar nichts mehr und schlafe dauernd ein. Als ich dieses Ding abgekriegt habe, das hat furchtbar wehgetan, aber jetzt ist alles gut.«
»Wir haben beide Glück gehabt. In ein paar Tagen sind wir wieder auf den Beinen.«
Jenny schwieg und spürte, wie ihr die Tränen kamen. »Kannst du mich mal küssen? Als Vorschuss?«
»Wenn ich meinen Kopf zu dir runterbeuge, explodiert er.«
»Bloß nicht.« Cornelius’ Gesicht begann vor ihren Augen zu verschwimmen, aber Jenny war entschlossen, die wenigen Augenblicke mit ihm zu nutzen. »Was waren das für Leute?«
»Genau weiß ich es nicht.«
»Die hätten uns auch umbringen können.«
»Ja«, flüsterte Cornelius. »Aber das wollten sie noch nicht.«
Jenny schloss die Augen. Seine Stimme schien mitten in ihrem Kopf zu sein und ein wenig nachzuhallen. Dann schlief sie ein, ohne zu verstehen, was sie an diesem Satz so beunruhigend fand.
Sieben
Vierzehn Tage später erwachte Cornelius nachts, weil Jenny neben ihm schrie. Er zog sie an sich und streichelte sie, bis ihr Atem sich beruhigte. Als sie eingeschlafen war, drückte er einen Knopf an seiner Armbanduhr und fragte die Zeit ab. Es ist 4.15Uhr, sagte eine sanfte Frauenstimme. Noch mindestens zwei Stunden bis zum Aufstehen. Beinahe sofort begannen seine Gedanken zu kreisen, und er wusste, dass an Schlaf nicht mehr zu denken war.
Behutsam, ohne Jenny aufzuwecken, brachte er sich in eine bequemere Liegeposition und versuchte seine Schulter zu entlasten. Die malträtierte linke Hand hatte sich erholt, und er hatte auch die Kopfschmerztabletten absetzen können, aber der Schmerz in der Schulter erinnerte ihn jeden Augenblick daran, was in der Garage geschehen war.