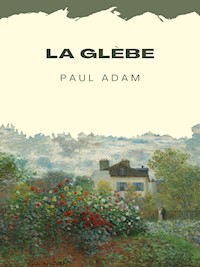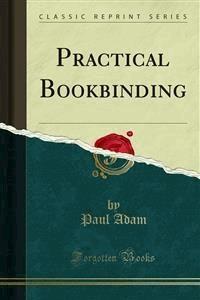1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In 'Der Bucheinband: Seine Technik und seine Geschichte' bietet Paul Adam eine umfassende Untersuchung des Buchbindens, beginnend bei den frühesten Techniken bis hin zu modernen Entwicklungen. Der Autor kombiniert fundierte historische Analysen mit praktischen Erläuterungen, was das Werk sowohl für Historiker als auch für Hobbybuchbinder interessant macht. Adams prägnanter und anschaulicher Schreibstil ermöglicht es den Lesern, die technologische Evolution des Bucheinbands und dessen Einfluss auf die Literatur und Kultur nachvollziehen zu können. Auf kunstvolle Weise verknüpft er technische Details mit kulturellem Kontext, weshalb dieses Buch als ein unverzichtbares Nachschlagewerk in der Buchwissenschaft angesehen werden kann. Paul Adam gilt als eine der herausragenden Stimmen in der Welt der Buchherstellung und -theorie. Sein umfangreicher Hintergrund in Kunstgeschichte und Restaurierung hat ihn dazu inspiriert, die oft übersehene Kunst des Buchbindens in den Mittelpunkt zu rücken. Durch seine langjährige Praxis und umfassende Forschung hat er ein tiefes Verständnis für die ästhetischen und technischen Aspekte des Bucheinbands entwickelt, was in diesem Werk deutlich zur Geltung kommt. 'Der Bucheinband' ist eine essentielle Lektüre für all jene, die sich für die Verbindung von Literatur, Kunst und Handwerk interessieren. Egal, ob Sie Buchbinder, Historiker oder einfach nur leidenschaftlicher Leser sind, Adams beeindruckende Darstellung der Buchbinderei wird Ihnen neue Perspektiven auf die Bedeutung und den Wert des geschriebenen Wortes eröffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Bucheinband: Seine Technik und seine Geschichte
Inhaltsverzeichnis
I. DIE TECHNIK DER BUCHBINDEREI.
Randverzierung von einem egyptisch-arabischen Einbande.
ERSTER ABSCHNITT. Die Anfertigung des Buches bis zum Beschneiden.
1. Einleitung.
Der Vorläufer unseres heutigen Bucheinbandes ist das im römischen Altertum und im Mittelalter gebräuchliche Diptychon. Dasselbe bestand aus zwei mit Wachs überzogenen Schreibtafeln von Holz oder Elfenbein, die mittels metallener Ringe oder Pergamentstreifen zusammengehalten wurden und auf der äußeren Seite mit Schnitzwerk reich verziert zu sein pflegten. Von der Zeit an, in welcher die Pergamenthandschriften üblich wurden und größeren Umfang annahmen, heftete man jedoch ganz ähnlich wie in neuerer Zeit die Lagen mit Zwirn an Pergamentstreifen in der Weise, daß der Faden von innen durch den Bruch der Lage gestochen, um den Pergamentstreifen herum und in die innere Seite zurückgeführt wurde.
So entstand der sogenannte Bund, wie er noch heute bei allen Bänden üblich ist, die auf Bund geheftet sind.
Man wird kaum irren, wenn man annimmt, daß die Entstehung der heutigen Buchform mit dem Beginn des Christentums zusammenfällt, während vordem vorzugsweise die Papyrusrolle zur Herstellung von Handschriften diente. Die Lagen der Pergamentbogen wurden je nach der Zahl der ineinander gesteckten Doppelblätter als Ternen, Quaternen, Quinternen und Sexternen bezeichnet. Die Vierzahl wird indeß die üblichste gewesen sein, denn späterhin wurde die Lage schlechtweg stets als Quaterne bezeichnet, und der neufranzösische Ausdruck für Heft — cahier — (quayer im altfranzösischen) hat sich aus quaternus entwickelt.
Der heute bei den Fachleuten für Kalbspergament gebräuchliche Ausdruck Velin, Vellum oder Velum ist die Bezeichnung für das lateinische membranae, dessen Paulus in seinem Briefe von Timotheus (II) erwähnt (τὰς μεμβράνας).
Die für besonders wertvoll erachtete Handschriften übliche Elfenbeindecke, deren Ursprung auf die Diptycha des Altertums zurückzuführen ist, wurde im Laufe der Zeit durch Holzplatten ersetzt, die man indeß auch durch reiche Verzierung mit Metall, Edelsteinen u. s. w. zum Kunstwerk zu gestalten suchte. Wir werden im zweiten Teile dieses Werkes auf die geschichtliche Entwickelung der Buchdecke des Näheren zurückkommen.
Um die auf Pergamentstreifen gehefteten Lagen besser zusammenzuhalten, bediente man sich eines breiten Stückes Leder, mit welchem der Rücken und auch die beiden Holzdecken seitlich bis zur Hälfte oder einem Drittel überklebt zu werden pflegten. Die Bundriemen (Pergamentstreifen) wurden bei diesem Verfahren durch die Deckel gezogen. Eine handwerksmäßige Herstellung der Einbände kannte das Mittelalter nicht. Vielmehr war jeder Buchschreiber in den Klöstern sein eigener Buchbinder, und nur bei kostbareren Bänden wurde die Hilfe des Goldschmiedes oder des Elfenbeinschnitzers in Anspruch genommen.
Fig. 1. Weicher Einband mit Überschlag. 14. Jahrh. u. früher.
Das Papier, das den Chinesen lange vor Christus bekannt war, brachten uns die Araber bei ihrer Ausbreitung über die Küsten des Mittelmeeres im 8. und 9. Jahrhundert. Im Orient bildete es das einzige Schreibmaterial, und alles, was von Werken orientalischer Literatur auf uns gekommen, ist auf diesen Stoff geschrieben. Zu der Zeit, da man bei uns noch lange auf Pergament schrieb, wurden im Orient schon die schönsten Miniaturmalereien auf einem Papier ausgeführt, das in Bezug auf Festigkeit wie auf Glätte nichts zu wünschen übrig läßt. Mit der Einführung des Papieres kam auch das Beschneiden der rauhen Ränder auf und damit allgemach auch das Runden der Rücken, wodurch die äußere Form des Buches eine gefälligere wurde. Die gewöhnlichen Handschriften in den Klosterbibliotheken hatten anfangs nur Pergamentumschläge, die zu beiden Seiten lang genug waren, um über einander geschlagen werden zu können. Die hintere Seite lief dann meist in eine Spitze, eine Art dreieckiger Klappe aus, an welche wohl auch Bänder oder Riemchen genäht waren, um das Ganze mehrmals umschlingen und zubinden zu können (Fig. 1).
Den Übergang von diesen weichen Bänden, welche bis ins 15. Jahrhundert hinein üblich waren, zu den späteren, mit seitlich überstehenden Holzdeckeln versehenen, bezeichnet eine Art Schutzdecke, die noch in vielen Beispielen aus dem 15. Jahrhundert erhalten ist. Der Band ist auf Lederbünde geheftet, an denen vorher mit Leder eingefaßte Deckel befestigt sind. Der äußere Lederbezug ist jedoch nicht nach innen eingeschlagen, sondern steht nach allen Richtungen soweit über, daß er die Bogenränder — Schnitt darf man wohl noch nicht sagen — völlig deckte. Zur besseren Befestigung ist er an den eingefaßten Kanten festgenäht (Fig. 2).
Fig. 2. Einband mit überstehendem Leder. 15. Jahrh.
Wir sehen also schon eine ganz merkliche Veränderung, während der leitende Gedanke — Schutz gegen eindringenden Staub — derselbe blieb. Bei dieser Gelegenheit sei auch des Buchbeutel gedacht. Ähnlich wie der eben erwähnte Band gestaltet, zeigt diese Einbandform nur darin einen Unterschied, daß das überstehende Leder am Unterschnitte soweit verlängert ist, um am Ende zusammengefaßt und in einen Knoten verschlungen werden zu können; dieser Knoten trug einen Metallring zum Anhängen an den Leibgurt.
Fig. 3. Buchbeutel. Düsseldorfer Museum.
Wir kennen eine ganze Reihe von bildlichen Darstellungen des Buchbeutels auf Gemälden, Miniaturen, an Holzschnitzereien etc., doch sind in Wirklichkeit nur fünf Buchbeutel bis jetzt bekannt, von denen der schönste in Nürnberg (Anzeiger d. Germ. Mus. 1862, Spalte 324) die anderen in München, Nürnberg, Frankfurt a/M. (v. Bethmann) und in Düsseldorf sich befinden.
In der Folge fiel dies überstehende Leder weg; es wird glatt um die Kanten her geschlagen, ja es ist wohl möglich, daß man von den Buchbeuteln selbst das Überstehende abschnitt, sofern keine Veranlassung mehr vorlag, das Buch als fahrende Habe mit sich zu führen. Damit sind wir denn bis zu der Form des Einbandes gekommen, die im großen ganzen noch heute im Gebrauch ist.
Aufhängen planierter Bogen. (Zu Seite 10.)
Von einem arabischen Einbande.
2. Das Rohmaterial und erste Behandlung vor dem Heften.
Älteste Einrichtung der Lagen. — Aufthun. — Aus dem Falz schlagen. — Planieren. — Flicken. — Falzen. — Karton. — Kleben. — Einpressen.
Zu der Zeit, wo die Herstellung der Handschriften hauptsächlich in Klöstern von schreibkundigen Mönchen, die nicht selten auch Künstler waren und die Schrift mit buntem Zierat, Initialen und Miniaturen versahen, betrieben wurde, blieb auch die Sorge für den Schutz der Handschrift durch eine Umhüllung dem handwerklichen Geschick der Klosterbrüder vorbehalten.
Der handwerksmäßige Betrieb der Buchbinderei begann naturgemäß erst mit der Erfindung des Buchdruckes. Die gedruckten Bogen kamen, wie es noch heute der Fall ist, roh (in albis) zum Buchbinder. Da man die Glättpresse nicht kannte, mußte der Buchbinder zunächst das durch den Druck rauh gewordene Papier glätten. Er bediente sich dazu des »Schlaghammers«. Der technische Ausdruck für diese Vorarbeit war: Aus der Lage schlagen oder Aus dem Falz schlagen. Von der Mitte beginnend wurde die Lage Schlag an Schlag nach dem Rande zu behandelt. Dadurch setzte sich der Druck und das in der Mitte stärkere (Bütten-) Papier wurde kräftig zusammengeschlagen und eine gleichmäßigere Stärke erzielt. Der eiserne Schlaghammer hatte bis zu zwölf Pfund Gewicht. Als Unterlage für die Papierlage diente ein Steinblock, dessen obere Fläche geschliffen war. In Ermangelung dessen benützte man wohl auch Gußplatten, die in einem Holzklotz eingelassen waren. Noch heute sind Schlaghammer und Schlagstein vielfach angewendete Werkzeuge, wenngleich sie durch die glatten und fest satinierten Maschinenpapiere und durch zweckmäßige Maschinen fast ganz entbehrlich geworden sind.
Eine andere vorbereitende Arbeit war das jetzt nur noch ausnahmsweise vorkommende Planieren der rohen Druckbogen, eine Arbeit, die dem Schlagen vorhergehen muß. Die Druckpapiere waren früher ungeleimt, hauptsächlich wohl aus dem Grunde, weil ungeleimtes Papier die Druckfarbe leichter annimmt. Um solchem Papiere besseren Halt und »Griff« zu geben, wird es vor dem Binden mit kochendem Leimwasser durchtränkt, welches, um das Aneinanderkleben der Bogen zu verhüten, während des Kochens einen Zusatz von Alaun erhält, was das Verseifen des Leimes zur Folge hat.
Außer dem Alaun wurden dem Planierwasser auch wohl noch andere Stoffe zugesetzt, wie Eisenvitriol oder eine Coloquintenabkochung, wodurch dem Wurmfraß, der namentlich im Orient zerstörend auftritt, vorgebeugt werden sollte — schwerlich mit Erfolg.
Das beste Planierwasser für Druckpapiere besteht aus ½ Pfd. Leim (besten hellen Kölnischen) der mit Wasser 24 Stunden eingeweicht und abgekocht wird, nebst 4 Liter kochendem Wasser. Damit alle Unreinigkeiten ausgeschieden werden, wird das Leimwasser durch grobes Sackleinen oder ein Haarsieb gegossen, in welches vorher ½ Pfd. Alaun geschüttet wurde. Durch diese Lösung wird das bedruckte Papier Lage um Lage, jede etwa 5 Bogen dick durchgezogen oder einige Zeit eingelegt, bis es sich vollgesaugt hat. Das Gefäß, in dem sich das Leimwasser befindet, soll flach sein und nicht aus Eichenholz, da dieses Holzsäure abgiebt, die dem Papier einen gelben Schein erteilt. Das Beste bleibt für alle Fälle eine große Mulde von Holz oder Metall, wie sie von den Fleischern benützt wird.
Sind alle Druckbogen planiert, so werden sie durch Auspressen von dem überflüssigen Wasser befreit. Nachdem man oben und unten abgängige Papiere zum Schutze vorgelegt hat, bringt man die feuchten Bogen auf das sogenannte Planierbrett. Dies ist ein starkes Brett, welches ringsumher mit Leisten versehen ist, die den Zweck haben, das wiederholt naß werdende Brett gegen das Ziehen zu schützen, und dazu dienen, das beim Pressen heraustretende Wasser zu sammeln, das dann an einer hierfür bestimmten Öffnung abgelassen wird. Das Brett hat eine Größe von etwa 40 zu 60 cm. Das Auspressen des Wassers geschieht mittels der Stock- oder Handpresse. Seit ältester Zeit, solange man überhaupt die Arbeit des Pressens verfolgen kann, kennt man die große Stockpresse genau in der Anordnung, wie sie zum Keltern benützt wurde, und die kleinere Handpresse. Erstere besteht aus zwei starken Brettern die mittelst einer Hebelstange zusammengepreßt werden. Die Handpresse besteht aus zwei Pressbalken, die vermittelst Muttern, welche auf Spindeln drehbar sind, zusammengeschraubt werden. (Fig. 4.) Zu der Handpresse gehört dann noch der Pressbengel, eine Handhabe zum Anziehen oder zum Öffnen der Muttern.
Fig. 4. Handpresse mit Pressbengel.
Neuerdings wird auch die große Stockpresse, aber in Eisen ausgeführt, wieder mehr zur Anwendung gebracht; jede Maschinenfabrik, die Buchbinderwerkzeugmaschinen fertigt, liefert diese Pressen je nach der auszuübenden Kraft mit zwei oder vier Säulen.
Will man irgend etwas einpressen, so muß das zu Pressende zwischen Brettern liegen, die je nach der Größe als Median-, Folio-, Quart-, Duodez- oder Sedezbretter bezeichnet werden. Von jeder dieser Sorten unterscheiden wir, je nach dem Gang der Faser, Länge- oder Querbretter. Alle Preßbretter sollen aus Birnbaum, Ahorn oder Buche sein. Keines der weichen Hölzer eignet sich für diesen Zweck, ebensowenig Holz mit sehr harten Jahresringen, wie etwa Eichenholz sie aufweist. Die Preßbretter haben stets den Zweck, etwas eben und glatt zu pressen, und aus diesem Grunde sollen sie selbst glatt und eben sein. Deshalb ist bei der Behandlung dieses Werkzeuges alle Vorsicht nötig, um die ursprüngliche Glätte der Fläche zu erhalten.
Hat man nun planierten Druck einzupressen, so ist es nicht zu vermeiden, daß hierbei die Preßbretter durchnäßt werden, daß Papierreste, Leim oder andere Unreinigkeiten sich daran festsetzen. Deshalb ist es zweckmäßig, für diese Arbeit besondere Preßbretter bereit zu halten, um die anderen zu schonen. Man achte beim Einpressen mit der Handpresse darauf, daß die Richtung der Preßbalken sich mit der der Faser der obersten Bretter kreuzt, da andernfalls die Bretter springen oder gar brechen würden.
Preßt man den planierten Druck oder das Planier in einer Stockpresse aus, so genügt es, das oben beschriebene Planierbrett unten in die Presse zu setzen, die planierten Bogen mitten darauf aufzuschichten, ein Planierpreßbrett oben aufs Ganze zu legen und nun fest zuzudrehen. Mit der Handpresse wird es freilich etwas umständlicher; da wird das nasse Planier ebenfalls in derselben Weise geschichtet, jedoch nicht in die Presse gehoben, wie wir dies später bei anderen Arbeiten sehen werden, sondern das Ganze zieht man etwas über die Tischkante vor und setzt die geöffnete Holzpresse so an, daß ein Balken unter, der andere über das Einzupressende zu liegen kommt, und nun zieht man mittelst des Preßbengels nach und nach abwechselnd beide Schraubenmuttern an, die man vorher leicht mit der Hand angedreht hatte. Neigt man nun die Presse ein wenig nach der Seite, an der im Unterlagsplanierbrett die Wasserausflußöffnung ist, so kann man dieses nach Belieben in einen untergestellten Topf oder eine Schüssel auslaufen lassen.
Nun erübrigt noch das Trocknen des nassen Druckes. Dies geschieht auf Schnüren oder auf dreieckigen Latten, auf welche die Bogen, ebenfalls in 4⁄6 Blatt starken Lagen aufgehängt werden. Früher hing der Buchbinder solchen nassen Druck in seiner Werkstatt auf. Die Folge war, daß ihm dabei das Werkzeug verrostete, und er selbst nebst seinen Arbeitern sich jedesmal einige Tage recht unbehaglich fühlte. Heute, wo diese Arbeit zur Seltenheit geworden ist, wird man auf einem Bodenraum gewiß einen Platz erübrigen können, auf dem sich einige Schnüre zum Aufhängen der Bogen spannen lassen.
In der Zeit, als man noch sehr viel Planier zu trocknen hatte, verwendete man Planierleinen aus gesponnenen Pferdehaaren, welche die Feuchtigkeit nicht annehmen und sehr leicht sauber zu halten sind, während Hanfleinen sehr häufig gewaschen werden müssen, wenn man dunkle Streifen auf dem Papier vermeiden will. Waren die Leinen niedrig gespannt, so hing man den nassen Druck über den linken Arm, löste mit der rechten Hand eine Lage um die andere ab und hing sie so auf, daß jede Lage das Ende der vorhergehenden ein wenig deckte; dies hatte seinen guten Grund darin, daß man nach dem Trocknen die Lagen von einem Ende nach dem andern, auf jeder Leine zusammenschieben konnte. Bei hochgespannten Leinen, die mit der Hand nicht zu erreichen sind, bediente man sich des Planierkreuzes, einer auf einer Stange rechtwinklig befestigten oben gerundeten Latte, mit welcher die Lagen emporgehoben und auf die Leine niedergelassen wurden.
Wenn sich beim Aufhängen herausstellt, daß einzelne Bogen nicht völlig vom Wasser durchtränkt sind, so müssen diese sofort ausgemerzt und in siedend heißes Wasser gelegt werden. Andernfalls würde sich auf der Wassergrenze ein Fleck bilden, abgesehen davon, daß das nicht gefeuchtete Stück des Papieres ungeleimt bliebe und leicht mit anderen Bogen zusammenklebt. Das kochende Wasser zieht den Leim wieder aus dem Papier heraus; es versteht sich von selbst, daß solche Bogen getrocknet und die Arbeit des Leimens wiederholt werden muß. Häufiger als dieser Fehler kommt das Zerreißen der feuchten Bogen vor, und diese zu flicken ist nicht angenehm. Etwas gut und unauffällig zu flicken ist eine besondere Kunst, die große Geduld und peinliche Sauberkeit erfordert, Zweckmäßig ist es immer, den Druck nach dem Trocknen zu flicken, weil man dann sauberer arbeiten kann, die einzelnen Stücke auch besser trocken als naß zu handhaben sind. Man unterscheidet zwei Arten des Flickens: das Übereinandersetzen und das Anstoßen mit aufgelegtem Papier. Die erstere Art ist die beste, da man nachher fast nichts oder doch nur wenig bemerkt, wenn man sauber gearbeitet hat; leider kann man dies nur dann thun, wenn die Art des Schadens es gestattet. Ist ein Riß erfolgt, so daß die getrennten Teile gewissermaßen von einander geschält sind, daß also jeder Teil etwas auf den anderen übergreift, so wird jeder der beiden Teile mit ganz sauberem Kleister und vermittelst eines sauberen Falzbeines auf der Bruchstelle dünn, oder, wie der Fachmann sagt, »mager« angeschmiert, die beiden Teile genau auf einander gepaßt und in der Weise angerieben, daß man ein sauberes Blatt Papier unter, ein eben solches über die geflickte Stelle legt und nun mit den Fingerspitzen das Ganze, insbesondere die Bruchstelle vorsichtig anreibt. Keinesfalls darf man aber mit einem Falzbein anreiben; dies würde den Kleister aus den Fugen heraustreiben und die Flickarbeit von vornherein unsauber erscheinen lassen.
Nehmen wir nun den weniger günstigen Fall an, daß der Bruch glatt durchgeht, glücklicherweise aber an der Bruchstelle das Papier auf beiden Seiten unbedruckt ist, so kann man auf dieser unbedruckten Stelle sehr wohl einen Papierstreifen aufkleben, nachdem die beiden Bruchkanten etwas kräftigen Kleister erhielten und genau zusammengestoßen wurden. Nun ist es freilich unzulässig, auf diesen Riß einen Streifen Papier fest aufzukleben; man hilft sich aber dadurch, daß man ein Stückchen Papier, möglichst genau in Stoff und Farbe passend, über den zusammengestoßenen Bruch und darüber ein sauberes Makulaturblatt legt, und nun das Ganze mit den Fingern anreibt. Der Erfolg wird sein, daß der Kleister nicht allein die Bruchstelle des Papieres zusammenhält, sondern daß auch das Streifchen Papier an der geflickten Stelle noch teilweise haften bleibt. Nach dem völligen Abtrocknen reißt man dies Blättchen vorsichtig ab, und zwar so, daß das Papier selbst sich spaltet und nur einzelne Fasern des Stoffes haften bleiben, gerade hinreichend, um die schadhafte Stelle entsprechend zu verstärken. Auch wenn das Papier an der Bruchstelle auf beiden Seiten bedruckt ist, kann man ähnlich verfahren, muß aber Seidenpapier zum Auflegen nehmen, das man nach dem Trocknen sehr vorsichtig abreißt.
Wir haben nun das Planier trocken und wollen es, damit es sich besser falzt, einige Zeit fest einpressen, nachdem wir selbstverständlich alle Bogen recht gleichmäßig, faltenlos und eben übereinander geschichtet haben. Da haben wir denn vollauf Muße, über das »Schlagen«, von welcher Arbeit wir den Abstecher zum Planieren machen mußten, noch einige Bemerkungen zu machen.
Wir unterscheiden das leichte Schlagen oder »Pumpen« und das eigentliche Schlagen. Ersteres hat den Zweck, das Papier nur obenhin und im großen Ganzen auf eine geringere Dicke zu bringen. Die Lagen können deshalb stärker sein als im anderen Falle. Von dem eigentümlich hohlen Geräusch hat diese Arbeit auch wohl den Namen erhalten. Will man aber dem Papier schärfer zu Leibe gehen und soll die Dicke desselben gehörig beschränkt werden, dann muss man es in wesentlich dünnere Lagen abteilen. Dies geschieht aber erst nach dem Falzen; wir verschieben daher das nähere Eingehen darauf bis nach dieser Arbeit und nehmen zunächst unsere Druckbogen wieder aus der Presse.
Ziehen wir irgend einen Bogen aus einem Druckwerk heraus, so finden wir meist oberhalb des Textes die Seitenzahlen angegeben. Es würde aber dem Buchbinder einige Schwierigkeiten machen, aus den Seitenzahlen sogleich die als erste Seite des Bogens bezeichnete herauszufinden und demgemäß den Bogen in richtiger Seitenfolge zu falzen. Deshalb ist in der sogenannten Signatur, die der Setzer anbringt, eine Einrichtung getroffen, welche das vordere Blatt eines jeden Bogens sofort erkennen läßt. Der aufmerksame Arbeiter wird also nicht leicht »verfalzen« können. Die Signatur zeigt die Reihenfolge der Bogen mit 1, 2, 3 u. s. w. oder (früher) mit Buchstaben a, b, c etc. am Fuße der Seite rechts an und die Zahl des ersten Blattes wiederholt sich, mit einem Stern versehen, auf dem zweiten Blatte (die sog. falsche Signatur) an derselben Stelle.
Faltet man ein leeres Blatt Papier zusammen, so wird man Kante auf Kante richten. Bei bedrucktem Papier ist dies anders; der weiße Rand ist für den Falzer völlig Nebensache, seine Aufgabe ist vielmehr, die einzelnen Kolumnen des Druckes, d. h. die von dem Letternsatz eingenommenen Flächen, genau auf einander zu bringen, so daß sie sich, wenn man sie gegen das Licht hält, decken. Zu dem Ende legt man die zu falzenden Bogen in einem nicht zu dicken Stoße mitten vor sich auf den Werktisch und zwar so, daß die rechte Signatur oben links auf der Unterseite, die falsche Signatur oben rechts auf der Oberseite der Falzlage sich befindet. Die rechte Hand, welche zugleich ein Falzbein führt, greift den Bogen am rechten Rande etwa in der Mitte und schlägt denselben so nach links zusammen, daß die Ränder einander etwa gleich stehen. In dem Augenblicke aber, wo die rechte Hälfte des Bogens links ankommt, greift die Linke so zu, daß der Zeigefinger zwischen die Blätter in der Nähe der Kolumnenecken zu liegen kommt, während Daumen und Mittelfinger von außen zufassen, den Bogen etwa in Augenhöhe bringen und hier so richten, daß die Kolumnen sich ganz genau decken; bei dieser Arbeit hilft die Rechte durch Hin- und Herschieben der beiden Bogenhälften nach, ohne das Falzbein fortzulegen (Fig. 5). Sind die Kolumnen in richtiger Lage, so legt man den Bogen nieder, und während die Linke denselben noch hält, streicht die Rechte den zu bildenden Bruch kräftig und mit einem sicheren Strich nieder, und zwar von unten nach oben, indem das Falzbein mit der Spitze etwas schräg nach links oben gerichtet gehalten wird (Fig. 6). Damit sich die Bogen leicht aufgreifen lassen, streicht man über den Stoß dann und wann mit dem Falzbein halbrechts aufwärts, wodurch sich die obersten Bogen in dieser Richtung etwas über die anderen hervorschieben, so daß die Rechte sehr wohl, ohne daß die Augen folgen, den jeweiligen obersten Bogen greifen kann. Dies wäre das erste »Tempo«, um mit unseren deutschen Unteroffizieren zu reden, und es wäre wirklich nicht übel angebracht, diese Arbeit, die mit einiger Übung ungemein rasch auszuführen ist, in völlig militärischem Sinne »nach Zählen blind geladen« zu erlernen; einstweilen aber wollen wir uns bemühen, die zweite Bewegung zu machen und den Bogen fertig zu falzen.
Fig. 5. Stellung der Hände beim Richten der Kolumnen.
Fig. 6. Niederstreichen des Falzstrichs.
Fig. 7. Ergreifen des Bogens zum zweiten Bruch.
Fig. 8. Niederbiegen des zweiten Bruches.
Indem man das Falzbein in der Gegend des Mittelsteges unter den eben gemachten Bruch schiebt, ergreift man den Bogen mit Falzbein und Zeigefinger, und zwar so, daß man mit einer kurzen Drehung der Hand den Bogen zwischen Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger fassen kann, oder besser gesagt, daß die beiden letzteren in dem Bogen um den ersteren herum einen Bruch formen können (Fig. 7