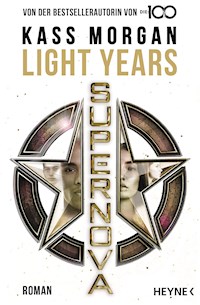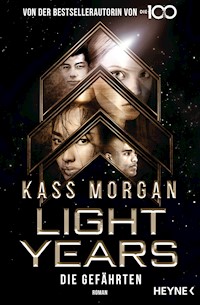11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kappa Rho Nu ist die exklusivste Studentinnenverbindung am Westerly College. Ihre Partys sind legendär, ihre Wohltätigkeitsbälle luxuriös. Doch hinter der glitzernden Fassade haben die »Rabenschwestern«, wie sich die Mitglieder nennen, ein dunkles Geheimnis: Sie sind ein Hexenzirkel. Für die Außenseiterin Vivi Deveraux bedeutet die Aufnahme in den Club der Rabenschwestern einen Neustart. Scarlett Winters will unbedingt Präsidentin der Schwesternschaft werden, wie schon ihre Mutter vor ihr. Wäre da nur nicht Scarletts dunkles Geheimnis, dem Vivi bedrohlich nahe kommt. Doch dann entlarvt jemand die Rabenschwestern, und Scarlett und Vivi müssen zusammenarbeiten, um eine Katastrophe zu verhindern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
Vivi Devereaux kann ihr Glück kaum fassen, als sie eingeladen wird, der exklusivsten Schwesternschaft am Westerly College beizutreten. Doch Kappa Rho Nu, die alle nur die Rabenschwestern nennen, sind weit mehr als nur eine Studentenverbindung: Es ist ein Hexenzirkel, und auch in Vivi schlummert eine magische Gabe.
Scarlett Winter wusste schon immer, dass sie eine Hexe ist. Sie will unbedingt die nächste Präsidentin der Rabenschwestern werden, wie ihre Mutter und ihre Schwester vor ihr. Als ihr Außenseiterin Vivi als Schülerin zugeteilt wird, ist Scarlett nicht gerade begeistert. Nicht nur, dass Vivi nicht aus einer bekannten Hexenfamilie stammt, sie scheint sich auch noch in Scarletts Freund Mason verliebt zu haben! Doch dann greift jemand die Rabenschwestern an und droht, die Wahrheit über den Hexenzirkel zu enttarnen. Scarlett und Vivi müssen zusammenarbeiten, wenn sie die Katastrophe verhindern wollen …
DIEAUTORINNEN
Kass Morgan studierte Literaturwissenschaft an der Brown University und in Oxford. Derzeit lebt sie als Lektorin und freie Autorin in Brooklyn. Ihr erster Roman Die 100 schaffte es auf Anhieb auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, und auch mit den Folgebänden der Serie knüpfte Kass Morgan an ihren sensationellen Erfolg an. Mit ihrer neuen Romanserie Light Years wagt sie sich in die ferne Zukunft der Menschheit vor, während sie mit Danielle Paige und den Rabenschwestern die Welt der Hexen erkundet.
Danielle Paige schrieb mehrere erfolgreiche Jugendbücher, mit denen sie auf der Bestsellerliste der New York Times landete. Sie arbeitet hauptberuflich in der TV-Industrie, wo sie mit dem Writers Guild of America Award ausgezeichnet wurde und bereits für mehrere Emmy Awards nominiert war. Sie lebt und arbeitet in New York City.
KASS MORGAN
DANIELLE PAIGE
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von
Maike Hallmann
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
THERAVENS
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Ausgabe 01/2022
Copyright © 2020 by Alloy Entertainment
Copyright © 2022 dieser Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Jennifer Jäger
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,
unter Verwendung des Originalmotivs von Shyama Golden
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-25964-8V001
www.heyne.de
Für meine Mutter, Marcia Bloom, die mich die beste Art Hexerei gelehrt hat – wie man die Schönheit sieht, die einen umgibt, und Magie findet, wo man sie nicht erwartet hätte.
KASS
Für Andrea, Sienna, Fiona und meinen gesamten Hexenzirkel. Und für meine Mutter Shirley Paige, deren Magie mich niemals verlassen wird.
DANIELLE
PROLOG
Die Hexe betrachtete das blonde Mädchen, das mit angstgeweiteten Augen auf dem Boden kauerte.
»Sieh mich nicht so an. Ich hab dir doch gesagt, ich will das nicht tun«, sagte die Hexe, während sie den Kreis zog, die Kerzen entzündete und den blubbernden Inhalt des Kessels überprüfte. Das bereits geschärfte Messer lag schimmernd auf dem Altar, der neben ihrer Opfergabe stand.
Statt einer Antwort stöhnte das Mädchen auf, Tränen strömten ihr über die Wangen. Sie war geknebelt, aber ihre Worte hallten kristallklar durch den Kopf der Hexe.
Vergiss nicht, wer ich bin. Vergiss nicht, wer du bist. Denk an die Rabenschwestern.
Die Hexe verhärtete ihr Herz. Sicher hatte ihr entschuldigender Tonfall bewirkt, dass das Mädchen eine Gelegenheit witterte. Eine Chance, sie zum Einlenken zu bewegen. Hoffnung. Eine Chance, doch zu überleben. Aber dafür war es zu spät. Magie hielt keine Predigten. Magie gab, und Magie nahm. Das war ihr Geschenk. Das war ihr Preis.
Die Hexe kniete sich neben das Mädchen und überprüfte noch einmal die Fesseln. Straff, aber nicht so fest, dass sie die Blutzufuhr abschnürten. Sie war kein Monster.
Das Mädchen fing wieder an zu schreien, gedämpft durch den Knebel in ihrem Mund.
Die Hexe biss die Zähne zusammen. Es wäre ihr sehr viel lieber gewesen, wenn das Mädchen bewusstlos wäre. Aber das Ritual, das sie ausgegraben hatte, war diesbezüglich sehr eindeutig. Wenn es funktionieren sollte, musste sie alles perfekt ausführen. Falls es nicht funktionierte …
Sie schloss die Augen. Darüber durfte sie nicht nachdenken. Es musste klappen. Etwas anderes war nicht denkbar.
Sie hob das Messer und stimmte ihren Sprechgesang an.
Am Ende war es verblüffend einfach. Ein rascher Bogen mit dem Messer, ein roter Sprühregen, gefolgt von dem unverwechselbaren elektrischen Knistern freigesetzter Magie.
Magie, die jetzt ihr gehörte.
1
Vivi
»Vivian.« Daphne Devereaux stand vor dem Zimmer ihrer Tochter, einen übertrieben dramatischen Ausdruck auf dem Gesicht. Trotz der erbarmungslosen Hitze in Reno trug sie einen bodenlangen, mit goldenen Fransen abgesetzten schwarzen Hausmantel, und um das widerspenstige dunkle Haar hatte sie einen Samtschal gewickelt. »Du kannst nicht fahren. Ich hatte eine Vorahnung.«
Vivi sah zu ihrer Mutter hoch, unterdrückte ein Seufzen und packte weiter. Heute Nachmittag würde sie zum Westerly College in Savannah aufbrechen, und sie gab ihr Bestes, um ihr ganzes Leben in zwei Koffer und einen Rucksack zu quetschen. Zum Glück hatte sie jede Menge Erfahrung mit dem Kofferpacken. Wann immer Daphne Devereaux eine ihrer »Vorahnungen« hatte, waren sie am nächsten Morgen abgehauen, scheiß auf die noch nicht bezahlte Miete und alles, was nicht ins Gepäck passte. »Es ist gut für die Seele, einen ganz neuen Anfang zu wagen, Zuckererbse«, hatte Daphne einmal zu der achtjährigen Vivi gesagt, als die sie anbettelte, umzukehren und ihr Plüschnilpferd Philip zu holen. »Schlechte Energie sollte man nicht mit sich herumschleppen.«
»Lass mich raten«, sagte Vivi und stopfte mehrere Bücher in ihren Rucksack. Daphne würde ebenfalls umziehen, sie tauschte Reno gegen Louisville ein, und Vivi traute ihrer Mutter ohne Weiteres zu, ihre Bibliothek einfach zurückzulassen. »Du hast eine mächtige Finsternis auf mich zukommen sehen.«
»Du bist nicht sicher dort an … dieser Schule.«
Vivi schloss die Augen und atmete tief durch, um sich, wie sie hoffte, zu beruhigen. Schon seit Monaten war ihre Mutter nicht in der Lage, das Wort College über die Lippen zu bringen. »Es heißt Westerly. Das ist kein Schimpfwort.«
Ganz im Gegenteil: Westerly war Vivis Rettungsanker. Sie war völlig perplex gewesen, als sie ein Stipendium bekommen hatte – an einem College, von dem sie geglaubt hatte, es läge weit jenseits ihrer Reichweite. Vivi war schon immer eine gute Schülerin gewesen, aber sie hatte insgesamt drei unterschiedliche Highschools besucht – an zweien davon hatte sie mitten im Schuljahr begonnen –, und ihr Zeugnis enthielt fast ebenso viele Lücken wie Einsen.
Daphne hingegen hatte diese Chance nicht im Mindesten beeindruckt. »Du wirst Westerly hassen«, hatte sie voller Überzeugung behauptet. »Ich würde niemals auch nur einen Fuß auf diesen Campus setzen.«
Und damit war es für Vivi beschlossene Sache gewesen. Wenn ihre Mutter Westerly so sehr hasste, dann war es ganz genau der richtige Startpunkt für Vivi, um ein brandneues Leben zu beginnen.
Daphne stand noch immer bekümmert auf ihrer Türschwelle. Vivi warf einen Blick auf den Westerly-Kalender, den sie an die vergilbte Wand gepinnt hatte – die einzige Dekoration im ganzen Zimmer. Von allen Wohnungen, in denen sie im Lauf der Jahre gelebt hatten, mochte sie diese hier am wenigsten: ein mit Gips verspachteltes Zweizimmerapartment, das direkt über einem Pfandleiher lag und nach Zigaretten und Verzweiflung stank. Wie fast das ganze staubige Nevada. Die Fotos im Kalender, lauter Hochglanz-Lobgesänge auf efeuüberwucherte Gebäude und moosbewachsene Eichen, waren für sie zu einem Symbol der Hoffnung geworden. Eine Erinnerung daran, dass etwas Besseres auf sie wartete, eine Zukunft, die sie selbst gestalten konnte – weit weg von ihrer Mutter und deren unheilverkündenden Omen.
Aber dann sah sie die Tränen in den Augen ihrer Mutter und wurde etwas milder gestimmt. Auch wenn Daphne eine nahezu perfekte Schauspielerin war – das musste man schließlich sein, wenn man seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Fremde um ihr Geld zu erleichtern –, Tränen vorzutäuschen war ihr nie gelungen.
Vivi ließ den fertig gepackten Koffer stehen und ging quer durch das vollgestopfte kleine Zimmer auf ihre Mutter zu. »Wird schon alles gut werden, Mom«, sagte sie. »Ich bin ja nicht lange weg. Ehe du dichs versiehst, ist schon Thanksgiving.«
Ihre Mutter schniefte und streckte ihr einen blassen Arm entgegen. Vivi hatte die helle Hautfarbe ihrer Mutter geerbt, was bedeutete, dass sie nach fünfzehn Minuten unter der Wüstensonne bereits Sonnenbrand bekam. »Ich hab das Kreuz für dich gelegt. Sieh mal, was ich gezogen habe.«
Es war eine Tarotkarte. Daphnes Beruf war, all den traurigen, bemitleidenswerten Gestalten, die zu ihr kamen und gutes Geld für hohle Phrasen zahlten, »das Schicksal zu lesen«: Ja, dein stinkend fauler Mann wird bald Arbeit finden; nein, dein Versager von einem Vater hasst dich nicht, in Wirklichkeit versucht er, dich ebenfalls zu finden …
Als Kind hatte Vivi es geliebt, ihrer schönen Mutter dabei zuzusehen, wie sie die Kunden mit ihrem schillernden Wesen und ihrer Weisheit einlullte. Aber je älter sie wurde, desto unbehaglicher wurde ihr bei dem Gedanken, dass ihre Mutter aus dem Schmerz anderer Menschen Profit schlug. Sie ertrug es nicht mehr mitanzusehen, wie die Leute ausgenutzt wurden, doch sie konnte auch nichts dagegen tun – immerhin war Daphnes Kartenlegerei ihre einzige Einnahmequelle, ohne die sie weder die Miete für die schäbige Wohnung bezahlen konnten noch ihr Essen, das sie ohnehin immer im Sonderangebot kauften.
Aber jetzt war damit Schluss. Vivi hatte endlich einen Fluchtweg gefunden. Ein neuer Anfang wartete auf sie, sicherer Abstand zu Daphne und ihren impulsiven Entscheidungen, die Vivi ständig von einem Tag auf den anderen vollständig entwurzelten, nur weil ihre Mutter mal wieder eine »Vorahnung« gehabt hatte.
»Lass mich raten«, sagte Vivi und betrachtete die Tarotkarte in der Hand ihrer Mutter mit hochgezogenen Brauen. »Der Tod?«
Das Gesicht ihrer Mutter verdüsterte sich, und Daphnes normalerweise melodische Stimme war so leise und klang dennoch so schneidend, dass Vivi eine Gänsehaut bekam. »Vivi, ich weiß, dass du nicht ans Tarot glaubst, aber hör dieses eine Mal einfach auf mich.«
Vivi nahm die Karte und drehte sie um. Natürlich – ein Skelett mit einer Sense in der Hand starrte sie an. Statt Augen hatte es nur tiefe Höhlen im Schädel, und der Mund schien sich zu einem höhnischen Grinsen zu verziehen. Aus dem lehmigen Erdreich ringsum drängten körperlose Hände und Füße nach oben, und im Hintergrund versank die Sonne hinter einem blutroten Horizont. Unerwartet verspürte Vivi ein eigenartiges Schwindelgefühl, als stünde sie am Rand eines klaffenden Abgrunds statt in ihrem Zimmer, aus dessen Fenster nichts weiter zu sehen war als das neongelbe Schild mit der Aufschrift WIRKAUFENGOLDAN auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
»Ich habe es dir gesagt. Westerly ist nicht sicher, nicht für jemanden wie dich«, flüsterte Daphne. »Du hast die Fähigkeit, hinter den Schleier zu blicken. Das macht dich zur Zielscheibe dunkler Mächte.«
»Hinter den Schleier?«, wiederholte Vivi trocken. »Ich dachte, so was würdest du nicht mehr sagen.« Vivis ganze Kindheit hindurch hatte Daphne versucht, sie in ihre Welt voller Tarot und Séancen und Kristalle hineinzuziehen, hatte behauptet, dass in Vivi »besondere Kräfte« darauf warteten, entfesselt zu werden. Sie hatte ihr sogar das Deuten einfacher Kartenlegungen beigebracht, und die Kunden waren wie gebannt davon, ein kleines Kind mit den Geistern kommunizieren zu sehen. Aber irgendwann hatte Vivi die Wahrheit begriffen – sie verfügte über keine geheimnisvollen Mächte, sondern war nur ein weiterer Bauer auf dem Spielbrett ihrer Mutter.
»Ich habe keine Gewalt darüber, was für eine Karte ich ziehe. Es wäre dumm, eine solche Warnung zu ignorieren.«
Draußen hupte es, und irgendwer brüllte Obszönitäten. Vivi seufzte und schüttelte den Kopf. »Aber du hast mir doch selbst beigebracht, dass der Tod für Veränderung steht.« Sie wollte ihrer Mutter die Karte zurückgeben, aber Daphne ließ die Arme stur an den Seiten herabhängen. »Ist doch ziemlich offensichtlich, dass es darum geht. Das College ist mein Neuanfang.«
Keine spontanen mitternächtlichen Umzüge in andere Städte mehr, keine plötzliche Entwurzelung immer dann, wenn Vivi gerade richtige Freundschaften schloss. In den nächsten vier Jahren konnte sie sich als normale Studentin ganz neu erfinden. Freunde kennenlernen, ein Sozialleben aufbauen, vielleicht auch ein paar außerschulische Aktivitäten aufnehmen – beziehungsweise erst mal rausfinden, was ihr überhaupt Spaß machte. Sie waren so oft umgezogen, dass sie in nichts richtig gut war. Nach drei Monaten hatte sie mit dem Flötenunterricht aufhören müssen, Softball war für sie mitten in der Saison vorbei gewesen, und Französisch hatte sie so oft schon im Einführungskurs aufgeben müssen, dass sie kaum mehr sagen konnte als Bonjour, je m’appelle Vivian. Je suis nouvelle.
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Der Tod wurde von der Zehn der Schwerter und dem Turm flankiert. Verrat und plötzlich hereinbrechende Gewalt. Vivian, ich habe ein ganz schreckliches Gefühl …«
Vivi gab es auf und steckte die Karte in ihren Koffer, dann richtete sie sich auf und nahm Daphnes Hände. »Das ist für uns beide eine Riesenveränderung. Es ist okay, wenn du durch den Wind bist. Sag mir einfach, dass du mich vermissen wirst, so wie eine ganz normale Mutter, statt irgendwas über Zeichen aus der Geisterwelt zu erzählen.«
Ihre Mutter drückte ihre Hände ganz fest. »Ich weiß, dass ich diese Entscheidung nicht für dich treffen kann …«
»Dann hör damit auf, es zu versuchen. Bitte.« Vivi verflocht ihre Finger mit denen ihrer Mutter, so wie sie es oft getan hatte, als sie noch klein war. »Ich will an unserem letzten gemeinsamen Tag nicht mit dir streiten.«
Als Daphne endlich begriff, dass sie eine verlorene Schlacht kämpfte, ließ sie die Schultern sinken. »Versprich mir, vorsichtig zu sein. Vergiss nicht, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Selbst etwas, das auf den ersten Blick gut aussieht, kann gefährlich sein.«
»Ist das deine Art, mir zu sagen, dass ich insgeheim böse bin?«
Ihre Mutter bedachte sie mit einem vorwurfsvollen Blick. »Sei einfach klug, Viv.«
»Das krieg ich auf jeden Fall hin.« Vivi grinste breit, und Daphne verdrehte die Augen.
»Ich hab eine Egomanin großgezogen.« Aber trotz ihrer Worte beugte sich ihre Mutter vor und nahm sie in den Arm.
»Daran bist du selbst schuld mit deinem ganzen Gerede von wegen du bist magisch begabt und kannst alles«, sagte Vivi und befreite sich aus der Umarmung, um den Koffer zu schließen. »Ich bin vorsichtig. Versprochen.«
Und das würde sie tatsächlich sein. Ihr war klar, dass auf dem College manchmal üble Dinge passierten. Überall konnte etwas Schlimmes passieren, aber Daphne machte sich was vor, wenn sie glaubte, irgendwelche albernen Tarotkarten hätten etwas zu bedeuten. Es gab keine Magie.
Zumindest glaubte Vivi das.
2
Scarlett
Nicht du suchst deine Schwestern aus, sondern die Magie, hatte Scarlett Winters Kindermädchen Minnie ihr mal gesagt, Jahre bevor Scarlett Kappa Rho Nu beigetreten war. Und jetzt, als ihre Mutter den Wagen durch das schmiedeeiserne Tor von Westerly lenkte und sie an all den anderen Studenten vorbeifuhren, fielen Scarlett Minnies Worte wieder ein. Manche der Mädchen drückten ihre Koffer fest an sich, sahen sehr jung und nervös aus; andere ließen den Blick mit einem Hunger über den Campus schweifen, als würden sie sich schon darauf freuen, ihn zu erobern. Irgendwo in diesem Meer aus Mädchen befanden sich auch diejenigen, die sie für Kappa rekrutieren würden. Die neuen Rabenschwestern, wie sich die Kappas selbst bezeichneten, die binnen einem Jahr zu Scarlett aufblicken und sie als Anführerin betrachten würden, wenn alles nach Plan verlief – und die Magie auf ihrer Seite war.
Sobald sie durchs Tor waren, fühlte sie sich freier und stärker. Als würde sie aus dem Schatten ihrer Familie ins Licht treten. Das ergab allerdings überhaupt keinen Sinn, weil ihre Mutter Marjorie und ihre große Schwester Eugenie überall im Kappa-Verbindungshaus präsent waren. Auf den Gruppenbildern an den Wänden. Auf den Lippen der älteren Verbindungsschwestern. Sie hatten dem College lange vor Scarlett ihren Stempel aufgedrückt. Aber trotz des großen Erwartungsdrucks war Scarlett entschlossen, allen zu beweisen, dass die beste Winter erst noch kam. Sie würde Verbindungspräsidentin werden, so wie Mutter und Schwester vor ihr, aber sie würde noch besser sein als sie, strahlender, unvergesslicher. Das war das Schöne daran, Nachfolgerin zu sein: Sie konnte sie immer noch übertreffen. Oder zumindest redete sie sich das ein.
»Du hättest das rote Kleid anziehen sollen«, sagte Marjorie und warf ihrer Tochter über den Rückspiegel einen kritischen Blick zu. »Das sieht mehr nach einer zukünftigen Präsidentin aus. Du musst Macht ausstrahlen, guten Geschmack, Führungsqualitäten …«
Scarlett erhaschte einen Blick auf sich selbst hinter dem Abbild ihrer Mutter im Spiegel. Scarlett, Eugenie und Marjorie hatten dunkle Haut, jede in ihrer ganz eigenen Schattierung. Sie alle sahen blendend aus, aber während Eugenie das Ebenbild der Mutter war, hatte Scarlett ein ganz eigenes Gesicht, das von einer scharf geschnittenen Nase und weit auseinanderstehenden Augen dominiert wurde. Früher hatte Scarlett ihre Mutter und Eugenie immer sehr um ihre Ähnlichkeit beneidet. Sie hatten sogar die gleiche perfekte Nase.
Scarlett strich ihr grünes, in A-Linie geschnittenes Kleid glatt. »Mama, ich bezweifle, dass Dahlia die nächste Kappa-Präsidentin anhand ihres Kleids am ersten Schultag auswählt. Und Rot zu tragen, wenn man Scarlett heißt, ist einfach ein bisschen drüber.«
Marjories Gesicht wurde sehr ernst. »Scarlett, absolut alles fließt in die Überlegungen mit ein.«
»Sie hat völlig recht«, warf Eugenie vom Beifahrersitz aus ein.
»Hör auf deine Schwester. Sie war zwei Jahre in Folge Präsidentin«, sagte Marjorie stolz. »Und jetzt ist es an dir, die Familientradition weiter fortzuführen.«
Eugenie schmunzelte. »Es sei denn, du bist damit zufrieden, vom Rand aus zuzusehen.«
»Natürlich nicht. Ich bin schließlich eine Winter, oder etwa nicht?« Scarlett richtete sich auf und funkelte ihre Schwester wütend an. Sie wusste nicht genau, weshalb Eugenie darauf bestanden hatte mitzukommen; sie betonte ständig, wie wahnsinnig beschäftigt sie als Juniorpartnerin in der Anwaltskanzlei der Mutter doch sei. Allerdings ließ Eugenie nie eine Gelegenheit aus, Scarlett auf ihren Platz zu verweisen. Zum Beispiel, indem sie dafür sorgte, dass sie an Scarletts erstem Tag nach den Semesterferien vorn saß, während Scarlett mit dem Rücksitz vorliebnehmen musste.
Ihre Mutter nickte nachdrücklich. »Vergiss das nie, mein Liebling.« Sie drehte sich zu Scarlett um, und ein Hauch ihres Parfüms wehte durch den Wagen; ein dezenter Jasminduft, der Scarlett daran erinnerte, wie ihre Mutter sich spätabends nach einem langen Tag in der Firma immer in ihr Zimmer geschlichen und sie auf die Stirn geküsst hatte. Sie hatte stets so getan, als würde sie fest schlafen, weil ihre Mutter sich solche Mühe gab, sie nicht zu wecken. Dabei machte es ihr gar nichts aus, geweckt zu werden. Diese späten Besuche riefen ihr ins Gedächtnis, wie viel sie ihrer Mutter bedeutete – etwas, das Scarlett tagsüber nicht immer spürte.
Und was ihrer Mutter am meisten bedeutete, war, dass beide Töchter in ihre Fußstapfen traten und Verbindungspräsidentinnen von Kappa wurden. Ihre ganze Kindheit hindurch hatte Scarlett immer wieder gehört: Eine Kappa-Präsidentin kann sich nicht mit nur einem Vorzug allein begnügen, Scarlett. Sie muss alles zugleich sein: klug, stilsicher, freundlich. Ein Mädchen, das gleichermaßen Neid und Respekt in anderen weckt. Ein Mädchen, für das ihre Schwestern immer an erster Stelle kommen – und das mächtig genug ist, um die Welt zu ändern.
Solange sie denken konnte, wusste Scarlett, dass sie eine Hexe und Kappa ihre Bestimmung war. In der Schwesternschaft aufgenommen zu werden war unabdingbar; Präsidentin zu werden wurde vorausgesetzt, das war das Allermindeste. Und deshalb hatte Minnie, die schon das Kindermädchen von Scarletts Mutter gewesen war, Scarlett unterrichtet – in einem Alter, in dem andere längst in Rente waren. Hatte sie die Magie gelehrt, so wie sie es schon bei ihrer Schwester und Mutter getan hatte.
Jede Hexe kam mit einem besonderen Talent auf die Welt: Kelche, das Zeichen des Wassers; Münzen, das Zeichen der Erde; Schwerter, das Zeichen der Luft; und Stäbe, das Zeichen des Feuers. Diese vier Symbole entsprachen den Farben im Tarot, was Scarlett schon immer amüsiert hatte. Tarot wurde von Unwissenden häufig als reine Scharlatanerie betrachtet – die meisten Leute ahnten nicht, wie nah die Karten der Wahrheit kamen.
Scarlett gehörte den Kelchen an, was bedeutete, dass ihre Magie am stärksten war, wenn sie mit dem Element Wasser arbeitete. Von Minnie hatte sie gelernt, dass sie mit ihrer Magie – die richtigen Symbole und Worte vorausgesetzt – die Welt größer und heller zu machen vermochte.
Minnie war selbst nie eine Rabenschwester gewesen; ihre Familie pflegte ihre ganz eigene Magie zu wirken, voller Geheimnisse und Zauber, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Aber sie kannte die Winters schon ihr ganzes Leben und verstand den familiären Druck, der auf Scarlett lastete, besser als irgendjemand sonst auf der Welt. Minnie hatte immer an sie geglaubt – hatte sie getröstet, wenn sie die mütterliche Enttäuschung oder Eugenies Verachtung zu spüren bekam. Minnie war es auch gewesen, die Scarlett gesagt hatte, dass sie die mächtigste Hexe der Welt werden konnte, wenn sie nur an sich selbst glaubte und auf die Magie vertraute.
Als Minnie letztes Frühjahr an Altersschwäche gestorben war, hatte Scarlett so furchtbar um sie geweint, dass es rings um sie plötzlich zu regnen begonnen hatte. Noch immer verspürte sie beim Gedanken an Minnie eine schmerzliche Leere tief in ihrem Herzen, aber sie wusste, dass Minnie sich nichts mehr gewünscht hatte, als dass Scarlett glücklich war, und deshalb war sie entschlossener denn je, ihrer Familie und sämtlichen Rabenschwestern zu beweisen, dass sie mächtig genug war, um die nächste Präsidentin der Schwesternschaft zu werden.
Scheitern war keine Option.
Marjorie hielt vor dem Kappa-Verbindungshaus, und Scarletts Herz setzte einen Schlag aus. Das wunderschöne taubengraue Gebäude war im Stil der französischen Renaissancearchitektur erbaut, die Balkone hatten schmiedeeiserne Geländer, und auf dem Dach befand sich ein Witwenausguck, auf dem die Schwestern manchmal ihre Sprüche einübten. Mitglieder der Schwesternschaft strömten in Scharen ins Haus, sie schleppten Koffer und Lampen und umarmten einander, nachdem sie sich einen ganzen Sommer lang nicht gesehen hatten. Da war Hazel Kim, eine Schülerin im zweiten Jahr und der Star des Leichtathletikteams; Juliet Simmons, eine brillante Chemikerin und Trankbrauerin in ihrem Seniorjahr; und Mei Okada aus Scarletts Jahrgang, die ihr Aussehen mit der gleichen Leichtigkeit wechselte wie andere ihre Klamotten.
Marjorie schaltete den Motor aus und blickte sich um wie die Befehlshaberin auf einem Schlachtfeld. »Wo steckt Mason? Ich wollte alles über seine Reise hören.«
»Er kommt frühestens morgen«, antwortete Scarlett und versuchte, ihr vorfreudiges Lächeln zu zügeln.
Sie hatte Mason fast zwei Monate lang nicht gesehen. So lange waren sie noch nie getrennt gewesen, seit sie vor zwei Jahren zusammengekommen waren. Nach dem Besuch einer Hochzeit in Italien hatte Mason ganz spontan beschlossen, eine Rucksacktour durch Europa zu machen. Hatte das Praktikum in der Kanzlei seines Vaters unterbrochen – und sämtliche Pläne torpediert, die Scarlett bereits für den Sommer gemacht hatte. Also hatte Scarlett ihr Praktikum in der mütterlichen Kanzlei absolviert, über Schriftsätzen gebrütet, mit ihren Verbindungsschwestern die sozialen Events für das kommende Jahr geplant und dabei die ganze Zeit auf die Fotos und kurzen Nachrichten von Mason gewartet, die nur sehr sporadisch eintrudelten und sie über seine Reise auf dem Laufenden hielten – Bin eben im Lake Como geschwommen – wünschte, du wärst auch hier; du solltest das Wasser in Capri mal sehen! Nach deinem Abschluss nehme ich dich mit hierher. Es sah Mason gar nicht ähnlich, sich vor familiären Verpflichtungen zu drücken oder sie den ganzen Sommer lang warten zu lassen. Und normalerweise wartete Scarlett auf nichts und niemanden, das war ein ehernes Grundprinzip, aber Mason war es wert.
»Lade ihn zu uns ein, sobald es geht«, drängte Marjorie, ihre Stimme klang so warm wie nur selten. Eugenie verlagerte das Gewicht, nahm ihr Handy und scrollte gereizt durch ihre Kanzleimails.
Scarlett unterdrückte ein selbstzufriedenes Lächeln. Mason war der einzige Punkt, den sie gegen Eugenie verbuchen konnte. Mason war ein Spiegelgefährte. So nannte man in der Schwesternschaft jene Menschen, die einer Rabenschwester würdig waren. Und die Messlatte dafür, sich als Spiegelgefährte zu qualifizieren, lag ungeheuer hoch. Nur die Allerbesten genügten diesen Ansprüchen, und Mason war der Beste. Nicht nur seine Herkunft stimmte – er war der Sohn von Georgias zweitberühmtestem Anwalt, nach Marjorie natürlich, und Präsident ihrer verbündeten Bruderschaft –, sondern vor ihm lag auch eine glänzende Zukunft. Der beste Student seines Jahrgangs, sportlich, wahnsinnig sexy … und ihr ganz und gar ergeben. Das i-Tüpfelchen: Ihre Mutter war hin und weg von ihm.
»Danke fürs Bringen, Mama«, sagte Scarlett, die Hand schon auf dem Griff der Wagentür.
»Oh, hier«, sagte ihre Mutter, als wäre es ihr eben erst wieder eingefallen. Sie reichte eine verpackte Schachtel nach hinten.
Scarlett spürte, wie ihr Gesicht aufleuchtete, als sie die Schachtel entgegennahm – sie konnte sich nicht entsinnen, dass ihre Mutter Eugenie am ersten Tag ihrer Juniorzeit am College ein Geschenk gemacht hatte –, und sie musste sich zusammenreißen, um das Papier nicht hastig aufzureißen.
Es war ein Deck Tarotkarten, wunderschön illustriert. Auf den Kartenrückseiten war eine wissend lächelnde Frau abgebildet, die dem Betrachter förmlich entgegenzukommen schien.
»Sind das mal deine gewesen?«, erkundigte sich Scarlett, die sich fragte, ob dies vielleicht die Karten waren, die ihre Mutter und Eugenie in ihrer Zeit als amtierende Präsidentinnen benutzt hatten. Der Gedanke, in eine solche Familientradition aufgenommen zu werden, berührte sie.
»Die sind brandneu. Ich habe sie von einer mächtigen Münzen-Schwester bestellt, die eine hohe Position im Senat innehat. Sie hat sie selbst gemalt«, verkündete ihre Mutter.
Vor Enttäuschung wurde Scarlett die Brust eng. So sehr Scarlett politischen Adel auch zu schätzen wusste – wie kam ihre Mutter dazu, ihr diese Karten jetzt zu geben? »Sie sind wunderschön, Mama, aber ich hab doch schon Minnies Karten.« Scarlett war fassungslos, wie wenig ihre Mutter sie offenbar kannte. Niemals würde sie Minnies Deck durch irgendwelche brandneuen Karten ersetzen.
»Neues Jahr, neuer Anfang«, sagte ihre Mutter. »Ich weiß, wie viel dir Minnie bedeutet hat; mir ja auch. Aber ich weiß, dass du noch immer trauerst, und Minnie würde nicht wollen, dass du diese Traurigkeit mit dir ins neue Jahr schleppst. Dich als Präsidentin der Rabenschwestern zu sehen wäre ihr wichtiger als alles andere.«
Du meinst, dir wäre es wichtiger als alles andere. Scarlett steckte die Karten ein, beugte sich zwischen den Sitzen nach vorn und küsste ihre Mutter auf die Wange. »Du hast recht. Danke, Mama«, murmelte sie, obwohl sie ganz sicher nicht vorhatte, diese neuen Karten jemals zu benutzen.
Nach einem pflichtschuldigen Kuss für Eugenie und einem zweiten für ihre Mutter stieg Scarlett aus und holte ihre beiden Koffer aus dem Kofferraum, die dank eines Zaubers federleicht waren. Sie winkte und sah dem Wagen nach, bis er um die nächste Straßenecke verschwunden war. Als sie einen Schritt zurücktrat, stieß sie mit einem harten, muskulösen Körper zusammen. »Hey. Pass doch auf!«, zischte sie.
Hinter ihr erklang eine ungehaltene Stimme: »Du bist in mich reingerannt.«
Scarlett drehte sich um und sah sich Jackson Carter gegenüber, mit dem sie letztes Jahr gemeinsam Philosophie gehabt hatte. Er trug kurze Jogginghosen und Kopfhörer und war ein bisschen außer Atem. Auf der dunkelbraunen Stirn standen Schweißperlen, und das T-Shirt klebte ihm schweißnass am durchtrainierten Körper. »Aber eigentlich überrascht es mich nicht. Ihr Kappas führt euch schließlich immer auf, als würde euch hier alles gehören.«
»Ist ja auch so«, erwiderte Scarlett ohne jedes Zögern. Dies war ihre erste Unterhaltung, bei der es nicht um tote Philosophen ging, und sie fand, er bewies ausgesprochen schlechte Manieren, indem er das Gespräch mit einer Beleidigung begann. »Du stehst direkt vor unserem Verbindungshaus.«
Jackson stammte nicht aus Savannah. Nicht im Entferntesten. Das war ganz klar an seinen schlechten Manieren und seinem grundlegenden Mangel an Ehrerbietung zu erkennen – ganz zu schweigen davon, dass ihm der Akzent fehlte. Seine Konsonanten hockten stur an ihrem Platz, ganz anders als bei ihr – sie selbst dehnte sie effektvoll in die Länge. Ein Gentleman hätte ihr angeboten, ihre Koffer zu tragen. Allerdings hätte ein Gentleman sie gar nicht erst dafür angeblafft, dass sie auf ihrem eigenen angestammten Weg stand.
Jackson beugte sich dichter heran. »Wie ist das eigentlich, verliert ihr Kappas eure Seele Stück für Stück oder geht das mit einem Ruck, so wie man ein Pflaster abzieht?«
Scarlett sträubten sich die Nackenhaare. Sie wusste, wie er sie sah, und sie wusste auch, weshalb. Es gab unzählige Filme, die Verbindungsstudentinnen als hohle, arrogante Hexen darstellten, und damit meinte sie nicht die magische Sorte. Und leider gab es nur allzu viele echte Aufnahmen und Geschichten, die dieses Bild bestätigten. Bei dem Gedanken an ein Video, das neulich viral gegangen war, wäre sie beinahe zusammengezuckt: Ein Verbindungsmädchen hatte einen offenen Brief an ihre Schwestern geschrieben, der alles auflistete, was sie an ihnen verabscheute. Aber Scarlett war sicher: Für jede dieser scheußlichen Geschichten gab es Dutzende andere über Mädchen, die aus gutem Grund in einer Verbindung waren. Um der Gemeinschaft willen. Und Kappa war noch mehr als eine einfache Gemeinschaft: Das Haus bot Schutz, war ein sicherer Rückzugsort, an dem die jungen Mitglieder der Schwesternschaft lernen und sich in der Anwendung der Magie üben konnten. Allerdings konnte sie das Jackson natürlich nicht erzählen.
»Mit einem Ruck«, antwortete sie. »Es erstaunt mich, dass du das nicht weißt, wo du doch von deinem hohen Ross aus so einen guten Ausblick auf uns arme, moralisch verkommene Verbindungsschwestern hast.«
»Wenigstens in dem Punkt sind wir uns einig.« Mit blitzenden braunen Augen verschränkte Jackson die Arme vor der Brust.
»Wenn du so ein großes Problem mit uns hast«, sagte Scarlett, die allmählich richtig in Fahrt kam, »dann solltest du vielleicht besser aufpassen, wo du langrennst.«
»Ist das eine Drohung?« Er zog eine Braue hoch und musterte sie von oben bis unten, als sähe er sie zum ersten Mal. »Denn nach allem, was man so hört …«
Plötzlich wurde sein Blick ganz leer, und er sah über sie hinweg, als würde er etwas betrachten, das sich knapp über ihrem Kopf befand. Als wäre sie für ihn vollkommen aus der Welt verschwunden. Sein Kopf ruckte zur Seite, und ohne ein weiteres Wort lief er wieder los.
Scarlett drehte sich zum Verbindungshaus um. Dahlia Everly, die amtierende Präsidentin, und Tiffany Beckett, Scarletts beste Freundin, kamen gerade Arm in Arm die Treppe hinunter; Dahlias blonder Pferdeschwanz war ein wenig dunkler als Tiffanys platinblondes Haar. Dahlia zwinkerte ihr zu, womit klar war, wer hinter dem Zauber steckte, der den Jungen gerade getroffen hatte.
»Danke.« Scarlett stellte ihre Koffer ab und schoss einen letzten vernichtenden Blick hinter dem entschwindenden Jackson her. Sie hatte keine Ahnung, was mit ihm los war oder weshalb er die Kappas so sehr verabscheute. Wahrscheinlich hatte ihm letztes Jahr eine der Schwestern einen Korb gegeben. Jungs waren manchmal lächerlich empfindlich und kleingeistig.
»Was war denn los?«, fragte Dahlia. »Du hast ausgesehen, als ob du ihm jede Sekunde eine Kategorie drei überbrezelst.«
»Wohl kaum. Ein Bengel wie der ist es nicht wert, ihn ordentlich durchzuweichen.«
»Warum hast du denn überhaupt mit dem geredet?« Dahlia rümpfte die Nase. Sie war die vollendete Verkörperung der befehlsgewohnten Verbindungspräsidentin: Für sie war jemand, der nicht Teil des Griechischen Systems war, ihre Zeit nicht wert.
»Hab ich nicht. Er ist in mich reingerannt – wortwörtlich.«
Tiffany lachte bloß und breitete die Arme aus.
Scarlett stürzte sich in die Umarmung ihrer besten Freundin, drückte sie fest an sich, wobei sie allerdings darauf achtete, Tiffanys Seidenbluse nicht zu zerknittern. »Ich hab dich vermisst.«
»Ich dich auch.« Tiffany küsste sie auf die Wange. Ihr dunkelroter Lippenstift hinterließ nicht die geringste Spur. Das Make-up einer Rabenschwester verschmierte nie.
»Wie geht es deiner Mom?«, erkundigte sich Scarlett.
Über Tiffanys Gesicht glitt ein Schatten. Dahlia verlagerte unbehaglich das Gewicht. »Wir probieren es gerade mit einer neuen Behandlung. Bald wissen wir mehr.«
Scarlett umarmte Tiffany noch einmal. Ihre Freundin hatte den Sommer in Charleston verbracht, um ihrer Mutter beizustehen, die gegen den Krebs kämpfte. Letztes Jahr hatte Tiffany Dahlia gebeten, einen gemeinsamen Heilritus für ihre Mom durchzuführen – auch wenn jede Rabenschwester eine fähige Hexe war, so war die vereinte Schwesternschaft doch erheblich mächtiger als jede für sich. Als Präsidentin war es an Dahlia zu entscheiden, welche Zauber die Schwesternschaft in Gemeinschaft wirkte – eine Aufgabe, die sie ganz ungeniert genoss. Als Houstoner Debütantin liebte Dahlia es, das Sagen zu haben, diejenige zu sein, zu der die anderen aufblickten. Ihr Selbstbewusstsein machte sie zu einer ausgezeichneten Präsidentin, allerdings beschlich Scarlett manchmal der Eindruck, dass Dahlia die eigene Autorität mehr am Herzen lag als die Bedürfnisse der anderen Mädchen. Und laut Dahlia gab es in der Geschichte des Hauses Kappa eine Menge fehlgeschlagener Heilungsrituale dieser Größenordnung. »Manches liegt einfach nicht in unserer Macht«, hatte Dahlia gesagt.
Tiffany hatte ihr diese Abfuhr nie verziehen, weil sie den Verdacht hegte, dass Dahlia sich weniger um Tiffanys Mom sorgte als um die möglichen Risiken und darum, wie das Durchführen eines solchen Zaubers nach außen wirken mochte. Scarlett hatte die Angst in den sonst so furchtlosen Augen ihrer besten Freundin gesehen und war ebenfalls unzufrieden mit Dahlias Entscheidung. Sie hatte mit Minnie darüber gesprochen. Damals hatte sie ja nicht gewusst, wie nah Minnie selbst dem Tode stand.
»Gäbe es einen Zauber gegen das Sterben, wären wir keine Hexen – wir wären unsterblich. Jene Zauber, die den Tod besiegen, fordern ihn zugleich als Preis«, hatte Minnie sie mit traurigem Lächeln gewarnt.
Mit einem strahlenden Lächeln, das Scarlett sofort als vorgetäuscht durchschaute, löste sich Tiffany aus ihrer Umarmung. Sie blinzelte rasch, um die Tränen zurückzudrängen, denen sie, wie Scarlett deutlich spürte, ganz nah war, obwohl Tiffany eine Schwester der Schwerter war, nicht der Becher.
»Wie laufen die Vorbereitungen?«, wechselte Scarlett das Thema, um Tiffany aus dem emotionalen Fokus zu entlassen, und blickte zum Haus hinauf.
»Hazel und Jess kümmern sich gerade um die Zauber«, sagte Tiffany, sichtlich erleichtert, nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
Scarlett nickte. Die Tradition wollte, dass die Studentinnen im zweiten Jahr das Haus für die Rekrutierungsparty dekorierten. Dieses Jahr lautete das Thema »1920er-Jahre«, und sie konnte es kaum erwarten zu sehen, was sich ihre Schwestern hatten einfallen lassen.
»Hast du die Wunderkerzen mitgebracht?«, fragte Dahlia.
»Hab ich hier«, sagte Scarlett und tippte auf einen ihrer Koffer. »Hab sie gestern Abend verzaubert.«
Minnie hatte immer gesagt, dass in Wirklichkeit die Magie die Wahl traf, und sie hatte recht – meistens jedenfalls. Alle Mädchen waren magisch begabt, ob sie es wussten oder nicht. Die Stärke ihrer Magie war entscheidend. Während sie in manchen kaum mehr war als ein Flüstern, nahezu unhörbar, konnten andere Windböen von der Stärke eines Tornados herbeirufen. Die Wunderkerzen, die die Kappas bei ihren Rekrutierungspartys verteilten, zeigten an, wer über ausreichend Magie verfügte, um zu den Rabenschwestern zu gehören. Aber das war nicht das einzige Kriterium. Die Rabenschwestern nahmen nur makellose Mädchen auf. Auf Persönlichkeit, Abstammung, Intelligenz und Kultiviertheit kam es an. Und das Allerwichtigste war, den anderen eine gute Schwester zu sein.
»Ich kann es nicht erwarten, die neuen Kandidatinnen in Augenschein zu nehmen«, sagte Tiffany und tippte lächelnd die Fingerspitzen aneinander.
»Natürlich nehmen wir nur die Besten«, sagte Scarlett. Unter all den Westerly-Frischlingen mächtige Hexen ausfindig zu machen war, als würde man Diamanten in einem Meer aus geschliffenen Zirkonia suchen. Sie wollte keinen Haufen aus aufsässigen, untauglichen Verbindungsschwestern im zweiten Jahr haben, wenn es für sie an der Zeit war, Präsidentin zu werden.
»Natürlich«, bestätigte Dahlia mit einem Stirnrunzeln in ihrem perfekten Gesicht. »Wir müssen Kappa beschützen. Das Letzte, was wir wollen, ist ein zweiter Harper-Skandal.«
Scarlett drehte es den Magen um, und sie vermied es sorgsam, Tiffany in die Augen zu sehen. Ein zweiter Harper-Skandal. Zwischen ihr und Tiffany entstand eine eigenartige Spannung, als hätten sie gerade dieselben finsteren Gedanken, obwohl keine von ihnen ein Wort gesagt hatte. Gedanken an etwas, an das zu denken Scarlett sich stets verbot.
Etwas, das alles zerstören könnte, für das sie so hart gearbeitet hatte.
3
Vivi
Vivi rückte den Schulterriemen ihres Rucksacks zurecht und zuckte zusammen, als sich die Ecke eines gebundenen Buchs in ihren Rücken bohrte. Sobald sie durchs schmiedeeiserne Tor getreten war, stellte sie den größeren ihrer beiden Koffer ab und beugte und streckte die verkrampften Finger. Die Busstation war keine zweieinhalb Kilometer von Westerly College entfernt, aber ihre vollgestopften Koffer von dort aus hierherzuschleppen hatte fast eine Stunde gedauert, und ihre Handflächen brannten. Aber als Vivi jetzt einen tiefen Zug der verblüffend gut riechenden Luft in die Lunge sog, spürte sie, wie die Aufregung ihre Erschöpfung vertrieb. Sie hatte es geschafft. Nach achtzehn anstrengenden Stunden – ach was, nach achtzehn anstrengenden Jahren – stand sie jetzt endlich auf eigenen Füßen, traf ihre eigenen Entscheidungen, und ihr richtiges Leben konnte beginnen.
Sie warf einen Blick auf ihr Handy, auf dem eine Karte eingeblendet war, dann blickte sie über das vor ihr liegende Rasengeviert. Auf der anderen Seite stand ein mit Efeu überwuchertes Steingebäude, und aus den Fenstern im zweiten Stock hing ein Banner mit der Aufschrift WIRHEISSENUNSERENEUZUGÄNGEWILLKOMMEN.
Ich bin fast da, sagte sie sich selbst und stapfte weiter, achtete nicht auf ihre schmerzenden Schultern. Aber als sie die ganzen Studenten und ihre Eltern sah, die sich vor dem Gebäude drängten, wurde ihr ein bisschen übel. Neue Situationen waren ihr leider alles andere als fremd. Sie hatte insgesamt vier Grundschulen besucht, zwei Mittelschulen und drei Highschools. Die meiste Zeit ihres Lebens war Vivi immer die Neue gewesen.
Aber jetzt war alles anders. Sie würde vier ganze Jahre an der Westerly bleiben, eine längere Zeit, als sie je zuvor an ein und demselben Ort verbracht hatte. Sie würde also nicht automatisch das neue Mädchen sein. Sie konnte sein, wer immer sie sein wollte.
Sie musste nur noch rausfinden, wer genau das eigentlich war.
Vivi schleppte ihre Taschen zu dem Klapptisch, an dem freiwillige Helfer Informationspakete an die Neuen verteilten. »Willkommen«, flötete ein blasses Mädchen mit langem, glattem rotem Haar, als sich Vivi näherte. »Wie lautet dein Nachname?«
»Devereaux«, antwortete Vivi und betrachtete das Mädchen mit der leuchtend rosafarbenen Bluse und dem perfekten Lidstrich. Normalerweise empfand sie solche Eleganz als Seltenheit, etwas, das in ihr Bewunderung auslöste, aber nicht zwingend Neid, ungefähr so wie die Fähigkeit, mit der Zunge die eigene Nasenspitze zu berühren oder auf den Händen zu laufen. Aber als sie sich umsah, stellte sie fest, dass solche Gepflegtheit hier offenbar der Standard war. Nie zuvor hatte Vivi so viele manikürte Hände und pastellfarbene Oberteile gesehen, und zum ersten Mal fragte sie sich, ob ihre Mutter vielleicht doch recht gehabt hatte – vielleicht war das hier tatsächlich nicht die richtige Schule für Vivi.
»Devereaux«, wiederholte das rothaarige Mädchen und arbeitete sich durch einen dicken Stapel Unterlagen. »Du bist in Simmons Hall untergebracht, Raum drei-null-fünf. Simmons ist das Gebäude dort auf der rechten Seite. Hier ist dein Info-Ordner … und dein Ausweis. Er ist zugleich dein Schlüssel, also nicht verlieren.«
»Danke.« Vivi streckte die Hand nach der Mappe aus, aber das Mädchen ließ nicht los. Sie blickte wie gebannt über Vivis Schulter hinweg.
Als sich Vivi umsah, stellte sie fest, dass alle in dieselbe Richtung starrten. Etwas an der Luft auf dem Campus schien sich zu verändern, nur ganz leicht, wie die schwache Elektrizität vor einem Sturm.
Vivi richtete den Blick in dieselbe Richtung wie alle anderen. Drei Mädchen schritten über den samtig grünen Rasen in der Mitte des quadratischen Platzes. Selbst aus der Entfernung war offensichtlich, dass sie keine Neuankömmlinge waren. Zum Teil lag es an der Kleidung; das schwarze Mädchen in der Mitte trug ein mintgrünes Kleid mit einem ausgestellten Rock, der um ihre langen Ballerinabeine schwang, und ihre Freundinnen – beide weiß und blond – trugen nahezu identische Tweedröcke und cremefarbene Seidenoberteile, wie Vivi sie bisher nur bei reichen Frauen in Filmen gesehen hatte. Aber selbst in schäbigen Jogginghosen hätten die Mädchen Aufmerksamkeit erregt. Sie bewegten sich mit einer gleichmütigen Selbstsicherheit, als wüssten sie genau um ihr Recht, überall langzugehen, wo sie wollten, so schnell oder so langsam es ihnen gerade gefiel. Als hätten sie keinerlei Scheu, ihren Platz in der Welt zu beanspruchen. Für jemanden wie Vivi, die einen Großteil ihres Lebens damit verbrachte, sich so gut wie möglich anzupassen und nicht aufzufallen, war es eigenartig berauschend, andere Mädchen zu sehen, denen es derart offensichtlich nichts ausmachte, im Mittelpunkt zu stehen.
Sie sah zu, wie das Trio auf ein Haus aus roten Ziegelsteinen zuging, vor dem etliche Studenten warteten. Sobald die Mädchen eintrafen, teilte sich die Menge; alle machten bereitwillig Platz, um die drei durchzulassen.
»Das sind Kappas«, sagte die Rothaarige, der Vivis neugieriger Blick offenbar aufgefallen war. »Eine der Schwesternschaften auf dem Campus. Alle nennen sie die Rabenschwestern. Ich weiß nicht, weshalb. Vielleicht weil sie so mysteriös und geheimnistuerisch sind.«
»Tut mir leid«, sagte Vivi und errötete, weil sie beim Gaffen erwischt worden war.
»Schon okay. Die Wirkung haben sie auf jeden. Wenn du sie in Aktion erleben willst, dann geh heute Abend zu ihrer Rekrutierungsparty. Wenn sie potenzielle neue Mitglieder in Augenschein nehmen, drehen sie so richtig auf.« Sie zuckte mit den Schultern und tat gleichgültig, aber in ihren Augen schimmerte unübersehbare Sehnsucht. »Du solltest es dir wirklich mal ansehen, und wenn es nur ist, um einen Blick auf ihr Verbindungshaus zu werfen. Ist die einzige Gelegenheit des ganzen Jahres, zu der sie Nicht-Kappas reinlassen, und es ist ziemlich spektakulär.«
»Ja, mal sehen«, sagte Vivi, insgeheim entzückt, dass jemand annahm, sie wäre der Typ Mädchen, der sich eine Party »mal ansehen« ging. Auf keiner ihrer drei Highschools war sie je zu einer Party eingeladen worden. Sie war nicht ganz sicher, dass ausgerechnet dieses Großereignis der Kappas der richtige Einstieg war, aber wer weiß? Vielleicht war College-Vivi der Herausforderung ja gewachsen.
»Na dann. Willkommen auf Westerly!«
Vivi atmete tief durch, mobilisierte ihre letzten Kraftreserven und schleppte ihre Koffer die dreistufige Steintreppe hinauf und durch die offen stehende Holztür. Schleifte die Koffer mühsam hinter sich das enge Treppenhaus hinauf in der Hoffnung, dass sie es ohne Pause ins nächste Stockwerk schaffen würde, aber nach ein paar Stufen ließen ihre Arme sie einfach im Stich. Die Koffer purzelten die Stufen hinunter und schlugen mit lautem Plumps unten auf.
»Brauchst du Hilfe?«
Vivi drehte sich um und sah am Fuß der Treppe einen weißen Jungen mit dunklem, lockigem Haar stehen, der belustigt zu ihr hinaufgrinste.
Gerade wollte sie sagen, sie hätte alles im Griff, aber dann ging ihr auf, wie lächerlich das klingen würde – immerhin lagen die Koffer, die sie gerade hatte fallen lassen, direkt vor seinen Füßen. »Danke. Wenn es dir nichts ausmacht?«
»Macht es nicht. Und selbst wenn, würde ich es trotzdem tun.« Er hatte einen schwachen Südstaatenakzent und zog die Vokale etwas in die Länge. Im nächsten Moment schnappte er sich beide Koffer zugleich und stapfte damit die Treppen hinauf, an Vivi vorbei.
»Anscheinend stimmt es, was man über Südstaatenmanieren sagt«, sagte Vivi und zuckte zusammen, weil sie die alberne Bemerkung im selben Augenblick bereute.
»Oh, mit Manieren hat das gar nichts zu tun«, antwortete der Junge ein bisschen außer Atmen. »Das ist eine Frage der allgemeinen Sicherheit. Du hättest jemanden umbringen können.«
Vivi spürte, wie sie rot anlief. Eilig schloss sie zu ihm auf. »Lass mich einen Koffer tragen«, sagte sie.
Sie erreichten den zweiten Stock, aber er setzte die Koffer nicht ab. »Kann ich nicht«, sagte er vergnügt. »Meine Neigung zu Ritterlichkeit und die Besorgnis um die öffentliche Sicherheit machen es mir vollkommen unmöglich, dieses Gepäck abzustellen, bevor es sich außerhalb der Gefahrenzone befindet. Welche Zimmernummer?«
»Drei-null-fünf. Aber du musst das wirklich nicht tun. Den Rest schaffe ich auch allein.«
»Denk nicht mal dran«, antwortete er. Vivi folgte ihm und empfand eine Mischung aus schlechtem Gewissen und Aufregung. Nie zuvor hatte ein Junge ihr Zeug getragen.
Als sie den dritten Stock erreichten, wandte sich der Junge nach rechts und stellte die Koffer ächzend vor einer Tür ab. »So, da wären wir. Zimmer drei-null-fünf.«
»Danke.« Vivi fühlte sich immer unbeholfener. Sollte sie ihn nach seinem Namen fragen? Nach seinem Studiengang? Wie freundeten sich normale Menschen mit anderen Leuten an?
»War mir ein Vergnügen.« Er grinste, und für einen Augenblick konnte sich Vivi auf nichts anderes mehr konzentrieren als auf das Grübchen, das sich in seiner linken Wange bildete. Ehe ihr einfiel, was sie sagen sollte, machte er kehrt und ging wieder Richtung Treppenhaus. »Versuch, niemanden umzubringen«, rief er über die Schulter, und dann war er verschwunden.
»Ich kann für nichts garantieren.« Sie bemühte sich, verspielt und sexy zu klingen, obwohl es keine Rolle mehr spielte, da er längst weg war.
Vivi öffnete die Tür, darauf gefasst, sich einer Mitbewohnerin gegenüberzusehen, aber das Zimmer war leer. Es gab nur zwei extragroße Doppelbetten darin, zwei abgenutzte Holzschreibtische und einen Schrank mit einem Ganzkörperspiegel an einer Tür. Für ein Studentenwohnheim ziemlich nett – geräumig, hell und luftig. Das genaue Gegenteil der vollgestopften, engen Wohnung in Reno.
Sie zerrte einen ihrer Koffer zum Bett und öffnete ihn, während sie sich fragte, wann ihre Mitbewohnerin kommen würde und ob es wohl okay war, wenn sie einfach eine Seite des Zimmers für sich beanspruchte. Doch ehe sie etwas aus ihrem Koffer nehmen konnte, flog ein Fenster auf; warme, duftende Luft wehte herein und wirbelte die Blätter aus ihrer Infomappe durchs Zimmer. Als sie das Zimmer betreten hatte, war das Fenster fest geschlossen gewesen.
Seufzend sammelte Vivi die Blätter ein und rief sich ins Gedächtnis, dass durch den großen Temperaturunterschied im Zimmer und draußen ausreichend Luftdruck entstehen konnte, um das Fenster aufzustoßen. Dieses Phänomen war nur eins von vielen, die sie sich eingeprägt hatte, um sich die Eigenartigkeiten zu erklären, die überall passierten, wo sie sich aufhielt.
Doch dann fiel ihr Blick auf die Tarotkarte, die fein säuberlich am Kopfende ihrer unbezogenen Matratze lag, als hätte jemand sie absichtlich dort hingelegt.
Es war die Karte mit dem Tod darauf, die ihre Mutter ihr gegeben hatte.
Schauerlich grinsend starrte das Skelett sie an, und einen Augenblick lang glaubte sie zu sehen, wie die Augen rot aufglühten. Vivi erschauerte, obwohl sie ganz genau wusste, dass ihr nur das Licht einen Streich spielte. Westerly ist nicht sicher, nicht für jemanden wie dich, hörte sie Daphne flüstern.
Ein Stück den Flur runter knallte eine Tür, und vom Campus unten drang Gelächter herauf. Vivi schüttelte den Kopf und riss sich zusammen. Hier war sie jetzt also, hatte sich erst gestern von ihrer Mutter befreit, und schon hielt sie Ausschau nach irgendwelchen Zeichen des Universums. Daphne wäre vermutlich fast stolz auf sie gewesen.
Mit einem abfälligen Schnauben steckte sie die Karte mit dem Tod darauf in ihre Schreibtischschublade und schloss sie. Vivi brauchte keine Zeichen. Sie brauchte keine Magie. Sie konnte auf die Stimme ihrer Mutter, die ihr irgendwas ins Ohr flüsterte, gut verzichten. Alles, was sie wollte, war ein ganz normales Studentenleben.
Und das würde heute Abend mit dieser Rekrutierungsparty beginnen.
4
Scarlett
Das Kappa-Verbindungshaus war wie verwandelt. Die moderne metallic-graue Tapete war zu dem hellen Rosa verblasst, das die Wände früher einmal geziert hatte, und statt des niedrigen Samtsofas stand da jetzt eine vergoldete Chaiselongue. Der Raum war kaum wiederzuerkennen. Nur die Musik, die aus den Bluetooth-Lautsprechern dröhnte, verriet, dass sie sich noch immer im 21. Jahrhundert befanden. Die Rekrutierungsparty begann in zwei Stunden, und alle Schwestern rackerten sich ab – die Studentinnen im zweiten Jahr waren für die Deko verantwortlich, die Juniorstudentinnen kümmerten sich um Speisen und Getränke, und die Mädchen aus dem Abschlussjahrgang eilten hin und her, um sich zu vergewissern, dass sämtliche Hinweise auf Magie verschwunden oder gut verborgen waren.
Nachdem sie das Cateringteam fertig instruiert hatten, begaben sich Scarlett und Tiffany nach oben, um sich umzuziehen. Tiffanys Zimmer lag zwei Türen neben dem von Scarlett, und als Tiffany auf dem Rückweg vorbeikam, spähte sie hinein. »O mein Gott, ich kann es nicht fassen, dass du den immer noch hast«, sagte sie, kam herein und nahm den ramponierten dreibeinigen Elefanten in die Hand, der auf Scarletts Kommode stand.
Scarlett lachte. »Ich sollte ihn vermutlich vor der Party noch wegstellen.«
»Der erste Eindruck ist alles«, stimmte Tiffany ihr zu.
Scarlett hatte Tiffany vor zwei Jahren kennengelernt, als sie selbst auf die Rekrutierungsparty gegangen war. Obwohl sie für Kappa geboren und erzogen war, hatte Scarlett sich trotzdem Sorgen gemacht – Sorgen, dass sie nicht genügen, dass sie ihre Familie enttäuschen würde. Aber dann war auf einmal Tiffany neben ihr aufgetaucht, hatte auf Dahlias perfekt geschwungene Nase gedeutet und geflüstert: »Ich verwette meinen gesamten Treuhandfonds darauf, dass diese Nase ein Illusionszauber ist.« Scarlett hatte nicht gelacht, hätte es allerdings gern getan. Plötzlich erschien ihr das Mädchen, das sich um die Neuzugänge des Hauses Kappa kümmerte, gar nicht mehr so einschüchternd, und ihre Nervosität verflüchtigte sich. Es stellte sich heraus, dass Tiffany gar keinen Treuhandfonds besaß, nicht im Entferntesten, aber sie war trotzdem reich – an Magie, an Spontaneität und an Respektlosigkeit. Ehe sie Tiffany begegnet war, hatte Scarlett nicht die leiseste Ahnung gehabt, wie sehr sie jemanden mit den beiden letzteren Eigenschaften in ihrem Leben brauchte.
Damals hatte das Thema »Ein Ball in Schwarz-Weiß« gelautet, und sie hatten die ganze Nacht lang getanzt in ihren bodenlangen Kleidern, ohne sich darum zu scheren, dass die weißen Säume im Morgengrauen ganz dreckig waren. Am nächsten Morgen hatte Scarlett Tiffany in ihren Lieblingsantiquitätenladen in der Stadt mitgenommen, den die Touristen und auch die anderen Hexen damals noch nicht entdeckt hatten. Sie waren zwischen endlos vielen staubigen Möbeln, Lampen, winzigen Figürchen und alten Bildbänden hindurchgeschlendert, bis Tiffany im Gang mit dem Spielzeug stehen blieb und sich mit kindlicher Begeisterung umsah. »Plüschtiere und Puppen sind einfach das Allerbeste – so viel Energie. So viel reine Liebe«, hatte sie gerufen.
Scarlett hatte nach einem Elefanten gegriffen, dem ein Bein fehlte. »So viel reines Irgendwas«, sagte sie lachend, und Tiffany stimmte in ihr Lachen mit ein. Aber Scarlett hatte gewusst, was sie meinte.
»Danke, dass du mir den Laden damals gezeigt hast«, sagte Tiffany jetzt leise und drückte den abgeliebten Elmo an ihre Brust.
Sie hatten an jenem Tag Dutzende Gegenstände mitgenommen, die sich perfekt für Zaubersprüche eigneten – und waren seither unzertrennlich. Tiffany war genau wie die Schwester, die sich Scarlett immer gewünscht hatte. Sie ergänzten einander gut: Scarlett hielt sich streng an die Regeln der Magie, während Tiffany sich gern Späße mit ihrer Gabe erlaubte. Das Motto der Kappas ließ sich mit »Schwesternschaft. Führung. Treue. Nächstenliebe« übersetzen, was Scarlett immer so interpretiert hatte, dass sie über die Welt herrschen und sie retten sollten. Aber Tiffany betrachtete Hexen nicht als eine Art Superhelden, jedenfalls nicht ausschließlich. »Was hat man denn davon, eine Hexe zu sein, wenn man keine Magie anwenden darf, um bei Starbucks schneller dranzukommen?«, fragte sie immer. Scarlett verstand, worauf sie hinauswollte – was brachte es einem denn, der Welt zu helfen, wenn man sich nicht auch selbst helfen konnte?
Tiffanys Augen schimmerten, wann immer sie eine ihrer brillanten Ideen hatte oder auch nur das kleinste Fünkchen Magie einsetzte, um kleine Alltagsungerechtigkeiten zu korrigieren. Wenn sie beispielsweise mithilfe eines klitzekleinen Zaubers einem Verbindungsbengel, der etwas zu lange und zu aufdringlich eine Schwester angeglotzt hatte, den Drink aufs Hemd kippen ließ oder wenn sie einem sexistischen Professor, der ausschließlich Jungs Bestnoten gab, ein Wahrheitsserum verpasste. Sie war klug und lustig und hatte genau die richtige Dosis Schalk im Nacken. Tiffany war die Einzige, die Scarlett auf andere Gedanken bringen und sie daran erinnern konnte, dass eine Hexe zu sein auch Freude mit sich brachte, nicht nur Pflichten. Und normalerweise war Scarlett guter Dinge, wenn sie zusammen waren, und freute sich auf alles, was sie gemeinsam vorhatten.
Das Tarot lieferte eine Erklärung für die Verbindung zwischen ihnen – Kelche und Schwerter schlossen üblicherweise schnell Freundschaft miteinander –, aber Scarlett stellte sich gern vor, dass sie einander auch ganz ohne Magie nahestünden. Allerdings spürte sie in diesem Augenblick plötzlich Distanz zwischen ihnen.
Scarlett holte tief Luft und dachte daran, was Dahlia vorhin gesagt hatte. »Tiff, denkst du manchmal an Harper?«
Tiffany erstarrte. »Wir waren uns doch einig, dass wir darüber nicht reden.«
»Ich weiß. Aber was, wenn es jemals rauskommt …«
»Wie sollte es denn rauskommen? Wir sind die Einzigen, die davon wissen.«
Das war nicht ganz richtig. Gwen, ein Mädchen aus ihrem Haus, hatte ebenfalls gewusst, was wirklich geschehen war. Aber Gwen war lange fort, und sie hatten dafür gesorgt, dass sie es nie, wirklich niemals irgendwem erzählen konnte.
»Alles ist in Ordnung, Scarlett. Vertrau mir, wir sind auf der sicheren Seite«, sagte Tiffany entschlossen, steckte den Elefanten in Scarletts Schrank und strich ihr Kleid glatt.
»Klopf klopf«, hörten sie eine tiefe Stimme sagen.
Scarlett wirbelte herum. »O mein Gott, Mason! Ich dachte, du kommst erst morgen!«
»Ich hab’s früher geschafft«, antwortete er lächelnd.
Wäre er nicht ihr Freund gewesen, hätte sie sein gutes Aussehen verstörend gefunden. Einer seiner Mundwinkel hob sich stets ganz leicht, als könnte es jeden Moment passieren, dass er über irgendetwas lachte. Seine Haut war tiefgolden gebräunt. Das Haar war etwas länger als sonst und kräuselte sich an den Schläfen, und das T-Shirt konnte die gut definierten Muskeln nicht ganz verbergen.
Tiffany räusperte sich. »Ich lass euch zwei dann mal allein … wir sehen uns gleich unten, Scar.« Sie ließ vielsagend die Brauen tanzen.
Sobald Tiffany weg war, kam Mason auf Scarlett zu, schlang die Arme um sie und zog sie an sich, um sie lange und innig zu küssen. In dem Moment, als sich ihre Lippen berührten, schloss sie die Augen und ließ sich an seine Brust sinken. Auch nach zwei Monaten schmeckte er noch genau wie sonst auch, nach warmen Sommertagen.
Ihre Mutter hatte mal gesagt, Liebe auf den ersten Blick gäbe es nicht, aber dafür Liebe auf den ersten Witz. Scarletts Vater hatte sie mit seinem trockenen Humor förmlich von den Socken gehauen, und auch jetzt noch, dreißig Jahre später, brauchte Marjorie Winter ihren Mann nur anzusehen und wusste sofort, weshalb sie ihn liebte – selbst wenn sie in dem Moment stinkwütend auf ihn war.
In dieser Hinsicht hatte Mason Gregory Scarlett gleich doppelt erwischt: Für sie war es Liebe auf den ersten Blick und auf den ersten Witz gewesen.
Sie waren sich zum ersten Mal auf einer gemeinsamen Party von Kappa und Pi Kappa Rho begegnet, dem Pikiki, auf dem die Kappa-Mädchen Baströcke zu ihren Bikinioberteilen getragen hatten und die PiKas nur Baströcke. Die PiKas hatten allen Mädchen, die ihnen gefielen, Blumenketten umgehängt, und das Verbindungshaus der PiKas war wie eine Insel dekoriert gewesen, mit echten Palmen und einer aufblasbaren Wasserrutsche, die vom Dach bis zum Pool reichte. Mit dem albernen, aber charmanten Spruch, so leicht würde er sich nicht hergeben, hatte Mason sich geweigert, Scarlett eine Kette umzuhängen. Stattdessen hatte er eine einzelne Frangipaniblüte daraus abgezupft und ihr überreicht. Sie verlangte spielerisch auch den Rest der Kette, aber er hatte ihr von einer Inseltradition erzählt. »Ein Mädchen steckt die Blüte hinter ihr rechtes Ohr, wenn sie frei ist und interessiert, und hinter ihr linkes, wenn eher die Hölle zufriert.« Sie hatte gelacht und die Blüte hinter ihr rechtes Ohr gesteckt. Seitdem waren sie zusammen.
Scarlett hatte ihre eigenen Theorien über die Liebe. In ihren Augen ging es um mehr als um den gleichen Humor und das Aussehen. Liebe hatte einen eigenen Rhythmus, so wie er auch jedem Zauber innewohnte. Und Mason und Scarlett hatten diesen gemeinsamen Rhythmus vom ersten Augenblick an gespürt. Über nichts auf der Welt war sich Scarlett sicherer als darüber, dass ihr Platz an Masons Seite war. Oder besser: Sein Platz war an ihrer Seite.
Er löste sich von ihr und trat einen Schritt zurück, um sie genauer anzusehen; sein Blick verharrte kurz dort, wo die weiße Spitze ihres BHs hervorblitzte, und wanderte zum Saum des Kleides weiter, der um ihre Schenkel spielte. »Du siehst einfach fantastisch aus, wie immer. Wie machst du das? Im Ernst, ich hab noch nie gesehen, dass auch nur deine Frisur nicht richtig sitzt.«
»Magie natürlich.« Sie blinzelte ihm zu.
Er wusste nicht, dass es kein Witz war. Die Rabenschwestern waren auf Geheimhaltung eingeschworen. Nur Mitglieder und Ehemalige wie ihre Mutter und ihre Schwester wussten, dass Kappa in Wahrheit eine Schwesternschaft aus lauter Hexen war. Mason interessierte sich sehr für Geschichte, und in einem anderen Leben hätte er sich sicher an den vielen Hexenlegenden erfreut, die sich um ihre Familie rankten. In seinem Zimmer im Verbindungshaus hatte er Dutzende Biografien stehen – die meisten davon fanden sich auf keinem Lehrplan. Es hätte ihn glücklich gemacht zu erfahren, wie Magie die Welt geformt hatte und welche bedeutenden historischen Gestalten Hexen gewesen waren, die ganz subtil die Entwicklung der Zivilisation anstießen. Aber die Regeln waren eindeutig: Er durfte es niemals erfahren. Manchmal hatte sie das Gefühl, dieses Geheimnis würde sie trennen wie ein stählerner Keil, der zwischen ihnen steckte, aber so sehr Scarlett Mason auch liebte, so sehr sie sich wünschte, sie könnte ihm ihr ganzes Selbst offenbaren, sie würde ihre Schwestern niemals verraten.
»Du siehst auch ganz und gar nicht übel aus. Du bist so braun geworden. Lass mich raten, du bist mal wieder auf Jothams Jacht gestrandet?« Jotham war ebenfalls PiKa und Masons bester Freund. Und er war der Grund dafür gewesen, dass Mason über den Sommer unterwegs gewesen war: Jotham hatte ihn zur Hochzeit seines Bruders mitgenommen, und der Rest war Geschichte. Sie beschloss, Jotham später zur Strafe einen Zauber anzuhängen.
Mason schüttelte den Kopf. »Nein, die Jacht hab ich ausgelassen. Es hat sich rausgestellt, dass es in Portugal eine irre Surfer-Szene gibt.«
»Ich wusste gar nicht, dass du ein aufstrebender Beachboy bist.« Scarlett sagte es leichthin, aber sie war verärgert. Sie hatte tatsächlich nicht gewusst, dass sich Mason fürs Surfen interessierte. Weshalb hatte er ihr kein Wort darüber geschrieben? Die letzten Wochen waren so ein Durcheinander gewesen, dass sie kaum Zeit gefunden hatten, um miteinander zu reden. Aber Scarlett war von ihrem Praktikum verschluckt worden – das war eine ganz andere Hausnummer als Mason, der offenbar zu beschäftigt damit gewesen war, zu surfen.
Mason grinste. »Jotham hat irgendein Mädchen, das er auf der Hochzeit kennengelernt hat, auf der Jacht mit nach Ibiza genommen. Ich hatte keine Lust, das fünfte Rad am Wagen zu spielen. Keine Ahnung, was mich da gepackt hat, aber jedenfalls hab ich mir ein Eurail-Ticket gekauft und bin in den Zug gesprungen. Ein paar Nächte hab ich sogar in einem Hostel verbracht.«
Ihre Augenbrauen schossen himmelwärts. »Du hast in einem Hostel übernachtet? Obwohl du eine Jacht hättest haben können?« Die Jacht von Jothams Familie war im Grunde ein kleineres Kreuzfahrtschiff.
»So schlimm war es gar nicht.«
»Bist du sicher, dass du dir keine Bettwanzen eingefangen hast?« Misstrauisch begutachtete sie ihn, und er lachte laut auf.
»Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Es hätte dir gefallen.«
Scarlett rümpfte die Nase. »Ein Hostel? Wohl kaum.«
»Im Ernst, Scar, es war ein bisschen wie in einem dieser Filme mit Untertiteln, die du so gern magst.«
»Aber du hasst solche Filme«, protestierte sie halbherzig. Er sagte immer, wenn er lesen wollte, würde er sich ein Buch schnappen.
Seine Stimme wurde ernst. »Es war ganz anders als diese üblichen Familienurlaube und auch anders als Urlaub mit Freunden. Keine Wanderungen, keine Galas, keine Jachten, keine Erwartungen … gar nichts. Ich hatte alles selbst in der Hand. Hab alle Entscheidungen selbst getroffen. Was ich sehen will, wo ich hingehe. Ich hab mich … frei gefühlt.« Inzwischen sprach er schneller, so wie immer, wenn er über etwas redete, das ihn begeisterte. Nur begeisterte er sich normalerweise für Kant oder die Ilias oder den Börsenindex. Wüsste sie es nicht besser, hätte sie geglaubt, jemand hätte ihn verhext.
»Du klingst fast, als würdest du dir wünschen, du wärst dortgeblieben«, brach es aus ihr heraus.
Mason blickte sie nachdenklich an. »Ein bisschen wünsche ich mir das auch. Aber nur, wenn du dabei wärst, natürlich«, fügte er hastig hinzu. »Hier fühlt sich alles so … vorherbestimmt an. Weißt du, was ich meine?«
Scarlett zog eine Braue hoch. »Nein. Wovon sprichst du?«
Mason ächzte. »All diese Praktika und Rechtsreferendariate und Zusatzkurse. Mein Dad nimmt völlig selbstverständlich an, dass ich in seine Fußstapfen treten und ebenfalls Anwalt werden will.«
»Ich dachte, du willst das auch.« Ich dachte, wir wollten das auch. Sie liebte Masons Ehrgeiz, der ihren eigenen beinahe noch übertraf. An ihrem einmonatigen Jubiläum hatten sie gemeinsam alles durchgeplant: Sie würden an derselben Uni Jura studieren, bevorzugt Harvard, dann Praktika in den Firmen ihrer Eltern absolvieren, und wenn sie genug Erfahrung hatten, dann würden sie sich mit ihrer eigenen Kanzlei selbstständig machen.
»Ich weiß … das dachte ich ja auch. Aber vielleicht …« Er seufzte und schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Ich weiß nicht. Es gibt noch eine Million anderer Möglichkeiten und Start-ups, für die man nichts weiter braucht als einen Computer und eine Internetverbindung. Hast du noch nie darüber nachgedacht, einfach auf deine Eltern und auf Westerly zu pfeifen und was ganz anderes zu machen?«
Scarlett kniff die Augen zusammen. Ein Start-up? Hielt er sich jetzt für Mark Zuckerberg, oder was? »Alles, was ich je wollte, ist hier. Kappa. Du. Unsere Familien. In der Welt herumzugammeln ist was für Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Solche Leute sind wir nicht.«
Mason zuckte mit den Schultern und zupfte an einem ausgefransten Bändchen an seinem Handgelenk herum, das Scarlett noch nie gesehen hatte.