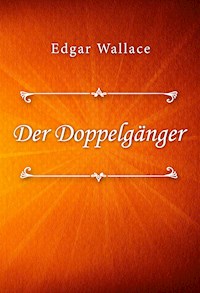
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jenny Miller reist nach London, um sich von ihrem Vermögensverwalter und Onkel Harry Selsbury Auskunft über ihre Finanzen einzufordern, ist ihr doch zu Ohren gekommen, dass ihr gesamtes Erbe veruntreut worden sei. Onkel Harry kann den Verdacht zwar widerlegen, benimmt sich jedoch ansonsten äußerst merkwürdig. Harry hat ein Verhältnis mit der verheirateten Germaine de la Roche und wird auf Schritt und Tritt von einem Privatdetektiv überwacht. Um diesem zu entkommen, wollen die beiden nach Ostende reisen. Durch den Detektiv erfährt Jenny unterdessen, dass Germaine Lockvogel für einen Verbrecher sein soll. Ein berüchtigter Verbrecher nimmt das Aussehen seiner Opfer an, um so ihre Bankkonten zu plündern. Bald nennt die Presse ihn den „Doppelgänger“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1924
Copyright © 2022 Classica Libris
Original Title
Edgar Wallace
Double Dan
1.
„Sie ist eine Waise“, sagte Mr. Collings gerührt. Für Waisen hatte er eine besondere Vorliebe. Sonst war er als Rechtsanwalt im Verkehr mit seinen Klienten ein strenger, etwas zurückhaltender Mann, der gern zum Abschluß von Vergleichen riet. Es kamen Klienten in sein Büro, die ganz sicher waren, daß ihre Feinde sich selbst in ihre Hände gegeben hatten. Sie sprachen von Schadenersatzforderungen, die sich auf fünfstellige Zahlen beliefen und den vollkommenen Ruin von Leuten oder Firmen bedeuteten, die sie beleidigt hatten. Aber als sie wieder fortgingen, waren alle ihre Berechnungen über den Haufen geworfen und ihre Zukunftspläne vernichtet. Mr. Collings glaubte nun einmal nicht, daß Prozesse vorteilhaft seien. Seiner Meinung nach war es viel besser, alle Streitfragen gütlich beizulegen.
Wenn ein Ermordeter aus seinem Grabe auferstehen, in Mr. Collings Büro kommen und sagen könnte: „Ich habe eine ganz einwandfreie Klage gegen Binks. Er hat mich erschossen. Sie sind doch davon überzeugt, daß ich einen Schadenersatzanspruch an ihn stellen kann?“, dann würde Mr. Collings geantwortet haben; „Das ist noch gar nicht sicher. Ich zweifle daran. Man könnte auch sehr viel zugunsten von Mr. Binks anführen. Haben Sie sich nicht auf seine Kosten bereichert? Sind Sie nicht selbst in einer unangenehmen Lage? Sie tragen doch zunächst einmal ein Geschoß im Leibe herum, das zweifellos das Eigentum von Mr. Binks ist. Man kann nie genau wissen, welchen Standpunkt das Gericht einnimmt. Ich gebe Ihnen den guten Rat, mich zu Vergleichsverhandlungen zu ermächtigen.“
Aber wenn es sich um Waisen handelte, war Mr. Collings weich wie Butter. Seine Eltern hatten ihn einfach und streng erzogen, und er hatte sonntags fromme Bücher lesen müssen, in denen von Waisen, von gutherzigen Drehorgelspielern und von kleinen Mädchen erzählt wurde, die viel aus guten Büchern lernten, später als Missionsfrauen nach Afrika gingen und dort starben, tief betrauert und beweint von den bekehrten Eingeborenen. Die schlechten Menschen in diesen Geschichten waren meistens junge Burschen, die heimlich die Rosinen aus dem Kuchen nahmen, nur weißes Brot aßen und die Krusten wegwarfen. Sie mißhandelten die Hunde und traten sie mit Füßen, fingen die Fliegen, warfen sie in die Netze der Spinnen und beobachteten mit grausamer Freude und Mordlust, wie diese über ihre armen Opfer herfielen und ihnen das Blut aussaugten.
„Sie ist eine Waise“, sagte Mr. Collings noch einmal und seufzte vernehmlich.
„Sie ist schon seit zehn Jahren eine Waise“, entgegnete Mr. William Cathcart zynisch.
Mr. Collings war untersetzt, hatte einen kahlen Kopf und hielt gern nachmittags ein kleines Schläfchen. Mr. Cathcart war im Gegensatz zu ihm mager, hatte ein schmales Gesicht und volles Haar. Auch schlief er niemals tagsüber, wie man wußte. Er haßte Waisenkinder. Stets gab es ihretwegen unangenehme Auseinandersetzungen über die Elternschaft, über testamentarische Bestimmungen, und immer hatte man Schreibereien mit dem Vormundschaftsgericht. Am liebsten hätte er sich hinter Stacheldraht gegen Waisen verschanzt.
„Sie ist die sonderbarste Waise, die mir jemals begegnet ist“, fuhr Mr. William Cathcart erbarmungslos fort. „Dem Gesetz nach ist sie noch ein Kind, aber sie hat ein Bankguthaben von hunderttausend Pfund. Ich vergieße ihretwegen keine Träne – das dürfen Sie mir glauben!“
Mr. Collings wischte sich die Augen.
„Aber sie ist doch eine Waise!“ Er versuchte vergeblich, das steinharte Herz von Mr. Cathcart zu erweichen.
„Mrs. Tetherby hat ihr das Geld geschenkt, während sie noch lebte – daran ist doch nichts Besonderes. Wenn ich einem Waisenkind“ – er schluckte und wollte seine Rührung verbergen – „einen Schilling, ein Pfund, ja selbst tausend Pfund schenkte, so wäre das doch kein Bruch des Gesetzes oder eine Ungehörigkeit, selbst wenn ich es Tag für Tag täte?“
Mr. Cathcart dachte nach.
„Unter gewissen Umständen könnte es doch ein Unrecht sein“, meinte er dann.
Mr. Collings verwahrte sich dagegen, aber er wollte nicht verletzend werden.
„Mrs. Tetherby war träge. Starke Frauen sind oft so.“
„Sie war direkt faul“, erwiderte Cathcart.
„Es gibt nur wenig Tanten, die Zuneigung zu ihren Nichten fühlen. Aber Mrs. Tetherby liebte Diana. Aus ihrem Testament geht das deutlich hervor. Sie hinterließ ihr alles –“
„Es war ja gar nichts zu hinterlassen“, unterbrach ihn Mr. William Cathcart befriedigt.
Wie dieser Mann Waisenkinder haßte!
„Es war nichts mehr da, weil sie ja schon zu Lebzeiten Diana die Kontrolle über ihr Vermögen überließ.“
„Das tat sie doch nur, weil sie sich nicht damit belasten wollte“, sagte Mr. Collings leise. „Sie hat dieses Waisenkind doch so geliebt!“
„Wenn man jemals einer Frau auf der Welt nicht hätte gestatten dürfen, ein Mädchen von Diana Fords Charakter zu erziehen, so war es Mrs. Tetherby. Als Kind von sechzehn Jahren hatte Diana schon eine leidenschaftliche Liebesaffäre mit einem Studenten –“
„Es war ein Student der Theologie“, verteidigte sie Mr. Collings. „Vergessen Sie das nicht! Das läßt doch die Sache in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ich kann mir wohl denken, daß ein junges Mädchen sein Herz einem zukünftigen Geistlichen schenkt. Ein Student der Medizin wäre mir dagegen ganz unmöglich erschienen.“
„In meinen Augen ist es um so schlimmer, wenn er ein Student der Theologie war.“
„Aber schließlich hat uns Mrs. Tetherby wegen dieser Angelegenheit um Rat gefragt“, sagte Mr. Collings etwas vorwurfsvoll. „Ob sie nun zu lässig oder zu energisch war, auf jeden Fall ist sie zu uns gekommen.“
„Sie wollte von uns erfahren, ob sie vor Gericht schuldig gesprochen würde, wenn sie diesem verfluchten Mr. Dempsi auflauerte und ihn über den Haufen schösse. Sie erzählte uns doch, daß sie schon die Hunde auf ihn gehetzt hatte, ohne ihn abschrecken zu können.“
„Dempsi ist tot“, erwiderte Mr. Collings heiser. „Ich habe schon vor acht Monaten mit Diana über ihn gesprochen, als ihre verehrte Tante starb. Ich fragte sie, ob diese Wunde vernarbt sei. Sie antwortete, daß sie kaum noch daran denke. Nur manchmal mache sie sich abends noch den Spaß, sein Gesicht aus dem Gedächtnis zu zeichnen.“
„Ein herzloses, teuflisches Mädchen!“
„Sie ist ein Kind – und in der Jugend geht dergleichen schnell vorüber. Man vergißt sogar Leibschmerzen sehr rasch“, sagte Mr. Collings.
„Haben Sie auch mit ihr über Leibschmerzen gesprochen?“ fragte der andere höhnisch.
Mr. Collings zog die Augenbrauen hoch. Ein Mann von seiner Gutherzigkeit war solchen Gemeinheiten gegenüber einfach machtlos.
„Eine Waise“ – begann er eben wieder, als ein Schreiber ins Büro trat.
„Miss Diana Ford“, meldete er an.
Die beiden Chefs der Rechtsanwaltsfirma Collings und Cathcart wechselten Blicke.
„Lassen Sie die junge Dame näher treten.“ Die Tür schloß sich hinter dem Schreiber. „Seien Sie liebenswürdig zu ihr, William“, bat Collings.
Mr. Cathcart rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her.
„Wird sie denn liebenswürdig zu mir sein?“ fragte er bitter.
„Garantieren Sie mir und sind Sie bereit, Geld darauf zu wetten, daß sie höflich ist?“
In der Tür erschien ein hübsches Mädchen. Sie sah blühend wie der Frühling aus. Die Farbe ihrer Wangen erinnerte an Pfirsiche, und sie brachte den Duft blumiger Wiesen mit in dieses dumpfe Büro. Ihre Sprache hörte sich an wie das Geplätscher eines kristallklaren Baches, der zwischen Lärchen und Erlen dahineilt. Das war Miss Diana Ford.
Während des Krieges hatte Mr. Cathcart eine Stellung in einem Armeeversorgungsdepot eingenommen (Heimatdienst) und hatte infolgedessen eine gewisse Art zu denken beibehalten. Er nahm den Tatbestand wie folgt auf:
Mädchen. Schlank. Mittelgröße.
Augen. Graublau, groß. Unschuldiger Blick.
Mund. Rot, geschwungen, ziemlich groß.
Nase. Gerade, gutgeformt.
Haare. Goldblond, Bubikopf.
Nach dieser Beschreibung war Diana ebensowenig wiederzuerkennen wie ein gewöhnlicher Mensch nach den Eintragungen in seinem Reisepaß. Sie war frisch und natürlich.
Impulsiv ging sie auf Mr. Collings zu und küßte ihn. Mr. William Cathcart schloß die Augen, um nicht das wohlgefällige Lächeln zu sehen, mit dem sein Partner diese Bevorzugung quittierte.
„Guten Morgen, lieber Onkel! Guten Morgen, Onkel Cathcart!“
„Morgen“, erwiderte Mr. Cathcart. Er war so feindlich wie nur möglich gesinnt.
„Morgen“, ahmte sie ihn nach. „Und ich bin doch in so guter Stimmung gekommen und habe Sie doch so gern. Ich habe Sie sogar Onkel genannt“, rief sie vorwurfsvoll.
„Habe ich gehört“, brummte der neuernannte Verwandte. „Es wäre weit besser, Miss Ford, wenn wir uns in mehr geschäftlichen Formen bewegten –“
„Bewegen Sie sich meinetwegen auf Autobussen und Elektrischen, wenn Ihnen das Spaß macht“, sagte sie seufzend, nahm ihren Hut ab und legte ihn auf das nächste Aktenstück. „Ach, Onkel Collings, ich bin krank!“
Mr. Cathcart sah bestürzt auf.
„Ich bin ganz krank von Australien. Mir macht das Leben hier keine Freude mehr. Ich bin krank von der ganzen Stadt, von den Leuten, von der Umgebung, von allem! Ich fahre heim.“
„Heim?“ rief Mr. Collings atemlos. „Aber meine gute, liebe Diana, Sie wollen doch nicht etwa nach England gehen?“
„Natürlich will ich nach England! Ich werde dort meinen Vetter Gordon Selsbury besuchen.“
Mr. Collings fuhr sich mit der Hand über die Stirn.
„Es ist natürlich ein älterer Herr?“
„Ich weiß es nicht.“ Sie zuckte gleichgültig die Schultern.
„Aber er ist doch verheiratet?“
„Vermutlich. Er ist hübsch, und alle hübschen Leute sind verheiratet – die Anwesenden sind selbstverständlich ausgeschlossen.“
Mr. Collings war Junggeselle und konnte deshalb herzlich über den Spaß lachen. Mr. Cathcart aber als ein verheirateter Mann machte ein saures Gesicht.
„Sie haben sich wohl telegrafisch und brieflich angemeldet. Mr. Selsbury hat nichts gegen Ihren Besuch einzuwenden?“
„Nicht im geringsten – er wird entzückt sein, mich zu sehen.“
„Zwanzig Jahre alt“, sagte Mr. Cathcart kopfschüttelnd. „Vor dem Gesetz noch ein Kind. Ich glaube wirklich, wir müßten erst mehr über Mr. Selsbury und seine Verhältnisse erfahren, bevor wir gestatten könnten – wie, Collings?“
Mr. Collings schaute das junge Mädchen fast bittend an. Sie hatte niemals verwaister ausgesehen als in diesem Augenblick.
„Es wäre doch vielleicht besser –?“ fragte er behutsam.
Diana lächelte, ihre Augen strahlten, und ihre kleinen weißen Zähne blitzten.
„Ich habe schon meine Kabine belegt, sie ist sehr hübsch. Es ist ein besonderer Baderaum und auch ein Wohnzimmer dabei. Die Wände sind ganz mit Brokatseide ausgeschlagen. Und es steht eine hübsche, niedliche Bettstelle aus Messing in der Mitte, so daß ich nach beiden Seiten herausfallen kann.“
Mr. Cathcart fühlte, daß jetzt der Augenblick gekommen sei, seine Autorität geltend zu machen.
„Ich kann Ihrem Plan nicht zustimmen“, sagte er ruhig.
„Warum denn nicht?“ Sie sah ihn von oben her an und warf den Kopf in den Nacken.
„Ja, warum denn nicht?“ fragte auch Mr. Collings.
„Weil Sie noch nicht volljährig sind, meine liebe, junge Dame, weil Sie nach den Gesetzen dieses Landes noch ein Kind sind, und weil Mr. Collings und ich die Vormundschaft über Sie führen. Ich bin alt genug, Ihr Vater sein zu können –“
„Oder auch mein Großvater! Aber kommt es denn darauf an? Neulich traf ich in dem Zug von Bendigo hierher einen Herrn von sechzig Jahren, der mich in den Arm zwicken und dauernd meine Hand in die seine nehmen wollte. Das Alter macht gar nichts aus, wenn nur das Herz jung ist.“
„Das stimmt“, bestätigte Mr. Collings, dessen Herz noch sehr jung war.
„Der langen Rede kurzer Sinn ist, daß Sie nicht abfahren dürfen“, sagte Mr. Cathcart entschieden. „Ich möchte nicht erst eine gerichtliche Entscheidung hierüber herbeiführen –“
„Einen Augenblick, Sie schlechter Freund der armen jungen Leute!“ Diana nahm kurz entschlossen mehrere große Gesetzbücher und einen ganzen Stoß von Gerichtsakten vom Stuhl, legte ihn auf die Erde und setzte sich. „Meine Kenntnis des Gesetzes ist ja nur oberflächlich“, sagte sie ernst. „Ich habe mein Leben auf den Grassteppen von Kara-Kara zugebracht. Aber obwohl ich nur ein unwissendes Waisenkind bin…“
Mr. Collings seufzte.
„… so ist mir doch bekannt, daß ein Anwalt erst einen Klienten haben muß, bevor er eine Gerichtsentscheidung beantragt. Denn kein Jurist, es sei denn einer, der vor Verliebtheit verrückt ist, stellt Anträge bei Gericht, ohne einen Klienten zu vertreten.“
Mr. William Cathcart zuckte die Schultern.
„Sie müssen sich Ihr Bett allein machen.“
„Der Gerichtshof kann mir mein Bett auch nicht machen!“ antwortete sie.
Mr. Cathcart sah, wie sie auf ihn zukam und schnell seinen Federhalter nahm.
„Onkel Cathcart, ich hoffte so sehr, daß wir als gute Freunde scheiden würden! Jeden Abend, wenn ich vor meinem Bett zum Abendgebet niederknie, sage ich: ,Lieber Gott, bitte, gib doch Onkel Cathcart ein bißchen mehr Humor und mache ihn ein wenig liebenswürdiger.‘ Ich habe immer geglaubt, daß dieses Wunder eines Tages geschehen würde.“
Onkel Cathcart rückte auf seinem Stuhl unruhig hin und her.
„Gehen Sie Ihren eigenen Weg“, sagte er laut. „Ich kann keinen alten vernünftigen Kopf auf junge Schultern setzen. Wir werden ja noch länger leben, und dann werden wir ja sehen.“
„Man probiert den Pudding am besten, indem man ihn aufißt. Das haben Sie eben vergessen, Onkel Cathcart.“
Mr. Collings speiste mit Diana in einem Restaurant zu Mittag.
„Was ist eigentlich dieser Mr. Selsbury für ein Mann?“
„Ach, er ist wundervoll“, sagte sie träumerisch. „Er hat damals in dem Universitätsachter bei dem Rennen mitgerudert und gewonnen. Ich bin ganz verschossen in ihn!“ Mr. Collings sah sie entsetzt an. „Ist er auch verschossen in Sie?“ fragte er atemlos. Diana lächelte. Sie hatte gerade ein kleines Spiegelchen aus der Handtasche gezogen und puderte sich ein wenig. „Er wird sich schon in mich verlieben“, sagte sie sanft.
2.
Mr. Gordon Selsbury war von Natur aus weder anomal noch exzentrisch. Aber er hielt sich doch für etwas höherstehend als andere Menschen, für einen Feingeist und für einen jener besonders begnadeten Sterblichen, die die Dinge von einer höheren Warte aus betrachten.
Er lebte in der City Londons, und sein Beruf stand in schreiendem Gegensatz zu seiner geistigen Einstellung, denn er war Generalvertreter einer der größten Versicherungsgesellschaften und lebte als solcher in äußerst guten pekuniären Verhältnissen.
Manchmal saß er vor seinem mit echt silbernen Gittern und Beschlägen geschmückten Kamin und dachte in philosophischer Ruhe über die Laune des Schicksals nach, das ihn zu einer so nüchternen geschäftlichen Tätigkeit verurteilte. Denn während andere Menschen nur stumpf vegetierten und triebhaft ihren Leidenschaften und Begierden frönten, lebte er in höheren geistigen Sphären.
Wenn er seinen Gedanken nachhängen konnte, fühlte er sich erhaben über die Welt und ihren verabscheuungswürdigen Kampf ums Dasein. Er war ein Mann, der durch seine geistige Begabung wie ein Fels über nebligen Niederungen in einsamer Höhe ragte, wo sich nur schneebedeckte Gipfel zum blauen Himmel emporreckten. Und doch – das schien ihm am erstaunlichsten – konnte er heruntersteigen in die Arena des Lebens, mit diesen Materialisten ringen, sie besiegen und ihren zusammengeballten Fäusten unheimliche Summen dieses schmutzigen Geldes entreißen.
„Nein, Trenter, ich werde morgen nachmittag nicht zu Hause sein. Sagen Sie bitte Mr. Robert, daß er mich in meinem Büro sprechen kann. Danke schön.“
Der Butler verneigte sich respektvoll und ging zum Telefon zurück.
„Mr. Selsbury wird morgen nicht zu Hause sein, Sir.“
Bobby Selsbury war sehr ärgerlich.
„Sagen Sie ihm bitte, daß er mir fest versprochen hat, mit mir und meinem Freund eine Partie Bridge zu spielen. Rufen Sie ihn doch einmal ans Telefon.“
Gordon erhob sich etwas gelangweilt von seinem weichgepolsterten Stuhl, ließ sich aber vor seinem Angestellten nicht das geringste merken.
„Ja, ja, ich weiß“, sagte er müde, „aber mir fiel ein, daß ich mich schon anderweitig verabredet hatte. Du mußt eben sehen, daß du dir die Zeit sonst irgendwie vertreibst, mein Junge. – Was erzählst du mir da? Ach, das ist doch Unsinn!… Also, ich kann dir wirklich nicht helfen, du mußt dich schon nach anderer Gesellschaft umsehen – ich habe morgen nachmittag unheimlich viel im Geschäft zu tun… ich spreche am Telefon nicht gern über geschäftliche Angelegenheiten. Auf Wiedersehen! – Trenter!“
Der Butler wartete in devoter Haltung und schien gespannt auf die Anordnungen seines Herrn zu sein.
„Jawohl, Sir?“
Mr. Selsbury wandte langsam den Kopf, bis seine dunklen Augen auf dem Gesicht des Dieners ruhten.
„Heute morgen sah ich zufälligerweise, daß Sie das Zimmermädchen küßten. Sie sind doch ein verheirateter Mann und haben dadurch eine gewisse Verantwortung, über die Sie sich unter keinen Umständen hinwegsetzen dürfen. Eleanor ist womöglich leicht beeinflußbar, Mädchen in dem Alter sind schnell verliebt. Es ist absolut verwerflich, das Leben eines jungen Mädchens dadurch zu ruinieren, daß Sie eine Leidenschaft in ihr erwecken, die Sie weder erwidern können noch dürfen. Auch ich habe darunter zu leiden – heute morgen war mein Rasierwasser nicht rechtzeitig auf meinem Zimmer. Das darf nicht wieder vorkommen!“
„Nein, Sir“, sagte Trenter.
Derartige Neuigkeiten kommen gewöhnlich auf schnellstem Wege in das Dienstbotenzimmer. Selsburys Worte schienen beinahe seelische Fernwirkung zu haben.
Eleanor war ein hübsches, großes Mädchen mit blassem Gesicht, blitzenden Augen und schwarzen Augenbrauen. Sie stand eben vor dem Spiegel und benützte den Lippenstift. Plötzlich hielt sie in dieser Beschäftigung inne. Sie war sehr entrüstet.
„Weil er ein so eiskalter und hundeschnäuziger Antonius von Padua ist, glaubt er, daß wir keine menschlichen Gefühle haben. Der arme, kaltblütige Fisch! Ich werde es ihm bei Gelegenheit schon sagen, daß ich es nicht dulden kann, wenn er so über mich spricht und dadurch meinen guten Ruf verdirbt. Dieser Schnüffler, dieser Leisetreter, dieser Spion!“
„Wer ist denn der Antonius von Padua?“ fragte Trenter.
„Das ist der Heilige, der von Frauen versucht wurde und die Prüfung siegreich bestand“, erwiderte Eleanor. Sie schien aber nicht abgeneigt zu sein, ihrerseits die Versucherin zu spielen.
„Wer hat Mr. Selsbury versucht?“ fragte er aufgebracht.
„Niemand, wenn Sie etwa mich meinen sollten. Ich möchte nur einmal sehen, wenn er seinen Arm um mich legen wollte – daran würde er denken!“
„Soweit wird er sich niemals vergessen“, sagte Trenter.
Sie warf den Kopf in den Nacken.
„Ach, ich weiß nicht!“ Eleanor sah die starke Köchin an. „Fragen Sie nur einmal hier.“
„Großer Gott, Köchin, er hat Sie doch nicht etwa –?“ fragte Trenter entsetzt.
Zum Glück war Mrs. Magglesark langsam von Begriff.
„Ja, ich habe ihn auch gesehen“, sagte sie. Aber Eleanor unterbrach sie sofort wieder, weil sie diese Geschichte selbst erzählen wollte. „Ich und die Köchin saßen letzten Sonntag oben auf einem Autobus –“
„In Knightsbridge.“ Die Köchin wollte auch etwas berichten.
„Wir sprachen gerade zusammen und lachten, als die Köchin sagte: ,Sieh mal, Nelly, da ist der gnädige Herr.‘“
„Nein, ich sagte: Sieh mal, der Kerl hat ganz die Visage von unserem Herrn“, verbesserte Mr. Magglesark.
„Und richtig, er war es“, fuhr Eleanor fort. „Denken Sie sich, er hatte ein Mädel, schlank, groß und ganz in Schwarz gekleidet, neben sich – und er streichelte ihre Hand!“
„Aber doch nicht auf der Straße?“ fragte Trenter ungläubig.
„Nein, er saß mit ihr in einem Auto. Von dem Autobus aus konnten wir gerade in den Wagen hineinsehen.“
„War sie hübsch?“ fragte Trenter.
Eleanor kräuselte die Lippen.
„Nun ja, ich könnte mir denken, daß es Leute gäbe, die sie hübsch fänden. Was meinst du, war sie hübsch?“ wandte sie sich an die Köchin.
Mrs. Magglesark, die schon ziemlich bejahrt und infolgedessen etwas milde in ihrem Urteil geworden war, sagte, sie sei hübsch gewesen.
„Er hat ihre Hand gehalten und gestreichelt?“ fragte Trenter nachdenklich. „Es war doch nicht etwa Mrs. van Oynne?“
„Wer ist denn das?“
„Oh, sie war schon zweimal zum Tee hier, sie ist eine Amerikanerin, ist immer sehr vornehm gekleidet und heißt Heloise mit Vornamen. Sie sieht sehr schön aus. Gewöhnlich geht sie in Schwarz und trägt einen Hut mit einem Paradiesvogel.“
„Ja, sie trug Paradiesvogelfedern auf dem Hut“, bestätigten die Köchin und Eleanor.
„Dann war sie es bestimmt. Aber da ist nichts dabei – das ist eine gebildete Dame, die viele Bücher liest. Als sie das letztemal hier war, unterhielten sie sich von der Seele des eigenen Ichs. Ich habe nicht viel von der Unterhaltung gehört, es war auch so hohes Zeug, daß ich es nicht verstanden habe.“
Auf Eleanor machte diese Mitteilung großen Eindruck.
„Das ist doch merkwürdig, Sie sind doch sonst so klug“, meinte sie.
Gordon Selsbury konnte über alles sprechen. In seinen Unterhaltungen und philosophischen Betrachtungen mit Heloise van Oynne zergliederte er alles auf dem Seziertisch seines Verstandes, von gemeinen Bohnensträuchern bis zur höchsten Metaphysik. Allerdings führte er gewöhnlich das Gespräch, aber sie hing wie verzückt an seinem Munde, und er glaubte, daß sie seinen schwierigen Gedankengängen folgte.
Gordon saß am Nachmittag mit ihr in einem Teesalon des Hotels Coburg. Es waren außer ihnen nicht viele Gäste da.
„Ich möchte Ihnen, schon seit ich Sie kennenlernte, etwas sagen, meine liebe Heloise.“ Gordons wohltönende Stimme klang dunkel und geheimnisvoll. „Es ist kaum einen Monat her, es scheint mir fast unglaublich! Wir sind einander schon früher begegnet, in längst versunkenen Zeiten, vor Tausenden von Jahren, in dem Tempel der Atlantis, wo weißgekleidete, ernste Priester mit langen Bärten Zauberformeln beteten. Sie waren damals eine große Dame, aber ich war nur ein niedriger Gladiator. Daß die Kampfspiele des späteren Roms und selbst die Zirkusspiele unter den Kaisern viel älter sind und in ein graues Altertum hinaufreichen, dessen bin ich ganz sicher. Könnten denn nicht die Überreste der sterbenden Atlantis den Beginn der etruskischen Kultur bedeuten…?“
Sie schaute ihn wie verzaubert an.
„Wie glänzend, daß Sie die Etrusker mit der mythischen Kultur von Atlantis in Verbindung bringen!“ Aber ihre entzückten Blicke verrieten wenig von dem, was sie dachte.
„Das Schönste an unserer seelischen Freundschaft ist doch, daß sie nichts mit dieser brutalen, materiellen Welt zu tun hat“, sagte er.
„Wie meinen Sie das?“
Sie hatte sich vorgebeugt und erinnerte ihn durch die Bewegung einen Augenblick an Trenter – er war unangenehm berührt.
„Ich meine“, er wischte mit seiner Hand einen Kuchenkrümel von seinem Knie, „wir haben unsere Freundschaft niemals durch eine gewöhnliche Liebelei erniedrigt.“
„Oh!“ Heloise van Oynne lehnte sich in ihren Stuhl zurück.
„Da haben Sie recht.“ Es lag etwas unendlich Süßes und Wohltuendes in ihrer Stimme. Sie sprach so befriedigt, daß sie selbst jemand getäuscht hätte, der auf ihre seelische Wellenlänge eingestellt war.
„Die vollkommene innere Übereinstimmung, das Verständnis von Seele zu Seele überragt alle sinnlichen Eindrücke, auf so hoher Stufe sie auch stehen mögen.“
Sie sah ihn mit einem zärtlich lächelnden Blick an. Das tat sie immer, wenn sie nicht recht verstand, was Gordon zu ihr sagte, besonders wenn er in diesen hohen Regionen schwebte.
„Die Seele ist sicher das Vornehmste und Schönste, was es überhaupt gibt“, sagte sie in tiefen Gedanken. „Die meisten Menschen sind zu gefühllos, sie verstehen das nicht. Das ist nicht gut für uns, denn wer könnte unser Verhältnis zueinander verstehen, Gordon? Für gewöhnlich kann man sein Herz und sein Innerstes nicht offenbaren. Instinktiv schreckt man zurück, wenn man mit Leuten in Berührung kommt, die zu materiell sind.“
Sie seufzte tief auf, als ob sie schon viel Böses im Leben erfahren hätte und als ob ihre zarte Seele von dieser rauhen Außenwelt gekränkt und verletzt worden sei. Plötzlich schien sie an gewissen Anzeichen zu ahnen, daß er sein Innerstes erschloß und daß seine wunderbare Seele nun überströmen wollte. Sie hatte eine gewisse Angst davor; denn bei früheren Gelegenheiten war es dann schwer gewesen, ihn, der in den unermeßlichen Regionen höherer Welten weilte, mit zarten Händen wieder zur Wirklichkeit zurückzuführen.
„Gordon, Sie haben mir schon viel von Ihrer Kusine in Australien erzählt“, sagte sie deshalb schnell, um dem Gespräch eine mehr irdische Wendung zu geben. „Sie muß sicher sehr interessant sein. Sprechen Sie doch noch ein wenig von ihr – ich höre es so gern, wenn Sie mir von Ihren Verwandten erzählen. Ich bin Ihnen so zugetan, Gordon, daß alles, was irgendwie mit Ihnen in Zusammenhang steht, mich anzieht und fesselt.“ Sie legte ihre behandschuhte Hand auf sein Knie.
Keine andere Frau hätte es wagen dürfen, das zu tun – er hätte sofort die Polizei gerufen. Aber Heloise… Er legte seine Hand freundlich auf die ihre.
„Ich weiß nichts Genaues über sie. Es ist mir nur bekannt, daß sie eine schreckliche Liebesaffäre mit einem gewissen Dempsi gehabt hat. Ich habe Ihnen das doch schon alles gesagt. Aber jetzt geht es ihr gut, wie ich annehme. Ich habe mich immer ein bißchen um sie gekümmert, habe ihr ab und zu Bücher geschickt und einige Briefe geschrieben, in denen ich ihr gute Ratschläge gab. Ich denke mir immer, daß der Rat eines Mannes von einem jungen Mädchen viel leichter befolgt wird als der einer Frau. Wann haben wir doch neulich über sie gesprochen? Ach ja, ich erinnere mich, als wir unsere tiefgründige Unterhaltung über die Seele des eigenen Ichs führten.“
„Hat sie eigentlich hellen oder dunklen Teint?“ Mit dieser Frage verbarrikadierte Heloise schnell und schlau wieder den Weg in die Metaphysik.
„Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Kurz bevor meine Tante starb, bekam ich noch einen Brief von ihr. Darin sagte sie mir, daß Diana Dempsi vergessen habe, aber doch gern ein Foto von ihm gehabt hätte – der Mann ist nämlich auch gestorben. Ist Ihnen jemals zum Bewußtsein gekommen, Heloise, wie sonderbar die Beziehungen zwischen Tod und Leben sind?“
„Dieses arme Mädchen in Australien! Ich würde doch soviel darum geben, wenn ich sie einmal sehen könnte, Gordon.“
Er schüttelte den Kopf und lächelte liebenswürdig.
„Ich glaube kaum, daß Sie ihr jemals begegnen werden.“
3.
Cheynel Gardens ist einer der wenigen Plätze, die kein Chauffeur ohne die Hilfe von Leuten finden kann, die dort in der Nähe wohnen. Die Chauffeure haben wohl davon gehört, können sich dunkel darauf besinnen, daß sie schon Fahrten dahin ausgeführt haben, aber wo es eigentlich liegt, ist ihnen unbekannt. Nur die Polizei und die Postboten wissen das.
Gordon bewohnte dort ein Eckhaus, zu dem auch ein Garten gehörte, nach dem wahrscheinlich die ganze Straße benannt worden war. Die Fenster vom großen Studierzimmer waren aus buntem Glas und hatten eine gewisse Ähnlichkeit mit Kirchenfenstern.
Dieser Raum nahm aber auch eine besondere Stellung im Hause ein. Niemand durfte ihn ohne die ausdrückliche Erlaubnis Gordons betreten. Die starke Eichenholztür war noch mit einer Stofftür gesichert, um den Schall zu dämpfen, so daß kein Geräusch Gordon stören konnte, wenn er den „Economist“ und die „Versicherungsrevue“ las. Morgens las er die „Times“, aber abends widmete er sich eingehenden soziologischen Studien. Wenn er davon genug hatte, griff er zu dem Buch „Zur Genealogie der Moral“ – Nietzsche war einer seiner Lieblingsautoren.
Gordon stieg aus dem Auto, mit dem er nach Hause gefahren war, und gab dem Chauffeur ein Trinkgeld von zehn Prozent, das er zwar aufs genaueste ausgerechnet hatte, wobei er sich aber doch ein klein wenig zu seinen Gunsten irrte. Langsam stieg er die Treppe zur Haustür hinauf und öffnete sie. Es war ein Teil des täglichen feierlichen Rituals. Trenter nahm seinen Hut, seinen Spazierstock, seine Handschuhe, und Gordon fragte wie gewöhnlich:
„Sind Briefe gekommen?“
Wenn Trenter „Nein“ gesagt hätte, so wäre das eine unverzeihliche Unterbrechung der Zeremonie gewesen.
„Jawohl, Sir“, antwortete er wie stets. „Und –“ er räusperte sich.
Er konnte sich eine weitere Erklärung schenken, denn Gordon starrte schon auf vier große Koffer, die fast die ganze Diele einnahmen. Auf dreien las er die Aufschrift „Wird während der Reise nicht gebraucht“, auf dem vierten war ein Schild aufgeklebt: „Kabinengepäck“.
„Was soll denn das bedeuten?“ fragte Gordon atemlos.
„Die junge Dame ist heute nachmittag angekommen, Sir!“
Trenter verging fast vor Aufregung.
„Die junge Dame ist heute nachmittag angekommen – welche junge Dame?“
„Miss Ford, Sir.“
Gordon runzelte die Stirn. Er hatte diesen Namen in irgendeinem Zusammenhang schon gehört. Ford – Ford – das klang doch so bekannt!
„Miss Diana Ford aus Australien!“
Seine Kusine! Mr. Selsbury nickte gnädig. Die Selsburys waren höfliche Menschen, und das Gefühl für Gastfreundschaft war noch nicht ganz in ihm erstickt.
„Sagen Sie bitte Miss Ford, daß ich nach Hause gekommen bin und daß ich mich freuen würde, sie in meinem Studierzimmer zu empfangen.“
Trenters Gesicht zuckte nervös.
„Dort ist sie bereits! Ich sagte ihr sofort, daß niemand hineingehen dürfe, wenn Sie nicht zu Hause seien.“
Gordon war verstimmt. Einem Gastgeber ist es stets unangenehm, wenn seine Gastfreundschaft schon vorweggenommen und nicht als ein Geschenk empfunden, sondern als ein Recht beansprucht wird.
„So?“ sagte er, aber lächelnd. „Nun, Miss Ford kommt aus Australien, und man kann nicht erwarten, daß sie unsere Gewohnheiten kennt. Ich werde zu ihr gehen.“
Er klopfte an die Tür, und er hörte, wie eine Stimme „Herein“ sagte.
„Ich freue mich, dich zu sehen, meine liebe Kusine Diana.“
Er sah sich im Zimmer nach ihr um, konnte sie aber nicht entdecken, bis aus seinem eigenen Sessel, in dem er stets am Kamin saß, eine weiße Hand erschien.
„Komm doch näher, Gordon!“
Sie sprang auf und sah ihn an. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und es sich bequem gemacht. In ihren Seidenstrümpfen sah sie noch kleiner aus als sonst. Er hielt sie für schön, etwa in dem Sinne, wie er ein nettes Kätzchen für hübsch gehalten hätte. Die ganze Sache kam ihm amüsant vor.
„Nun, mein junges Fräulein“, sagte er väterlich und wohlwollend, „hier sind wir also angekommen? Ich hatte niemals erwartet, dich in London zu sehen. Hattest du eine gute Fahrt?“ „Bist du verheiratet?“ fragte sie gespannt.
„Nein, ich bin ein überzeugter alter Junggeselle.“
„Ah!“ Sie seufzte erleichtert auf. „Ich war während der ganzen Reise besorgt, daß das der Fall sein könne – du hast mir noch gar keinen Kuß gegeben.“
Gordon war so wenig auf den Gedanken gekommen, sie zu küssen, als es ihm eingefallen wäre, ihr mit dem Buch auf den Kopf zu klopfen, das er in der Hand hielt. Aber die Selsburys waren von Hause aus sehr höflich, und so neigte er sich und berührte sie flüchtig mit den Lippen.
„Setz dich bitte – ich werde Tee für dich bestellen. Es tut mir so leid, daß du auf mich warten mußtest. Wo wohnst du denn?“
Sie blitzte ihn mit ihren Augen an.





























