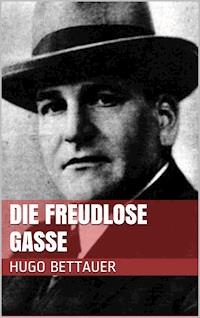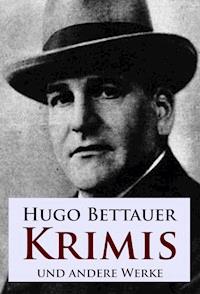Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Berlin um 1920. Einem Serienkiller fallen vier junge und heiratswillige Frauen zum Opfer, die alle auf eine Kontaktanzeige geantwortet haben. Ein Ende des Mordens ist nicht abzusehen. Inspektor Krause wird auf diesen mysteriösen Fall angesetzt. Er begibt sich auf die Suche nach den blonden Mann und Verlobten der jungen Frauen. Ist er einem Wahnsinnigen mit Engelsgesicht auf der Spur?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Bettauer
Der Frauenmörder
Krimi-Klassiker
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Die Müller, Möller, Jensen und Pfeiffer
Joachim von Dengern, alias Krause
Vier Mädchen ohne Anhang
Selma Cohen als Fünfte
»Idylle an der Havel«
Der blonde Herr mit dem Kneifer
Thomas Hartwig
Im Literaten-Café
Lotte Fröhlich
»Überführt!«
Unterhaltung mit einem Mörder
Kämpfende Seelen
»Drei Menschen«
Das große Rätsel
Der große Prozess
Die Sensationspremiere
Die Bombe platzt!
Aus dem Dunkel empor!
Impressum neobooks
Die Müller, Möller, Jensen und Pfeiffer
Der Frauenmörder
von
Hugo Bettauer
Inhalt
»Lieber Krause, Sie müssen Klarheit in die Sache bringen! Nur läppischer Zufall? Ne, das glaube ich nicht und Sie glauben es auch nicht, soweit ich aus Ihrem wieder einmal total versteinerten Gesicht lesen kann! Innerhalb von sechs Wochen verschwinden unter Hinterlassung ihrer Habseligkeiten vier Mädchen, alle zwischen zweiundzwanzig und sechsundzwanzig Jahre, alle vier heiratstoll und mit je einem fragwürdigen Bräutigam behaftet. Ne, lieber Krause, da liegt kein dämlicher Zufall vor, sondern ein Verbrechen! Und dem müssen wir auf die Spur kommen.«
Krause sah den Chef der Berliner Kriminalpolizei, Dr. Clusius, aus wasserhellen, verschlafenen, müden und leblosen Augen bewegungslos an und sagte, während es nervös um seine dünnen, blutleeren, bartlosen Lippen zuckte: »Herr Doktor sind sehr aufgeregt! Und das ist nicht gut, denn wenn Herr Doktor aufgeregt ist, gelingt es Ihnen nicht, mir ein klares Bild zu geben. Darf ich also bitten, mir nun in aller Ruhe zu sagen, was Herrn Doktor zu der Annahme gebracht hat, dass ein grauenhafter Unhold sein Wesen treibt und Mädchen verschleppt?«
Die Schmisse1 im runden Gesicht des hohen Kriminalbeamten färbten sich rot, weil er aus den Worten von Krause eine leise Ironie herauszuhören glaubte. Er strich sich hastig durch die schütteren, ein wenig angegrauten Haare und blätterte in den Papieren, die vor ihm lagen.
»Sie sind heute wieder unausstehlich, Krause! Aber meinethalben! Machen Sie sich Ihre Notizen und ich werde alles genau erzählen.«
Krause rührte sich nicht.
»Herr Doktor belieben zu vergessen, dass ich mir niemals Notizen machen muss, weil ich Gelegenheit genug hatte, mein Gedächtnis zu schärfen.«
Dr. Clusius erhob seine Stimme.
»Jawohl, Herr von Krause, ich gestattete mir, einen Augenblick Ihre Biografie zu vernachlässigen. Also gut, schreiben Sie nicht auf, aber setzen Sie sich und bringen Sie mich nicht zur Verzweiflung! Ich habe Ihnen gesagt, dass dem Polizeipräsidium innerhalb einiger Wochen vier Vermisstenanzeigen gemeldet wurden. Es handelt sich um folgende Fälle: Ein Mädchen, laut Meldeschein Trude Müller aus Berlin, dreiundzwanzig Jahre alt, hat am ersten Juli bei der Witwe Wendler, Waterloo-Ufer sechs, ein Zimmer gemietet. Die junge Dame machte einen guten, vertrauenswürdigen Eindruck, gab an, Lehrerin zu sein und demnächst heiraten zu wollen. Die Miete für das Zimmer zahlte Trude Möller für einen Monat im Vorhinein. Am sechsten Juli erzählte sie ihrer Wirtsfrau, dass sie mit ihrem Bräutigam eine kleine Reise unternehmen müsse. Er wolle ein Besitztum an der Havel unweit von Ketzin erwerben und es vor Kaufabschluss mit ihr besichtigen. Sie werde in Ketzin bei einer Tante ihres Bräutigams übernachten und morgen, spätestens übermorgen wieder zurück sein. Das Mädchen machte rasch eine Handtasche zurecht und stellte ihren Bräutigam, der gleich darauf mit einem Taxi vorgefahren kam, der Frau Wendler vor. Dieser Bräutigam dürfte angeblich Schollern oder Schullern geheißen haben, trug einen Kneifer und wird als hagerer, blonder Mann in den Dreißigern geschildert. Die Müller kam nicht mehr zurück und am sechzehnten Juli erstattete Frau Wendler die Vermisstenanzeige, der das Revieramt keine sonderliche Aufmerksamkeit schenkte. Der von Fräulein Müller hinterlassene Holzkoffer ist noch ungeöffnet und liegt jetzt hier im Aufbewahrungsraum des Präsidiums. Zweiter Fall: Am fünften Juli erschien in der Pension der Frau Zinkenbach in der Nürnberger Straße ein Mädchen und mietete ein Zimmer mit Vollverpflegung. Die Dame zog am zehnten Juli ein und füllte den Anmeldeschein höchst flüchtig mit Grete Möller aus, geboren in Hamburg, fünfundzwanzig Jahre alt. Schon zwei Tage später teilte sie dem Stubenmädchen frühmorgens mit, dass sie auf etwa zwei Tage verreisen werde, um mit ihrem Bräutigam ein Haus in der Havelgegend zu besichtigen. Den Bräutigam, der mit einem Taxi vorfuhr, hat niemand außer dem Portier gesehen, und dieser kann sich nur an einen blonden Herrn mit Kneifer erinnern. Auch Fräulein Möller ist nicht mehr zurückgekehrt. Dritter Fall: Am fünfzehnten Juli mietete ein Fräulein Annemarie Jensen, ebenfalls in Hamburg geboren, vierundzwanzig Jahre alt, ein bescheidenes Zimmer in der Fremdenpension der Frau Lestikow in der Motzstraße. Sie erzählte, sie sei eben aus Nordamerika zurückgekehrt und suche in Berlin eine Stelle als Hausdame. Einige Tage später aber vertraute sie der Frau Lestikow an, einen Herrn kennengelernt zu haben, der sie zu verehren scheint. Er sei sehr wohlhabend, in den besten Jahren, ein hochgebildeter Mann, Naturforscher und beabsichtige, sich unweit von Berlin anzukaufen, um in Ruhe seinen Forschungen leben zu können. Am einundzwanzigsten Juli kam Fräulein Jensen spätabends nach Hause und teilte der Frau Lestikow, die noch wach war, sehr erregt mit, dass sie sich mit dem Naturforscher verlobt habe und am anderen Tag mit ihm nach dem Havelstädtchen Ketzin reisen wolle, um dort ein in der Nähe befindliches Haus mit Garten zu besichtigen. Der Bräutigam, der anderen Tages gegen zehn Uhr vormittags Fräulein Jensen abholte, wurde von Frau Lestikow gesehen und ihr als Doktor Schindler vorgestellt. Er war sehr wortkarg, trieb zur Eile an, trug einen Kneifer, war schlank und blond. Fräulein Jensen kam, obwohl auch sie im Voraus gezahlt und ihr Gepäck hinterlassen hatte, nicht mehr zurück. Vierter und letzter Fall: Käthe Pfeiffer, geboren in Bayern, ohne Angabe des Ortes, fünfundzwanzig Jahre alt, Buchhalterin, mietete am zwanzigsten Juli ein möbliertes Zimmer bei der Witwe Klappholz in der Krummenstraße in Charlottenburg an. Frau Klappholz sah ihre Mieterin, die den ganzen Tag außer Haus war, nur selten. Am fünfundzwanzigsten Juli verließ Käthe Pfeiffer um sechs Uhr morgens das Haus und hinterließ folgendes Schreiben: ›Werte Frau Klappholz! Ich verreise auf zwei Tage, da mein Bräutigam eine Villa an der Havel kaufen will, die ich natürlich vorher auch besichtigen möchte. Bin spätestens übermorgen wieder hier. Ich bitte Sie, aufzupassen, dass nichts aus meinem Zimmer fortkommt. Bestens grüßend Käthe Pfeiffer.‹ Den Bräutigam hat niemand gesehen, Fräulein Pfeiffer ist nicht mehr zurückgekehrt und Frau Klappholz hat am fünften August, also genau vor einer Woche, die Anzeige erstattet.«
Dr. Clusius blies vor sich hin, streckte die Beine weit aus, schob Krause die Zigarren zu, zündete sich selbst eine an und sagte: »Ich bin fertig und werde wirklich staunen, wenn Sie sich alles gemerkt haben. Und nun, lieber Krause, was halten Sie davon?«
Krause kam jetzt endlich in Bewegung. Er stand auf, ging zum Fenster. Dort warf er einen Blick auf den Alexanderplatz, lachte kurz und trocken auf, weil ihm zwei dicke Frauen, die ihm Verlauf eines Tratsches ihre Marktkörbe gegeneinander schwenkten, komisch erschienen. Anschließend drehte er sich um und sprach, während sein mageres, verwittertes Gesicht, das mit der scharfen Hakennase einem Schauspieler, einem Jockei, aber auch einem ein wenig degenerierten Aristokraten gehören konnte, sich in tausend Falten und Fältchen legte, tonlos, ohne Erregung, gleichgültig, als würde es sich um eine Wetterfrage handeln: »Ich habe mir jedes Detail gemerkt und das war nicht schwer, weil diesen aus den Polizeirevieren stammenden Berichten eben jedes Detail fehlt. Was ich davon halte? Nun, dem Anschein nach könnte es sich allerdings um vier ganz gleichartige Verbrechen handeln. Quasi von ein und derselben Person.«
Der oberste Kriminalbeamte von Berlin sah den hageren, irgendwie grau erscheinenden und ganz in Grau gekleideten Mann interessiert an. »Sie drücken sich sehr vorsichtig aus, Krause! Dem Anschein nach und könnte sich … Wollen Sie also den Fall übernehmen?«
»Sicher. Er ist ernst genug, um mich anzuregen.«
Dr. Clusius lächelte und nickte befriedigt. »Was wollen wir also zunächst unternehmen?«
»Ganz klar, Herr Doktor! Morgen Vormittag müssen hier in diesem Zimmer die zurückgelassenen Gegenstände der verschwundenen Frauen, ihre Anmeldescheine und die vier Vermieterinnen, bei denen sie gewohnt hatten, sowie der Portier aus der Motzstraße zur Stelle sein. Na, vor dem Gequatsche der vier Weiber graut mir jetzt schon! Aber es muss überstanden werden und dann gehe ich los!«
Die Worte ›Dann gehe ich los‹ gefielen dem Chef so außerordentlich, dass er sich vergnügt die Hände rieb. ›Ich gehe los‹ hatte bei Krause zu bedeuten, dass er sich aus einem apathischen Nörgler in eine Dynamomaschine verwandelte und wirklich losging, wie ein Auto mit achtzig Pferdestärken. Krause ging nicht immer los, aber wenn er losging, dann arbeitete er mit hundert Sinnen und Gehirnen.
Joachim von Dengern, alias Krause
Während sich Dr. Wilhelm Clusius in seiner ganzen Art nicht sonderlich von anderen leitenden Polizeibeamten der Großstädte unterschied und seine erfolgreiche Laufbahn weniger irgendwelchen hervorstechenden Eigenschaften, als mustergültiger Pflichttreue, tadelloser Lebensführung und außerordentlichem Taktgefühl, bewiesen in peinlichen, in den vornehmsten Kreisen spielenden Affären, verdankte, glich Krause in keiner Weise den üblichen Kriminalunterbeamten, die man Detektive zu nennen pflegt. Und seine Karriere, seine Lebensgeschichte und sein Werdegang waren wohl ganz außerordentlicher Art. Aber sogar die wenigen Eingeweihten wussten von ihm nicht viel mehr, als dass Krause gar nicht Krause hieß, sondern dies nur ein von ihm angenommener Name sei, und dass es ihm nicht an der Wiege gesungen worden war, dereinst höchstpersönlich, nicht vom grünen Tisch aus, sondern mittelst Einsetzung aller Kräfte Verbrechern nachjagen musste. Genaues wusste im Roten Rathaus am Alexanderplatz eigentlich nur Dr. Clusius und weil er es wusste, so schätzte er diesen, mitunter höchst widerwärtigen Krause, sehr. Ganz tief im Inneren brachte er ihm eine Hochachtung und Bewunderung entgegen wie keinem anderen Menschen aus seinem Wirkungs- und Bekanntenkreis.
Krause war ein unglücklicher Mensch und hatte einen Knacks weg, von dem er sich nicht erholen konnte. Er hieß in Wirklichkeit Joachim von Dengern, entstammte einer wenig begüterten, aber um so vornehmeren Familie, hatte sein Einjährigenjahr2 bei den Gardekürassieren abgedient, war Reserveleutnant geworden und nach Erlangung des juristischen Doktordiploms und später des Referendarexamens in die Kanzlei eines der berühmtesten Berliner Rechtsanwälte, des Justizrates Rodenbach, eingetreten. Man war jung, hatte in Pommern einen Bruder Gutsbesitzer, der durch Heirat klotzig reich geworden war. Man lebte also ein bisschen, gab für nette kleine Mädchen mehr Geld aus, als man eigentlich durfte, pumpte von Zeit zu Zeit den um zehn Jahre älteren Bruder kräftig an, kam oft etwas verkatert und zu spät in das Büro oder zu Gericht. Kurzum, man lebte nicht schlechter als tausend andere junge Referendare, die ›von‹ sind, als nette, lustige Kerle gelten und gut daran tun, sich die Hörner abzustoßen, bevor es unter das Joch der Ehe und Würden geht.
Bis sich eines Tages Furchtbares und Unerwartetes ereignete. Justizrat Rodenbach hatte in einer Prozessangelegenheit von einem Klienten ein Depot von etlichen Millionen Mark in barem Geld erhalten. Diesen Betrag legte er in Gegenwart seines jungen Gehilfen, Dr. Joachim von Dengern, in den eisernen Kassenschrank, wobei er sagte, dass es eigentlich recht unvorsichtig sei, solche Summen zu behalten, umso mehr als der Kassenschrank veraltet sei und einem halbwegs gewiegten Einbrecher wenig Widerstand entgegensetzen wurde. Einer Bemerkung, der Joachim von Dengern pflichtschuldig beistimmte, nicht ohne zu denken, dass es gerade jetzt, da die Mittellosigkeit wieder einmal erheblich war, sehr schön wäre, einen Teil des Geldes zu besitzen. An diesem Tag gab es vielerlei Arbeit, manche, die nach Ansicht des Referendars hätte liegen bleiben können, nach der Ansicht des Justizrates aber unbedingt erledigt werden sollte. Joachim von Dengern musste tüchtig Überstunden machen und befand sich, nachdem der Justizrat sich ins königliche Opernhaus begeben und auch die anderen, weniger intensiv beschäftigten Herren fortgegangen waren, noch eine Stunde oder mehr allein im Büro. Er nahm daher, wie immer in solchen Fällen, die zweiten Büroschlüssel mit sich, nachdem er alle Türen ordentlich versperrt hatte, während der alte Bürodiener August, der schon frühmorgens zu kommen pflegte, die anderen Schlüssel besaß. Auch der Justizrat hatte natürlich Schlüssel bei sich.
Am anderen Tag fand Joachim von Dengern, als er nach durchzechter Nacht etwas bleich und zitterig den Dienst antrat, das Büro in chaotischem Zustand an. Furchtbares hatte sich ereignet! Der Kassenschrank war mittelst primitiver Instrumente aufgebrochen und seines kostbaren Inhaltes beraubt worden.
Dr. Clusius, damals noch gewöhnlicher Kriminalkommissar, führte die Untersuchung und wusste nach knapp einer Stunde genau Bescheid. Nur der Referendar Joachim von Dengern konnte der Täter sein! Er allein hatte von den Millionen im Kassenschrank gewusst, er war allein im Büro zurückgeblieben, er wusste genau, wo im Vorzimmer auf einem verstaubten Aktenschrank ein Werkzeugkasten stand, mittelst dessen Inhalt, wie einwandfrei nachgewiesen werden konnte, das Herausbrechen der Schlosszunge erfolgt war.
Außerdem: Dengern war verschuldet, hatte auf einen neuen Pumpversuch von seinem Bruder einen deutlich abwinkenden Brief erhalten, er führte überhaupt einen sogenannten liederlichen Lebenswandel. Kurzum, seine Verhaftung war gerechtfertigt. Wie sehr gerechtfertigt, erwies sich, als man ihn einer Leibesuntersuchung unterzog und in der Innentasche seines Stadtpelzes ein Bündel von Hunderttausendmarkscheinen fand. Unschwer wurde denn auch festgestellt, dass diese Tausendmarkscheine mit jenen übereinstimmten, die Justizrat Rodenbach am Tage vorher als Depot erhalten hatte.
Vergebens beteuerte Joachim von Dengern vor dem Untersuchungsrichter und später vor den Geschworenen, dass er keine Ahnung habe, wie die Tausender in seinen Pelz gekommen seien. Vergebens schrie er immer wieder: »Ich bin unschuldig!«
Das von Dr. Clusius erbrachte Beweismaterial war zu stark und Dengern wurde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein wenig hart, aber eines aufrechten, charakterfesten Mannes durchaus würdig, hatte sich in dieser Zeit der ältere Bruder Joachims angenommen, der auf einen jammervollen Brief, in dem Joachim bei dem Angedenken an seine verstorbenen Eltern und bei seiner Mannesehre seine Unschuld beschwor, nur die kernigen, lapidaren Worte zu erwidern wusste: »Belästigen Sie mich nicht mehr mit Zuschriften, die ich nur mit Ekel in die Hand nehmen kann. Ich habe keinen Bruder mehr! Mein Bruder ist an dem Tage gestorben, da er meinen Namen mit Schmach bedeckte!«
In den drei langen Zuchthausjahren, ein Jahr wurde ihm seiner guten Führung wegen geschenkt, klebte Joachim Dengern Tüten, band Gebetbücher ein und lernte, Ösen in Schuhoberteile zu machen. Und nebenbei dachte er am Tag bei der Arbeit und in der Nacht, wenn das Zuchthaus von den wüsten Träumen der gefesselten Menschen erdröhnte, nach. Immer dachte er an ein und dasselbe: Wie werde ich meine Unschuld erweisen, wie baue ich Tatsachen, Vermutungen, winzige Geschehnisse so auf und zusammen, dass sie dereinst meine Zeugen werden?
Im Kopfe setzte er, Papier erhielt er für solch alberne Dinge nicht, die Schrift zusammen, mit der er die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen sich beantragen wollte. Diese Schrift wurde immer umfangreicher. Es wurden schließlich hundert Seiten Maschinenschrift, die er jederzeit auswendig aufsagen konnte.
Als die drei Jahre um waren, hatte Joachim Dengern die Freiheit wieder, ein paar hundert ersparte Mark und allerlei wertvolle Gegenstände von früher, die er sofort verkaufte.
Nun entwickelte er eine Tätigkeit, die allein in ihrer Schilderung einen Roman bilden könnte. Er vertiefte sich in das Privatleben seines früheren Chefs, des Justizrates Rodenbach, wühlte sich Jahre zurück, umschlich die Frau, die Kinder, das Hausgesinde des Rechtsanwaltes, ermittelte, wohin der Trödler den altmodischen Kassenschrank verkauft hatte, den er nach der Affäre vom Justizrat billig bekommen hatte.