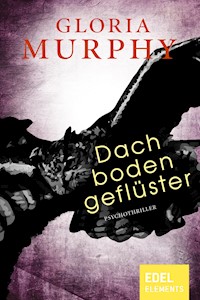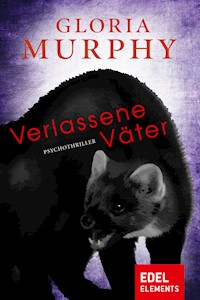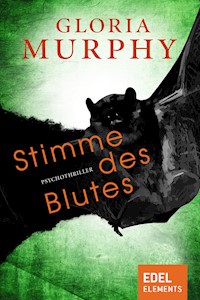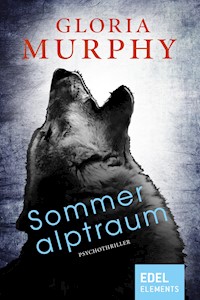3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannend bis zur letzten Seite - raffinierter Nervenkitzel von einer Meisterin des Psychothrillers! "Sprich nicht mit Fremden" - diese Warnung geben Mütter überall auf der Welt ihren Kindern mit auf den Weg. Lauren Sandler ist da keine Ausnahme - und muss erleben, dass sie ihre eigene Regel bricht. Lauren, die mit ihrer Tochter Chelsea in New York lebt, begegnet eines Tages auf einem Jahrmarkt dem charmanten Jonathan Grant, dem sie vom ersten Augenblick an nicht widerstehen kann. Doch bald muss Lauren erkennen, dass an den Warnungen der Mütter wohl doch etwas dran ist. Denn Jonathan entpuppt sich immer mehr als der Fremde in ihrem eigenen Haus...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gloria Murphy
Der Fremde in meinem Haus
Psychothriller
Aus dem Amerikanischen von Gabriela Schönberger-Klar
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Impressum
PROLOG
Es war, als hätte sich ein Vogel in ihrem Kopf eingenistet und angefangen, an ihrem Gehirn zu picken, das er für ein riesiges Samenkorn hielt. Eine Art supermoderner Gehirnschaber, den sich die Polizei hatte einfallen lassen, um sie abzuschalten und gleichzeitig anzuheizen. Was natürlich schwierig war, ungefähr so, als würde man ein Jo-Jo mit einem Stock statt mit einer Schnur tanzen lassen. Was die Polizei von dem Mädchen wollte, war, daß es endlich mit der Sprache herausrückte und erzählte, was es gesehen, was es getan hatte. Aber nicht, hier rumzusitzen und sie verständnislos anzustarren, auch nicht, herumzubrüllen und zu fluchen wie ein Landsknecht.
Landsknecht, Soldat, Polizist – sie konnte nicht anders, als sich immer wieder diese Wörter vorzusagen, bis ein Gefühl der Hitze und der klebrigen Sentimentalität in ihr hochstieg. Ein Eiswürfel wäre nicht schlecht, um der Sache mehr Biß zu verleihen, dachte sie, und während ihr das Wort Staatspolizist wieder durch den Kopf schoß, spürte sie, daß etwas Kaltes gegen ihre Stirn gepreßt wurde. O ja, entschuldigen Sie bitte, aber wovon ist hier eigentlich die Rede, Sir? Von einem berittenen Staatspolizisten, einem Nazi oder einfach einem x-beliebigen Wald-und-Wiesen-Uniformierten? Die Reise nach Jerusalem, wer keinen Stuhl erwischt, muß gehn ... Igitt, igitt, pfui Teufel. Okay, okay ich habe schon genug Zeit vertan, wo bist du, mein charmanter Prinz auf deinem weißen Schimmel? Los, schwing dich auf deinen Gaul und komm hierher, bevor die mir endgültig das Gehirn rauspicken.
Heute war ihrem langen, dunklen Haar nichts von seinem üblichen Glanz oder ihrer Haut von ihrer sonstigen rosigen Frische anzumerken; trotzdem wirkte sie im Schlaf noch immer heiter und war hübsch anzusehen, fast wie ein Engel. Zwei Pfleger in krankenhausgrünen Anzügen schoben ihre Bahre durch die Schwingtüren der Ambulanz hinaus auf den Korridor, wo ihr Vater wartete.
Er eilte sofort an ihre Seite; an einer Stange, die neben der Bahre hergeschoben wurde, hing ein durchsichtiges Plastik-säckchen, von dem aus eine klare Flüssigkeit in ihre Venen tropfte; ein Eisbeutel thronte auf ihrer Stirn und verbarg die Beule, die sie sich beim Sturz gegen das Waschbecken im Bad zugezogen hatte. »Wird sie wieder gesund werden?« fragte er. Eine dumme Frage. Er wußte, daß die beiden nur Pfleger waren, aber er brauchte verzweifelt Trost. »Hören Sie, ich muß unbedingt mit dem zuständigen Arzt sprechen.«
»Kommen Sie doch mit in ihr Zimmer. Der Doktor wird dann auch gleich nachkommen und Ihre Fragen beantworten«, erwiderte einer der Männer. Das Mädchen wurde in ein Bett umgelagert, und eine Schwester mit einem Klemmbrett kam und maß ihr den Puls und den Blutdruck; gleich nach ihr kam derselbe Arzt, den der Vater zuvor schon einmal gesehen hatte.
Ehe er ihn mit Fragen bombardieren konnte, hob der Arzt abwehrend beide Hände. »Sie wird wieder völlig in Ordnung kommen, Mr. Grant«, beschwichtigte er ihn. »Zumindest körperlich. Wir vermuten, daß sie mindestens ein gutes Dutzend Schlaftabletten genommen hat, genug, um einen kräftigen Ackergaul schachmatt zu setzen. Eine Weile stand es sogar Spitz auf Knopf ... Ja, ich würde sagen, Sie haben sie keinen Moment zu früh gefunden.«
Der Arzt strich sich mit der Handfläche über seinen schütteren Haarkranz, auf seinem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Mitleid und Fassungslosigkeit wider. »Himmel, erst zehn Jahre alt. Warum sollte sich ein Mädchen in dem Alter umbringen wollen?«
KAPITEL 1
Sprich nicht mit Fremden, lautet eine der wichtigsten Regeln, die Mütter permanent ihren Kindern einzubleuen versuchen. Auch Lauren Sandler, eine junge, alleinerziehende Mutter, bildete da keine Ausnahme. Lauren, die mit ihrer Tochter in einem kleinen Loft im obersten Stockwerk eines ehemaligen Bürogebäudes mitten in New York lebte, tat ihr Bestes, ihren eigenen Ratschlag zu befolgen. Doch ab und zu sollten selbst die besten Regeln gebrochen werden.
Vielleicht lag es an dem herrlichen Frühlingstag. Lauren und die fünf Jahre alte Chelsea genossen ihn auf dem Rummelplatz von Orange County in Elmwood Valley, das sich gerade mal fünfzehn Minuten vom Haus ihrer Schwester Fern, aber über achtzig Meilen vom Streß der Großstadt entfernt befand. Oder vielleicht hatte es auch mit dem Fremden selbst zu tun, der zwar nicht unbedingt einen besonders freundlichen Eindruck gemacht hatte, als sie ihn das erste Mal vor der Schießbude sah, wo er mit einem elektronischen Gewehr auf Holzenten zielte, die munter auf einem Wasserstrahl tanzten. Dem Stapel bunter Preise nach zu schließen, die neben ihm auf der Theke lagen, schien er sich dabei recht geschickt anzustellen. Ihre eigene Tochter hatte sie schließlich bei der Hand genommen und zu dem Stand gezerrt.
Aber es waren nicht die vielen Preise neben dem Fremden, die Marionetten, die Gummischlangen, die Plastikdinos oder die Sonnenschirmchen und Fächer aus buntem Papier, die Chelseas Aufmerksamkeit auf sich zogen. Sie deutete nämlich auf das oberste Regal hinter der Theke mit den Gewinnen, wo ein schwarzweißer, flauschiger Dalmatiner hockte, ein Schild zwischen seinen dicken Vorderpfoten, auf dem stand, daß er für fünfundzwanzig Punkte zu haben sei. »Mommy, schau mal«, strahlte sie. »Sieht der nicht aus wie echt?«
Sie hatte nicht gebettelt, und vielleicht war es genau das, was in Lauren den Wunsch wachrief, den Hund für sie zu gewinnen. Aber der Wunsch allein genügte in diesem Fall nicht; Lauren hatte in ihrem Leben noch nie ein Gewehr abgefeuert und kam einfach nicht dahinter, wie die Sache funktionierte. Und so ließ sie nach einem Dutzend vergeblicher Versuche das Gewehr auf die Theke sinken und gestand ihre Niederlage ein. Genau in dem Moment blickte der Fremde, der bisher schweigend daneben gestanden hatte, in ihre Richtung und lenkte die Aufmerksamkeit des Budenbesitzers auf sich. Mit dem Kopf auf seine Preise deutend, sagte er zu ihm: »Was meinen Sie, wie viele Punkte sind das, fünfunddreißig?«
Der Mann schien im Kopf rasch die Zahlen zu überschlagen und nickte bestätigend.
»Gut, dann tausche ich sie ein.« Mit einer Geste in Richtung des obersten Regals fügte er hinzu: »Geben Sie dem kleinen Mädchen dafür den Hund.«
Der Besitzer der Schießbude überreichte einer staunenden Chelsea das Plüschtier, noch ehe ihre Mutter Gelegenheit zum Reagieren hatte. Doch falls sie verärgert darüber gewesen sein sollte, daß man sie vorher nicht gefragt hatte, oder Chelsea hatte bitten wollen, das Geschenk zurückzugeben – alles löste sich in Wohlgefallen auf, als der Fremde sie schließlich ansprach. »Ich schätze, ich sollte mich bei Ihnen entschuldigen«, begann er. »Ich hätte mich zuerst mit Ihnen absprechen sollen, aber sie schien mir so ... na ja, sie schien ihn sich einfach so sehr zu wünschen.«
Er war groß, schlank, gutaussehend. Er trug braune Baumwollhosen und ein curryfarbenes Jackett. Er hatte die schönsten, traurigen dunklen Augen, die man sich vorstellen konnte, und ein energisches Kinn mit einem tiefen Grübchen in der Mitte. Er streckte ihr die Hand entgegen – kein Ring. Sie schätzte ihn auf Anfang Vierzig, aber der Altersunterschied bereitete ihr keine Kopfzerbrechen. Ihre Schwester würde sich ihren Kommentar natürlich nicht verkneifen können, aber im Augenblick wünschte Lauren sich nur, sie hätte sich etwas Hübscheres als ein Paar alte Jeans angezogen.
»Nett, Sie kennenzulernen. Ich heiße Jonathan Grant«, fuhr er fort; offensichtlich sah sie ihn erwartungsvoll an, denn er fügte umgehend hinzu: »Die meisten Leute hier in der Gegend kennen mich. Grant – Architekturbüro und Bauunternehmen. Unsere Firma arbeitet auch für die Stadt.«
Jetzt zögerte sie nicht mehr, die Hand zu ergreifen, die er ihr entgegenstreckte. »Ich bin Lauren Sandler«, erwiderte sie und wandte sich an ihre Tochter, die mit Sicherheit eine Auffrischung der Warnung vor Fremden nötig hatte. »Und diese kleine Dalmatiner-Liebhaberin hier heißt Chelsea.«
Er blickte auf Chelsea hinab, die mit ihrem neuen Freund, der nur unwesentlich kleiner als sie selbst war, fröhlich herumtollte. Dabei grinste sie übers ganze Gesicht, dessen rundliche Wangen von einem widerspenstigen Schopf goldener Locken eingerahmt wurden. »Sie ist ein ganz entzückendes Kind.«
Lauren nickte. »Danke. Und auch für das Geschenk, das war sehr großzügig von Ihnen.«
Mit einem Achselzucken ging er über ihre Dankbarkeitsbeteuerung hinweg; er machte aber auch keine Anstalten, das Gespräch mit ihr fortzusetzen.
»Der Rummelplatz ist wirklich schön dieses Jahr, viele neue Buden und Stände«, sagte sie deshalb. »Sind Sie heuer das erste Mal hier?« Mit einer Ausdehnung von fast achtzehn Hektar war das Volksfest von Orange County ein bedeutendes, jährlich wiederkehrendes Ereignis, das im Mai begann und bis zum Ende der Ferien im September dauerte. Als größte Einnahmequelle des Countys war hier von allem etwas geboten: Ausstellungen über Wissenschaft und Geschichte, Buden mit Kunstgewerbe und Handwerk, ausländische Spezialitäten, Tierschauen, Fahrgeschäfte und sportliche Wettbewerbe – nicht zu vergessen das nette kleine Wäldchen mit dem Ententeich und den Picknicktischen, das ungefähr eine halbe Meile entfernt lag.
»Es mag zwar nicht so aussehen«, entgegnete er mit einem leicht schiefen Grinsen, das ihr sofort sympathisch war, »aber ich bin aus beruflichen Gründen hier, um das Gerüst des Amphitheaters zu überprüfen.«
Lauren war in Gedanken bereits mit Planen beschäftigt; sie würde bis zum Wochenende bei Fern bleiben, und wenn er nicht zu weit weg wohnte ... aber seiner Körpersprache war zu entnehmen, daß er sich schon wieder auf dem Rückzug befand und ihn auch antreten würde, wenn sie die Sache nicht umgehend in die Hand nähme. »Jonathan, ich wollte Sie fragen –«, setzte sie an. Sie hielt inne und begann von vorne. »Also, wenn Sie noch nichts anderes vorhaben ... hätten Sie vielleicht später Lust auf einen Drink?«
Okay, sie hatte es gesagt. Offensichtlich wußte er mit ihrer Direktheit nichts anzufangen, denn er stand unentschlossen da, als würde er die Situation genauestens abwägen. Aber man schrieb schließlich die neunziger Jahre, und als achtundzwanzigjährige, berufstätige Frau, einmal verheiratet, geschieden, war es für sie nicht das erste Mal, daß sie einen Mann ansprach. Doch jetzt schmolz unter seinem prüfenden Blick ihre normalerweise recht ausgeprägte Selbstsicherheit wie Schnee in der Sonne dahin, während sie darauf wartete, ob der Fremde vielleicht die Freundlichkeit besaß, sie aus ihrer Verlegenheit zu erlösen oder ihr gar noch weiter entgegenzukommen. Was war sie doch für ein Vorbild für Chelsea.
Endlich kam er ihr zu Hilfe und bestand sogar darauf, statt des von ihr vorgeschlagenen Drinks sie und Chelsea zu einem tollen kleinen Italiener an der Route 95 auszuführen, den er recht gut kannte. Ehe sie den Rummelplatz verließen, rief Lauren noch in Ferns Immobilienbüro an, um ihr zu sagen, daß und warum sie später nach Hause kämen. Ihre Schwester konnte es sich zwar nicht verkneifen, sie sofort darauf hinzuweisen, daß es nicht sehr klug wäre, die Einladung eines völlig Fremden anzunehmen, aber sobald Lauren den Namen Jonathan Grant fallenließ, änderte Fern schlagartig ihre Meinung.
Als sie später wieder zu ihrem Wagen zurückkehrten, den sie auf dem Rummelplatz hatte stehenlassen, war es bereits zehn Uhr, und der Parkplatz war fast leer. Chelsea schlief, und Jonathan nahm sie, zusammen mit dem Plüschdalmatiner, den sie im Schlaf fest umklammert hielt, auf den Arm und legte sie auf den Rücksitz des Wagens ihrer Mutter. Die Erwachsenen, die sich offensichtlich nicht so leicht voneinander trennen konnten, blieben in der Dunkelheit draußen stehen und unterhielten sich angeregt. Jetzt fühlte man sich bereits etwas sicherer und konnte zu persönlicheren Themen übergehen. »Sie wollten mich heute nachmittag also tatsächlich stehenlassen und weggehen, einfach so?« meinte Lauren ironisch.
»Kann schon sein. Eigentlich wollte ich es ja nicht ...« Er verstummte einen Moment, als überlegte er, wieviel er sagen sollte, aber als er seine Entscheidung getroffen hatte, fuhr er fort: »Es ist schon eine Weile her, daß ich eine Frau kennengelernt habe, ich meine, eine, mit der ich mich hätte verabreden wollen. Ich habe eine sehr gute Ehe geführt, und wahrscheinlich erschien es mir einfach unvorstellbar, so etwas noch einmal zu erleben. Außerdem bin ich völlig aus der Übung.« Sie spürte, daß seine dunklen Augen prüfend auf ihr lagen. Als sie seinen Blick erwiderte, kroch langsam ein wohliger Schauer über ihren Rücken, und sie wußte, daß er dasselbe empfand. »Ich fühlte mich noch nicht bereit, Lauren. Nicht bis heute abend.«
In ihrem Gespräch zuvor hatte er erwähnt, daß seine Frau tot sei, aber sie war nicht weiter in ihn gedrungen, und er hatte auch nicht weiter ausgeholt. Doch jetzt sprudelte die ganze Geschichte aus ihm heraus wie ein Wasserfall und lieferte Lauren eine Erklärung für die Traurigkeit, die sie bereits den ganzen Abend an ihm bemerkt hatte. »Meine Frau ist nicht einfach so gestorben«, erzählte er. »Nancy wurde ermordet. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, falls so etwas überhaupt vorstellbar ist, sie war schwanger, am Anfang des vierten Monats. Wir hatten es schon eine ganze Weile versucht ...«
Er verstummte; es dauerte eine Zeit, bis er sich wieder im Griff hatte. Es war bestimmt nicht leicht für ihn, ihr dies zu erzählen, dachte Lauren und fragte sich, ob es vielleicht sogar das erste Mal war, daß er darüber sprach. »Das Baby ... es wäre ein Junge geworden«, sagte er schließlich. »Das ist jetzt alles ein Jahr her. Eines der Fenster im Erdgeschoß war eingeschlagen worden – so ist der Eindringling ins Haus gekommen. Wie es aussah, war es ein versuchter Raubüberfall, aber das einzige, das der Räuber erwischen konnte, war der Schmuck, den Nancy am Leib trug: ein Verlobungsring, ihr Ehering, eine Halskette aus Jade. Die Polizei vermutet, daß sie unten im Keller in ihrem Nähzimmer war und dann nach oben in die Küche ging. Sie war eine ausgezeichnete Hausfrau ... Sie kochte, sie nähte ... Sie arbeitete gerade an der Ausstattung für das Baby.«
Lauren nickte; sie hatte Frauen, die über ausgeprägte hausfrauliche Talente verfügten, immer schon bewundert, sich aber nie sonderlich bemüht, selbst welche zu entwickeln. »Er muß ihre Schritte auf der Treppe gehört haben, da die Polizei annimmt, daß er sich irgendwo versteckte, sie überrumpelte und mit einem Baseballschläger niederschlug. Sie ist rückwärts die Treppe hinuntergestürzt ...«
»Gott, wie schrecklich«, bemerkte Lauren, die erneut einen Schauer über ihren Rücken laufen spürte. Sie war entsetzt, daß in einem so verschlafenen Städtchen wie Elmwood Valley etwas so Gräßliches passieren konnte. »Ich hoffe, sie haben ihn erwischt –«, setzte sie im Überschwang ihrer eigenen Wut an, verstummte aber sofort wieder.
Er steckte seine Hände in die Hosentaschen, lehnte sich an den Wagen und starrte hinauf zu den Sternen. »Oh, sie hatten sofort einen Verdächtigen bei der Hand, aber außer dessen erbärmlicher krimineller Vergangenheit gab es nichts, was diesen Burschen mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht hätte.«
Er senkte den Blick und sah sie an. »Der Verdächtige hieß Jay Philips, ein Bursche aus Monticello. Mit fünfzehn hatte er seiner Schwester mit einem Stein den Schädel eingeschlagen, aber da er nach den Gesetzen des Staates New York noch unter das Jugendstrafrecht fiel, hatte er Glück – er wurde in eine Besserungsanstalt verfrachtet und mit achtzehn mit einer weißen Weste wieder entlassen. Soviel zum Thema Gerechtigkeit. Ich behaupte ja gar nicht, daß er Nancy getötet hat ... Ich weiß es nicht. Ich glaube nur nicht daran, daß Leute wie er sich jemals bessern werden.«
Lauren fiel dabei ein, daß sie einmal gelesen hatte, wie erschreckend niedrig die Aufklärungsquote bei Mordfällen war. »Ich nehme an, ohne Augenzeugen wird es nicht viel Hoffnung geben«, sagte sie.
»Es gibt vielleicht sogar einen Augenzeugen.«
»Aber?«
»Tja, das ist ziemlich kompliziert. Die Zeugin, jedenfalls glauben wir das, ist meine Tochter.«
Überrascht zu hören, daß er eine Tochter hatte, wartete Lauren neugierig, daß er fortfuhr.
»Sie heißt Emily und ist erst vor ein paar Wochen elf Jahre alt geworden. Das ist der Grund ...«, fügte er hinzu, machte aber gleich wieder eine Pause und spähte besorgt auf den Rücksitz, wo Chelsea mit angezogenen Armen und Beinen fest schlief. Wortlos zog er sein Jackett aus und deckte sie vorsichtig damit zu, ehe er sich wieder an Lauren wandte. »Ich versuche, sowenig wie möglich über sie zu reden. Denn jedesmal macht mich das entweder unglaublich traurig oder wütend, und mit beiden Gefühlen kann ich nicht besonders gut umgehen. Ich gehe ab und zu mal zu einem Schießstand, um meinen Ärger abzureagieren, und dann mache ich auch noch so nützliche Dinge wie auf Holzenten auf dem Rummelplatz schießen.«
Ein zynisches Lächeln krauste seine Mundwinkel. »Emily war in der fünften Klasse ... Nancy hatte sie an diesem Mittag von der Schule abgeholt. Die Schulkrankenschwester hatte angerufen und erzählt, daß sie mit einem ihrer Klassenkameraden zusammengestoßen und auf das harte Pflaster gefallen sei. Es war nichts Ernstes, nur ein paar Abschürfungen und blaue Flecken. Wer immer Nancy getötet hat, wußte nicht, daß Emily im Haus war. Gott sei Dank. Sonst wäre sie heute vielleicht nicht mehr am Leben.«
Lauren tauschte im Geist automatisch das Gesicht von Jonathans Tochter gegen das ihrer eigenen aus und empfand großes Entsetzen. »Aber wenn sie gesehen hat, wer es war?« »Wir wissen mit Sicherheit eigentlich nur, daß Emily, sobald sie dazu in der Lage war, sich das Telefon in der Küche schnappte, den Notruf 911 wählte und in den Hörer brüllte: ›Es war ein Fremder!‹ Die Dame vom Amt konnte nicht mehr aus ihr herausholen, keinen Namen, keine Adresse, und so redete sie so lange auf sie ein, bis der Anruf zurückverfolgt war. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie Emily auf dem Küchenfußboden kauernd vor, die Augen fest zusammengekniffen, den Telefonhörer an sich gedrückt ...«
Er wandte sich von ihr ab, hieb mit geballten Fäusten auf das Autodach und fuhr fort: »Sie erlitt einen schweren Schock, war völlig weggetreten ... Und mich konnten sie auch nicht erreichen. Ich war weit weg in Syracuse. Das einzige Mal, daß ich mit dieser Firma dort zu tun hatte, aber ausgerechnet an diesem Tag mußte ich fort sein.« Er verstummte und riß sich wieder zusammen. »Emilys Psychiater, Dr. Strickler, erklärte mir, daß ihre Abwehrmechanismen versagten, da sie einfach nicht mehr in der Lage war, mit dem fertig zu werden, was sie gesehen hatte. Ihre Reaktion ist weder atypisch noch notwendigerweise ungesund – Kinder verdrängen oft Erinnerungen, mit denen sie nicht umgehen können. Es wäre vielleicht alles nicht so schlimm, hätte sie sich nicht gar so weit zurückgezogen.« Jetzt erst drehte er sich wieder zu Lauren um. »Seitdem ist sie in der Bateman-Klinik und versucht, ihren Weg zurück zu finden.«
Die Bateman-Klinik, die westlich von Boston lag, war eine psychiatrische Anstalt für psychisch gestörte Kinder und Jugendliche und nach allem, was Lauren bisher gehört hatte, eine der besten Einrichtungen ihrer Art im ganzen Land, und auch eine der teuersten. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Jonathan«, meinte sie und trat endlich näher an ihn heran. Sie legte ihm die Hand auf den Arm. »Es tut mir so leid.«
»Zur Zeit geht es ihr ein wenig besser«, erklärte er, sich zu einem etwas muntereren Tonfall zwingend. »Wirklich. Es gab eine Zeit, da wollte sie nicht einmal mehr reden ... mit keinem, mich eingeschlossen. Aber in den vergangenen paar Monaten habe ich den einen oder anderen Fortschritt an ihr bemerkt. Sogar ihr Arzt hat es zugegeben, und Sie wissen doch, wie zurückhaltend diese Herren mit solchen Äußerungen sind. Natürlich gibt es keine Garantie, und ich verlange auch keine. Ich wünsche mir nur, daß sie eine Chance bekommt, eine einzige Chance. Und vielleicht denken Sie ja, daß ich mir etwas vormache, aber ich habe so ein Gefühl in mir, daß mein Mädchen bald wieder nach Hause kommen wird.«
Fern war noch wach und wartete auf Lauren und Chelsea, als die beiden in ihr Haus in dem nahe gelegenen Middletown kamen. Während sie eine Kanne mit Tee aufsetzte, trug Lauren Chelsea zu der Liege im Gästezimmer, zog sie aus und brachte sie ins Bett ... Dabei konnte sie an nichts anderes als an Jonathan denken.
Sie fühlte sich total ausgelaugt, als hätte sie eine zutiefst intime Begegnung mit diesem Mann hinter sich, allerdings auf emotionaler Ebene; noch nie zuvor hatte sie eine ähnliche Erfahrung gemacht. Er hatte ihr nicht sagen müssen, was er für seine Tochter empfand. Die Liebe war ein Teil von ihm. Sie konnte seinen Schmerz und seine Trauer spüren, und auch wenn das Wort »Schuld« nicht ein einziges Mal gefallen war, war es ständig präsent gewesen. Während er mit einem Kollegen auf einer Geschäftsreise gewesen war, war in sein Haus eingebrochen worden; die Logik sagte ihm zwar etwas anderes, aber seitdem wurde Jonathan Grant von der Vorstellung gepeinigt, daß er irgend etwas hätte unternehmen können oder müssen, um seine Familie zu retten.
Nachdem er Lauren in den Wagen geholfen hatte, hatte er vorsichtig die Tür geschlossen, um Chelsea nicht zu wecken, ehe er sich zum Abschied zu ihr hinunterbeugte. Sie dachte, er würde sie küssen. Sie konnte sich nicht erinnern, einen Mann jemals so sehr begehrt zu haben wie ihn. Aber er drückte nur den Sicherheitsknopf von Chelseas Tür hinunter und strich ihr dann mit den Knöcheln sanft über die Wange. »Gute Nacht«, sagte er.
»Ihr Jackett«, antwortete sie und drehte sich um. Aber er legte ihr die Hand auf den Arm und hielt sie zurück.
»Das nächste Mal«, meinte er.
Sie mußte schlucken – o ja, es würde ein nächstes Mal geben. Ganz bestimmt sogar.
»Okay, jetzt leg schon los«, forderte Fern Lauren auf, als sie endlich in die Küche zurückkam und auf einen Stuhl sank. Sie stellte eine Tasse mit süßem Tee vor sie hin. »Fang schon an zu reden.«
Lauren betrachtete ihre Schwester – eine ältere Ausgabe von sich selbst, wie Leute, die sie beide kannten, meinten. Sie waren beide hochgewachsen und blond, mit markanten Gesichtszügen, einer schönen Haut und großen, weit auseinanderstehenden Augen, deren Farbe je nach Stimmung und Laune intensiver oder blasser wurde. Fern, fünfzehn Jahre älter als ihre Schwester, war immer eher eine Mutter als eine Schwester für sie gewesen, da ihre Mutter gestorben war, als Lauren gerade sechzehn war. Fern hatte zum Teil Laurens Collegeausbildung finanziert und sie sogar ermutigt, Schauspielunterricht zu nehmen – wenn es denn unbedingt sein sollte.
Lauren hatte es zwar ernsthaft mit der Schauspielerei versucht, aber bald gemerkt, daß sie weder genügend Talent noch Hingabe für diesen Beruf besaß. Außerdem arbeitete sie viel lieber hinter den Kulissen. Erst als Fern von Manhattan wegzog, um eine Immobilienfirma zu betreiben, fand Lauren, die eben an der City University ihren Abschluß in Kommunikationswissenschaften gemacht hatte, endlich die Stelle, die sie sich immer vorgestellt hatte, und konnte so ihre heißersehnte Unabhängigkeit erringen.
Aber das bedeutete nicht, daß Fern nicht weiter häufig an der Strippe hing, neugierige Fragen stellte, Laurens Leben überwachte und – gewollt oder ungewollt – ihren Rat offerierte. Und es hielt Lauren auch nicht davon ab, eine kurzlebige Ehe in den Sand zu setzen, als deren einzig positives Produkt ein kleines Mädchen namens Chelsea hervorgegangen war. Lauren schlug Ferns Rat zwar meistens in den Wind, sah darin aber auch einen Gradmesser für die Anteilnahme ihrer Schwester an ihrem Leben und hätte deren Ratschläge zweifelsohne auch vermißt, wenn sie sie ihr eines Tages nicht mehr aufgedrängt hätte.
»Tja, laß mich mal überlegen«, erwiderte Lauren jetzt, als wälzte sie tatsächlich in ihrem Kopf alle Ereignisse dieses Nachmittags und Abends hin und her. »Was würdest du denn gerne hören? Okay, wie wäre es damit? Als er Chelsea und mich endlich auf dem Rummelplatz verließ und zu seinem eigenen Wagen zurückging, verschloß er erst alle unsere Türen und wartete so lange, bis wir weggefahren waren. Auf dem halben Weg hierher habe ich dann seinen Wagen im Rückspiegel entdeckt. Er ist uns bis hierher gefolgt, hat drüben auf der Straße geparkt und ist dann wieder gefahren, als Chelsea und ich sicher im Haus waren.« Fern nickte. »Du hast recht, das höre ich gern. Was mich allerdings überrascht, ist, daß es auch dir gefällt.«
Lauren war stolz auf ihre Fähigkeit, seit dem Tag, an dem sie Chelsea aus der Klinik nach Hause gebracht hatte, für sich und ihre Tochter zu sorgen. Gleich am Tag nach der Geburt hatte sie damals eigenmächtig beschlossen, sich selbst vorzeitig aus dem Krankenhaus zu entlassen; da sie ihren unaufmerksamen Ehemann jedoch telefonisch nicht erreichen konnte, nahm sie schließlich ein Taxi. Zu Hause spazierte sie mit Chelsea auf dem Arm ins Schlafzimmer, nur um festzustellen, daß er gerade mit einer anderen Frau zugange war. Der Telefonhörer lag neben dem Apparat.
Mark Brewer gehörte mittlerweile der Vergangenheit an; er hatte sie zwar um eine zweite Chance angefleht, aber in ihrem Herzen waren keine Gefühle mehr für ihn übriggeblieben. Sie reichte die Scheidung ein und nahm ihren Mädchennamen wieder an. Doch das war noch der leichtere Teil, schwieriger war es schon, die Ansprüche eines Kindes, einer Karriere und eines Haushalts unter einen Hut zu bringen – und das alles ganz allein. Um die Wahrheit zu sagen – die ersten beiden Jahre von Chelseas Leben verbrachte Lauren ständig am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Keiner blickte jedoch hinter die Fassade, zumindest keiner außer Fern. »Habe ich eigentlich schon gesagt, daß er mir gefällt?«
»Das mußt du gar nicht, ich sehe es dir auch so an. Wie alt ist er?«
» Einundvierzig.«
»Fast mein Alter. Tja, Lauren, das ist zu alt.«
Sie grinste und schüttelte den Kopf. »Irgendwie wußte ich, daß du das sagen würdest.«
»Woraus ich schließe, daß du nicht die Absicht hast, auf mich zu hören.«
Das Schöne oder auch weniger Schöne an jeder engen, tiefen Beziehung ist doch, daß die gegenteilige Meinung für keinen der Beteiligten ein Geheimnis mehr ist. Wenn Lauren gewollt hätte, hätte sie Ferns Sprüchlein an ihrer Stelle aufsagen können: Er ist klüger, gesetzter, hat mehr Erfahrung ist sich seiner selbst sicherer. Er wird schon alt sein, wenn sie erst so richtig in Schwung kommt; er ist nur ein Ersatz für den Vater, den sie nie hatte, aber immer haben wollte. Nichts davon traf zu ... außerdem hätte es nichts geändert. »Ich habe mir deine Meinung angehört, Schwesterherz«, entgegnete Lauren kühl. »Ich weiß, was du denkst. Doch in diesem Fall stimme ich nicht mit dir überein.«
»Ich sage ja nicht, daß er kein netter Mensch ist –«, setzte Fern an, aber Lauren schnitt ihr das Wort ab. Jonathan war nicht nur nett und nicht nur attraktiv, er hatte darüber hinaus etwas an sich, das ihn unwiderstehlich für sie machte. Natürlich war er ein Individualist, der seinen eigenen Kopf hatte, aber er war auch warm, liebevoll, sanft und aufmerksam ... Nein, ganz und gar nicht wie Mark. Was das betraf, da konnten nicht viele Männer, die sie kennengelernt hatte, Jonathan das Wasser reichen. »Und, willst du mir jetzt endlich verraten, was du über ihn weißt, oder muß ich das allein herausfinden?«
Fern schüttelte den Kopf und fuhr schließlich grummelnd fort: »Wer sagt denn, daß ich überhaupt etwas weiß?«
Lauren streckte die Hand aus versetzte ihrer Schwester einen spielerischen Klaps. »Würdest du jetzt bitte endlich aufhören, mir das Leben schwerzumachen? Du hast doch sofort gewußt, wer er ist, als ich dir seinen Namen nannte, also mußt du doch etwas Klatsch über ihn gehört haben.«
Fern gab schließlich doch nach und fing zu erzählen an. »Also, ich weiß, daß er ein paar hundert Meilen weiter nördlich in Rochester aufgewachsen ist und mit seiner Frau hierherkam, als er seinen Collegeabschluß hatte. Offensichtlich hat er eine Menge Geld geerbt, als seine Eltern starben.«
Das erschien Lauren nur logisch angesichts seiner Lincoln-Continental-Limousine, der teuren Kleidung, die er trug, und natürlich der Einrichtung, in der seine Tochter untergebracht war.
»Und ich stelle mir vor, daß er mit seinem Job auch nicht gerade schlecht verdient. Aber es hat ihm nicht sehr geholfen, sein vieles Geld ...«
Lauren nickte und deutete an, daß sie wußte, was seiner Familie zugestoßen war. »Ja, eine schreckliche Geschichte«, meinte sie.
»Soweit ich weiß, war seine Frau eine nette Person. Ein liebevoller, hübscher, häuslicher Typ«, fügte Fern hinzu. »Die Leute hier in der Gegend fühlen sich normalerweise ziemlich sicher – aber noch Monate nach dem Vorfall waren alle ängstlich, kannten kein anderes Thema mehr, verriegelten alle Türen, ließen ihre Kinder nicht mehr aus den Augen und warnten sie eindringlich vor allen Fremden ...«
»Seine kleine Tochter sah doch mit an, was geschah. Sie ist in einer privaten psychiatrischen Anstalt in Massachusetts untergebracht. Man fährt fast zwei Stunden bis dorthin, aber er besucht sie jede Woche.«
»Trotz der goldenen Löffel im Mund, mit denen er aufgewachsen sein mag, war er meines Wissens immer ein hingebungsvoller Vater und Ehemann – das, was die Leute eben einen grundanständigen Burschen nennen würden.« Fern stieß einen tiefen Seufzer aus. »Wie heißt es gleich noch mal: Das Unglück trifft immer die Tüchtigen ...?«
Lauren war in Gedanken bereits ein Stück weiter; sie war fest entschlossen, Jonathan Glück zu bringen. Als ihre erste Ehe gescheitert war, hatte sie es für unwahrscheinlich gehalten, jemals wieder zu heiraten, aber plötzlich ertappte sie sich dabei, wie sie sich eine Zukunft mit Jonathan ausmalte und sich fragte, wie es wohl wäre, in seinen Armen aufzuwachen.
Aber ganz so einfach verhielt es sich mit der netten kleinen Anekdote, die sie Fern über ihn erzählt hatte, auch wieder nicht. In dem Punkt hatte Fern nur teilweise recht. Gut, er hatte sie bis nach Hause begleitet, und Lauren hatte seine Fürsorglichkeit ihr und Chelsea gegenüber als recht schmeichelhaft empfunden, aber gleichzeitig war sie doch auch ein wenig merkwürdig berührt gewesen. Ganz deutlich waren Jonathan seine Furcht und seine Besorgnis anzumerken, daß jederzeit, wenn er nicht auf der Hut wäre, wieder etwas Ähnliches geschehen könnte, wie es seiner Familie zugestoßen war.
Jonathans übertriebene Fürsorglichkeit sollte sich denn auch als einer der schwierigsten Aspekte ihrer Beziehung erweisen. Lauren hatte mittlerweile eine gute Stellung in der Redaktion der CBS-Morgensendung Home Show, die in Manhattan produziert wurde, aber Jonathan sah es gar nicht gerne, daß sie in einer Stadt mit einer so hohen Verbrechensrate lebte, und drängte sie, ihre Arbeit dort aufzugeben und nach Elmwood Valley zu ziehen – ein Wunsch, der ganz in Ferns Interesse war. Aber sie konnte ihren Job nicht einfach so aufgeben, vor allem schon deswegen nicht, weil Stellen auf diesem Gebiet ziemlich dünn gesät waren.
Und so verlieh Jonathan seiner Besorgnis täglich über das Telefon Ausdruck und deckte sie mit guten Ratschlägen ein: »Nimm nie nach Einbruch der Dunkelheit die U-Bahn, geh nicht in die Nähe von Port Authority, sprich nicht mit Fremden.«
»Du hörst dich ja schon an wie Fern«, zog Lauren ihn dann immer auf und versuchte, seine Befürchtungen mit Humor zu zerstreuen. Aber in Wahrheit waren seine Ängste nicht grundlos – mehr und mehr verkam die Stadt zu einem regelrechten Kriegsgebiet. Wenn Jonathan sie einmal in der Woche besuchen kam, brachte er jedesmal tütenweise Lebensmittel und hübsche Kleider oder Kleinigkeiten für sie und Chelsea mit.
Während sie in der Küche dann ihr Bestes gab, um eine perfekte Mahlzeit auf den Tisch zu bringen, schraubte er Sicherheitsschlösser an alle Türen, überprüfte ihren Rauchmelder und ihre Fenster und heiterte Chelsea mit lustigen kleinen Geschichten auf. Und wenn Chelsea dann endlich im Bett lag, ließ er Laurens Träume wahr werden. Er war ein wunderbarer Liebhaber – zärtlich, leidenschaftlich; er wußte genau, wo und wie er sie zu berühren hatte ... Keiner schien sie je so gekannt zu haben wie Jonathan.
Und jeden Freitagabend um sechs Uhr holte sie Chelsea von ihrer Tagesmutter ab und fuhr, so schnell sie konnte, über das Wochenende ins Haus ihrer Schwester, nur daß sie dort mittlerweile nur noch den kleinsten Teil des Wochenendes verbrachte. Sonntag war dann Besuchstag in der Bateman-Klinik; sie und Chelsea begleiteten Jonathan selbstverständlich auf seiner wöchentlichen Fahrt in den Norden, wo er die beiden normalerweise im Kinderkino zur Filmmatinee, am Spielplatz gleich um die Ecke oder im Museum absetzte, während er Emily besuchte.
Vier Monate später, nachdem er Lauren mit Liebe und Aufmerksamkeit im Überfluß völlig den Kopf verdreht hatte, zückte Jonathan einen dreikarätigen, pfirsichförmigen Diamanten – den schönsten Ring, den Lauren jemals gesehen hatte – und bat sie, ihn auf der Stelle zu heiraten. Mit Tränen in den Augen sagte sie ja. Trotz ihrer anfänglichen Skepsis – Lauren kannte ihn doch erst einige wenige Monate – hatte auch Fern ihn mit der Zeit schätzen und respektieren gelernt und konnte nicht länger leugnen, wie zufrieden sie über die Aussicht war, ihre kleine Schwester bald wieder in ihrer Nähe zu haben.
Jonathan war zwar überall in der kleinen Gemeinde bekannt und wurde von vielen Menschen bewundert, aber sein Leben hatte sich immer ausschließlich um seine Arbeit und seine Familie gedreht, so daß ihm kaum Zeit geblieben war, irgendwelche Freundschaften zu pflegen. Mit einer Ausnahme: Jerry Reardon, ein immer gutgelaunter, großzügiger Bursche, der fünfundsechzig Meilen weiter nördlich eine Firma für Industriebau besaß und leitete. Es war Jerry gewesen, der Jonathan am Anfang seiner Karriere geraten hatte, an verschiedenen wichtigen Ausschreibungen teilzunehmen, und der ihm anschließend den einen oder anderen Auftrag hatte zukommen lassen.
Wie es das Schicksal wollte, sollte Lauren Jerry Reardon nur ein einziges Mal treffen. Jonathan und sie waren Wochenendgäste in seiner eindrucksvollen Junggesellenbude, einer Zwölfzimmervilla außerhalb von Albany. Zu Jonathans großer Freude verstanden sich die beiden auf Anhieb. Aber bereits sechs Wochen später, gerade als Jonathan ihre Hochzeitspläne verkünden und Jerry bitten wollte, sein Trauzeuge zu werden, erhielt er einen Anruf, daß Jerry bei einem Unfall auf der Baustelle tödlich verunglückt sei. Jonathan litt schwer unter dem Verlust seines Freundes. Aus diesem Grund, und auch angesichts der großen Enttäuschung, daß Emily nicht an der Zeremonie würde teilnehmen können, beschlossen sie, Ende November eine weniger aufwendige Trauung bei sich zu Hause abzuhalten, ein knappes Jahr, nachdem sie sich kennengelernt hatten.
Jerrys Tod war eine Tragödie, die Jonathan mit Sicherheit noch die nächsten Jahre nachhängen würde, aber was die Tatsache betraf, daß Emily leider nicht an ihrer Hochzeit teilnehmen konnte, wollten sie sich nicht lange mit negativen Gedanken belasten, sondern lieber hoffen, daß sie bald nach Hause käme. Daran mußten Jonathan und Lauren einfach ganz fest glauben. Aber wenn es um so etwas Zerbrechliches wie das Gefühlsleben eines Kindes ging, dann schienen für jeden Schritt nach vorne erst einmal tausend Hürden überwunden werden zu müssen. Emily hatte zwar endlich die Tatsache akzeptiert, daß ihre Mutter tot war, aber allein die bloße Erwähnung der Möglichkeit, die Sicherheit der psychiatrischen Anstalt zu verlassen und wieder in die Welt hinauszutreten, versetzte sie bereits in hellsten Aufruhr.
Obwohl der Arzt Jonathan endlich grünes Licht gegeben hatte, seiner Tochter von seiner bevorstehenden Eheschließung mit Lauren zu erzählen, verlief das eigentliche Gespräch nicht so reibungslos, wie sie es gerne gehabt hätten: Emily hatte sich mit beiden Händen die Ohren zugehalten und sich abrupt von ihrem Vater abgewandt, nicht bereit, eine neue Familie, geschweige denn eine Stiefmutter oder eine neue Schwester zu akzeptieren.
Erst vier Monate nach der Hochzeit lernten Lauren und Chelsea sie dann endlich kennen – an dem Tag, an dem Emily nach Hause kam.
KAPITEL 2
Lauren hatte die ganze Zeit, seit Jonathan weggefahren war, um Emily abzuholen, in der Küche herumgewerkelt. Sie betrachtete sich zwar immer noch als Hobbyköchin, bemühte sich aber sehr, und Jonathan ermutigte und unterstützte sie in ihren Versuchen. Bevor sie bei ihrer Eheschließung ihre Arbeitsstelle in Manhattan aufgegeben hatte, hatten sie und Jonathan lange darüber diskutiert und waren gemeinsam zu dem Schluß gekommen, daß dies ihr letzter Job sein solle, zumindest für eine Weile. Jonathan, der in der Obhut von Kindermädchen und seinen bereits ziemlich alten Eltern groß geworden war, war der Ansicht, daß Kinder – auch wenn sie schon in der Schule waren – eine Vollzeitmutter bräuchten.
Obwohl Lauren sich immer als eine Frau betrachtet hatte, die beruflich Karriere machen wollte, hatte auch sie, wie jede andere berufstätige Frau, unter den unvermeidlichen Schuldgefühlen gelitten, die damit einhergehen, wenn man das eigene Kind der Obhut anderer anvertraut. Jetzt war Chelsea sieben Jahre alt und ging in die zweite Klasse, und Lauren war Hausfrau und Mutter, und wenn ihr mal die Decke auf den Kopf fiel und sie daran zweifelte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, dann genügte ein Blick auf die glücklichen Gesichter von Chelsea und Jonathan, um alle ihre Unsicherheiten zu verjagen.
Lauren schob die Auflaufform mit der selbstgemachten Lasagne in das unterste Fach im Kühlschrank und holte die Teigböden für die Erdbeertörtchen aus ihren Formen, um sie abkühlen zu lassen. Das war zwar Emilys Lieblingsessen, aber die vielen verschiedenen Gerüche und ihre große Nervosität schlugen Lauren allmählich auf den Magen. Sie warf einen Blick auf die Uhr, ließ in der Küche alles liegen und stehen und lief über die hintere Küchentreppe rasch nach oben, um zu duschen und sich umzuziehen. Jonathan hatte von der Klinik aus angerufen, um ihr zu sagen, daß er gegen halb elf mit Emily losfahren würde, was bedeutete, daß sie jeden Moment zu Hause eintreffen konnten.
Als sie das neue Haus gekauft hatten, hatte Jonathan Lauren mit einem eigenen Bad und Ankleidezimmer überrascht. Es gab darin jede Menge Platz für Regale und Schubläden, so daß andere Schränke und Kommoden überflüssig waren. Aber am schönsten war die riesige, in den Boden eingelassene, runde Badewanne, in der Lauren sich dem Luxus duftender und salbender Bäder hingeben konnte, was sie doppelt zu schätzen wußte, da sie in ihrer Stadtwohnung bisher nur eine Duschkabine gehabt hatte. Jetzt wählte sie einen Rock mit einem passenden Oberteil aus, gemustert, wie Jonathan es mochte, und wünschte sich, ihr Magen würde sich endlich wieder beruhigen.
Sie schlüpfte in ihre Unterwäsche und ging zu der eleganten Frisierkommode, über der in voller Breite ein Spiegel mit Goldrahmen hing. Sie zog sich einen Hocker heran und setzte sich, öffnete ihre Schmuckschatulle und kramte lange nach einem Paar silberner Ohrringe in Blattform, bis sie sie endlich gefunden hatte. Dann nahm sie ihre Antibabypillen, drückte die Tablette für Samstag heraus und schluckte sie. Jonathan hätte sich zwar ungeheuer gefreut, wenn sie schwanger geworden wäre, aber was das betraf, hatte sie sich bisher unnachgiebig gezeigt. Kein Baby, zumindest so lange nicht, solange die Familie in ihrer jetzigen Form keine Einheit bildete – also erst, wenn Emily zu Hause wäre, die Mädchen sich aneinander gewöhnt hätten und Emily sich mit ihrer Stiefmutter soweit arrangiert hätte ...
Mit einem Fön bürstete Lauren ihr dickes, honigblondes Haar nach hinten, bis es ihr weit über den Rücken fiel. Seit ihren Tagen an der High-School war es nicht mehr so lang und glänzend gewesen. Mit unsicherer Hand trug sie schließlich ein wenig Lippenstift und Rouge auf. Ganz ruhig, Lauren, ermahnte sie sich. Das ist kein Vorstellungsgespräch, bei dem es um den Job deinen Lebens geht, du sollst nur ein Kind kennenlernen. Ein elf-, bald zwölfjähriges Mädchen dürfte doch keine so einschüchternde Wirkung auf dich haben.
Sie eilte nach unten und mußte kurz grinsen, als sie das Wohnzimmer und die Eingangsdiele sah: Alles war voller Girlanden aus Kreppapier, Luftballons und Pappendeckelschilder, die feinsäuberlich bemalt und beschriftet waren – WILLKOMMEN ZU HAUSE, EMILY. Auf dem Teppich lagen eine Kinderschere, eine Rolle Klebeband, Papierschnipsel und buntes Kreppapier. Lauren hatte Chelsea zwar die nötige Ausrüstung gekauft, aber Idee und Durchführung waren ganz ihr überlassen geblieben.
»O Liebling, das sieht richtig hübsch aus«, sagte sie.
»Meinst du wirklich?« fragte Chelsea, nicht ganz überzeugt. Sie deutete auf das Schild in der Eingangshalle und verzog das Gesicht zu einer Grimasse der Unzufriedenheit. »Das W ist mir nicht so gut gelungen.«
»Ich möchte wetten, daß ihr das gar nicht auffällt. Wer hat dir übrigens gesagt, wie man Emily schreibt?«
»Im Schrank von Emilys Zimmer habe ich eine Blechschachtel gefunden. Zum Glück für mich war das Schloß kaputt. Auf dem Deckel stand innen dick und fett ihr Name.«
»Chelsea!«
»Ich habe doch nur hineingeschaut.«
»Du hattest in ihrem Zimmer nichts zu suchen, und ganz bestimmt steht es dir nicht zu, deine Nase in ihre persönlichen Dinge zu stecken.«
Chelsea verschränkte die Arme vor der Brust, offensichtlich sehr verstimmt über diese ihrer Meinung nach ungerechten Vorwürfe. »Da war doch nichts anderes drin außer einem Klappmesser, altem Kaugummi, Steinen, einem Säckchen mit Murmeln, Modeschmuck und einer Vogelkralle«, listete sie jeden einzelnen Gegenstand auf, als ob sie es auswendig gelernt hätte. Als sie die Vogelkralle erwähnte, zuckte Lauren betroffen zusammen. »Und außerdem habe ich die Schachtel doch nur aufgemacht, weil ich nachsehen wollte, ob ihr Name –«
»Hör auf, laß es gut sein«, unterbrach Lauren sie, und Chelsea verstummte. »Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist nur, daß du in ihrem Zimmer eigentlich nichts zu suchen hattest. Wenn du das nächste Mal den Drang verspürst, dir etwas anzusehen, das dich nichts angeht, dann frag vorher.«
»Wen denn?«
»Denjenigen, dem es gehört, natürlich.«
»Aber sie war doch nicht da.«
»In so einem Fall mußt du deine Neugierde eben zügeln.« Lauren war nicht gewillt, sich von der Logik einer Siebenjährigen bremsen zu lassen.
Chelsea überlegte einen Moment und startete dann ihren letzten Versuch. »Und was ist mit dir? Dich habe ich aber auch in ihrem Zimmer gesehen.«
Bei ihrem Einzug hatte Lauren die Maler beauftragt, in Emilys Zimmer Wände und Holzverkleidungen mit einem neuen Anstrich zu versehen. Die großen Doppelfenster hatte sie mit apfelgrün und weiß gestreiften Schals ausgestattet, die farblich auf den ebenfalls neuen Bettüberwurf abgestimmt waren. Sie hatte noch kurz überlegt, Poster aufzuhängen und anderen Schnickschnack aufzustellen, dann aber beschlossen, die weitere Ausschmückung des Zimmers doch lieber Emily zu überlassen.
Als Lauren erfahren hatte, daß Emily für immer nach Hause zurückkehren sollte, hatten sie und Beatrice, ihre Zugehfrau, die mehrmals in der Woche kam, sich darangemacht, Emilys Möbel aufzupolieren, ihre Schränke und Schubladen auszumisten und alte Kleider wegzuwerfen oder für die Kleidersammlung in Kartons zu verpacken. Nach fast zwei Jahren im Krankenhaus würden Emily bestimmt keine ihrer alten Sachen mehr passen. Da sie ihre Nase jedoch nicht in Dinge stecken wollte, die sie nichts angingen, hatte Lauren mit Absicht die Schreibtischschubladen ausgelassen und außer den Kleidungsstücken, die sie aus dem alten Haus mitgebracht hatten, nichts angerührt.
»Ich habe aber meine Nase nicht in Dinge gesteckt, die mich nichts angehen«, gab sie auf Chelseas Frage zur Antwort. »Jeder hat ein Recht auf Privatsphäre, mußt du wissen.« Als sie jedoch das betroffene Gesicht ihrer Tochter sah, fügte sie mit versöhnlicherer Stimme hinzu: »Sogar eine große Schwester.«
»Wird sie wirklich meine Schwester sein?«
»Das ist sie bereits.«
»Was ist jetzt mit meiner Adoption?«
Lauren lächelte. Chelsea wurde nie müde, ihr diese Frage zu stellen oder sich die Antwort darauf anzuhören, auch wenn sie ganz genau wußte, daß sich die gesetzliche Prozedur bereits über Gebühr in die Länge zog. Jonathan hatte Chelsea von Anfang an adoptieren wollen, und bis zum vergangenen Monat hatten sie sich deswegen auch bemüht, Mark Brewer ausfindig zu machen, um ihn dazu zu bewegen, auf alle Rechte an seiner Tochter zu verzichten, die er seit ihrer Geburt ohnehin nicht mehr gesehen hatte.
Lauren wünschte sich, sie hätte ihn nie auf der Geburtsurkunde als Vater eintragen lassen, aber so war das nun mal, und es hatte wenig Sinn, sich zu wünschen, es wäre nie geschehen. Jonathan hatte schließlich beim zuständigen Gericht in New York den Antrag gestellt, Chelsea mit der Begründung adoptieren zu dürfen, daß ihr leiblicher Vater sie im Stich gelassen habe. Wenn alles nach Plan lief, wäre dieser Antrag gegen Ende des Sommers dann rechtskräftig. »Es dauert nur noch ein paar Monate«, versicherte sie Chelsea deshalb.
Sie nickte. »Ob Emily mich wohl mag, was meinst du?«
Lauren bückte sich und nahm ihre Tochter in die Arme, küßte sie auf den Hals und kitzelte sie. »Wieso sollte sie ein so lustiges kleines Clownsgesicht wie das deine nicht mögen?« Chelsea brach in prustendes Gelächter aus, und schließlich ließ Lauren sie wieder los, stellte sie auf die Beine und deutete auf den unordentlichen Haufen, der auf dem Teppich lag. »Geh und räume deine Sachen auf. Und beeil dich.«
Chelsea ließ sich auf die Knie fallen und sammelte rasch die Schnipsel ein. »Wenn Daddy heimkommt, dann bekommt er einen ganz lieben, dicken Kuß von mir.«
»So? Wie kommt es, daß er heute so hoch in deiner Gunst steht?«
»Weil ich mir immer eine große Schwester gewünscht habe und er mir heute eine mitbringt.«
Mit beiden Händen voller Sachen rannte Chelsea aus dem Zimmer, wobei ihr rosa Baumwollkleidchen neckisch ihre Beine umschwang. Lauren fiel ein, daß die Post bestimmt schon gekommen war, und schlüpfte in ihren Anorak; Jonathan hatte es gerne, wenn die Post und die Zeitungen bereits auf ihn warteten, wenn er nach Hause kam. Sie hatte eben die Haustür hinter sich geschlossen, als sie den schwarzen Wagen sah, der in der Nähe der hohen Gitter vor dem Eingang hielt; ihr Herz machte einen Satz, als sie kurz dachte, daß das schon Jonathan und Emily wären, aber sie waren es nicht.
Wer immer es war, er fuhr nun langsam weiter, vorbei an dem fast einen Hektar großen, baumbestandenen Grundstück vor ihrem Haus; da hatte sich bestimmt jemand verfahren und war nun auf der Suche nach einer Hausnummer. Sie schaute von der Straße zurück in Richtung Garten und betrachtete die kahlen Äste und den schmutziggrauen Schnee mit den Flecken bloßer Erde dazwischen, die so typisch für Mitte März waren.
Ihr neues Haus stand nur vier Meilen von dem entfernt, in dem Jonathan mit Nancy und Emily in Candlewood Terrace gelebt hatte, und befand sich in einer relativ einsamen Gegend von Elmwood Valley. Bei den meisten Entscheidungen hinsichtlich der Innenausstattung des neuen Heimes hatte Jonathan Lauren freie Hand gelassen, aber auf einigen Dingen hatte er doch bestanden; so hatte er die Riegel an Türen und Fenstern auf den neuesten Stand der Technik bringen und ein Sicherheitssystem installieren lassen, das direkt mit dem örtlichen Polizeirevier verbunden war. Dieses System schloß auch einen vier Meter hohen Maschendrahtzaun mit ein, der mit einem Alarmsystem und einer Videoüberwachung ausgestattet war, so daß sie alle Besucher vorher überprüfen konnten, ehe sie das elektronisch betriebene Tor öffneten und Zugang zum Grundstück gewährten.
Fern nannte das neue Haus an der Mountain View Road – elf geräumige Zimmer, drei offene Kamine und zwei Treppen, die in den oberen Stock führten – nur scherzhaft »die Burg«, und das Eisentor, das sich nur mit der entsprechenden Fernbedienung vom Auto aus oder auf Erlaubnis der Hausbewohner öffnen ließ, »die Zugbrücke« über den Burggraben. Lauren konnte ihr nur zustimmen, war aber mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt, daß Jonathans Seelenfrieden nicht über Nacht wieder zurückkehren würde; auch wenn ihr die Sicherheitsmaßnahmen für ihren Geschmack etwas übertrieben erschienen – wenn sie nötig waren, damit ihr Mann mehr Vertrauen in die Sicherheit seiner Familie hatte, was sollte dann so schrecklich daran sein?
Sie holte die Zeitungen und die Post aus dem eisernen Kasten, der an dem Gitter hing, eilte ins Haus zurück und überflog sie hastig; das meiste davon waren Reklamesendungen und Rechnungen, drei Geschäftsbriefe für Jonathan, darunter auch die vertrauten braunen Umschläge der Anwaltskanzlei Michael Perkins, die Jonathan seit langem vertrat.
Im Wohnzimmer legte sie THE NEW YORK TIMES und THE WALL STREET JOURNAL für Jonathan auf den kleinen Beistelltisch. Die Briefe und die Rechnungen kamen in den Korb mit den Posteingängen auf dem Mahagonischreibtisch in seinem Arbeitszimmer, und die Reklamesendungen blieben für sie übrig. Sie schob sie in die entsprechende Ablage in der Küche und wollte sie bei passender Gelegenheit durchsehen. Schließlich stellte sie sich an das Erkerfenster im Wohnzimmer, um Ausschau nach Jonathan zu halten. Sie holte tief Luft, sie hatte so lange auf diesen Tag gewartet, und jetzt war sie glücklich, aufgeregt und gleichzeitig starr vor Angst. Sie wünschte sich, sie hätte Gelegenheit gehabt, Emily bereits früher einmal zu treffen, das hätte es jetzt für sie beide einfacher gemacht. Aber Jonathan hatte Emily noch so bedrängen können, doch endlich seine neue Familie kennenzulernen, sie hatte ihm diese Bitte immer abgeschlagen, das heißt, bis vor ein paar Tagen, als ihr Arzt anrief, um ihnen zu sagen, daß sie mitten in der Nacht aufgewacht sei und darauf bestanden habe, umgehend nach Hause zu kommen.
Lauren saß immer noch am Fenster, als Jonathans neuer schwarzer Lexus die Einfahrt bis zum Tor hochfuhr, das sich auf ein Infrarotsignal hin öffnete. Sie rannte hinaus in die Halle, um Chelsea zu rufen, die sofort aus ihrem Zimmer und die Treppen heruntergestürzt kam; auf einer der oberen Stufen blieb sie stehen, von wo aus sie den besten und deutlichsten Blick auf ihre neue Schwester hätte, wenn diese gleich durch die Tür treten und von ihrer Dekoration begrüßt werden würde.
Aber es kam nicht so, wie sie es sich erwartet hatte; der einzige, der durch die Tür trat, war ein glücklich lächelnder Jonathan mit zwei Koffern in der Hand, und als Lauren ihn fragend ansah, wo das Mädchen denn nun stecke, deutete er mit dem Kopf hinter das Haus. »Sie wollte sich zuerst auf dem Grundstück umsehen. Wahrscheinlich kommt sie von hinten durch die Küche herein.«
Lauren deutete auf Chelseas Kunstwerke. Jonathans Lächeln verschwand. »Oh, ihr hättet mich warnen sollen.« Dann zwinkerte er Chelsea zu. »Das hast du aber toll gemacht, Engelchen.«
Doch damit war Chelseas Enttäuschung nicht aus der Welt geschafft, und angesichts der Mühe, die sie sich mit ihrer Überraschung gemacht hatte, war das für Lauren nur zu verständlich. »Komm mit«, sagte sie tröstend und griff nach Chelseas Hand, »was hältst du davon, wenn wir Emily suchen?« Und dann gingen alle drei in Richtung Küche.
Doch offensichtlich hatte Emily es nicht so eilig. Sie beobachteten sie von dem Fenster neben dem Küchentisch aus; Emily trug einen roten Anorak und eine rotweiße Mütze, sie war größer und natürlich älter und sah überhaupt nicht so aus wie auf den Fotos. Sie ließ sich Zeit, während sie im Garten herumspazierte und sich gründlich umsah. »Es muß ihr alles so fremd vorkommen ... Da kommt sie nach Hause zu einer neuen Familie, in ein neues Haus«, bemerkte Lauren und stellte fest, daß sie bereits die ersten Entschuldigungen für ihre Stieftochter erfand; sie fragte sich, ob sie das vielleicht nur tat, um ihre eigene Verlegenheit zu überspielen, die sie jetzt empfand, während sie untätig herumstand und darauf wartete, sie endlich kennenzulernen.
Aber gerade als Jonathan die Tür öffnen und sie ins Haus rufen wollte, drehte Emily sich um und stapfte die Stufen zur Veranda hoch, die Hände tief in den Taschen ihres Anoraks vergraben. Sie kam herein, und Jonathan legte den Arm um sie. Übers ganze Gesicht grinsend, verkündete er: »Prinzessin, ich möchte, daß du deine neue Mutter und deine kleine Schwester Chelsea kennenlernst.«
Etwas Falscheres hätte er nicht sagen können – Lauren konnte es der Art entnehmen, wie sich die Augen des Mädchens verengten und deutlich Verwirrung oder Zorn widerspiegelten, vielleicht auch beides.
»Willkommen zu Hause, Liebling!« fügte Lauren hinzu, die jedoch gleich darauf feststellte, daß sie damit Fehler Nummer zwei begangen hatte; ihre wohlgemeinten Worte hatten viel zu vertraulich geklungen. »Wir haben den ganzen Tag auf dich gewartet, wir dachten schon, du würdest gar nicht mehr kommen –«
»Darüber solltest du dich bei ihm beschweren«, erwiderte Emily und deutete auf ihren Vater.
»O nein, das war doch nicht als Beschwerde gemeint. Ich wollte nur sagen, daß wir alle so –«
Aber da hatte Emily bereits das Interesse verloren; brüsk wandte sie sich ab und sah sich im Zimmer um. Und sosehr Lauren sich auch wieder um gute Stimmung bemühte, es kamen immer nur die falschen Worte heraus. Sie ertappte sich dabei, daß sie einen unbeholfenen Satz an den anderen klebte, und fragte sich verzweifelt, warum sie sich nicht besser auf diese Begegnung vorbereitet hatte, während Chelsea, die plötzlich auch ganz verschüchtert war, sich an sie klammerte. Endlich zog Emily ihre Jacke aus und setzte ihre Wollmütze ab, unter der ein Kurzhaarschnitt zum Vorschein kam, der besser zu einem Jungen gepaßt hätte. »Und, wie gefällt dir mein neuer Stil?« fragte sie ihren Vater. »Ich habe ihn mir aus einer Zeitschrift abgeschaut, speziell für Gelegenheiten wie diese geeignet.«
»Es ist ... es ist recht hübsch«, antwortete er gedehnt. Er weiß seinen Schock ziemlich gut zu verbergen, dachte Lauren, aber sie sah ihm seine Enttäuschung deutlich an. Er mochte es, wenn Mädchen ihr Haar lang trugen, und hatte des öfteren mit Emilys wunderbaren Haaren geprahlt. Aber es waren schließlich ihre Haare.
»Was soll ich damit machen?« fragte Emily mit einem Blick auf ihre Jacke und die Mütze; im Gegensatz zu Lauren schien sie nicht die geringste Nervosität zu verspüren.
Als sie sie jetzt etwas genauer betrachtete, konnte Lauren durchaus eine Ähnlichkeit mit den Fotografien entdecken, aber der wichtigste Unterschied zu früher lag in ihren Augen, die – groß und dunkel wie zwei Teiche und denen Jonathans nicht unähnlich – völlig ihren Glanz und ihre Lebendigkeit verloren zu haben schienen. Bildete sie sich die Kälte darin nur ein? Vielleicht lag es einfach daran, daß Emily überhaupt nicht mehr wie ein kleines Mädchen aussah ... wären da nicht das zu enge Trägerkleid aus Cordsamt und die viel zu weite Bluse mit dem Spitzenkragen gewesen, die sie trug. Es mußte dringend eine neue Garderobe für sie angeschafft werden, ganz dringend.
»Also, erzähl doch mal, wie war die Fahrt nach Hause?« forderte Lauren sie auf, nachdem sie Emily zu dem Schrank in der Halle geführt und einen Kleiderbügel herausgeholt hatte.
Emily zuckte nur die Schultern und reichte Jonathan, der die Sachen zufrieden im Schrank verstaute, ihre Jacke und die Mütze. Er hätte nicht glücklicher sein können. Ihre erste Begegnung war zwar katastrophal verlaufen, aber er freute sich offenbar so sehr darüber, seine Familie endlich wieder vereint zu wissen, daß es ihm gar nicht aufgefallen war.
* * *
Jonathan kehrte zum Wagen zurück, um das restliche Gepäck zu holen, und Emily folgte Lauren und Chelsea nach oben in ihr Zimmer. Emily konnte zwar nicht umhin, die Dekorationen zu bemerken, als sie das Wohnzimmer und die Halle durchquerten, zog es aber vor, kein Wort darüber zu verlieren. Als sie zu ihrem Zimmer kamen, reagierte sie mit Gleichgültigkeit. Drinnen ließ sie sich auf den neuen Bettüberwurf fallen und bat darum, allein gelassen zu werden. Chelsea machte einen zerknirschten Eindruck, und als sie wieder unten waren, setzte sich Lauren zu ihr. »Ich weiß, daß du enttäuscht bist, Liebling. Ich auch. Aber ich glaube, wir sollten etwas Verständnis dafür aufbringen, was Emily im Moment durchmacht.«
»Was ist Verständnis?«
»Mitgefühl. Und Freundlichkeit. Vergiß nicht, sie war lange weg. Das letzte, was sie noch weiß, ist, daß ihre Mutter glücklich und am Leben war, gleich hier in der Nähe wohnte und mit ihrem Daddy verheiratet war.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Wieso nicht?«
»Weil ihr Daddy mein Daddy und mit dir verheiratet ist. Nicht mit ihrer toten Mutter.«
Lauren seufzte, was hatte sie erwartet? Sie konnte es ja selbst kaum begreifen. Sie waren zwar erst seit vier Monaten verheiratet, aber die Zeit kam ihr bereits wie eine Ewigkeit vor; mehr als einmal fragte sie sich, wie sie ohne Jonathan jemals hatte glücklich sein können.
Zugegeben, manchmal übertrieb ihr lieber Ehemann es mit seiner Fürsorge, aber für Jonathan stand die Familie nun mal an erster Stelle. Er war keiner jener Männer, die tranken oder spielten und sich bis spät in die Nacht mit Freunden herumtrieben. Jeden Abend war er gegen halb sechs, wenn nicht schon eher, zu Hause, oft mit einer Überraschung für »seine Mädchen«. Er war schon fast zu aufmerksam und großzügig; es gab nichts, das er nicht getan hätte, um Lauren und ihre Tochter glücklich zu machen. »Wenn du etwas haben willst, Lauren, irgend etwas, dann brauchst du mich nur darum zu bitten«, sagte er immer. Er war ein Ausnahmemann, und Lauren konnte den Gedanken kaum ertragen, daß er jemals einer anderen gehört haben sollte.
Aber wenn sie die Mauer einreißen wollte, die Emily um sich errichtet hatte, dann mußte sie sich etwas einfallen lassen. Im Augenblick stellte sie sich die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, in Candlewood Terrace Nummer fünfunddreißig wohnen zu bleiben; nachdem das Haus monatelang ohne einen ernsthaften Interessenten auf dem Markt gewesen war, hatte Jonathan es nur widerstrebend Fern zur Vermietung überlassen. Hätte die vertraute Umgebung Emily die Eingewöhnung leichter gemacht, oder hätten die Erinnerungen nur einen Rückfall bei ihr hervorgerufen?
Chelsea machte sich daran, ihre verschmähten Kunstwerke wieder von der Wand zu nehmen, während Lauren in die Küche ging, um aufzuräumen. Nachdem Jonathan den großen Schrankkoffer in Emilys Zimmer gebracht hatte, machte er sich auf die Suche nach Lauren. Als sie ihm eine Tasse Tee eingoß, konnte sie es nicht mehr länger für sich behalten. »Sind dir ihre Augen aufgefallen?«
»Wie meinst du das?«
Sie wollte nicht sagen, daß sie ihr kalt erschienen waren. Deswegen suchte sie nach einem anderen Wort. »Sie waren so zornig«, erklärte sie. »Und das kann sie doch logischerweise nur auf mich sein.«
»Jetzt komm aber, Lauren. Ich weiß, das ist nicht einfach für dich, aber ich dachte nicht, daß du so empfindlich sein würdest. Du weißt doch, was das Mädchen im letzten Jahr alles durchgemacht hat ... Ich zweifle auch nicht daran, daß sie noch viel Zorn mit sich herumträgt, aber damit haben wir doch gerechnet, oder nicht?«
»Ja, natürlich, und ich will sie auch nicht kritisieren. Ich will sie doch nur verstehen, damit ich ihr helfen kann.«
»Du kannst ihr helfen, indem du sie bedingungslos akzeptierst, aber nicht, indem du versuchst, jeden ihrer Schritte zu analysieren.«
»Tut mir leid, du hast wahrscheinlich recht«, erwiderte sie. Und es tat ihr wirklich leid, sie hatte nicht kritisieren wollen; aber der Zorn, die Kälte, oder was immer das war in Emilys Augen, machten ihr angst, und sie hätte es so gerne verstanden. Aber eigentlich verstand sie nur zu gut, und das war Teil des Problems. In Emilys Augen war Lauren die andere Frau, weshalb sollte sie da nicht wütend auf sie sein? Sie versprach, sich zu bessern, und sagte: »Ach, übrigens, gab es noch irgendwelche abschließenden Anweisungen von ihrem Arzt?«
Jonathan schien erleichtert. Er haßte jeden Streit und zog sich immer sofort zurück, wenn es ihm zu viel wurde. Jetzt ergriff er Laurens Hand und küßte sie sanft. »Der Doktor meinte, daß Emilys Wunsch, nach Hause zu kommen, als großer Fortschritt zu betrachten sei. Diese Entscheidung getroffen zu haben sollte ihr das Gefühl geben, wieder etwas Kontrolle über ihr Leben zu haben. Selbstverständlich muß ihre Therapie fortgesetzt werden.« Er schob eine Hand in seine hintere Hosentasche, holte seine Brieftasche heraus, entnahm ihr einen Zettel und gab ihn ihr. »Das sind die Namen einiger Therapeuten hier in der Gegend. Dr. Strickler wird sich sicher mit ihm oder ihr – ganz gleich, für wen wir uns entscheiden – in Verbindung setzen wollen.«
Sie faltete den Zettel auseinander und las die Liste mit den Ärzten in der Annahme, daß Jonathan wollte, daß sie sich darum kümmerte.
Obwohl Lauren bisher nur Mitglied im Eltern-Lehrer-Verband und in einer sich monatlich in der Bibliothek treffenden Büchergruppe war, warnte Jonathan sie immer wieder mal im Scherz, sich nicht gleich für ein Dutzend Komitees verpflichten zu lassen, um sich dann hinterher zu wundern, wieviel Arbeit sie plötzlich am Hals hatte. Aber Lauren war zum Glück nicht der Typ dafür. Sie fuhr Chelsea einmal in der Woche zum Wichteltreffen ihrer Pfadfindergruppe und zur Gymnastik und natürlich auch zu den obligatorischen Geburtstagspartys, wo die Mütter meistens im Hintergrund zusammensaßen und die Fortschritte ihrer Sprößlinge diskutierten. Alles positive, gesunde Aktivitäten, um den Tag auszufüllen. Aber nichts, das sie auf die Konfrontation mit Emily vorbereitet hätte, und plötzlich kam sie sich schrecklich unzulänglich vor.
»Tu mir doch einen Gefallen, Liebling, und schau dir die Ärzte an. Überprüf ihre Referenzen und laß mich dann wissen, was du von ihnen hältst. Du solltest dir vor allem diese Dr. Greenly in Middletown ansehen. Strickler kennt sie persönlich und schätzt ihre fachliche Kompetenz sehr.« »Aber natürlich erledige ich das«, sagte sie eifrig, faltete die Liste wieder zusammen und schob sie in die Ablage unter dem Telefon. »Ich wünschte nur, es gäbe noch mehr, das ich tun könnte.«
Er legte ihr die Hand unters Kinn und liebkoste ihr Gesicht und ihren Hals mit seinen Fingern. »Aber du tust doch schon so viel, mein Liebling, siehst du das denn nicht? Du bist für sie da, du bist bereit, ihr ein gutes Heim zu schaffen. Natürlich bin ich weder taub noch blind, und dumm bin ich auch nicht. Natürlich sehe ich, daß sie so tut, als wäre ihr das alles nicht wichtig, aber das ist nur aufgesetzt. Das zeigt mir nur, daß sie Angst hat. Sobald sie dich näher kennenlernt, wird sie sich in dich verlieben, wie es mir passiert ist. Vertrau mir, es wird alles gut werden; du mußt ihr nur etwas Zeit geben. Sicher, eine Sache ist da noch ...«
»Was denn, Liebling?«
»Mit diesem Haarschnitt sieht sie aus, als ob sie mit dem Kopf in eine Kreissäge geraten wäre. Er ist einfach schrecklich.«