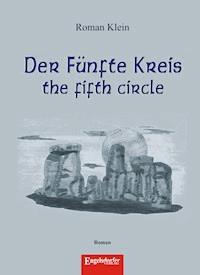
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Gleichgewicht im Universum ist aus den Fugen geraten. Einer geheimnisvollen parallelen Welt, die irgendwo im unendlichen Universum liegt, droht der Untergang. Eine dämonische, finstere Macht versucht diese fremde Welt an sich zu reißen. Angst und Schrecken verbreiten sich in Nordland. In Nordland leben sanftmütige Geschöpfe inmitten einer grandiosen, friedlichen Landschaft. Ihr Tun und Handeln steckt voller Magie und Zauberei. Sie lieben die einfachen Dinge und haben Spaß am Leben, das mehrere hundert Jahre andauern kann. Doch der Dämon strebt nach der vollkommenen Macht des Kosmos und bringt allen den Tod. Nur die Macht der Fünf Kreise ist imstande, das Gleichgewicht wieder herzustellen und den Dämon dorthin zu verbannen, wo die Zeit ihren Anfang nahm. Annika, Peter, Hardy und der Ich-Erzähler gelangen durch einen Zauber in die Welt Nordlands. Sie sind die einzige Hoffnung für das bedrohte Land, denn die Geister der Kreise können nur in Menschen fortbestehen und so die gefährliche Reise zu den Kreisen überleben. Das Leben der vier Freunde und ihrer Begleiter befindet sich von nun an in tödlicher Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1: Das Eintreffen
Kapitel 2: Der große Rat
Kapitel 3: Ein Juwel im schattigen Gebirge
Kapitel 4: In Frau Eilas Haus
Kapitel 5: Eine Verschwörung
Kapitel 6: Ein Wiedersehen am See
Kapitel 7: Im ewigen Eis
Kapitel 8: Zeit des Erwachens
Kapitel 9: Im Eliashain
Kapitel 10: Ein Wolf im Schafspelz
Kapitel 11: Ach, du schönes Thrivaldi
Kapitel 12: Eine wilde Horde zieht westwärts
Kapitel 13: Das Tor zur Finsternis
Kapitel 14: Der letzte Gang
Roman Klein
Der Fünfte Kreis - the fifth circle
Roman
Impressum eBook:
eISBN: 978-3-86703-831-7
Copyright (2008) Engelsdorfer Verlag
Impressum Printausgabe:
Bibliografische Information durch
Die Deutsche Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Korrektorat: Dr. Mechthilde Vahsen
Copyright (2006) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Kapitel 1 Das Eintreffen
Weißer, dicker Rauch quoll aus einem engen, schwarzen Schornstein durch das feuchte Nadelgeäst in den verhangenen Himmel. Beständig tröpfelte der Regen auf das Dach der Blockhütte, in der wir uns notgedrungen einquartieren mussten, denn unermessliche Regenmassen ließen in den letzten Tagen und Nächten den Waldboden aufweichen und verwandelten die Trampelpfade in schlammige, schmierige Rutschbahnen. Die Pegel der nahen Flüsse stiegen um einige Höhen an. In einem fort sorgten dunkelgraue Wolken aus Westen für ergiebigen Nachschub. Für sommerliche Verhältnisse, es war Ende Juli, war es fühlbar kalt. Wechselbäder aus Regen, Sonne, Wind und Wolken, zwischendurch die störenden Temperaturschwankungen, waren seither typisch für den Norden Skandinaviens.
Während die Welt draußen zu versinken schien, brannte im offenen Kamin, ein wärmendes, wohl tuendes Feuer. Über den lodernden Flammen hing an einer Eisenstange, ein übergroßer eiserner Kochtopf, der im Laufe der Jahre eine schwarze Rußkruste abbekommen hatte. Vom breiten Kaminsims aus wurde der Abzug, der aus naturbelassenen Steinen gemauert war, nach oben hin immer schmaler, bis er letztlich durch das Dach nach draußen stieß. Die milchigen Fugen zwischen den Steinen folgten einem ungleichen Muster und es bedurfte schon reichlicher Fantasie, daraus etwas erkennen zu können. Und doch glotzten mehrere Gesichter hervor, mal mit langer und mal mit kurzer Nase, wenn man mit geübten Augen das Gesamtbild betrachtete. Zwei große Holzpritschen, längs im Raum stehend, dienten als Schlafstelle, die nicht gerade gemütlich, aber dienlich war. Dazwischen ragte ein kleiner, runder Tisch, aus massivem, heimischem Fichtenholz gezimmert und mehrere einzelne Holzstämme dienten lässig als Stühle. Auf den Schlafpritschen legten wir unsere Isolationsmatten aus, sie sorgten für eine weiche Unterlage. Die Schlafsäcke kamen obendrauf.
Wenigstens war es in der Hütte trocken und warm. Die Haut eines Zeltes hätte bestimmt bei dieser Witterung kapituliert, früher oder später wäre das Regenwasser, erst in Tropfen, dann in Strömen eingedrungen; so kam uns diese etwas urige Hütte gerade recht. Sie stand unmittelbar am Ufer des Lemmenjokis, dem Fluss, der alsbald unser aller Schicksal besiegelte. Er führte uns in eine Welt, von der wir nicht einmal zu träumen wagten.
Vom Hüttenvorbau führte ein Bootssteg direkt auf den offenen Fluss hinaus. Am Ende des Steges konnten wir im glasklaren Wasser Fischebeobachten und bekamen zudem eine erweiterte Übersicht über den wildverzweigten Flusslauf.
Peter Petrell, der von uns liebevoll Peti genannt wurde, stand gerade dort und starrte auf das vom Regen stark gekräuselte Wasser. Als er so dastand, fiel mir auf, dass er gar nicht so dick war, wie wir meinten, oder er hatte in den letzten Wochen stark abgenommen. Jedenfalls war er groß und die Größe und sein stämmiges Auftreten machten ihn beinahe perfekt. Und er war, wenn er wollte, eine richtige Kämpfernatur.
Peti war vor etlichen Jahren mit seinen Eltern in unser Dorf gezogen. Herr Petrell arbeitete als Ingenieur in der Elektroindustrie, während Frau Petrell Hosen, Pullover und Anzüge für Kinder nähte, deren Maße nicht ganz der gewünschten Norm entsprachen, also mehr für Petis Kaliber. Anfangs mochten wir den Fremden überhaupt nicht, denn egal, wo er auftauchte, es gab immer Zank und Streit, ab und an flogen auch schon mal gewaltig die Fetzen. Dieser Neunmalkluge wusste es immer besser als alle anderen, aber nur mit seiner großen Klappe. War er doch zehn und wir schon beinahe elf.
Es passierte vor genau sieben Jahren an einem heißen Sommertag. Früh am Morgen machten wir uns eifrig für eine längere Radwanderung startklar, als Peti mit seinem Bike ankam und uns bat, mitfahren zu dürfen. Ich und meine besten Freunde, Hardy und Annika diskutierten darüber und ließen ihn widerwillig mitfahren. Insgeheim aber ahnte ich, dass Peti auf halber Strecke die Luft ausgehen würde, immerhin lagen einige Berge vor uns, die es in sich hatten, so dachte ich damals. Jedenfalls hatten wir schon an den Bergen zu knabbern, wo wir doch erfahrene Mountainbiker und geübt waren. Außerdem kam uns der Heimvorteil gelegen, denn wir kannten jeden Stein und jeden Fels, jeden Baum und Strauch, wir waren im Grunde per Du mit ihnen und wussten über die Unwegsamkeiten Bescheid. Spätestens am Teufelssprung würde er sich vor Angst in die Hose machen und umkehren.
Anfangs hielt Peti tapfer durch und zeigte keinerlei Art von Schwäche, doch frühzeitig, bereits am zweiten Berg verlor er den Anschluss an uns; er fiel zurück. Wie eine jahrhundertealte Dampflok, die ihre besseren Tage längst gesehen hatte, rang er nach Luft und plagte sich den Hügel hinauf, schnaufend, schon beinahe quälend. Sein Fahrrad wankte dabei heftig hin und her, wütend über uns, gar über sich selbst, trat er mit der Kraft, die ihm noch zur Verfügung stand, in die Pedale und erklomm schwerfällig im Zickzackkurs den Berg. Wir waren bereits oben angekommen und sahen dem Trauerspiel, das er uns darbot, spöttisch zu. Annika bekräftigte, siehabe es vorausgesehen, dass er auf halber Strecke schlapp machen würde, er sei halt der geborene Verlierer. Schweißgebadet erreichte Peti nach einer Weile endlich die ersehnte Kuppe. Es kam mir vor, als habe er unterwegs geweint oder es waren bloß die Schweißperlen auf seinem knallroten Gesicht, in denen der Schein der Mittagssonne reflektierte und seinen Augen einen ungewöhnlichen Glanz verlieh. Es wurde immer heller, über uns war Himmel, blau und klar. Das Thermometer stieg. Auch den dritten und den vierten Hügel meisterte Peti mehr schlecht als recht. Nach rasanten Abfahrten qualvollen Anstiegen standen wir nachmittags dann am gefürchteten Teufelssprung. Der Name Teufelssprung ging in die Frühzeit zurück. Der Legende nach stieg des Nachts der Leibhaftige aus dieser Schlucht empor, mit Schwefeldampf und Fegefeuer. Kleinkinder, die er in den umliegenden Dörfern entführte, verschwanden danach für immer in dieser Felsspalte. Die Kluft sei der geheime Eingang zur Unterwelt, erzählte man sich, und wer dort hineinkletterte, kam nie wieder heraus.
Von der einen auf die andere Seite maß die Schlucht fast drei Meter, zehn bis fünfzehn Meter ging es senkrecht in die Tiefe, wobei die Spalte nach unten hin schmaler wurde und in einer kleinen, dunklen Ritze endete. Wer hier rüber wollte, musste mit dem Fahrrad weit springen können und zudem einen Affenzahn draufhaben. Schaffte jemand den Sprung nicht, kam der Teufel und holte ihn in der Nacht. Bisher hatte es jeder, der seinen Schweinehund überwinden konnte, geschafft, da die gegenüberliegende Seite über gut einen Meter tiefer lag, so ähnlich wie der Absprung von einem Schanzentisch beim Skispringen, nur dass es hier Fahrräder waren und keine Skier. Auf den ersten Blick erkannte man den hilfreichen Unterschied jedoch nicht. Dies ließen wir Peti aber nicht wissen, stattdessen flößte ihm Hardy, der ihn von Anfang an Dicker nannte, Angst ein, indem er immer wieder unterstrich, dass das A und O des Sprungs das Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit sei. Fuhr man zu langsam, so wäre das der Sturz in die Hölle, fuhr man zu schnell, konnte es passieren, dass man vor der Schlucht stürzte und sich sämtliche Knochen brach. Ich wusste, dass dieses Getue und Gehabe völliger Blödsinn war, hielt mich dennoch bedeckt. Alle Blicke waren auf Peti gerichtet, dessen scharfe Augenspiele dem steilen kurzen Pfad galten, der über die Felsspalte führte, auf nichts anderes wollte er sich konzentrieren. Eiskalt übersahen wir seine innere Anspannung, die an seinen Nerven zerrte und ihn mürbe machte, der blasse Schein in seinem Gesicht sprach Bände.
Heute weiß ich, was ich an jenem Tag für Peti empfand, es war pures Mitleid gepaart mit der Angst, nach Hause zu kommen und den Elternzerknirscht berichten zu müssen, dass ihr Sohn in die Hölle gefahren sei. So bat ich ihn, die Sache nochmals zu überdenken, es wäre bestimmt keine Schande, kurz vor dem Ziel einen Rückzieher zu machen und auch Feiglinge hätten in unserer Welt ihren angestammten Platz. Doch Peti war felsenfest entschlossen, er schüttelte den Kopf. Vorsichtshalber erlaubte er uns den Vortritt, um ganz sicher zu gehen, dass wir nur ja keine Worte schlugen, sondern auch wirklich sprangen.
So oft hatten wir die Felsspalte bezwungen und jedes Mal schoss erneut das Adrenalin in unsere Köpfe und ließ die Körper kribbeln. Auf der gegenüberliegenden Seite heil angekommen, fühlten wir uns wie kleine Helden oder mehr noch, wie halbwüchsige Gottheiten!
Hardy, Annika und ich rasten also nacheinander den schmalen, steinigen Waldpfad hinunter und hüpften mit unseren Mountainbikes über die Teufelsschlucht hinweg. Auf der anderen Seite gingen wir abrupt in die Eisen und stellten die Räder quer. Jetzt war Peti an der Reihe. Gemeinsam feuerten wir ihn an und versuchten, den letzten Zweifel aus ihm herauszuschreien. Mit immenser Kraft stieß er sich vom Boden ab. Um rasant beschleunigen zu können, legte er den großen Gang ein. Als er über die Kante wie ein geölter Blitz hinwegfegte, hallte zugleich ein lauter Schrei durch den dichten Laubwald; er – Peter Petrell, der Neuling aus unserem Dorf, hatte sich tatsächlich überwinden können und den Todessprung mit viel Schneid gemeistert! Ohne nur einen Moment lang zu zögern.
Von nun an wurden wir die besten Freunde; Hardy nannte ihn seither nicht mehr Dicker und Annika fand ihn, wie sie später einmal erwähnte, richtig süß.
Ganze drei Tage waren wir flussaufwärts einem schmalen Pfad, der sich am Flussufer entlang schlängelte, gefolgt. Das bedeutete drei Tage Regen. Eigentlich wollten wir bis zur Quelle wandern, um mit einem dort geliehenen Kanu zurück zum Ausgangspunkt zu treiben. Die Wasser des Lemmenjokis waren teils ruhig, teils mürrisch, sie mündeten auf ihrer langen Reise irgendwann in den Inari, den heiligen See der Samen. Es sind die Urskandinavier schlechthin, die man spöttisch auch Lappen nennt.
Wir durchwanderten also oberhalb des Polarkreises die Wildnis Lapplands, genauer gesagt, befanden wir uns in Nordfinnland. Lange, zu lange hatten wir auf dieses Naturabenteuer hingespart, jeden Groschen gesammelt, und wenn wir ihn trotzdem ausgeben mussten, drehten wir ihn nicht nur zweimal, sondern dreimal um. Die meiste Kohle ging für die Ausrüstung drauf wie Wanderschuhe, Ruck- und Schlafsäcke, wasserdichte Kleidung,Igluzelte, Kocher, Wanderstöcke sowie allerlei Kleinkram, der das Leben in der Wildnis etwas erträglicher machte. Doch all das moderne Wanderzeug schützte uns nicht davor, dass wir geradewegs in ein Abenteuer hineintrieben, von dem man annehmen musste, dass so etwas nur in Märchen oder Sagen eine Bedeutung hatte. Niemals – nicht einmal ansatzweise dachten wir daran, eines Tages unser Leben in tödliche Gefahr zu bringen, um es am seidenen Faden hängen zu lassen. Von diesen Dingen, die uns hier draußen bald einholten, ahnten wir noch nichts. Allerdings, etwas Merkwürdiges gab es da schon: Als wir in den Zug, der uns nach Norden brachte, einstiegen, äußerte sich Hardy überraschend mit den Worten: „Diese Reise, meine Freunde, werden wir in unserem ganzen Leben nie mehr vergessen.“
Wie Recht er hatte! Dass wir vier einmal eine tragende Rolle zum Schutz des Universums einnehmen würden, überstieg sowieso unsere kühnsten Vorstellungen. Heute sind wir schlauer.
Hardy hatte womöglich eine Vorahnung von den Eskapaden, in die wir uns geradewegs hineinmanövrierten, er fühlte sie – die Gefahr.
„Guten Morgen, Peti, ist das vielleicht ein Sauwetter?“, rief ich auf den Steg hinaus, es regnete wahrhaftig Bindfäden.
„Das kann man laut sagen“, antwortete Peter. Er hatte eine Teekanne mit, um Wasser aus dem Fluss zu schöpfen. „So langsam fürchte ich, dass mehr Wasser von oben kommt, als je im Fluss fließen kann“, schimpfte er und drückte die Kanne unter Wasser. „Hör mal, Tobias, wenn das so weitergeht, müssen wir bald auf die Bäume klettern, um nicht zu ertrinken!“
Ich grinste verhalten. Im gleichen Augenblick rannte ein nackter, dunkler Körper mit lautem Tamtam an mir vorbei auf Peti zu und platschte kurz vor ihm mit einer eleganten Arschbombe punktgenau ins eiskalte Wasser. Was der Regen bisweilen nicht geschafft hatte, bewerkstelligte nun die Wasserfontäne, die sich über Peti ergoss.
„Hardy!“, schrie Peti auf. „Du Idiot!“ Er tobte und huschte mit einem Satz zurück. Jetzt war er nass – bis auf die Haut.
„Ich weiß gar nicht, was du hast, dieses Wetter lädt doch geradezu ein zum Baden“, erwiderte Hardy. Schadenfroh grinste er über beide Ohren, dabei zeigte er seine strahlend weißen Zähne. Er machte mit einem Heidenspaß ein paar heftige Schwimmzüge, sogar Unterwasserrollen ließ er nicht aus.
Unmittelbar stürmte Annika mit knallrotem Kopf und mit einem Entsetzen in den Augen aus der Hütte. „Habt ihr das gesehen? Dieserblöde Kerl zog sich ohne jede Scham einfach vor mir aus. Habt ihr ihn gesehen?“ wiederholte sie und warf einen mürrischen Blick auf den planschenden Spaßvogel, der sein Bad offensichtlich genoss.
Der pitschnasse Peti einerseits und das verstörte Gesicht Annikas andererseits lockerten etwas unsere miese Laune. Fassungslos standen Beide aufgebracht da. Ich fand die Situation ganz amüsant und lustig, und kurz darauf lachte ich lauthals los. Es dauerte auch nicht lange, dann kehrte die gute Stimmung wie zu Beginn unserer Reise, zwar zögerlich, aber mit neuem Schwung zurück.
Hardy Urban, er hatte viel von seinem Vater Ballentimes, der übrigens bei der US-Armee diente und seinen Dienst auf einer amerikanischen Airbase in Deutschland leistete. Seine Mutter war die Großkusine meiner Mutter, demgemäß war Hardy über wenige Ecken mit mir verwandt. Nach dem Dienst in der Armee fing Ballentimes als Maschinenbauer in der Firma meines Onkels an. Herr Urban, ein Spaßmacher mit Bomben und Granaten und immerzu fröhlich, pfiff und sang den lieben langen Tag, allzeit für jeden Unsinn zu haben, bis – ja, bis eines Tages die Welt für ihn buchstäblich unterging; und nicht nur für ihn! Der tödliche Autounfall seiner Frau schockte uns alle in der Familie, das Pfeifen und das Singen verstummten urplötzlich und kamen nie wieder zurück. Hardy war damals zwölf. Wir saßen an jenem tragischen Nachmittag bei uns zu Hause in der Küche, Hardys Vater saß teilnahmslos am Küchentisch. Immer wieder sagte er das amerikanische Wort Why? Dieses WHY wiederholte er unzählige Male mit schüttelndem Kopf, den er auf dem Tisch abstützte. Tränen standen in seinen blassen Augen, aber richtig losgeheult hatte er nicht. Meine Mutter tröstete ihn, indem sie ihren Arm über seine Schulter legte und seine kurzen lockigen Haare streichelte. Mein Vater und unzählige Verwandte, gar das halbe Dorf waren an jenem Tag auf den Beinen. Fassungslos standen sie da und rätselten und philosophierten über das Unglück. Auf meine Frage hin, was das für Hardy wie auch für seinen Vater gegenwärtig bedeutete, bekam ich keine Antwort, stattdessen schickte meine Mutter Hardy und mich zum Spielen rauf auf mein Zimmer. Er schlief bei mir in dieser Nacht und die ganze Woche und wir hatten schulfrei. Die Erwachsenen waren damit beschäftigt, die Beerdigung zu organisieren. Es war meine erste Bestattung, die ich ganz bewusst miterlebte, und ich wünschte mir, solch eine Erfahrung nie wieder machen zu müssen!
Radfahren, Joggen, Bodybuilding, so sah Hardys Welt noch Jahre später aus. Sein Leben bestand größtenteils aus sportlichen Aktivitäten. Heutegehe ich davon aus, dass er nur seine unguten Gefühle, die Trauer um seine Mutter verdrängte, denn über ihren Tod hatte er nie gesprochen – jedenfalls nicht mit mir. Die Jahre vergingen wie im Flug, mehr und mehr wurde er wie sein Vater. Wenn er sang, klang es jedoch, als würde ein streunender Hund der Samstagssirene hinterherheulen. Er verfehlte die korrekten Tonlagen um Meilen. Doch mit jedem Singsang, den er von sich gab, wuchs er beinahe über sich hinaus und trällerte selbstbewusst, ohne Rücksicht auf Verluste, drauflos. Hardy Urban, ein junger Mann wie ein Kleiderschrank und das in den besten Jahren. Er hatte stets das Herz am richtigen Fleck. Schon von Kindesbeinen an besaß er die schwarzbraune Hautfarbe seines Vaters, die später auf die Mädels in unserer Schule anziehend wirkte; wie der Waschbrettbauch und die ausgeprägten Muskeln, die dunkle Haut verlieh ihnen noch mehr Ausdruck. Auf einem Foto, das sein Vater auf einer seiner Geburtstagspartys von uns beiden geschossen hatte, standen buchstäblich Käse neben Schokolade, Hering neben Haifisch! Und ich war stolz, einen solchen Freund zu haben. Gemeinsam gingen wir oft durch dick und dünn!
Am späten Nachmittag, die Sonne machte sich über den gequellten Wolken auf den Rückzug, beratschlagten wir den weiteren Verlauf unserer Wandertour. Das verblasste Tageslicht tauchte die Landschaft in Trostlosigkeit.
Annika wollte, falls keine Wetterbesserung einträfe, umkehren. Ihr Spaßfaktor läge gleichsam bei null. Zugegeben, meine Urlaubsstimmung sank von Regentag zu Regentag auch immer tiefer in den Keller. Anfangs beherrschte eine rege, eher sachliche Diskussion die Szenerie im Blockhaus, bis sich die Gemüter wegen Kleinigkeiten so erhitzten, dass eine heftige Auseinandersetzung zu entfachen drohte. Rasch beschuldigte jeder jeden, ein Wort ergab das andere, bis Peti sich anmaßte, Hardy mit der geballten Faust zu drohen. Jetzt war Maßarbeit gefragt.
„Kinder“, unterbrach ich im letzten Moment das Gezanke. „Es bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, dadurch kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner. Ich bin der Meinung, wir sollten eine demokratische Lösung finden und darüber abstimmen oder mindestens einen Kompromiss schließen, der vielleicht so aussehen könnte: Wir wandern noch einen Tag weiter flussaufwärts, bis uns die Möglichkeit geboten wird, ein Boot zu mieten. Regnet es dann immer noch in Strömen, nehmen wir das Angebot an und kehren auf dem Wasser um. Lässt der Regen unerwartet nach, setzen wir unsere Tour wie geplant bis zur Quellefort!“ Nebenbei kramte ich die Karte aus meinem Rucksack und breitete sie auf dem Tisch aus. „Laut dieser Karte kommen wir nach etwa drei Stunden Fußmarsch an einer anderen Hütte mit Bootsverleih vorbei. Wenn wir Glück haben, liegt mindestens eines am Ufer.“
„Was machen wir, wenn dort keine Boote zu finden sind und das Sauwetter weiter anhält?“, fragte Annika.
„Übrigens, mit einem Boot wären wir viel schneller wieder am Ausgangspunkt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort kein Boot am Ufer oder am Steg angebunden ist, Annika.“
Es war dumm von mir zu glauben, dort Boote anzunehmen, aber was sollte ich in einer solchen Situation tun? Die Karte war schon etwas älter und ein schwarz gedrucktes Boot auf dem Papier war noch lange kein Garant für einen öffentlichen Bootsverleih. Vielmehr benutzte man die Boote, um von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Dabei musste man darauf achten, dass auf einer Uferseite immer mindestens ein Boot lag, um anderen ebenfalls die Möglichkeit zu geben, den Fluss überqueren zu können. Nahm man das letzte Boot, dann musste man zum anderen Ufer paddeln, dort ein weiteres ins Schlepptau nehmen und umkehren, es auf der anderen Seite wieder anbinden und dann erst zurückschippern. Erst jetzt durfte man seine Reise fortsetzen. Sicherlich gab es welche, die sich nicht darum scherten und das Jedermannsrecht einfach ignorierten. Dann konnte es passieren, dass man nicht weiter konnte, ehe jemand von der anderen Seite kam.
„Bist du dir da ganz sicher?“ Jetzt sah mich Annika mit ihren schwarzen Kohleaugen argwöhnisch an, beugte sich über die Karte und tippte mit dem Zeigefinger auf die Stelle, wo die Hütte verzeichnet war. Ihr rotes langes Haar fiel dabei weich auf das bunte Papier.
„Hellsehen kann ich sicherlich nicht, lassen wir es drauf ankommen. Ich habe jedenfalls keinen Willen, bei diesen Wolkenbrüchen den Rückweg zu Fuß anzutreten.“
Peti pflichtete mir bei, auch Hardy nickte verhalten und meinte ironisch: „Was soll das ganze Getue, wir haben Ferien, alle Zeit der Welt.“ Er steckte die Entscheidung trocken weg.
Schon am anderen Morgen packten wir in aller Herrgottsfrüh unsere sieben Sachen, buckelten die Rucksäcke und setzten unsere Tour in die abgemachte Richtung fort. Der Regen hatte etwas nachgelassen, dennoch war ich überzeugt, wenn wir ein Boot fänden, hieße es umkehren – was auch ganz in meinem Interesse war. Gegen Mittag trafen wir auf dieerwartete Holzhütte. An der Uferböschung lagen, umgedreht zwei Boote, die von Weitem eher Nussschalen glichen.
„Das sind aber keine Touristenboote. Sie riechen streng nach Privatbesitz“, meinte Annika voller Skepsis.
Es waren keine Kanus, sondern ganz gewöhnliche Ruderboote, von denen eins schon in die Jahre gekommen war. Kein Zweifel, das Haus befand sich tatsächlich in privater Hand. Allein die undurchdringlichen Gardinen an den Fenstern und ein übergroßer Briefkasten an der Haustür waren Indizien dafür, dass in diesem Haus irgendwer wohnte. Die Boote gehörten unmissverständlich dazu. Es war ein ganz gewöhnliches Häuschen, ohne Bootsverleih und ohne Schnickschnack.
„Was nun?“, fragte Annika. Sie ging zu einem der Boote und klopfte behutsam mit ihrem Wanderstock auf die Holzplanken. „Sie sind okay, der Besitzer hat sie womöglich umgedreht, damit der Regen sie nicht volllaufen lässt. Lasst uns einfach eines ergattern und schleunigst von hier verschwinden!“
„Du kannst doch nicht einfach das Eigentum anderer Leute nehmen. So was nennt man Diebstahl, meine Liebe, der übrigens hier oben in Skandinavien ganz anders geahndet wird als bei uns daheim!“, wetterte Hardy und zeigte ihr deutlich den Vogel.
„Ja, ja! Bestimmt wird man deiner Meinung nach, hinter schwedischen Gardinen noch gefoltert“, meinte sie voller Hohn.
„Jetzt spinnt sie total“, meldete sich Peti zu Wort und setzte mit „hysterisches Weib“ noch einen drauf.
„Du“, sie deutete auf Peti, der bereits seinen Rucksack abgelegt hatte und hektisch darin rumwühlte, „hast doch nur eine große Klappe und die schon immer gehabt. Es regnet weiterhin in Strömen, du Dummkopf. Ich bin klatschnass, wenn ich eine Lungenentzündung davontrage, bist du ganz alleine schuld!“
„Nun mal langsam mit den jungen Pferden! Wie es aussieht, ist niemand zu Hause. Wir binden das Boot einfach am Ausgangspunkt für jedermann sichtbar am Ufer fest, dort wird es der Besitzer mit Sicherheit nicht verfehlen, wenn er danach sucht. Er wird es später mit einem Motorboot flussaufwärts schleppen, wie es viele hier tun. Ich bin nicht gewillt, weiter zu wandern geschweige denn zu Fuß umzukehren. Ich finde Annikas Idee zwar nicht die klügste, jedoch die einfachste.“ Ich war mir sicher, niemand von uns wollte den langen Weg zurück marschieren, alle hatten auf irgendeine Art und Weise die Schnauze gestrichen voll oder schon etliche Blasen an den klammen Füßen.
„Da ist er ja!“ Aus seinem Rucksack zog Peti unerwartet einen langen Dolch, den er zum 18. Geburtstag von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Er war mindestens so lang wie mein Unterarm. Fix rannte er zu dem Boot und durchtrennte das Anlegeseil mit einem einzigen Hieb. Kraftvoll stülpte er es um. „Was ist? Worauf wartet ihr?“
Übereifrig ließen wir die Nussschale zu Wasser und verstauten in Windeseile unsere Rucksäcke darin. Jeder suchte sich, sofern es eben ging, einen einigermaßen bequemen Platz, Hardy und Peti saßen sich gegenüber an den Rudern, Annika vorne und ich als Steuermann ganz hinten. Mit aller Kraft stieß ich uns vom Ufer ab. Die zwei stärksten, Hardy und Peti machten den Anfanf und ruderten als Erste und wir nahmen schnell an Fahrt zu. Vorsichtig blinzelte ich über meine Schulter zum Ufer zurück in der Hoffnung, dass uns niemand beobachtete. An den Fenstern des Hauses rührte sich nichts, kein Zurückziehen der Gardinen und keine bösen Blicke. Noch wenige Ruderschläge und wir hatten die Mitte des Flusses erreicht, gegenwärtig konnten wir die Strömung zu unseren Gunsten nutzen. Nach einer Weile verschwand das Haus hinter einer kleinen Bucht. Endlich konnten wir aufatmen. Als alle sichtlich erleichtert waren, tauchte im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz anderes Problem auf. Der Regen ließ den Wasserstand im Boot gefährlich und spürbar ansteigen. Mit einer leeren Konservendose schöpfte ich fieberhaft das Wasser wieder hinaus. Doch es war vergebens, das Gepäck lag schon halb unter Wasser, das Boot wurde voller und voller. Wir gerieten in Panik und die Bewegungen arteten so heftig aus, dass das Ruderboot zu kentern drohte. Inzwischen lagen unsere Rucksäcke allesamt unter Wasser. Leider blieb uns keine Zeit, alle wichtigen Gegenstände wasserdicht zu verstauen. „Tschüss, du kleines Radio, ade, Kamera, lebt wohl, ihr schönen Dinge, die ihr keine Feuchtigkeit mögt“, sagte ich leise und traurig vor mich hin.
Der Pegel stieg und stieg. Auch Annika und Peti schöpften eifrig mit Topf und Tasse.
„Da!“, schrie Annika plötzlich, als habe sie nach jahrzehntelanger Suche an einem Fluss endlich Gold-Nuggets gefunden. „Ein Loch in der Bodenwanne!“
Hastig zog sie ihren Regenponcho aus und versuchte unermüdlich, das Leck mit dem Nylonstoff zu stopfen, dabei presste sie übereifrig ihre Lippen auf die Zunge. Als dann noch Hardy uns auf die herannahenden Stromschnellen aufmerksam machte, war das Chaos perfekt.
„Ein Unglück kommt selten allein“, stellte Peti in einem Tonfall fest, als sähe er sich schon gekentert in den Fluten treiben. Er konnte doch schwimmen oder etwa nicht?
Flugs erhaschte uns die starke Strömung wie ein Sog. Hardy holte die Ruder ein, denn er hatte nicht die geringste Chance, diese Nussschale irgendwie noch auf Kurs halten zu können. Es hatte keinen Zweck. Die tobende Strömung nahm Gewalt über das Boot. Schläge von rechts, Stöße von links, hoch und runter; wie auf einer gigantischen Achterbahn fühlte wir uns. Wir kauerten uns tief in das Boot, dicht an dicht gedrängt. Mehrmals drehte es sich um die eigene Achse. Wasser schwappte ab und zu über die Bordwand. „Wenn wir jetzt kentern, ist alles verloren!“, rief ich den anderen zu. „Unsere teuren Ausrüstungen finden wir nie wieder.“
Die gesamte Bootsmannschaft war trotz allem ungewöhnlich ruhig, als ob die Zeit auf Kommando angehalten wurde. Anfangs bekamen wir jede Einzelheit mit, das Aufprallen des Bootes auf den rundgeschliffenen Felsen, das Brausen und Toben der Wassermassen, doch von einer Sekunde auf die andere schien es umgekehrt zu sein, nicht wir drehten uns, sondern die Erde drehte sich um das Boot, das starr und regungslos auf einer Wasserwoge, die von Geisterhand gehalten wurde, erstarrt war. Die lauten Geräusche verhallten in einem ewigen Sog. Die Welt um uns drehte sich immer schneller und schneller. Es kam mir vor, als säßen wir im Auge eines mächtigen Wirbelsturms, in dem Totenstille herrschte, während ringsherum jedes Hindernis in Schutt und Asche gelegt wurde. Im Moment geschah es ähnlich. Die Landschaft drehte sich rasend schnell um das Boot, nur noch unterschiedliche Farbstriche konnte man von der Umgebung erkennen. Kurz darauf setzte sie sich wie ein riesiges, verschwommenes Puzzle neu zusammen und blieb wie durch Geistarhand stehen. Unser Boot wippte leicht und unbefangen auf den Wogen hin und her. Langsam entfernten sich die tosenden Stromschnellen wieder und der Spuk hatte endlich aufgehört. Noch stark benommen kauerte ich mich auf und schaute mich um. Auf den ersten Blick sah die Umgebung vertraut, sogar friedlicher als zuvor aus. Auf beiden Uferseiten erstreckten sich durch Tannen dicht verwucherte, steile Berghänge, die auf halber Höhe mit ihren nackten Felsen prahlten. Das Schichtgestein an den senkrecht verlaufenden Felswänden bildete die Grate, die auf den Uferseiten parallel zum Fluss verliefen. Über die Grate hinweg erstreckten sich im Osten wie auch im Westen Plateaus, grüne Hochebenen, auf denen zahlreiche Flechten und Moose wuchsen. Vereinzelt wucherten auch Birken aus dem kargen, steinigen Boden. Von Wind und Wetter gezeichnet, trieben sie in solchenHöhen nur begrenzt und sahen kümmerlich aus, während ihre Vettern weiter unten in den Talmulden zu stattlichen Bäumen heranwuchsen.
Wie aus heiterem Himmel hatte es aufgehört zu regnen und nicht nur das, die Luft war so staubig trocken, als ob das Land seit Wochen keinen Regenguss erlebt hätte. Die Sonne färbte den östlichen Grat abwechselnd in Grau und Gelb. Sie schien ¬– die Sonne schien! Der wolkenlose Himmel zeigte sich strahlend blau. Unser Boot war knochentrocken, die Ausrüstung nicht einmal feucht, auch das Loch in der Beplankung existierte zu unserem Erstaunen nicht mehr. Hardy runzelte die Stirn, sagte aber kein Sterbenswort. Mit weit aufgerissenen Augen besah er Annika, musterte sie mit scharfen Blicken, dann drehte er sich zu Peti hin, jetzt wurden seine Augen größer, schlussendlich blähten sich seine Wangen zu Hamsterbacken auf. Mit dem Oberkörper über die Bootskante gebeugt übergab er sich, was die Fische sicherlich freute. Mir wurde auch speiübel und die anderen blieben ebenfalls nicht verschont. So brachen wir uns gemeinsam die Galle aus dem Leib. Etwas Seltsames ging hier vor und bald würden wir dahinter kommen!
Nachdem unsere Mageninhalte auf die unnatürlichste Art und Weise entleert wurden, ging es uns noch jämmerlicher; in der Magengegend rumorte es mehr denn je. Die Gesichter der anderen waren kreidebleich. Peti drückte mit verschränkten Armen fortwährend auf seinen Bauch und wippte mit seinem Oberkörper vor und zurück, anschließend beugte er sich abermals über die Bootskante. Ich konnte nicht zuschauen und musterte zwischenzeitlich Annika von oben bis unten. Ihre weit aufgerissenen Augen funkelten unecht und starrten ins Leere. Mit meiner Hand fuchtelte ich vor ihrem Gesicht herum; sie zeigte keine Regung, sie war, wie man so schön sagte, geistig umnachtet. Annika würde sagen, völlig von der Rolle. Erst als ich ihre Schulter packte, um sie kräftig durchzurütteln, fingen ihre Augenlider an zu zucken. Wie aus einem tiefen Traum erwacht, richtete sie ihren fixierten Blick auf mich. „Was – was war das?“
„Was war was?“, fragte ich erstaunt.
„Ich sah merkwürdige Dinge“, stellte sie aufgeregt fest. „Ich sah Menschen, die anders aussahen als wir und in einem fernen Land lebten, dessen Namen ich noch nie gehört habe.“
Leider konnte ich ihr nicht folgen und schüttelte verständnislos den Kopf. Das einzige, was ich in den letzten Minuten gesehen hatte, war mein Spiegelbild im Wasser gewesen, in das ich mich übergab, und im Anschluss die Totengesichter auf unserem Boot. Zugegeben, die Situation war schon unerklärlich. Vieles konnte ich nicht deuten, wie zum Teufel konnte dasLoch in der Bootsbeplankung einfach verschwinden? Das Ganze glich einer Verschwörung.
„Wo sind wir überhaupt?“, fragte Peti, dem es anscheinend wieder besser ging.
„Wo sollen wir schon sein, hilf mir lieber, das Ruderpaddel in ihre Halterung zu bringen.“ Hardys Versuche, das Ruder wieder in ihre Halterung zu hieven, misslangen. Immer wieder verfehlte er die kleine Bohrung in der Bootskante um einige Zentimeter, in der der Metallbolzen Halt finden soll. Überhaupt hatte er große Mühe das Ruder hochzuheben und es in Position zu bringen. Die Anstrengungen spiegelten sich in seinem verzerrten Gesicht wider, dem Anschein nach musste das Ruder hunderte Kilo wiegen.
„Hilf mir mal jemand!“, rief er mit letzter Kraft.
Genervt riss Peti ihm das Ruderpaddel aus den Händen und steckte den Bolzen zielstrebig in die Bohrung.
„Was ist los? Hast du keinen Mumm mehr in den Knochen?“, wetterte er mit Hardy.
„Ich finde keine Erklärung, ich fühle mich plötzlich so kraftlos, so schwach. Mir ist, als hätte ich übermäßigen Sport getrieben“, rechtfertigte er sich. Er ließ sich rückwärts auf die Rucksäcke fallen, dabei stellte er erneut fest, dass unsere Ausrüstung trocken war.
Langsam ließen wir uns mit der Strömung flussabwärts treiben. Nach etwa zweihundert Meter machte der Fluss nach Osten hin eine starke Biegung. Außer dem Glucksen der Wellen, die an die Bootsbeplankung schwappten, war es mucksmäuschenstill auf dem Boot.
Ich beobachtete aufmerksam die Ufer zu beiden Seiten. Der grelle Schrei eines Adlers unterbrach kurzweilig das Schweigen. Hoch oben über uns zog er majestätisch seine Kreise. Geschickt nutzte er die warmen Aufwinde, die von den Felsen her kamen und stieg und stieg immer höher. Irgendwann entdeckte ich nur noch einen winzigen schwarzen Punkt im Himmelblau.
Einige Kilometer waren wir vorangekommen. Hardy und Peti wechselten sich wortlos beim Rudern ab. Ich versuchte, das Boot mittels Steuerruder stets auf der Flussmitte zu halten, was gar nicht so einfach war. Es gab sehr viele Strömungen. Annika kramte die Karten aus meinem Rucksack.
„An der Hütte, wo wir zuletzt waren und vor dem Regen Unterschlupf fanden, machen wir Halt“, unterbrach ich die beängstigende Grabesstille in der Nussschale.
Annika reichte mir die Kartenmappe und nickte mir zu. Ihr Gesicht strahlte eine Zufriedenheit aus, die ich so bei ihr noch nie gesehen hatte. Sie war die Jüngste von uns, eigentlich auch die Bockigste und Geräuschvollste, wenn man das sagen durfte.
Annikas Elternhaus stand am Rande unseres Dorfes, in Richtung des kleinen Wäldchens Rodenwald. Unter seinem mächtigen Laubdach spielten wir früher als Kinder Räuber und Gendarm. Sie war immerzu der Anführer einer Gruppe, meist gehörte sie den Räubern an, was Annika hervorragend stand. Mit ihren seidig glänzenden, roten Haaren verglichen wir sie oft mit der Roten Zora aus einer gleichnamigen Fernsehserie. Diese Figur war ihr wirklich auf den Leib geschrieben. Sie war ein „Lausbub im Mädchenrock“, keine Frage, aber ein gut aussehender. Das letzte Wort überließen wir jedenfalls immer ihr, es war das klügste, denn es brachte gar nichts, ihr zu widersprechen. Am liebsten half sie ihrem Vater Norbert Moosmann, der Förster beim Staatlichen Forstamt war, in der Werkstatt oder bei der Waldarbeit, während ihre Freundinnen die Dorfstraße mit ihren Puppenwagen unsicher machten. Nie hatte ich sie, solange ich sie kenne, in einem Kleid oder gar Rock gesehen. Bluejeans, ein Modegeck der frühen Achtziger und langes Haar waren ihre Markenzeichen und es gefiel uns – jedenfalls den Jungs aus meiner Schule; das waren bestimmt nicht wenige. Zu jener Zeit trug man die Jeans knalleng. Ihre Weiblichkeit konnte sie so sicherlich nicht vor stierenden Augen verbergen. Vielleicht mochte sie gerade dies, provozieren! Mode war ohnehin für Annika ein Fremdwort, dabei hätte sie durchaus als Model auf den Laufstegen flanieren können. Bereits mit sechzehn übertraf sie die Größe ihres Vaters um etliche Zentimeter. Mit Einsneunundsiebzig gehörte Norbert nicht gerade zu den Zwergen. Er behauptete stets, sie sähe ihrer Mutter ähnlich, als sie in ihrem Alter war. Ihre Mutter hatte Annika nie kennen gelernt, sie starb bei ihrer Geburt. Sehr viele Jahre später heiratete Norbert eine andere Frau. Die Tatsache, dass Annika lange Zeit die einzige Frau im Haushalt des Försters war, machte sie womöglich stark und unabhängig. Jedenfalls musste sie zumindest schneller erwachsen werden als ihre gleichaltrigen Freundinnen. Mit der Stiefmutter pflegte Annika erst nach ihren pubertären Krisen ein freundschaftliches, friedliches Verhältnis. Davor gab es oft nur Zank und Streit. Annika wollte unbedingt nach diesen Ferien ihr Biologiestudium abschließen und sich alsbald im Naturschutz behaupten, zur Freude ihres Vaters.
Ich weiß noch: Bei unserem letzten Abstecher in die Alpen gab sie uns einen Vorgeschmack auf das, was uns noch blühte. Der Umwelt-Enthusiast! „Geht vorsichtig und schaut auf eure Füße und zertretet nicht die seltenen Blumen. Bleibt immer auf den vorgeschriebenen Pfaden wegen der Bodenerosion.“
Und als Hardy es doch tatsächlich wagte, aus einem klaren Bach zu trinken, hielt sie ihm einen überschwänglichen Vortrag über Bakterien, Viren und weiß der Kuckuck noch nicht alles. In und mit der Natur war ihr Motto und sie liebte die natürlichen, einfachen Dinge wie keine Zweite, die ich kannte.
„Als Försterin könnte ich sie mir gut vorstellen“, meinte Peti grinsend, als wir einmal, wie schon so oft, gemütlich am abendlichen Lagerfeuer saßen; von da an nannten wir sie, wenn uns danach war, ‚Die Försterin’.
„Laut der Karte müsste auf der linken Uferseite gleich die Blockhütte auftauchen.“ Ich hielt nach ihr Ausschau.
„Wenn wir überhaupt noch in Finnland sind“, annoncierte Annika.
Wieder konnte ich aus ihren Worten keine Schlussfolgerungen ziehen. Mit Argusaugen durchstöberte ich das Flussufer und hoffte insgeheim, dass die Hütte auf der Stelle erscheinen würde. Doch sie erschien nicht; stattdessen wurde der Wald dichter und der Fluss enger. Mit der Verjüngung wurde auch die Strömung stärker und zerrte an dem Boot, das schließlich schneller wurde. Nach einem kleinen Zwischenspurt ergoss sich der Lemmenjoki erneut in ein breites Flussbett.
Hardy grübelte nach und meinte: „Es ist schon reichlich spät geworden und ich werde allmählich müde. Ist es nicht an der Zeit, ein Nachtlager aufzuschlagen?“
„Daran dachte ich schon eine Weile, die Hütte haben wir bestimmt übersehen“, erklärte ich.
Sichtlich erschöpft steuerten wir kurz darauf das linke Ufer an und machten fest. Die Sonne hatte sich inzwischen gegen das Gesetz der Natur hinter den östlichen Bergen verkrochen undwar nicht wie gewohnt im Westen untergegangen. Mit ihr verabschiedete sich auch das helle Tageslicht und die Gegend tauchte ein in eine fahle Dämmerung. Die Luft war ungewöhnlich kühl und frisch. Sie roch nach frischen Gräsern und Kräutern. Die Tatsache, dass es in den Sommermonaten im Norden Skandinaviens nie dunkel wird, kam uns nun zugute. Doch dass sie hier im Osten unterging, kam mir mehr als verschroben vor, denn es war gegen das Gesetz der Natur. In Windeseile wurden die Zelte aufgebaut und balddarauf ein Lagerfeuer gezündet. Das knorrige Holz knackte und zischte in den Flammen. Aus der Ferne rief ein Uhu unentwegt, womöglich nach seinen Artgenossen, er heizte die gespenstige Ruhe mit seinen Rufen auf. Diesmal wurde es keine der endlosen langen Nächte, die wir schon so oft gemeinsam am Feuer verbracht hatten, jeder von uns erreichte schnell die nötige Bettschwere und schlüpfte in seinen Schlafsack. Peti und Annika waren die letzten.
Es muss mitten in der Nacht gewesen sein, als mich Schritte aus dem Schlaf rissen. Irgendwer oder irgendetwas schlich um die Zelte. Ich dachte an einen Vielfraß, an ein Rentier oder einen Elch, doch dann schweiften meine Gedanken zum Besitzer des Bootes. Ich rüttelte Hardy wach.
„Was ist los?“, fragte er mit vernehmlicher Stimme, halb im Schlaf.
Ich zischte und hielt ihm den Mund zu. „Psst, da draußen ist jemand.
Hörst du ihn?“ Hardy wehrte sich gegen meine Hand und rang nach Luft.
„Bist du übergeschnappt?“
„Jemand schleicht um die Zelte. Psst!“
„Das ist bestimmt ein Fuchs oder Rentier. Lass mich weiterschlafen.“, gähnte Hardy und wälzte sich zur Seite.
„Und was machen wir, wenn es ein Bär ist?“
Plötzlich brach mit einem lauten Knacks ein Ast, gleich vor dem Zelt. Jetzt richtete sich Hardy wieder ruschlig auf. „Was war das?“, flüsterte er.
„Ich weiß es nicht.“
Blitzschnell ergriff ich den Reißverschluss und öffnete mit einem einzigen Ruck den Eingang des Zeltes. Hardy befreite sich indessen aus seinem Schlafsack und stürzte mit lautem Gebrüll und Gekreische hinaus. Unmittelbar folgte ein dumpfer Schlag. Stampfend und eilig entfernten sich die Schritte in den dichten Wald, wo sie hergekommen waren. Jetzt war es totenstill. Vor Angst machte ich mir fast in die Hosen. Nur zögerlich streckte ich meinen Kopf aus dem Zelt nach draußen.
„Hardy“, rief ich mit zitternder Stimme, „wo bist du?“ Ich bekam keine Antwort. Als ich mich umsah, entdeckte ich neben dem Zelt Hardys Füße. Wild entschlossen nahm ich allen Mut, den ich kriegen konnte, zusammen und krabbelte hinaus. Ich eilte zu ihm hin und packte ihn an seinen Schultern. Immer wieder sah ich ängstlich über meine Schulter. Regungslos lag er auf dem Boden, am Kopf blutete er stark.
„Was ist passiert?“, fragte ich nach. Pure Angst kroch nun in meine Knochen und mein Herz pochte fühlbar im Hals. Mit einem gellenden Hilferuf weckte ich die anderen, die kurz darauf hinzueilten.
„Lass mich mal ran“, tobte Annika und schubste mich beiseite. Sie ohrfeigte Hardy leicht.
Zögernd öffnete er seine Augen und fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. Fragend starrte er uns der Reihe nach an. „Wo bin ich, was ist geschehen? Mir brummt der Schädel. Oh, mir ist schlecht.“
„Was war denn los?“, fragte mich Peti interessiert und angespannt.
Ich berichtete ihm von dem Zwischenfall, dabei war ich felsenfest überzeugt, die Bewegungen stammten mitnichten von einem wilden Tier. Peti beobachtete mich argwöhnisch, er runzelte dabei die Stirn.
Hardy lag noch immer auf dem Boden. Ich reichte ihm meine Hand und half ihm wieder auf die Beine, während Peti ihn abstützte. Hardy konnte sich kaum halten, so schwindelig war es ihm. Annika hastete indessen ins Zelt und ergriff die Erste-Hilfe-Tasche. Darin waren allgemeine Arzneien enthalten wie eine Schere, Verbandspäckchen, Kohletabletten gegen Durchfall, Pflaster, Wundsalben, Salben gegen Blasen an den Füßen, Pinzette, Dreieckstücher, Schmerztabletten, starke und leichte, sowie Signalleuchtpatronen für den äußersten Notfall. Auf der Patronenpackung stand: ‚Nur bei Gefahr für Leib und Leben anwenden!’
„Sein Leben war doch nicht ernsthaft in Gefahr, oder?“, schwankte ich mit den Gedanken, als ich sein blutüberströmtes Gesicht besah.
Annika, unsere Försterin, spielte jetzt die erste Geige. Wie eine Krankenschwester umsorgend verband sie erst einmal die klaffende Wunde am Kopf. Dabei ging sie mit viel Fantasie zu Werke. Anschließend nahm sie eine Plastikschüssel, rannte zum Fluss und füllte sie mit Wasser. Hardy wusch sich behutsam das Blut aus dem Gesicht. Das Wasser war eiskalt. Danach schaute er einigermaßen wieder menschlich aus. Eine Schmerzpille sollte das Kopfweh lindern, was auch nach einer Weile eintraf. Plötzlich gab es einen grellen Blitz, der die Zelte und die Umgebung für einen Moment lang aufhellte. Peti schoss ein Foto von Hardy, den man in seinem Outfit leicht mit einem Inder oder Araber verwechseln konnte. Wie der Turban eines Sohns der Wüste sah der meisterhaft gewickelte Kopfverband von Annika aus. Wie ich schon sagte, mit viel Fantasie!
„Wenn die Situation nicht so ernst wäre“, sagte ich leise, „dann würde ich auf der Stelle losbrüllen.“
„Hardy, du siehst bescheiden aus“, meinte Peti dann.
„Haha, sehr komisch.“
Ich musste mich am Riemen reißen. Auch Peti kämpfte erkennbar gegen einen drohenden Lachanfall an. „Und ‚Blitz’, wieder etwas fürs Fotoalbum!“
Annika fürchtete, dass Hardy eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen habe, und fragte ihn: „Wie viele Finger kannst du erkennen?“ Sie zeigte ihm drei Finger von einer Hand.
„Drei.“
„Und jetzt?“
„Vier.“
„Und wie viele sind es jetzt?“
„Was soll das, Annika ¬– ich bin okay!“, unterstrich Hardy genervt seinen Zustand. Er schlug ihre Hand vor seinem Gesicht weg. Jetzt schmerzte abermals der Kopf.
„Hör sofort auf, Annika!“, schrie Peti. „Lass ihn in Ruhe, du siehst doch, dass es ihm nicht gut geht, also unterlass deine Spielchen.“
„Hört schleunigst auf, hier herumzualbern“, Hardy fasste sich erneut an seine Birne, „gebt mir lieber noch eine Schmerztablette.“
Ich reichte ihm eine von den starken. „Wer oder was war das, zum Teufel! Erinnerst du dich an Einzelheiten?“
Hardy strengte sich an, so als würde er ohne seine Lesebrille aus einem unsichtbaren Buch vorlesen, bei dem die Buchstaben verschwommen schienen, trotzdem las er Wort für Wort vor: „Da, da war ein Mann, ein großer Mann – ein Riese! Er trug seltsame Kleider und einen langen, dichten Bart. Ich sprang ihm auf den Rücken und umklammerte kraftvoll seinen Hals. Er war zu stark und schüttelte mich ab und dann wurde mir schwarz vor Augen. Dies hier habe ich ihm abjagen können.“ Dann reichte er mir ein kleines, rundes Amulett, das aus purem Gold gefertigt war. Sorgfältig nahm ich es unter die Lupe. Zwei Gesichter, die ineinander verschmolzen waren, konnte ich darauf erkennen. In den Augen der Gesichter waren winzige, blau schimmernde Edelsteinchen eingebettet. Der Rand war kunstvoll verziert. Über den Gesichtern waren Zeichen eingraviert und als Hintergrund diente ein mächtiger Baum; vielleicht eine uralte Eiche? Jedenfalls wurde dieses edle Schmuckstück an einem schmalen, simplen Lederband um den Hals getragen.
„So weit ich gehört habe, findet man am Lemmenjoki hier und da noch Gold. Es gibt sie noch, die Goldgräber vom Lemmenjoki, wahrscheinlich gehörte das Haus, wo wir das Boot stahlen, solch einem. Jener verfolgte uns dann, um seinen Besitz zurückzufordern, oder was meint ihr dazu?“ Peti sah zuerst Annika, dann mich erkundigend an.
„Mag sein, dass es der Bootsbesitzer war“, antwortete ich. Insgeheim erlaubte ich mir, meine Antwort doch zu überdenken. „Aber warum hat der Kerl nicht einfach sein Boot geschnappt und sich aus dem Staubgemacht? Nein, es war sicherlich kein Goldgräber, der Hardy niedergeschlagen hat, die Sache stinkt bis zum Himmel!“
An Schlaf dachte nun niemand mehr, die Aufregung war zu wirksam, hellwach überlegten wir, was zu tun war. Hurtig schlugen wir die Zelte ab, verstauten das Gepäck im Boot und fuhren mit halber Kraft voraus. Hardy lag wie in einer Hängematte auf den Rucksäcken, das Schaukeln übernahm der Fluss von ganz allein. Annika saß am Steuerruder, Peti und ich hatten die Ruder in den Händen. In der Früh erreichten wir eine einladende Anlegezone, wo wir unser Frühstück nachholen wollten. Die Mühsal des Flusses hatte diesen Platz gestaltet und große Mengen Sand dem Ufer vorgelagert. Hier machte auch der Lemmenjoki eine kleine Biegung, was sich dahinter verbarg, konnten wir nicht erahnen. Diese große Unbekannte würde alsbald unser Leben elementar verändern, in das größte Abenteuer würde sie uns führen.
Hardy schlief den Schlaf der Gerechten, Versuche, ihn aufzuwecken, scheiterten. Peti kochte Kaffee, Annika und ich probierten meine neue Angelrute aus. Mit Fertigfutter allein lebte es sich bequem einfach, allerdings verlangte der Gaumen nach einer gewissen Zeit nach was Frischerem. Ein Fisch böte eine willkommene Abwechslung. Petri Heil!
Großspurig zelebrierte ich das punktgenaue Auswerfen der Angelschnur, ich wollte damit Annika imponieren. Entscheidend war ein sicherer Stand und dass man im richtigen Moment die Schnur frei gab, während man die Rute mit Gefühl nach vorne peitschte. Ja gut, mir fehlte schon ein bisschen Übung, schließlich fängt man bekanntermaßen Fische im Wasser und nicht etwa auf Bäumen. Der Haken verfing sich doch tatsächlich im Dickicht hinter mir. Als ich mich umdrehte, da ich den Haken vorne vermisste, sah ich den fetten, dicken Regenwurm unerreichbar an einem dünnen Zweig hin- und herbaumeln.
„Super, Tobias, ich habe schon immer gewusst, dass du ein hervorragender Angler bist! Ein wahrer Meister seiner Klasse! Das Verdienstkreuz ist dir sicher“, rief Annika spöttisch und fing an zu lachen.
„Gut – lach du nur, du wirst sehen, ich stecke voller Überraschungen“ entgegnete ich wütend.
Zugegeben, das letzte Mal, als ich die Angelrute in den Händen hielt, lag weit zurück. Ehrlich gesagt, ich konnte mich gar nicht so recht daran erinnern. Früher war ich oft mit meinem Vater zum See Angeln gefahren. In aller Herrgottsfrühe standen wir schon am Wasser, es war meist noch dunkel. Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt doch ein Sprichwort. Mein Vater und ich fuhren immer an den gleichen ruhigen See, der nur sowimmelte von Fischen. Als mein Vater Jahre später meinte, er müsse wegen einer anderen Frau die Familie verlassen, verschwand auch die Scheinliebe zum Angeln. Nach zwanzig Jahren Ehe, so was. Meine Eltern lebten all die Jahre glücklich oder weniger glücklich miteinander, um zum Schluss zu erfahren, dass sie überhaupt nicht füreinander bestimmt waren. Der Ofen war aus! Meine Mutter, meine beiden Geschwister und ich blieben im elterlichen Haus, dessen Darlehensraten waren zum größten Teil getilgt, insofern bestand zumindest eine Möglichkeit, das Haus halten zu können. Magere Zeiten standen bevor. Meine Mutter war, in Anführungszeichen, eine einfache Hausfrau. Anfangs nahm sie jede Putzstelle an, die man ihr anbot. Wäre da nicht noch meine Großmutter gewesen, die uns finanziell unter die Arme gegriffen hätte, wäre die Schufterei meiner Mutter fast umsonst gewesen.
Ich ging weiterhin brav zur Schule, machte mein Abitur und studierte inzwischen Maschinenbautechnik. Jahre später heiratete meine Mutter wieder. Mein Stiefvater war vollends in Ordnung und wir kamen gut zusammen aus. Er war für mich fast so wie ein großer Bruder.
Wenn ich endlich mit dem Studieren fertig bin, möchte ich mich mit meinen Ideen selbständig machen oder im Unternehmen meines Onkels arbeiten. Doch bis es soweit ist, drücke ich noch zwei Semester die Schulbank. Das Studentenleben hat auch seinen gewissen Reiz; an diese Zeit möchte man sich später gerne wieder erinnern.
Nachdem ich es schließlich bewerkstelligte, die Angelschnur fachmännisch auszuwerfen, setzte ich mich auf den feinen Sandboden und wartete. Vom Schwimmer magisch angezogen, ließ ich dieses rotweiße Ding keine Sekunde aus den Augen, auch nur die kleinste Bewegung entging mir nicht. Die Strömung trieb den Schwimmer so deutlich ab, dass ich jede Menge Schnur nachgeben musste. Nachdem Annika als Zeuge einer Tiermisshandlung beiwohnte, schreckte sie zurück und ging. Sie konnte es nicht ertragen, wie ich den zweiten armen, kleinen Regenwurm auf den Angelhaken spießte. Tierquälerei nannte sie das. Ich musste ihr ja Recht geben, unfair war es durchaus. Mein Magen sprach dagegen eine andere Sprache. Übereilig zuckte auf einmal der Schwimmer. Anfangs tänzelte er auf dem Wasser, änderte schnurstracks die Richtungen und tauchte zu guter Letzt ab. Augenblicklich kam mein Auftritt: Wie ein geölter Blitz, riss ich die Angelrute nach oben – ich hatte ihn. Der Bursche wog mindestens vier, fünf Pfund. Der Kampf Mensch gegen Tier hatte begonnen. Eindeutig hatte ich die besseren Reserven und behielt die Oberhand. Zunächst ließ ich ihn zappeln, nahm ihm die Lebenskraft und zermürbteseinen Überlebenswillen, bis er nach langem Ringen letztlich aufgab. Aufgeregt zog ich den Prachtkerl an Land. Er war eine großartige Forelle, gerade passend für die Bratpfanne. Die schuppige Haut schimmerte in den schönsten Regenbogenfarben. Heftig schlug der Fisch mit der Schwanzflosse auf den Boden. Das letzte Aufbäumen vor dem Untergang sah aus, wie ein Tanz vor Freude. Das Maul wie auch die Kiemen öffneten und schlossen sich rastlos. Ich entzog dem Burschen sein Lebenselement, das Wasser, das er zum Leben so sehr brauchte wie der Mensch den Sauerstoff. Mit einer Hand packte ich den Kopf und löste den Haken. Wild entschlossen griff ich nach meinem Dolch und setzte zum Todesstoß an, dann, nach kurzer Betrachtung, erblickte ich ein glänzendes Auge der Forelle. Ihre Pupille waren weit aufgerissen. Da lag sie nun vor mir und starrte mich mit ihrem angsterfüllten Auge an. In jenem Augenblick plagte die Forelle eine unvorstellbare Todesangst. Jetzt spürte ich Mitempfinden, Mitleid, und ich stand vor einer großen Entscheidung – ich stach zu. Nunmehr fühlte ich mich so mies, so erbärmlich, die einzige Frage, die mich quälte, war, warum ich das getan hatte. Ich fühlte mich schwach und mein Herz pochte laut. Der Dolch stach kerzengerade bis zum Schaft im lockeren Sandboden. Behutsam hob ich den Fisch auf und trug ihn zum Wasser hinüber, vorsichtig tauchte ich ihn in sein Lebenselixier. Ein paar Sekunden in seinem Element und die Lebensgeister kehrten in seine Muskeln zurück, mit kraftvollen Flossenschlägen erwachte der Bursche zu neuem Leben und entschwand in die Tiefe. „Lebe wohl, mein kleiner Freund“, dachte ich, packte nachdenklich meine Sachen und kehrte zu den anderen zurück. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, den Fisch zu töten. „Was bin ich für ein Weichei!“
Spöttisch empfing mich Annika: „Na du Petrijünger, kein Glück gehabt?“
„Keine Ahnung, die Fische wollen irgendwie heute nicht beißen.“
„Es sah aber eben so aus, als hättest du einen am Haken“, behauptete Peti voller Skepsis. Er hatte mich die ganze Zeit über im Visier.
„Der Haken verfing sich in einer Wurzel, das war der Fisch, den du gesehen hast“, antwortete ich lapidar. Ich hatte die Wahl und es war eine gute Wahl!
Hardy lag derweil wie ein Toter im Boot. Ich ging zu ihm. Peti brühtete unterdessen einen neuen Kaffee auf. Nach mehrmaligem Anschubsen wurde Hardy zögernd munterer. Etwas benommen setzte er sich auf und wagte einen Rundblick, dabei knacksten hörbar seine Halswirbeln und sein Anblick war äußerst fragwürdig. Ich ging davon aus, dass sein Schädel fürchterlich brummte, doch das Gegenteil war der Fall. Anstatt sich ruhigzu verhalten und langsam aus dem Boot zu steigen, sprang er wie eine Gazelle über die Bootskante in den lockeren Sand. „Ich habe einen Bärenhunger“, bekräftigte der Todkranke, während er seinen Bauch tätschelte, „eine trockene Kehle habe ich ebenso.“
„He! Hast du keine Kopfschmerzen mehr?“
„Wieso?“ Er fasste sich an den Kopf, jetzt erst bemerkte er den Verband.
Erstaunt darüber, rollte er sich diesen vom Kopf. „Wer war das?“
Jetzt verstand ich nur noch Bahnhof. „Wer war was?“, fragte ich ihn mit fragendem Blick.
„Na, dieser grässliche Verband, du Scherzkeks. Noch nicht mal in Ruhe pennen kann man. Einer von euch hat immer Unsinn im Kopf.“ Hardy riss sich den Verband vom Kopf und zerknautschte das Baumwollgewebe in den Händen, dann schmiss er es aufgebracht ins Boot zurück und hastete zu Peti. Verwundert schaute ich ihm nach. Mein Mund stand sperrangelweit offen und bot eine perfekte Falle für die lästigen, zahlreichen Mücken, die mich ringsum umschwärmten. I do like Tourist stand auf einem Warnschild, mit der Abbildung eines Moskitos im Eingangsbereich der Blockhütte, die auf unerklärliche Weise nicht mehr aufzufinden war. Die fantastische Genesung von Hardy allerdings war ebenso rätselhaft. Zum allerersten Mal überkam mich ein Unwohlsein, ich verspürte Angst. Diese Reise hätten wir nie machen dürfen, zu viele Gefahren lauerten, dass wir dennoch fuhren, war gewiss kein Zufall. Die Sonne, sie ging im Westen auf und im Osten unter, die Kompassnadel spielte fortan verrückt, das mysteriöse Verschwinden des Lecks in der Bootsbeplankung, der plötzliche Umschwung in eine Schönwetterlage und Hardys Wunderheilung kamen mir mehr als merkwürdig vor.
„Was war mit dem Unbekannten, der letzte Nacht um die Zelte schlich?“, dachte ich. Ich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein eisiger Schauer fuhr mir augenblicklich über den Rücken, als ein grässlicher Schrei aus dem dunklen Wald hallte.
„Tobias, komm, setz dich zu uns“, meinte Peti und wies mir, auf einem alten Holzstamm, einladend einen Platz zu, dann legte er kumpelhaft seinen Arm auf meine Schulter. „Ich habe uns ein Lunchpäckchen zubereitet, da dein Anglerglück dich offensichtlich im Stich gelassen hat. Kaffee ist auch noch in der Kanne. Hast du das eben mitbekommen? Hardys Wunde ist anstandslos verheilt. Nicht mal ein Kratzer ist zu sehen, seltsam, gell?“
„Vieles ist hier merkwürdig“, meinte Annika, die nachdenklich ihren Kaffee schlürfte und uns gespannt zuhörte.
Die anderen durften von meiner Furcht nichts mitbekommen, daher zuckte ich bescheiden mit den Achseln, runzelte die Stirn und schenkte mir eine Tasse Kaffee ein. Ich tat so, als wenn es die normalste Sache der Welt wäre. Der Kaffee war noch heiß und verbreitete einen heimischen, beruhigenden Duft.
„Ich kann mich an nichts mehr erinnern“, meldete sich Hardy unerwartet.
Die Ungewissheit plagte sein Gewissen.
„An deine Verletzung auch nicht?“, fragte ich und fügte hinzu, „irgendetwas ist hier gewaltig faul oder wie soll man sonst die Geschehnisse deuten. Habt ihr vorhin den Schrei gehört?“
„Schauderhaft, nicht wahr?“, bekräftigte Annika, die sich meiner Meinung prompt anschloss. Unbewusst bewertete sie ihren Traum, den sie nach den Stromschnellen träumte. Solch eine Platzwunde am Kopf könne unmöglich in so kurzer Zeit zuheilen, meinte sie. Peti teilte zu Recht ihren Standpunkt. Er hätte schon so manches erlebt, doch so etwas noch nicht, und die Tatsache, dass die Sonne im Osten unterging, sei reineweg absurd.
Beschwörend starrte Hardy auf das Amulett, er erhoffte insgeheim, eine klare Antwort auf seine plötzliche Vergesslichkeit, doch die Erinnerungen blieben wie weggeblasen. Auf und davon! Es sah so aus, als seien einige Gedanken irgendwie manipuliert und auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt worden.
„Wer zum Henker ist imstande, so etwas Verwerfliches zu tun?“, dachte ich.
Wieder ertönte ein gespenstischer Schrei ganz in der Nähe. Annika zuckte zusammen und Peti schaute hastig über die Schulter und anschließend zum Himmel hoch. „Kinder!“, stöhnte er aufgeregt, „ich bleibe hier keine Minute länger.“
„Ich auch nicht.“ Annika schüttete in Windeseile den Rest Kaffee in die Büsche und lief zum Boot.
„Wo wollt ihr denn hin?“, wunderte sich Hardy.
„Weg von hier, einfach nur weg!“ Peti packte übereifrig seinen Kocher, der aus verschiedenen Einzelteilen bestand, zusammen, klemmte ihn unter den Arm und verschwand Richtung Boot. Inzwischen hatte Annika es zu Wasser gelassen, ungeduldig saß sie am Steuerruder. „Beeilt euch!“
„Wir kommen!“, rief ich zurück. Ich schnappte Hardys Arm und zerrte ihn zum Boot.
„Meine Matte!“ Er riss sich los und lief zurück. „Habt ihr etwa meine Thermomatte gesehen? Sie ist verschwunden!“
„Auch das noch!“, schrie ich und lief ebenfalls zurück. Tatsächlich, sie lag nicht mehr an ihrem Platz. „Lass es sein, sie ist weg – wir müssen abhauen!“ Ich spürte, dass uns irgendjemand beobachtete, es lief mir kalt über den Rücken.
Widerwillig stieg Hardy ins Boot. Mit aller Kraft drückte ich uns vom Ufer ab. Peti ruderte wie von Sinnen, um schnellstmöglich die sichere Flussmitte zu erreichen.
„Was soll ich jetzt tun, ohne Matte …“
„Geh mir nicht auf den Geist mit der beschissenen Matte, schau dir lieber mal die zwei Gestalten am Ufer an!“, meinte Peti, in seinen funkelnden Augen spiegelte sich pure Furcht. Blitzschnell drehte ich mich um und tatsächlich, am Ufer standen zwei riesige Kerle in seltsamen Gewändern, die uns hinterher schauten. Der eine hatte doch wirklich Hardys Matte in der Hand und hielt sie hoch.
„He, der hat ja meine Thermomatte“, schrie Hardy, „lass uns umkehren!“ Er stoppte Petis wildes Rudern, indem er sich mit aller Kraft gegen ihn stemmte.
„Bist du wahnsinnig!“, schrie Peti und setzte sich zur Wehr.
„Was ist in euch gefahren, die sehen doch alle im Norden so aus. Es sind Samen, Rentierzüchter hier aus der Gegend. Bestimmt!“
„Samen, die über zwei Meter groß sind?“, fragte ich.
Ihre Gewänder schimmerten nicht in Blau wie üblich, sondern hatten die Farben weinrot mit schwarzen Verzierungen auf der Brust. Eine goldene Brosche hielt die Stoffgewänder, die bis zu den Füßen reichten, am Hals zusammen. Darunter trugen sie weiße Shirts mit einem großen Emblem. Außerdem besaßen sie keine trachtenüblichen Kapuzen. Ihr langes helles Haar hing glatt bis über die Brust und bedeckte die breiten, starken Schultern. Einer der beiden hielt sich an einem langen Holzstab fest und war im Besitz eines farbenfrohen Stirnbands. Sie trugen Leggings, die aus hellbraunem Leder gegerbt waren, und Mokassins. Diese Männer kamen nicht aus dem Norden. Sie waren eine Mischung aus nordamerikanischen Indianern, Chinesen wegen der schmalen Augen, und einem Hauch Afrikaner, denn ihre Hautfarbe war erkennbar dunkler als unsere. Gut, Hardys Hautfarbe war noch etwas dunkler. War es möglich, dass hier ein Film gedreht wurde? Die beiden sahen aus wie Statisten aus einem schlechten Endzeitepos. Absurde Ideen schossen mir durch den Kopf.
Wie besessen ruderte Peti auch dann noch weiter, als die Strömung längst unser Boot erfasst hatte.
„Peter!“, rief Hardy. Er bekam keine Antwort, wieder rief er: „Peti, sie sind fortgegangen, hör bitte mit dem Rudern auf, die Strömung ist stark genug. Was ist bloß in dich gefahren?“
Wie auf Kommando hörte Peti auf zu rudern. „Ich bekam plötzlich eine solche Bärenkraft und musste einfach rudern, ich konnte nicht anders.“
„Du meinst, du hattest die Hosen voll.“
„Vor den Männern etwa? Iwo, der eine heißt Namor und der andere Thessalla.“
„Wie war das? Woher willst du denn das wissen?“
„Das haben sie mir geflüstert“, beschwur Peti.
„Du hast doch überhaupt keine Silbe mit den Fremden gesprochen.“
„Das zwar nicht, ich weiß es aber trotzdem. Ich kann mir das auch nicht erklären. Stimmen in meinem Kopf verrieten mir ihre Namen.“
Gespannt lauschte ich dem feurigen Dialog, konnte aber nicht recht folgen, indessen wusste ich, dass das ziemlich abstrus klang, denn als wir davoneilten, glaubte ich auch Stimmen in meinen Ohren wahrzunehmen. Leider verstand ich sie nicht, da sie extrem undeutlich dröhnten. Namor oder Thessalla, die Namen klangen nicht gerade finnisch.
Wir fuhren flussabwärts. Nach einer Weile machte der Fluss eine lang gezogene Linksbiegung, die auf der Karte nicht verzeichnet war. Überhaupt waren viele Dinge nicht mehr dort, wo sie hätten sein sollen. Rechts erstreckte sich eine riesige Prallwand, Steilhänge von hunderten Metern Höhe, auf denen die Erdgeschichte anschaulich segmentiert war, wie in einer erdgeschichtlichen Enzyklopädie konnte man in den Segmenten lesen. Über dem Steilhang verlief eine sehr schmale Felsterrasse, auf der gerade eine Person Platz fände zum Wandern. Vereinzelt wuchsen hoch oben kleine Bäume und Sträucher aus Spalten und Rissen quer über den Fluss. Der unmittelbar dahinter angrenzende Felshöhenzug endete an einem prächtigen Tafelberg, der wie ein König über das Tal zu wachen schien. Jedem, der sich ihm näherte, würde er eine Salve Steine verpassen, so bedrohlich und finster sah er aus. Auf der gegenüberliegenden Seite erstreckte sich eine breite, flache Auenlandschaft. Dicht wucherndes, mannshohes Schilfgras verriet die Verlandungszone, die dahinter stehenden, gigantischen Bäume versperrten den Blick auf einen saftiggrünen Gleithang, der geradewegs auf eine Anhöhe führte, von der man nur noch die Kuppe sah. Kiesbänke zerschnitten hier und da den Schilfgürtel und boten gute Bootsanlegemöglichkeiten. Dem Angler hätten solche Bänke mitten im Schilf, wo der Hecht zu Hause war und jagte, das Anglerherz höher schlagen lassen. Annika bewunderte die noch völligintakte Naturwelt, die uns ein Schauspiel sondergleichen bot. Ein Flüstern tief aus meinem Inneren bat mich, an Land zu kommen. Eine fremde Stimme redete fortan auf mich ein. Widerwillig, schon eher unbewusst, machte ich also den anderen klar, eine Pause einzulegen, der Inari-See, unser eigentliches Ziel, könne nicht mehr allzuweit entfernt liegen.
„Das wollte ich auch gerade vorschlagen“, unterbrach mich Annika, während sie das Steuerruder freudig herumriss. Mit einem heftigen Ruck landeten wir auf einer der zahlreichen Kiesbänke. Es gab kein Zeichen von irgendwelchen Lebewesen, die sich bewegten, ausgenommen Vögel; derer gab es viele: kleine Wasservögel, die im Schilf pfiffen und piepsten, doch ließen sie sich selten blicken. Enten verließen fluchtartig das schutzbietende Schilf und stiegen wild flatternd auf. Ein- oder zweimal hörten wir das Rauschen und Schwirren von Schwanenflügeln, und als wir aufschauten, sahen wir eine lange Kette Gänse, die über den Himmel zog.
„Gänse“, sagte Peti, „und mächtig groß noch dazu!“





























