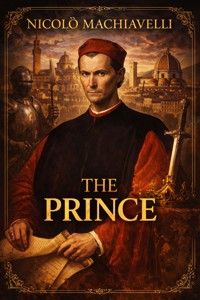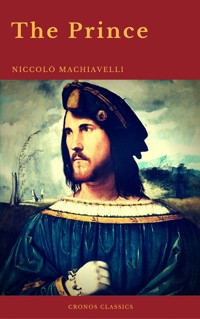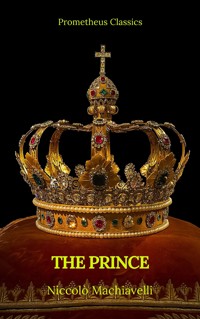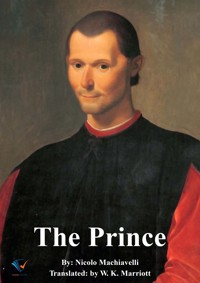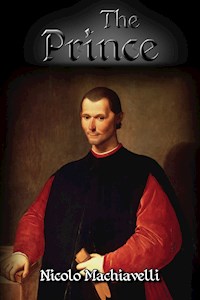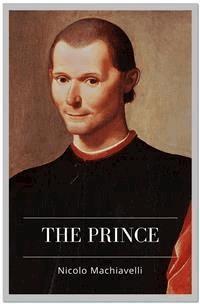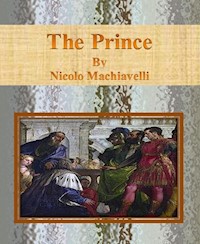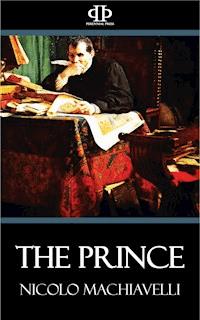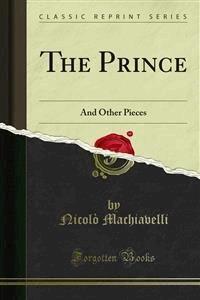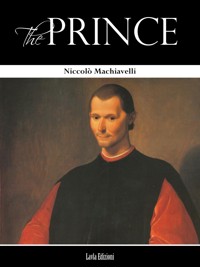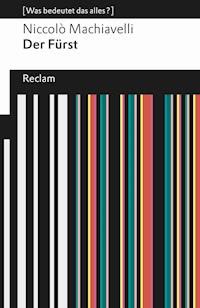
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek – [Was bedeutet das alles?]
- Sprache: Deutsch
Die 1513 erstmals erschienene Schrift widmet sich der Frage, wie man in einer feindlichen politischen Umwelt erfolgreich sein, Macht erwerben, diese Macht festigen und sogar noch ausweiten kann. Machiavelli beschreibt dabei die bis heute geltenden Mechanismen der Macht ohne jede Illusion und untersucht in schneidender Klarheit jene Notwendigkeiten, die mit dem hirnlosen Wüten eines an der Macht berauschten Tyrannen nichts zu tun haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Niccolò Machiavelli
Der Fürst
Übersetzt von Philipp Rippel
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 1986, 2014 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2016
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-960618-7
Inhalt
Niccolò Machiavelli an den erlauchten Lorenzo de’ Medici
Jene, die eines Fürsten Gunst zu gewinnen suchen, pflegen ihm zumeist mit solchen Dingen aus ihrer Habe zu nahen, die ihnen am teuersten sind oder von denen sie sehen, dass er an ihnen am meisten Vergnügen findet; so erhält er des öfteren Pferde, Waffen, Brokatstoffe, Edelsteine und ähnlichen Zierat, seiner Hoheit würdig, zum Geschenk. In dem Wunsch nun, mich Eurer Durchlaucht mit einem Zeugnis meiner Ergebenheit zu empfehlen, habe ich nichts in meinem Besitz gefunden, was mir teurer wäre oder was ich höher schätzte als die Kenntnis der Taten großer Männer, die ich mir durch lange Erfahrung mit den gegenwärtigen Zuständen und durch beständiges Studium der Verhältnisse des Altertums angeeignet habe; nachdem ich diese mit großer Sorgfalt lange durchdacht und überprüft hatte, habe ich sie jetzt in einem kleinen Band zusammengefasst, den ich Eurer Durchlaucht überreiche.
Obgleich ich dieses Werk nicht Eurer Hoheit für würdig erachte, vertraue ich dennoch darauf, dass Ihr es in Eurer Güte gnädig aufnehmt; denn ich könnte Euch kein größeres Geschenk machen, als Euch Gelegenheit zu geben, in kürzester Zeit mit all dem bekannt zu werden, was ich in so vielen Jahren und unter so vielen Unannehmlichkeiten und Gefahren erkannt und verstanden habe. Dieses Werk habe ich weder mit rhetorischen Floskeln geschmückt und ausgestattet, noch mit hochtrabenden und feierlichen Worten oder irgendeinem anderen äußerlichen Blendwerk und Zierat, mit denen viele ihr Thema vorzutragen und aufzuputzen pflegen; denn ich wollte, dass ihm nichts anderes zur Ehre gereiche, als durch die Mannigfaltigkeit des Inhalts und die Bedeutung des Gegenstandes zu gefallen. Auch möchte ich nicht, dass man es für Anmaßung halte, wenn ein Mann von geringem und durchaus niederem Stande sich erkühnt, Erörterungen über die Fürstenherrschaft anzustellen und sie in Regeln zu fassen; denn wie die Landschaftszeichner sich unten in die Ebene stellen, um den Anblick der Berge und der hochgelegenen Orte zu erfassen, und sich nach oben auf die Berge begeben, um die Weite der Niederungen zu überblicken, so muss man Fürst sein, um den Charakter der Völker zu verstehen, und dem Volk angehören, um das Wesen der Fürsten recht zu erkennen.
So möge denn Eure Durchlaucht diese kleine Gabe in eben dem Sinne entgegennehmen, in dem ich sie überreiche; wenn Ihr darin aufmerksam lest und studiert, könnt Ihr daraus meinen sehnlichsten Wunsch entnehmen, dass Ihr jene Größe erlangen möget, die Euch das Glück und Eure Talente versprechen. Und wenn Eure Durchlaucht von dem Gipfel Eurer Erhabenheit gelegentlich einen Blick in die Niederungen werfen wollen, so werdet Ihr bemerken, wie unverdient ich große und andauernde Ungunst des Schicksals zu ertragen habe.
I. Von den Formen der Fürstenherrschaft und den Arten, sie zu erwerben
Alle Staaten, alle Reiche, die über die Menschen Macht hatten und haben, waren und sind Republiken oder Fürstenherrschaften. Die Fürstenherrschaften sind entweder ererbt, sofern das Geschlecht ihres Herrschers seit langer Zeit regiert, oder sie sind neu erworben. Die neuerworbenen sind entweder völlig neu, wie es Mailand für Francesco Sforza war, oder sie sind als Glieder dem ererbten Staat des Fürsten angefügt, der sie erworben hat, wie das Königreich Neapel dem Reich des Königs von Spanien. Die so erworbenen Gebiete sind es gewohnt, entweder unter einem Fürsten zu leben oder aber frei zu sein; und ihr Erwerb geschieht entweder mit fremden oder mit eigenen Waffen, durch Glück oder durch Tüchtigkeit.
II. Von der ererbten Fürstenherrschaft
Von einer Erörterung der Republiken will ich hier absehen, da ich mich bei anderer Gelegenheit ausführlich damit befasst habe. Ich will mich allein der Fürstenherrschaft zuwenden und in der oben genannten Reihenfolge untersuchen, wie Fürstentümer regiert und behauptet werden können.
Zunächst erkläre ich, dass in den ererbten Staaten, die an das Geschlecht ihrer Fürsten gewöhnt sind, viel geringere Schwierigkeiten bestehen, die Macht zu behaupten, als in den neuerworbenen. Genügt es doch, die politischen Einrichtungen der Vorfahren lediglich nicht zu vernachlässigen und sich im übrigen dem Zeitgeschehen anzupassen. Auf diese Weise wird sich auch ein Fürst von durchschnittlichen Fähigkeiten stets in seinem Staat behaupten, es sei denn, dieser würde ihm von einer außergewöhnlichen und überragenden Macht geraubt; und selbst dann wird er ihn beim ersten Missgeschick des Eroberers zurückgewinnen.
Wir haben hierfür in Italien ein Beispiel am Herzog von Ferrara, der 1484 den Angriffen der Venezianer und 1510 denen des Papstes Julius nur deshalb standhielt, weil sein Geschlecht seit alters dieses Gebiet regierte. Da es nämlich für den angestammten Fürsten weniger Gründe und geringere Notwendigkeit gibt, Gewalt anzuwenden, genießt er größere Beliebtheit; und wenn er sich nicht durch außergewöhnliche Laster verhasst macht, ist es einsichtig, dass seine Untertanen ihm auf natürliche Weise zugeneigt sind. Auch lassen das Alter und die Beständigkeit der Herrschaft den Gedanken an frühere Neuerungen und die dafür ausschlaggebenden Beweggründe vergessen; denn stets hinterlässt eine Veränderung an einem Gebäude den Ansatz für eine weitere Veränderung.
III. Von der gemischten Fürstenherrschaft
Ein neuerworbenes Fürstentum bringt jedoch Schwierigkeiten mit sich. Beginnen wir mit demjenigen, das nicht völlig neu, sondern einem ererbten Staat angegliedert worden ist (weshalb man das Ganze in gewissem Sinn ›gemischt‹ nennen kann). Hier kommt es zu Unruhen vor allem infolge einer Schwierigkeit, die in der Natur der Sache liegt und in allen neuen Fürstentümern auftritt: Wechseln doch die Menschen gern ihren Herrn in dem Glauben, dadurch ihre Lage zu verbessern; ja dieser Glaube lässt sie gegen ihren Herrn zu den Waffen greifen; dabei aber werden sie Opfer einer Täuschung, denn die Erfahrung zeigt ihnen, dass sie ihre Lage verschlechtert haben. Dies ergibt sich wiederum aus der ebenso natürlichen wie allgemeinen Notwendigkeit, wonach ein Fürst die neu unterworfenen Untertanen sei es durch militärische Besetzung, sei es durch zahllose andere Gewaltanwendungen verletzen muss, wie eine neue Eroberung sie eben nach sich zieht. Damit machst du dir alle zu Feinden, die du bei der Besetzung jenes Herrschaftsgebiets geschädigt hast, und du kannst dir nicht die Freundschaft derer bewahren, die dich in ihr Land geholt haben, weil du sie nicht ihren Erwartungen gemäß zufriedenstellen und weil du ihnen gegenüber keine harten Maßnahmen ergreifen kannst, da du ihnen verpflichtet bist. Mag einer noch so stark durch seine Heeresmacht sein, so ist er doch stets auf die Zuneigung der Einwohner angewiesen, wenn er in ein Land eindringt. Aus diesen Gründen hat Ludwig XII., König von Frankreich, Mailand ebenso rasch besetzt wie verloren. Beim ersten Mal reichten die eigenen Streitkräfte eines Ludovico Sforza aus, um Ludwig die Stadt wieder zu entreißen; denn diejenigen Einwohner, die ihm die Tore geöffnet hatten, sahen sich in ihren Hoffnungen auf die zukünftigen Vorteile, die sie sich versprochen hatten, getäuscht und waren daher nicht bereit, die Unannehmlichkeiten durch den neuen Herrscher hinzunehmen.
Es ist richtig, dass abgefallene Länder, wenn sie zurückerobert werden, weniger leicht wieder verloren gehen; denn der Herrscher nimmt die Erhebung zum Anlass, ohne weitere Rücksicht seine Macht dadurch zu sichern, dass er die Schuldigen bestraft, die Verdächtigen entlarvt und sich an seinen schwächsten Stellen besser schützt. So genügte es das erste Mal, um Mailand von Frankreich wieder abfallen zu lassen, dass Herzog Ludovico an Mailands Grenzen Aufruhr stiftete; zum zweiten Mal ging es den Franzosen jedoch erst verloren, als sie die ganze Welt gegen sich hatten und ihre Heere vernichtet oder aus Italien vertrieben waren. Dies ergibt sich aus den oben dargelegten Gründen. Dennoch wurde Mailand den Franzosen das erste und das zweite Mal entrissen.
Die allgemeinen Gründe für das erste Mal wurden bereits erörtert; es bleibt noch übrig, die für das zweite Mal maßgeblichen zu benennen und herauszufinden, über welche Mittel der König von Frankreich verfügte und zu welchen ein anderer an seiner Stelle gegriffen hätte, um besser als jener das eroberte Gebiet behaupten zu können. Zunächst lässt sich sagen, dass Staaten, die durch Eroberung einem ererbten Staat des Eroberers angegliedert werden, entweder demselben Land und derselben Sprache angehören oder nicht. Im ersten Fall ist es sehr leicht, Herr über sie zu bleiben, besonders wenn sie nicht gewohnt sind, frei zu sein; und um sich ihren Besitz zu sichern, genügt es, das Geschlecht des bisher regierenden Fürsten auszulöschen. Denn die Bevölkerung verhält sich ruhig, solange man ihr in den übrigen Angelegenheiten die alte Ordnung belässt und ihre Lebensgewohnheiten nicht verändert. Das sehen wir am Beispiel Burgunds, der Bretagne, der Gascogne und der Normandie, die schon seit so langer Zeit mit Frankreich vereint sind; und wenn auch gewisse Unterschiede der Sprache bestehen, so ähneln sich doch die Lebensgewohnheiten und sind leicht miteinander verträglich. Wer solche Staaten erobert und sie behalten will, muss zwei Dinge beachten: Erstens muss er das Geschlecht ihres bisherigen Fürsten auslöschen, zweitens darf er weder ihre Gesetze noch ihre Abgaben ändern; auf diese Weise verschmelzen in kürzester Zeit alte und neue Herrschaft zu einem Ganzen.
Wenn man hingegen Staaten in einer Gegend erwirbt, deren Sprache, Sitten und Einrichtungen einem fremd sind, so stößt man auf Schwierigkeiten, und es ist ebenso viel Glück wie Energie nötig, um sie zu behalten. Eines der besten und wirksamsten Mittel bestünde darin, dass der Eroberer sich dort selbst niederließe. Damit würde er seinen neuen Besitz sicherer und dauerhafter machen. So sind die Türken in Griechenland vorgegangen, das sie trotz aller anderen Maßnahmen zur Behauptung ihrer Macht nur deshalb halten konnten, weil ihr Herrscher seinen Wohnsitz dorthin verlegt hatte. Bist du nämlich dort ansässig, so werden dir ausbrechende Unruhen sogleich bekannt, und du kannst sie rasch ersticken; bist du es aber nicht, so erfährst du von ihnen erst, wenn sie sich ausgebreitet haben und es kein Mittel mehr gegen sie gibt. Außerdem kann das Land nicht von deinen Beamten ausgeplündert werden. Die Untertanen genießen die Möglichkeit des unmittelbaren Zugangs zum Fürsten, so dass sie mehr Grund haben, ihn zu lieben, wenn sie gutwillig sind, und ihn zu fürchten, wenn sie anderen Sinnes sind. Wer unter den ausländischen Herrschern etwa die Absicht hätte, diesen Staat anzugreifen, wird mehr Respekt bekommen; denn solange der Fürst in diesem Gebiet ansässig ist, wird er es schwerlich wieder verlieren.
Das zweite sehr gute Mittel besteht darin, an ein oder zwei Stellen Kolonien anzulegen, die gleichsam dem Land zur Fessel werden; denn es ist nötig, entweder dies zu tun oder dort eine starke Besatzung zu unterhalten. Die Kolonien sind nicht mit großen Unkosten verbunden; ohne oder mit geringen Ausgaben lassen sie sich gründen und aufrechterhalten; und es werden nur die geschädigt, denen die Felder und Höfe genommen werden, um sie den neuen Bewohnern zu geben, was nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung betrifft. Da jene, die geschädigt wurden, zerstreut und in Armut leben, können sie gegen den Fürsten niemals etwas ausrichten; alle anderen bleiben einerseits frei von Einbußen und werden folglich Ruhe bewahren, andererseits hüten sie sich vor Verfehlungen aus Furcht, es könnte ihnen das gleiche widerfahren wie denen, die um ihr Eigentum gebracht wurden. Ich komme daher zu dem Schluss, dass diese Kolonien keine Unkosten machen, von größerer Ergebenheit sind und die Untertanen weniger schädigen; und die Geschädigten können nicht aufbegehren, da sie arm sind und zerstreut leben, wie schon gesagt wurde. Es gilt also festzuhalten, dass man die Menschen entweder verwöhnen oder vernichten muss; denn für leichte Demütigungen nehmen sie Rache, für schwere können sie dies nicht tun; also muss der Schaden, den man anderen zufügt, so groß sein, dass man keine Rache zu fürchten braucht. Unterhält man aber anstelle von Kolonien eine Besatzung, fallen beträchtlich höhere Unkosten an, wobei alle Einkünfte dieses Landes für seine Überwachung aufgewandt werden müssen und der Gewinn in Verlust umschlägt; auch entsteht größerer Verdruss, weil durch ständige Truppenverlegungen das ganze Land unter Einquartierungen leidet; das erfüllt jeden mit Missbehagen und lässt ihn zum Feind des neuen Fürsten werden; und zwar sind dies Feinde, die ihm schaden können, da sie – wenn auch besiegt – weiter auf ihren Höfen bleiben. In jeder Hinsicht ist darum diese Form der Bewachung ebenso untauglich, wie jene durch Kolonien von Nutzen ist.
Außerdem muss, wer eine Provinz mit fremden Sitten und Gebräuchen – wie sie hier in Rede steht – unterworfen hat, sich zum Oberhaupt und Schutzherrn der schwächeren Nachbarn machen und sich bemühen, die Mächtigen des Landes zu schwächen; desgleichen muss er verhüten, dass dort aus irgendeinem Anlass ein Fremder eindringt, der ebenso mächtig ist wie er selbst. Stets werden die Eroberer von denjenigen ins Land geholt, die darin aus zu großem Ehrgeiz oder aus Furcht unzufrieden sind; so haben die Ätoler ehedem die Römer nach Griechenland gerufen; wie diese auch in allen anderen Provinzen, in die sie einmarschierten, von den Einwohnern herbeigerufen worden waren. Es liegt in der Natur der Dinge, dass einem ausländischen Eroberer, sobald er in ein Land einfällt, alle Schwächeren darin zulaufen, getrieben von der Missgunst auf diejenigen, die ihnen gegenüber an Macht überlegen waren; daher kostet es den Eroberer keinerlei Mühe, diese Schwächeren für sich zu gewinnen; denn sogleich sind sie allesamt bereit, mit dem Regime des neuen Herrschers gemeinsame Sache zu machen. Er muss nur darauf bedacht sein, dass sie nicht zu viel Macht und Einfluss gewinnen; auch kann er leicht mit ihrem Wohlwollen und mit seinen Streitkräften die Mächtigen schwächen, um unbeschränkt Herr über dieses Land zu bleiben. Wer jedoch diese Rolle nicht gut zu spielen weiß, wird leicht wieder verlieren, was er erobert hat, und solange er es behält, wird er dort unzählige Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten haben.
Geschickt haben die Römer diese Kunstgriffe in den von ihnen eingenommenen Provinzen gehandhabt: sie legten Kolonien an, standen den Schwächeren bei, ohne deren Macht zu stärken, sie schwächten die Mächtigen und ließen keine ausländischen Machthaber dort Einfluss gewinnen. Ich will mich mit der Provinz Griechenland als einzigem Beispiel begnügen: die Achäer und die Ätoler wurden von ihnen unterstützt; das Königreich der Mazedonier geschwächt und Antiochus daraus verjagt; auch bewirkten die Verdienste der Achäer und der Ätoler nie, dass sie ihnen erlaubt hätten, ihre Staaten zu vergrößern; weder verleiteten die Überredungskünste Philipps sie jemals dazu, seine Freunde zu werden, ohne seine Macht zu beschneiden; noch konnte Antiochus mit seiner Macht ihnen das Zugeständnis abringen, einen Staat in diesem Land für sich zu behalten. Die Römer taten daher in diesen Fällen das, was alle klugen Fürsten tun müssen: diese haben nicht nur auf die gegenwärtigen Unruhen zu achten, sondern auch auf die zukünftigen, und müssen sie unter Aufbietung aller ihrer Kräfte im Keim ersticken; denn wer rechtzeitig vorbeugt, kann leicht heilen; wenn man jedoch wartet, bis die Unruhen ausgebrochen sind, kommt jede Medizin zu spät, denn die Krankheit ist unheilbar geworden. Es steht damit wie mit der Schwindsucht, die – wie die Ärzte sagen – am Beginn der Erkrankung leicht zu heilen und schwer zu erkennen ist, aber im Laufe der Zeit, wenn sie anfangs nicht erkannt und behandelt wurde, sich leicht erkennen und nur schwer heilen lässt. Ebenso verhält es sich mit dem Staatswesen; wenn man im voraus die darin aufkeimenden Übel erkennt (was nur dem Klugen gegeben ist), so kann man sie rasch kurieren; lässt man sie jedoch, weil man sie nicht erkannt hat, sich auswachsen, bis jeder sie wahrnimmt, dann gibt es kein Mittel mehr dagegen.
Daher haben die Römer, wenn sie Missstände voraussahen, stets Abhilfe geschaffen; und sie ließen sich jene nie lange hinziehen, nur um einem Krieg aus dem Wege zu gehen; denn sie wussten, dass man den Krieg nicht abschaffen, sondern nur zum Vorteil der anderen aufschieben kann; deshalb wollten sie in Griechenland gegen Philipp und Antiochus Krieg führen, um dies nicht in Italien tun zu müssen, obwohl sie damals das eine wie das andere hätten vermeiden können, was sie jedoch nicht wollten. Auch sagte ihnen niemals jener Leitsatz zu, den die Neunmalklugen unserer Zeit den ganzen Tag über im Munde führen: »Zeit gewonnen, alles gewonnen«, sondern sie erfreuten sich der Erfolge ihrer Tüchtigkeit und ihrer Klugheit; denn die Zeit jagt alles vor sich her und kann Gutes wie Schlechtes und Schlechtes wie Gutes bringen.
Aber kommen wir auf Frankreich zurück und untersuchen wir, ob es irgendeine von den genannten Regeln angewandt hat; und zwar möchte ich nicht von Karl, sondern von Ludwig reden als von demjenigen, dessen Vorgehen man besser verfolgen konnte, weil er länger in Italien geherrscht hat; und ihr werdet sehen, dass er das Gegenteil von dem getan hat, was man tun muss, um einen Staat in einem Land von fremden Sitten und Gebräuchen zu behaupten.
König Ludwig wurde nach Italien gerufen von dem Machteifer der Venezianer, die sich die halbe Lombardei durch seinen Einmarsch anzueignen hofften. Ich will diese von dem König getroffene Entscheidung nicht tadeln; denn da er in Italien Fuß fassen wollte und in diesem Land keine Freunde hatte, sondern ihm wegen des Verhaltens von König Karl alle Türen verschlossen waren, sah er sich gezwungen, jedes Bündnis einzugehen, das er nur konnte; und der reiflich erwogene Entschluss hätte sich für ihn gelohnt, wenn er bei seinen übrigen Unternehmungen keinerlei Fehler begangen hätte. Nachdem nämlich der König die Lombardei erobert hatte, gewann er sogleich das Ansehen zurück, das Frankreich durch Karl verloren hatte: Genua ergab sich; die Florentiner wurden seine Bundesgenossen; der Markgraf von Mantua, der Herzog von Ferrara, Bentivoglio, die Herrin von Forlì, die Herren von Faenza, von Pesaro, Rimini, Camerino und Piombino, die Republiken Lucca, Pisa, Siena, ein jeder kam ihm entgegen, um ihm seine Freundschaft anzutragen. Jetzt konnten die Venezianer die Unbesonnenheit des von ihnen gefassten Entschlusses ermessen: hatten sie doch, um zwei Städte in der Lombardei zu gewinnen, den König zum Herrn über ein Drittel Italiens gemacht.
Man bedenke nun, mit wie wenig Schwierigkeiten der König sein Ansehen in Italien hätte behaupten können, wenn er die oben angegebenen Regeln beachtet und alle seine Bundesgenossen gesichert und geschützt hätte, die – zahlreich und schwach – teils die Kirche, teils die Venezianer fürchteten und daher stets gezwungen waren, an seiner Seite zu bleiben; durch sie hätte er sich leicht derer versichern können, die mächtig geblieben waren. Aber kaum war er in Mailand, da tat er das Gegenteil, indem er Papst Alexander half, die Romagna zu erobern. Er bemerkte bei dieser Entscheidung nicht, dass er sich selbst schwächte, indem er sich dadurch der Bundesgenossen und derjenigen beraubte, die bei ihm ihre Zuflucht genommen hatten, und die Kirche stärkte, indem er der geistlichen Macht, die ihr so große Geltung verleiht, noch so viel weltliche hinzufügte. Nachdem er nun den ersten Fehler begangen hatte, war er gezwungen, in diesem Sinn fortzufahren, so dass er schließlich genötigt war, selbst nach Italien zu kommen, um dem Ehrgeiz Alexanders Schranken zu setzen und ihn daran zu hindern, Herr über die Toskana zu werden. Als genügte es ihm nicht, die Kirche groß gemacht und sich seiner Bundesgenossen beraubt zu haben, wollte er nun noch das Königreich Neapel dadurch gewinnen, dass er es mit dem König von Spanien teilte; war er zuvor unumschränkter Herr Italiens, so setzte er jetzt einen Mitregenten ein, wodurch die Ehrgeizigen des Landes und die mit ihm Unzufriedenen jemanden hatten, bei dem sie Rückhalt fanden; und statt in diesem Königreich einen ihm tributpflichtigen König zu belassen, entfernte er diesen, um einen anderen einzusetzen, der ihn selbst daraus vertreiben konnte.
Die Eroberungslust ist wahrlich eine sehr natürliche und verbreitete Erscheinung; und immer, wenn die Menschen – die dazu imstande sind – Eroberungen machen, werden sie gelobt oder wenigstens nicht getadelt; wenn sie aber nicht dazu imstande sind und doch unter allen Umständen Eroberungen machen wollen, so ist dies verfehlt und tadelnswert. War also Frankreich fähig, mit seinen eigenen Streitkräften Neapel anzugreifen, so hätte es dies tun sollen; war es aber nicht dazu fähig, so hätte es Neapel nicht mit anderen teilen dürfen; und wenn auch die Teilung der Lombardei mit den Venezianern Entschuldigung verdient, insofern Frankreich dadurch in Italien Fuß fasste, so verdient doch die Teilung Neapels Tadel, da sie nicht durch dieselbe Notwendigkeit gerechtfertigt ist.
Ludwig hatte demnach folgende fünf Fehler begangen: er hatte die Schwächeren vernichtet; die Macht eines Mächtigen in Italien gesteigert; einen besonders mächtigen Fremden