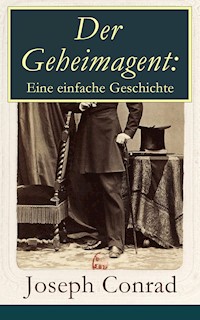
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der Geheimagent: Eine einfache Geschichte" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Joseph Conrad (1857-1924) war ein Schriftsteller polnischer Herkunft, der seine Werke in englischer Sprache verfasste. Seine bekanntesten Werke sind die Romane Lord Jim, Nostromo und Herz der Finsternis. Letzteres ist bis heute das meistzitierte und wirkmächtigste und wurde im Rahmen der literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskurse zu den Themen Postmoderne und Postkolonialismus häufig diskutiert und neuartig interpretiert. Der Roman "Der Geheimagent: Eine einfache Geschichte" gehört mit "Nostromo" und "Mit den Augen des Westens" zu den politischen Romanen Conrads. Hinter der Ebene des Spionageromans verbirgt sich eine komplexe und ironische Auseinandersetzung mit dem kleinbürgerlichen Leben in der modernen Großstadt. Conrad selbst hielt ihn für einen seiner besten Romane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Geheimagent: Eine einfache Geschichte
Ein politischer Roman (Anarchismus, Spionage und Terrorismus)
Übersetzer: Ernst W. Freißler
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Über einen solchen Fall habe ich schon einmal geschrieben. Das war, als ich das Werk eines deutschen Dichters französischer Nation und insbesondere seinen glücklichsten, uns ganz zum populären Besitz gewordenen Beitrag, den »Peter Schlemihl« wieder einmal bei uns »einzuleiten« hatte. Hier ist das Gegenstück unserer Tage, ein polnisch-englisches zur Abwechslung: es ist nicht unsere Anziehungskraft, die sich diesmal bewährt; wir sind unbeteiligt, wir übersetzen nur; doch soll das unser Vergnügen an dem schönen, merkwürdigen Falle nicht schmälern, und so neidlos gefesselt wollen wir darauf blicken, wie einst die anderen auf das Phänomen von Chamissos deutschem Dichtertum. Das Vorkommnis individueller Verliebtheit in eine andere nationale Lebensform, der entschlossenen und radikalen Auswanderung, der völligen persönlichen und geistigen Naturalisation in fremder Volkssphäre, so, als handle es sich um die menschlich-intelligente Richtigstellung eines Irrtums der fehlbaren Natur, – wiederholt sich, wie es scheint, mit einer gewissen Regelmäßigkeit in der Geschichte der Kultur und der Dichtung, und derjenige, dessen gesunde Ehrfurcht vor dem Natürlichen mit einiger weniger gesunden, aber menschlich nicht unanständigen Ironie gegen dies zweifellos heilige Element gemischt ist, wird die verzerrte Miene vermeiden, mit der man eine Monstrosität beobachtet, sondern mit Sympathie und Genugtuung eine nationale Freizügigkeit feststellen, deren Ergebnis nicht Kulturlosigkeit und seelischer Tod, sondern eine von allen Völkern bewunderte kulturelle Leistung war.
Nicht leicht zu sagen, aus welchem Grunde heut ein Franzose sollte geistig zum Deutschtum hinüberwechseln. Einst, in romantischen Zeiten, konnte es geschehen schlechthin aus Liebe zur Poesie. Wir waren das Land der Dichter und Denker; ein Dichter sein und deutsche Verse machen war bis zu einem gewissen Grade ein und dasselbe; man fühlte sich überall zum Deutschtum hingezogen, wenn man sich zur Poesie hingezogen fühlte, und Chamisso wurde deutsch, um ein deutscher Dichter zu sein. Der Fall Conrad liegt charakteristisch anders – charakteristisch sowohl in nationaler wie in zeitlicher Hinsicht. Der Pole ist durchaus nicht Engländer geworden, um englischer Schriftsteller zu werden, – soweit ich unterrichtet bin, hat ihm dieser Gedanke sehr fern gelegen. Er ist es geworden, um Seemann, a sailor, zu sein, aus unwiderstehlicher Lust zur Schifffahrt, – und hier nun werden die Fälle wieder verwandt. Denn da er, um Segler zu werden, ja auch zur französischen, russischen, deutschen Marine hätte gehen können, so muß das Englische und das Seemännische ihm in ähnlicher Weise und ähnlichem Grade zusammengefallen sein, wie dem Dichter des »Schlemihl« einst Poesie und Deutschtum; beide Male ist es ein Wechsel der Nationalität aus Leidenschaft für den Hauptberuf eines anderen Volkes, denjenigen, worin es sprichwörtlicherweise vor anderen glänzt, und die nationalen, wie namentlich auch die zeitlichen Umstände brachten es mit sich, daß Conrads Motive zur Konversion weit weniger geistiger Art waren als die Chamissos.
Doch wäre es wohl altmodisch-romantisch, das Geistige allzu eng zu fassen und es dem Literarischen gleichzusetzen. Die Liebe des Polen zum Seemännischen, das ihm das Englische war, wird von Anfang an mit tiefer Sympathie für englisches Wesen überhaupt, englische Lebenshaltung und -stimmung, englischen Tonfall und Sprachgeist verbunden gewesen sein; ohne Sprachlich-Geistiges geht es von vornherein nicht ab bei einer solchen Leidenschaft; am Ende war Conrads Konvertitentum nicht weniger »dichterisch«, als das Chamissos, und er wäre kaum englischer Schriftsteller geworden, nachdem er englischer Seemann gewesen, wenn nicht das Dichterische immer einschlägig gewesen wäre in seinem Träumen und Tun, wenn nicht sein ganzes exzentrisches Trachten aus den natürlichen Bindungen weg in eine fremde, geheimnisvoll wahlverwandte Sphäre schon das eines Phantasten und Poeten gewesen wäre.
Vor allem war seine Liebe zum Meere und den Abenteuern des Meeres zweifellos eine Dichterliebe, und vom Meere, vom Leben auf ihm und mit ihm hat er erzählt, als er an Land gegangen war, fast nur hiervon, in der klassischen Sprache der Seefahrer, auf englisch, – so ganz auf englisch, daß wenigstens dem Nichtengländer scheint, es hätte nicht englischer geschehen können, und daß in der Tat sein heute europäischer Ruhm der eines großen britischen Autors ist.
Als ich vor Jahren den Haag besuchte, hielt Galsworthy dort eben einen Vortrag über »Conrad und Tolstoi«. Ich hatte keine Ahnung, wer das sei, den man da mit dem russischen Giganten zusammenstellte; und mein Erstauen widerholte sich, als ich hörte, daß André Gide englisch gelernt habe, ausdrücklich, um Conrad im Original lesen zu können. Seitdem habe ich dies Erzählerphänomen kennengelernt in einigen seiner stärksten Werke: Ich las die dämonische Geschichte einer Windstille, genannt »Die Schattenlinie«, und die Geschichte eines Sturmes, die »Der Nigger vom Narzissus« heißt. Auch von den Büchern, die nur zum Teil auf dem Meere oder ganz auf dem festen Lande spielen, wie der technisch überaus verzwickte und virtuose Roman »Spiel des Zufalls« und dieses hier, die glänzende, packende Kriminalgeschichte »Der Geheimagent«, las ich dies und das und bin voll genug davon, um mich nicht unberufen zu fühlen, unserem Publikum irgendeines, maritim oder nicht maritim, also zum Beispiel den bewunderungswürdigen »Geheimagenten« persönlich ans Herz zu legen, – diesen, wenn ich es mir überlege, gerade deshalb, weil darin nicht zur See gefahren wird, und weil es für mein Gefühl eine ungerechte Schmälerung von Conrads jungem deutschen Ruhm bedeuten würde, wenn er allzu seemännischen Spezialcharakter gewönne. Ich gebe zu, daß das tiefste und persönlichste dichterische Erlebnis dieses Mannes das Meer, die gefährliche Kameradschaft mit dem Elemente gewesen ist und daß seine auffallendsten künstlerischen Leistungen auf diesem Gebiete liegen. Aber sein männliches Talent, sein Engländertum, seine freie Stirn, sein fester, kühler und humoristischer Blick, seine erzählerische Verve, Kraft und ernste Lustigkeit bewähren sich nicht weniger, wenn er sich auf dem Trockenen hält und das gesellschaftliche Leben des Festlandes anschaut, durchschaut und kritisch-plastisch gestaltet, wie in der vorliegenden spannenden, ja aufregenden Geschichte, einer Kriminalgeschichte, wie gesagt, und einer politischen Geschichte dazu, der Geschichte einer ausländischen, allzu ausländischen Gesandtschaftsintrige und ihrer tragisch-menschlichen Auswirkungen ...
Es ist eine antirussische Geschichte, deutlich gesagt, antirussisch in einem sehr britischen Sinn und Geist; große Politik steht hinter ihr, der große englisch-russische Weltgegensatz, und ich halte für möglich, daß dieser Gegensatz auch den Hintergrund – ich will nicht sagen: das Motiv – der leidenschaftlichen Englandliebe des Polen schon immer gebildet hatte. Handelte es sich um einen Deutschen, so wäre die Unterstellung kühn. Wir sind »Metaphysiker«; weder bewußt noch unbewußt würden wir je das Politische Einfluß auf unser Seelenleben gewinnen lassen. Aber wir haben angefangen, einzusehen, daß es bei anderen vielleicht etwas anderes ist, und daher meine Vermutung, daß polnische Antipathie gegen das Russentum sich in diesem Roman auf britisch auslebt.
Sie tut es namentlich in der Figur eines Herrn Vladimir, ersten Sekretärs der diplomatischen Vertretung einer auswärtigen, allzu auswärtigen Macht in London, der eigentlich die ganze Geschichte auf dem Gewissen hat und der, obgleich ein eleganter Mann, gelegentlich mit schlecht verhehlter Zustimmung des Autors ein »hyperboreisches Schwein« genannt wird. Von glatten Sitten im allgemeinen, nimmt er im Affekt eine »orientalische Ausdrucksweise« an und bekommt einen Kehlton, der schon nicht mehr nur unenglisch, sondern auch uneuropäisch, »innerasiatisch« anmutet. »Als Abkömmling einer langen Geschlechterreihe von Untertanen einer unumschränkten Macht«, heißt es von ihm, »hatte er aus Rasse- wie aus persönlicher Anlage Angst vor der Polizei ... Aber das Gefühl, das mit dem unvernünftigen Abscheu mancher Leute vor Katzen Ähnlichkeit hatte, hielt vor seiner unendlichen Geringschätzung der englischen Polizei nicht stand.« – »Die Wachsamkeit der Polizei«, sagt er – oder einer seiner Untergebenen sagt es für ihn –, »und die Strenge der Behörden! – Die allgemeine Milde des Gerichtsverfahrens hier und das völlige Fehlen von Unterdrückungsmaßnahmen sind ein europäischer Skandal. Was gerade jetzt gewünscht wird, ist die Betonung der Rastlosigkeit – der Gärung, die zweifellos vorhanden ist.« Es tagt nämlich in Mailand eine internationale Konferenz gegen die soziale Revolution. »Wir wollen der Konferenz in Mailand ein kleines Stimulans eingeben«, äußert Herr Vladimir »leichthin«. »Ihre Erwägungen über internationale Maßnahmen zur Unterdrückung politischer Verbrechen scheinen zu keinem Ende zu führen; England läßt aus. Dieses Land ist ganz lächerlich mit seiner gefühlsduseligen Rücksichtnahme auf persönliche Freiheit ... England muß aufgerüttelt werden ...«
Diese antisarmatische Satire, so leicht sie hingeworfen ist, strotzt von Stolz auf englische Freiheit und Zivilisation. Das verhaßte Russentum, britisch verhaßt, aber vielleicht ursprünglich polnisch verhaßt, wird zum Schuldigen gemacht an aller menschlichen Tragödie des Romans: an dem Tode des armen kleinen Stevie, der Ermordung des bemitleidenswerten Schurken Verloc, an dem Selbstmorde seiner Frau. Ist Conrad englischer in irgendeiner seiner Bordgeschichten als in dieser politischen Kriminalgeschichte? Zu Herrn Vladimir sagt ein braver britischer Polizeikommissar: »Was mir an der Sache am meisten gefällt, ist, daß sie eine so vorzügliche Handhabe zu einem Unternehmen bietet, das meiner Überzeugung nach unbedingt begonnen werden muß – das ist, zu der Säuberung dieses Landes von all den ausländischen Spitzeln, Polizisten und – Hunden dieser Art.« Hunde, das ist ein Ausdruck des Herrn Vladimir, ein orientalisch-innerasiatischer Ausdruck, im fremdartigen Kehlton zu sprechen, über welchen heutige Sowjetagenten wohl nicht schlechter verfügen, als Personen von der Art des Herrn Vladimir – was ich nur anmerke, um zu zeigen, daß unser Roman nicht veraltet ist, weil er unter dem Zarenreich spielt, und daß der westöstliche Gegensatz, der seinen weltpolitischen Hintergrund bildet, durch einen Regierungswechsel im Osten an Lebendigkeit nicht eingebüßt hat. Und hier noch eine Vermutung. Sollte nicht die entschiedene und schon tendenziöse Westlichkeit dieses außerordentlichen und in England, Frankreich, Amerika längst hochberühmten Schriftstellers schuld, gewissermaßen schuld daran sein, daß er in unserer »Mitte«, welche sich einer so entschlossenen und einseitigen Option instinktweise allezeit wird enthalten müssen, bisher so geringe Resonanz gefunden hat? Eine Zeitlang sah es so aus, als hätten wir gewählt, politisch und geistig-kulturell, nämlich den Osten; und das war gerade die Zeit, während der in Westeuropa Conrads Ruhm sich entfaltete. Für uns stand diese Erzählergestalt im Schatten Dostojewskis – einem Schatten, der, wir wollen das auch heute sachlich zugeben, drei bis vier Conrads zudecken und kaltzustellen imstande bleibt. Und doch hat sich manches geändert seitdem bei uns zulande; die Macht jenes epileptisch-apokalyptischen Sehertums über den deutschen Sinn ist bis zu einem gewissen Grade gebrochen; wir sind im Begriffe, uns vom christlich-byzantinischen Morgen zur Mitte, zu uns und also auch zu dem, was humanistischer und liberaler Westen in uns ist, zurückzufinden, und wenn nun ein führender Verlag die Hauptwerke des slawischen Wahlengländers in deutscher Sprache sammelt, so zeugt das von zutreffender Empfindung für die verbesserten Glückschancen, die dieser Dichter heute bei uns besitzt.
Nein, Conrad ist bei weitem nicht so groß wie Dostojewski! Aber ist es das Format allein, das unsere Liebe bestimmt? Es gäbe dann nichts zu lieben in einer Epoche, die vorderhand durchaus grazilere, schmächtigere Geistesformen aufweist, als die vergangene, als das neunzehnte Jahrhundert, das wir als sehr groß und recht unglückselig zu beurteilen gelernt haben. Gestehen wir, daß das offenbar zartere Format des zwanzigsten vor dem heroischeren seines Vorgängers nicht einmal die Feinheit voraus hat! In Wagner, Dostojewski, selbst in Bismarck vereinigt das neunzehnte Jahrhundert Riesenwuchs mit der äußersten Verfeinerung, einem letzten Raffinement der Mittel, dem freilich in allen Fällen etwas zugleich Krankhaftes und Barbarisches anhaftet. Vielleicht aber ist es gerade der Verzicht auf dies Element, von kranker Barbarei und – fast möchte man sagen – Asiatentum, durch welchen das zierlichere Format des Zeitgeistes bestimmt ist, den wir als verwandt, als brüderlich und nicht mehr als gestrig-väterlich empfinden; vielleicht liegt unserem Mangel an Größe der Wille zu einer reineren, helleren, gesunderen, fast möchte man sagen: griechischeren Menschlichkeit zugrunde, als die düstere Monumentalität des neunzehnten Jahrhunderts sie kannte; und vielleicht hat die Anglomanie des Slawen Conrad und seine Verachtung »innerasiatischer Kehltöne« etwas mit diesem Willen – oder dieser Aufgabe – der Epoche zu tun?
Wir wollen die Weltrevolution nicht vergessen, noch die geistigen Vorteile, die heutzutage mit guten Beziehungen zum Osten verbunden sind – Vorteile, um die jeder wachsame Westmensch den Zentraleuropäer heute rein geographisch beneidet und deren man sich durch die unbedingte Selbstverschreibung an den bürgerlichen Westen unzweifelhaft begäbe. In gewissem und wichtigem Sinn bliebe hier von einer Einbuße zu reden, selbst wenn man sich weigerte, zuzugeben, daß das Englische gegen das Kontinental-Europäische an und für sich eine Niveausenkung bedeutet. Mehr Form und mehr Borniertheit – wäre es das, was der Slawe einhandelte bei seinem Übertritt? Es liegt doch anders. Was er in den Kauf gab, waren Avantagen des Barbarismus, deren Wert er berechnet haben wird. Was er gewann, war Maß, Vernunft, Skepsis, geistiger Freiheitssinn und ein Humor, dessen ausgesprochen angelsächsische Männlichkeit ihn davor bewahrt, jemals ins Bürgerlich-Sentimentale umzuschlagen. Er ist hart und aufgeräumt, dieser Humor, und lebt gewissermaßen von der Vermutung, die sich im »Geheimagenten« irgendwo findet, »daß diese unsere Welt letzten Endes keine allzu ernsthafte ist«. Von christlich-östlicher Leidensveneration weiß er nicht mehr viel und erzählt von dem eisernen Haken, der einem armen alten Kutscher statt des Armes aus dem Rockärmel ragt, mit einer Trockenheit, die eher Ausdruck einer gewissen grimmigen Lebensheiterkeit als des Mitleids ist. Er ist oft in unscheinbaren Einzelheiten erquickend komisch, dieser Humor, wie anläßlich der Droschkenfahrt, deren Rasseln und Glasklirren den Eindruck erweckt, als ob alles hinter den Fahrenden zusammenstürze; oder in der Charakteristik des mechanischen Klaviers, dessen Tasten von einem »pöbelhaften Gespenst« bearbeitet zu werden scheinen und das abbricht, als sei es über irgend etwas verärgert. Er fällt nicht im geringsten aus dem Ton beim Anblick etwa eines Ermordeten. »Nun schien Herr Verloc nicht eigentlich zu schlafen, sondern nur mit gebeugtem Kopfe dazuliegen und beharrlich auf seine linke Brust zu sehen. Und als Genosse Ossipon den Messergriff erblickt hatte, da wandte er sich von der Glastür ab und erbrach sich heftig.« Hier fehlt jedes Getue. Das »Entsetzliche« ist mit einem festen, nüchternen, beinahe vergnügten, jedenfalls lebensheiteren Blick gesehen und in einem Geiste erzählt, der ebenso englisch wie zugleich auch nachbürgerlich-modern anmutet. Denn ganz allgemein und wesentlich scheint mir die Errungenschaft des modernen Kunstgeistes darin zu bestehen, daß er die Kategorien des Tragischen und des Komischen, also auch etwa die theatralischen Formen und Gattungen des Trauerspiels und des Lustspiels, nicht mehr kennt und das Leben als Tragikomödie sieht. Das genügt, um das Groteske zu seinem eigentlichsten Stil zu machen, und zwar in dem Grade, daß selbst das Großartige heute kaum anders als in der Gestalt des Grotesken erscheint. Es wird erlaubt sein, das Groteske den eigentlich antibürgerlichen Stil zu nennen; und wie bürgerlich es nun sonst um das Angelsachsentum bestellt sein möge, so ist zu erinnern, daß das Grotesk-Komische von jeher seine künstlerisch starke Seite war.
Nein, Conrads Westanschluß bedeutete keine künstlerisch-geistige Verbürgerlichung. Wenn er Herrn Vladimir die sozialkritischen Fragen in den Mund legt: »Ich hoffe, Sie geben zu, daß die Mittelschichten verdummt sind?« und Verloc antworten läßt: »Sie sind es!« so ist wenig Zweifel, daß er, der Autor, diese Ansicht teilt. Er ist zu sehr Künstler und freier Geist, um als Sozialist doktrinär zu sein, um es anders als auf spielende, freie und rein zeitkindliche Art zu sein. Die marxistische Theorie erscheint bei ihm als Haß- und Einsamkeitsmonomanie des »Bewährungsfristapostels« Michaelis; seine revolutionären Typen sind nicht die einnehmendsten; er gibt bei Gelegenheit eine stark pessimistische Psychologie des Empörers, und seine Skepsis gegen soziale Utopien kommt zutage, als er einen seiner Rebellen die seine aufstellen läßt, die »wie ein ungeheueres sauberes Spital« aussieht, »mit Blumen und Gärten, und in dem die Starken sich der Pflege der Schwachen zu widmen haben« – während ein elender kleiner Schreckensmann und Sprengstoffprofessor sich die gegenteilige erträumt, eine Welt wie ein Schlachthaus, wo die »Schwachen« der restlosen Vernichtung zugeführt werden. Aber all dieser Spott ist nicht gerade bürgerlich gemeint, und wenn es schon eine sehr hübsche Ironie ist, daß von dem braven Herrn Verloc gesagt wird, seine Sache sei die Beschirmung der sozialen Ordnung gewesen, nicht ihre Verbesserung »oder nur Beurteilung«, so wird diese Ironie zur großen Satire dort, wo es sich um den äußeren Hauptgegenstand der Geschichte, das Dynamitattentat handelt, das die Mailänder Konferenz stimulieren soll, und um das Ziel, gegen welches es sich am besten richtet. »Natürlich gibt es auch noch die Kunst. Eine Bombe in die Nationalgalerie würde einigen Lärm machen. Es wäre aber nicht ernst genug. Kunst war nie der Fetisch der Mittelschicht. Es ist, wie wenn man einem Manne in seinem Hause ein paar Hinterfenster einschlagen wollte. Um ihn aber wirklich zum Aufstehen zu bringen, müßte man ihm doch mindestens das Dach abdecken. Natürlich gäbe es ein wenig Geschrei, aber von wem? Von Künstlern, Kunstkritikern und dergleichen, von Leuten ohne Bedeutung ... Aber da ist nun die Bildung, die Wissenschaft. Jeder Dummkopf, der es zu einem Einkommen gebracht hat, glaubt daran, er weiß nicht, warum, aber er glaubt an ihre Bedeutung. Das ist der allerheiligste Fetisch. Die ganze Selbstsucht der Klasse, auf die es ankommt, wird wachgerufen werden. Sie glauben daran, daß in irgendeiner geheimnisvollen Weise die Wissenschaft die Quelle ihres Wohlstandes ist. Das tun sie ... Mord ist uns vertraut, er ist sozusagen eine feststehende Einrichtung. Die Kundgebung muß sich gegen die Bildung, die Wissenschaft richten ... Was denken Sie davon, die Astronomie anzupacken? ... Es gibt nichts Besseres ... Die ganze zivilisierte Welt hat von Greenwich gehört, noch die Schuhputzer an der Untergrundbahnstation in Charing Cross wissen etwas davon... Packen Sie den ersten Meridian! Sie kennen die Mittelklasse nicht so gut wie ich. Ihre Empfindlichkeit ist erschöpft. Den ersten Meridian. Nichts besser und nichts leichter, scheint mir.«
Diese gescheite Weisung Herrn Vladimirs an den armen Verloc ist die satirische Spitze des Buches. Sein Autor ist selbstverständlich der Unmensch nicht, die Wissenschaft zu verachten. Trotzdem ist er einer von ihr bestimmten und auf sie pochenden Menschlichkeit nicht hold, und gelegentlich spricht er von »jenem Blick voll unerträglichen und unerschütterlichen Dünkels, den nur die Beschäftigung mit der Wissenschaft in das Auge eines Sterblichen zu bringen vermag.« Nichtachtung der Kunst und des eigentlich Geistigen, aber grenzenlose und gläubigste Hochachtung vor der nutzbringenden Wissenschaft: dies empfindet Conrad als bürgerlich; und wenn auch sein Verhältnis zum Proletariat nicht ganz das vorschriftsmäßige, rechtgläubige ist, so offenbar darum, weil, auf dem Wege über den Marxismus, die Wissenschaft ja auch Erbe und Fetisch des Proletariats geworden ist – wie denn niemand leugnen wird, daß der Bolschewismus eine streng wissenschaftliche Weltanschauung ist.
Genosse Ossipon zum Beispiel, mit dem Spitznamen »der Doktor«, gewesener Mediziner ohne akademischen Grad, Wanderlehrer in Arbeitervereinen über die soziale Zukunft der Hygiene, Verfasser einer sofort von der Polizei beschlagnahmten Broschüre »Die fressenden Laster der Bürgerklasse« – Genosse Ossipon ist wissenschaftlich. »Typisch für diese Form der Entartung« findet er von oben herab das Kreisezeichnen des kleinen Stevie, diese sonderbare, mit soviel Hingabe geübte Produktion, die an ein kosmisches Chaos gemahnt, an den Versuch einer wahnsinnigen Kunst, daß Unfaßbare darzustellen. Und selbstverständlich kommt er auf die Ohrläppchen und auf Lombroso. »Lombroso ist ein Esel!« antwortet ihm ein noch Unversöhnlicherer, und der Autor nennt das ironisch »eine erschütternde Lästerung«. »Ist ihnen jemals ein solcher Schwachkopf vorgekommen? Für ihn ist der Gefangene der Verbrecher; ganz einfach, nicht wahr? Was aber ist mit denen, die ihn eingesperrt – hineingezwungen haben? ... Und was ist Verbrechen? Weiß er das, dieser Trottel, der seinen Weg in dieser Welt voll gesegneter Narren gemacht hat, indem er auf Ohren und Zähne von ein paar unglücklichen Teufeln sah! Zähne und Ohren kennzeichnen den Verbrecher? Und was ist es mit dem Gesetz, das ihn noch weit besser kennzeichnet – dem netten Brandeisen, das die Überfütterten erfunden haben, um sich gegen die Hungrigen zu schützen? Rotglühend auf ihr elendes Fell gebracht... So werden Verbrecher gemacht, damit deine Lombrosos ihren Blödsinn darüber schreiben können.« Mit dieser lästerlichen Erwiderung ist der Erzähler wohl bis zu einem gewissen und ziemlich hohen Grade einverstanden. Seine eigene Art aber, den kleinen Stevie zu sehen und zu zeichnen, läßt deutlich erkennen, daß er die Lombroso-Wissenschaftlichkeit im Verhältnis zu ihm nicht in der Hauptsache aus sozialen Gründen als bürgerliche Mesquinerie empfindet, sondern aus tieferen, religiösen.
Stevie, wie er namentlich auf der Droschkenfahrt und bei dem darauf folgenden Gespräch mit seiner Schwester Winnie – soweit bei seiner »Eigenheit« von einem Gespräch die Rede sein kann – sich offenbart, dieser minderwertige kleine Stevie, der so jenseits aller Lebenswerte liebenswürdig ist und den Winnie in der Tat so liebt, daß sie seinen Tod auf die furchtbarste, sie selbst vernichtende Weise rächt – Stevie ist die schönste, mit weitaus der lebhaftesten Rührung angeschaute Figur unseres Buches. Russischer Roman schlägt merklich in ihr durch; ohne Dostojewskis »Idioten«, diesen freilich im Format unvergleichlich größeren Versuch, auf der Grundlage des »Pathologischen« das menschlich Reinste und Heiligste zu geben, wäre sie kaum denkbar, denn auch sie ist ein dichterischer Versuch, das klinisch Minderwertige heilig zu sprechen. Es ist bezeichnend für die moderne Doppelgesichtigkeit des Verfassers, daß er die wissenschaftlich-pathologische Seite der Dinge nicht etwa verleugnet, romantisch die Augen davor schließt. Ich sehe ein naturalistisches Zugeständnis an die Wissenschaft darin, daß Stevies »Eigenheit« als in der Familie liegend charakterisiert ist und die Mordtat seiner Schwester durch die plötzlich scharf hervortretende Ähnlichkeit mit ihm stark idiotisch betont erscheint. Aber das hindert nicht, daß hier eine Psychologie mit religiöser Wertung herrscht, welche das »wissenschaftliche« Urteil des Genossen Ossipon über Stevie als das erscheinen läßt, was sie unter dem menschlichen Gesichtspunkte ist, nämlich als schäbige Halbbildung; und durch die feine, aber unmißverständliche Andeutung, daß dieses Urteil es ist, was in Verlocs bedrängte Seele den ersten Keim zu dem Gedanken senkt, Stevie zu dem politischen Attentat zu mißbrauchen, wird die »Wissenschaft« noch einmal kompromittiert und menschlich beschuldigt.
Das alles ist nicht bürgerlich; aber proletarisch orthodox ist es auch nicht. Es zeugt von jener ungebundenen Objektivität, die einzig Sache des klassenlosen Dichters, wenn auch eben wohl nur seine Sache ist und die sich bei Conrad überall und in allem am befreienden Werke zeigt. Wie er sachlich ist in seinem Urteil über die Geschlechter (er spricht von dem Zartgefühl, das in der männlichen Natur neben aufreizender Roheit wohne, und findet die Frauen von Natur aus schlauer und unerbittlicher in ihrer Begier nach Einzelheiten), so hält er sich nüchtern und kritisch in seinem Verhältnis zu Klassen und Mächten, zu allen falschen und vorläufigen Gegensätzen der Welt. Seine Ironie gegen die Lebensform »gesunder Untätigkeit« ist gut sozialistisch, aber den Typus des heiseren Hetzers, etwa unter einer Schiffsmannschaft (siehe den »Nigger vom Narzissus«), weiß er dem Leser in der Seele zuwider zu machen; und den Terroristen sagt er, daß sie nicht um ein Haar besser sind als die Macht, die gegen sie aufgeboten wird. »Gleich und gleich. Der Terrorist und der Polizeimann kommen aus dem gleichen Ei. Revolution und Gesetz – Gegenzüge im gleichen Spiel.« Das ist nicht müßige Gleichgültigkeit eines unbeteiligten Zuschauers. Es ist der Widerwille eines gar sehr beteiligten Geistes dagegen, in den Gegensätzen erbärmlich hängen zu bleiben. »Ihr Revolutionäre«, sagt er oder läßt er sagen, seid die Sklaven der Gesellschaft, die sich vor euch fürchtet... Selbstverständlich seid ihr das, da ihr ja die Ordnung umstürzen wollt. Sie beherrscht eure Gedanken und natürlich auch eure Handlungen, und daher können weder eure Gedanken noch eure Handlungen jemals abschließend sein.«
Conrads Objektivität könnte kühl scheinen, aber sie ist eine Leidenschaft, denn sie ist Freiheitsliebe – Ausdruck derselben Liebe und Leidenschaft, die den jungen Polen aufs Meer trieb und die zweifellos, wie einst im Falle Iwan Turgenjews, das tiefste Motiv seines kulturellen Anschlusses an den Westen war. Ich denke, sein Dichtertum wird diesen Freiheitssinn davor schützen, mit liberaler Bürgerlichkeit verwechselt zu werden, sein völliger Mangel an Weichlichkeit es bedenklich erscheinen lassen, ihn des Ästhetizismus zu zeihen. Conrads künstlerischer Erfolg bei uns wird durch das Maß seines Talentes bestimmt werden. Geistig werden sich namentlich diejenigen zu ihm finden, die im Gegensatz zu dem begeisterten Glauben einer großen Mehrzahl der Meinung sind, daß die Rolle der Freiheitsidee in Europa noch nicht ausgespielt ist.
Forte dei Marmi, August 1926Thomas Mann Der Geheimagent
I
Wenn Herr Verloc morgens ausging, so ließ er sein Geschäft angeblich in der Hut seines Schwagers. Das konnte er tun, weil im allgemeinen wenig Kunden kamen und vor den Abendstunden überhaupt keine. Herr Verloc kümmerte sich wenig um seinen angeblichen Laden, und überdies wurde sein Schwager von Frau Verloc beaufsichtigt.
Der Laden war klein, ebenso wie das ganze Haus. Es war eines der rußigen Backsteinhäuser, wie es sie in großen Mengen gab, bevor in ganz London mit Neubauten begonnen wurde. Der Laden glich einer viereckigen Schachtel, deren Stirnseite mit kleinen Scheiben verglast war. Unter Tags blieb die Tür geschlossen, abends aber stand sie unauffällig, doch verdächtig offen.
Das Auslagefenster enthielt Lichtbilder von mehr oder weniger unbekleideten Tänzerinnen; unterschiedliche Dinge in Packungen, die an Heilmittel gemahnten; geschlossene gelbe Briefumschläge, recht dünn, und in dicker, schwarzer Schrift ausgezeichnet mit 2/6. Einige Nummern alter französischer Witzblätter hingen an einem Bindfaden, wie zum Trocknen. Ein schmutziger Napf aus blauem Porzellan, ein Kästchen aus schwarzem Holz, einige Flaschen Merktinte, Stempelkissen; einige wenige Bücher, deren Titel auf unsauberen Inhalt deuteten; einige augenscheinlich alte Nummern dunkler Tagesblätter, schlecht gedruckt, mit Titeln wie: »Die Fackel«, »Der Gong« – Skandalblättchen. Die beiden Gasflammen im Laden waren immer klein gestellt, sei es nun aus Sparsamkeit oder aus Rücksicht auf die Kunden.
Diese Kunden waren entweder ganz junge Leute, die sich eine Zeitlang vor dem Auslagefenster herumdrückten, bevor sie hastig hineinschlüpften, oder Männer gesetzten Alters, die aber gemeinhin aussahen, als wären sie schlecht bei Kasse. Einige dieser letzten Art trugen die Kragen ihrer Überzieher bis zur Schnurrbartspitze aufgeschlagen; die Säume ihrer Beinkleider wiesen Schmutzspuren auf und schienen abgetragen zu sein und nicht eben kostbar. Die Beine, die darin staken, sahen in der Regel auch nicht nach viel aus. Die Hände tief in den Seitentaschen ihrer Röcke vergraben, schoben sich diese Leute, mit einer Schulter voran, seitlich durch die Türe, als fürchteten sie, die Glocke zum Tönen zu bringen.
Diese Glocke, an einem gebogenen Stahlband an der Türe befestigt, war schwer zu vermeiden; sie war hoffnungslos heiser; abends aber schnatterte sie beim leisesten Anreiz mit unverschämter Hartnäckigkeit hinter jedem Besucher her.
Sie schnatterte; und auf dieses Zeichen pflegte Herr Verloc hastig durch die staubige Glastüre hinter dem Ladentische aus dem rückwärts gelegenen Wohnzimmer einzutreten. Seine Augen waren von Natur schwer; er sah immer aus, als hätte er sich ganz angezogen einen vollen Tag auf einem ungemachten Bett gewälzt. Ein anderer Mann hätte ein solches Aussehen wohl als ausgesprochen nachteilig empfunden, denn im Kleinhandel hängt ja so viel von der freundlichen und einladenden Erscheinung des Verkäufers ab. Herr Verloc aber kannte sein Geschäft und ließ sich von ästhetischen Zweifeln über sein Äußeres nicht anfechten. Mit einer kalten, starr blickenden Unverschämtheit, die das Lautwerden irgend einer scheußlichen Drohung hemmen zu wollen schien, pflegte er über den Ladentisch weg irgendwelche Dinge zu verkaufen, deren Wert sich ganz offenbar lächerlich unter dem Preise bewegte, der dafür verlangt wurde: eine kleine, augenscheinlich leere Pappendeckelschachtel zum Beispiel, oder einen jener gut verschlossenen gelben Briefumschläge, oder einen schmutzigen Pappband mit verlockendem Titel. Dann und wann kam es vor, daß eine der ausgebleichten gelben Tänzerinnen an einen Liebhaber verkauft wurde, als wäre sie jung und lebendig.
Manchmal war es Frau Verloc, die auf den Ruf der heiseren Glocke hin erschien. Winnie Verloc war eine junge Frau mit voller Büste in engem Mieder und mit breiten Hüften. Ihr Haar war sauber geordnet; kühl blickend wie ihr Gemahl, bewahrte sie hinter der Brustwehr des Ladentisches eine anscheinend unergründliche Gleichgültigkeit. Dann pflegte wohl ein Kunde zarteren Alters in jähe Verwirrung zu geraten, weil er es mit einer Frau zu tun hatte, und, Wut im Herzen, den Wunsch nach einer Flasche Tinte hervorzustammeln, im Werte von sechs Pence (Preis in Verlocs Laden ein Schilling sechs Pence), die er, draußen angelangt, heimlich in die Gosse fallen ließ.
Die abendlichen Besucher – die Männer mit aufgeschlagenen Kragen und tief sitzenden weichen Hüten – nickten Frau Verloc vertraulich zu und schoben sich mit einem gemurmelten Gruße durch die Klappe am Ende des Ladentisches, die den Durchgang zu dem rückwärtigen Wohnraum und dem anschließenden Gang mit der steilen Stiege bildete. Die Ladentür bot den einzigen Eingang zu dem Hause, in dem Herr Verloc sein Geschäft als Verkäufer minderer Waren betrieb, seinen Beruf als Beschützer der Gesellschaft ausübte und seine häuslichen Tugenden zur Geltung brachte. Diese letzteren waren ganz ausgesprochen, er war überaus häuslich; weder seine seelischen, noch seine geistigen, noch seine körperlichen Bedürfnisse waren danach angetan, ihn viel außer Haus zu führen. Er fand innerhalb seiner vier Wände Ruhe für seinen Leib, Frieden für sein Gewissen, zugleich mit Frau Verlocs weiblichen Aufmerksamkeiten und der ehrerbietigen Wertschätzung von Frau Verlocs Mutter.
Winnies Mutter war eine stämmige, kurzatmige Frau mit großem braunen Gesicht; sie trug eine schwarze Perücke unter einer weißen Haube; ihre geschwollenen Beine zwangen sie zur Untätigkeit. Sie glaubte an ihre französische Abstammung, vielleicht mit Recht; und nach langjähriger Ehe mit einem konzessionierten Gastwirt mehr alltäglicher Klasse brachte sie sich durch die Zeit ihrer Witwenschaft mit dem Vermieten möblierter Zimmer an Herren, nächst Vauxhall Bridge Road, an einem Platz, der einstmals zu den besseren gehörte, gerade noch an der Grenze des Stadtbezirkes Belgravia; diese Ortsbezeichnung bot ihr bei Ankündigung ihrer Zimmer einigen Vorteil; die Mieter der würdigen Witwe aber gehörten nicht unbedingt zu den besseren Leuten. Ihre Bedienung besorgte die Tochter Winnie, die gleichfalls Spuren der französischen Abstammung aufwies, deren sich die Mutter rühmte, vor allem in der überaus sorgfältigen und künstlichen Anordnung ihres üppigen dunklen Haares. Winnie hatte noch andere Reize: ihre Jugend, ihre vollen, rundlichen Formen, ihre reine Haut, endlich ihre unergründliche Zurückhaltung, die aber nicht so weit ging, jegliche Unterhaltung unmöglich zu machen; diese wurde dann von des Mieters Seite angeregt und von ihr selbst mit gleichbleibender Liebenswürdigkeit fortgeführt. Herr Verloc mußte wohl für diese Reize empfänglich gewesen sein; Herr Verloc war kein Dauermieter; er kam und ging, ohne irgendwelchen ersichtlichen Grund. Gewöhnlich tauchte er in London (wie die Influenza) vom Festland her auf, nur wurde sein Kommen nicht von der Presse angekündigt, und seine Besuche setzten mit vollem Ernste ein. Er frühstückte im Bett und blieb schwelgerisch, mit dem Ausdruck stillen Vergnügens, jeden Tag bis Mittag liegen – manchmal sogar noch länger. Ging er aber einmal aus, dann schien er nur mit größter Mühe den Rückweg zu seinem zeitweiligen Heim am Belgravia-Platz zu finden. Er verließ es spät und kam früh zurück – um drei oder vier Uhr früh; beim Erwachen um zehn Uhr morgens sprach er Winnie, die ihm das Frühstücksbrett brachte, mit spaßhafter, müder Höflichkeit an, in dem heiseren, lispelnden Tonfall eines Menschen, der anhaltend mehrere Stunden hindurch geredet hat. Seine hervorstehenden Augen mit den schweren Lidern sandten verliebte und schmachtende Seitenblicke. Die Bettdecke hatte er bis zum Kinn heraufgezogen, und sein weicher schwarzer Schnurrbart bedeckte die dicken Lippen, von denen so viel Honig träufeln konnte.
In den Augen von Winnies Mutter war Herr Verloc ein äußerst netter Herr; nach ihren Lebenserfahrungen, in verschiedenen »Geschäften« gesammelt, hatte sich die gute Frau Verloc in den Ruhestand ein Idealbild des Gentleman herübergenommen, wie es etwa von den Inhabern einer besseren Bar verkörpert wird. Herr Verloc näherte sich diesem Ideal tatsächlich, er erreichte es sogar.
»Natürlich werden wir deine Einrichtung mitnehmen, Mutter«, hatte Winnie gesagt. Das Logierhaus mußte aufgegeben werden, seine Fortführung schien untunlich, denn die hätte für Herrn Verloc zu viel Unruhe mit sich gebracht und zu seinen sonstigen Geschäften nicht gepaßt. Was für Geschäfte das waren, sagte er nicht; nach seiner Verlobung mit Winnie aber nahm er sich die Mühe, vor Mittag aufzustehen, die Treppe zum Erdgeschoß hinunter zu steigen und sich Winnies Mutter im Frühstückszimmer angenehm zu machen, wo diese reglos ihre Zeit hinbrachte. Er streichelte die Katze, schürte das Feuer, ließ sich unten das Mittagessen auftragen, und verließ die etwas dumpfige Traulichkeit mit offenbarem Widerstreben, blieb aber desungeachtet doch bis spät in die Nacht aus. Niemals forderte er Winnie auf, mit ihm in ein Theater zu gehen, wie es ein so netter Gentleman doch hätte tun müssen. Seine Abende waren besetzt. Seine Tätigkeit war sozusagen politisch, hatte er Winnie einst gesagt, und sie würde sich, wie er eindringlich hinzufügte, seinen politischen Freunden gegenüber äußerst nett zu zeigen haben. Mit ihrem geraden, unergründlichen Blick hatte sie geantwortet, daß sie das natürlich tun würde.
Ob und was er ihr sonst noch über seine Tätigkeit gesagt hatte, konnte Winnies Mutter nicht herausbringen. Das Ehepaar nahm sie samt ihrer Einrichtung mit. Der kümmerliche Eindruck des Ladens überraschte sie, die Übersiedlung vom Belgravia-Platz in die enge Gasse in Soho hatte eine üble Wirkung auf ihre Beine, die ganz ungeheuerlich anschwollen. Andrerseits empfand sie wohltuend die völlige Freiheit von Geldsorgen. Die gewichtige Gutmütigkeit ihres Schwiegersohnes gab ihr das Gefühl völliger Geborgenheit. Die Zukunft ihrer Tochter war unstreitig gesichert, und sogar um ihren Sohn Stevie brauchte sie nicht länger bekümmert zu sein. Sie hatte sich nicht verbergen können, daß er eine böse Last war, der arme Stevie. Doch angesichts von Winnies Liebe für den bresthaften Bruder und von Herrn Verlocs Güte und freigebiger Gemütsart fühlte sie, daß der arme Junge vor den Tücken dieser rauhen Welt doch geschützt war, und im Innersten ihres Herzens war es ihr vielleicht gar nicht unlieb, daß die Verlocs keine Kinder hatten. Da dieser Umstand Herrn Verloc selbst völlig gleichgültig schien, und Winnie in ihrem Bruder ein Ziel für ihre mütterlichen Triebe fand, war es so für den armen Stevie wohl das beste.
Denn der Junge war nicht leicht zu haben; er war zart und in bescheidenem Maße auch hübsch, wenn man davon absehen wollte, daß er die Unterlippe so täppisch hängen ließ. Unter unserem ausgezeichneten System zwangsweiser Schulbildung hatte er übrigens lesen und schreiben gelernt, trotz dem unvorteilhaften Aussehen seiner Unterlippe. Als Laufjunge allerdings hatte er keinen wesentlichen Erfolg zu verzeichnen. Er vergaß seine Aufträge; allzuleicht ließ er sich von dem engen Pfade der Pflicht weglocken, durch den Anreiz streunender Katzen und Hunde, denen er durch enge Durchlässe bis in trübe Hinterhöfe folgte; durch die Komödien der Straße, denen er mit offenem Munde anwohnte, zum Schaden seiner Auftraggeber, oder durch die Tragödien gestürzter Pferde, deren heftiges Pathos ihn oft zu durchdringendem Schreien zwang, mitten in einer Menge, der es mißfiel, in dem ruhigen Genuß des nationalen Schauspiels durch schmerzliche Töne gestört zu werden. Wurde er dann von einem ernsten Schutzmann väterlich hinweggeleitet, so ergab es sich oft, daß der arme Stevie seine Adresse vergessen hatte, wenigstens vorübergehend. Eine plötzliche Frage ließ ihn stottern bis zum Ersticken. Aus Schreck über irgend etwas Unerwartetes begann er scheußlich zu schielen. Immerhin hatte er niemals Krämpfe (was doch ein Trost war), und vor den natürlichen Ausbrüchen von Ungeduld seitens seines Vaters konnte er sich immer, in den Tagen der Kindheit, in den Schutz der kurzen Röcke seiner Schwester Winnie flüchten. Andrerseits war der Verdacht gerechtfertigt, daß sich ein Schatz bedeutender Ungezogenheit in ihm verberge. Als er vierzehn Jahre alt geworden war, hatte ihm ein Freund seines verstorbenen Vaters, ein Vertreter einer ausländischen Firma für Büchsenmilch, versuchsweise die Stelle eines Kontorlehrlings übertragen. Dabei wurde er an einem nebligen Nachmittage, in Abwesenheit seines Chefs, überrascht, wie er im Stiegenhaus emsig Feuerwerk abbrannte. Rasch hintereinander ließ er ein Paket stolzer Raketen los, wütende Feuerräder und Knallfrösche dazwischen, und die Sache hätte leicht recht böse ausgehen können. Eine furchtbare Panik verbreitete sich durch das ganze Haus. Wild blickende, halberstickte Schreiber trampelten durch die raucherfüllten Flure, seidene Glanzhüte und ältere Geschäftsleute wurden gesehen, wie sie getrennt voneinander über die Stiege hinunterrollten. Stevie schien von seiner Tat keine persönlichen Vorteile zu erwarten, die Beweggründe für sein eigenartiges Vorgehen waren schwer zu entdecken; erst viel später gelang es Winnie, ihn zu einem verworrenen und schleierhaften Geständnis zu bringen, und darnach schien es, als ob zwei andere Lehrlinge in dem Geschäftshause ihn mit Erzählungen von Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen bearbeitet hatten, bis sein gesteigertes Mitgefühl sich in dem erwähnten Ausbruch Luft gemacht hatte. Der Freund seines Vaters aber entließ ihn auf der Stelle, um, wie er sagte, sein Geschäft vor völligem Niedergang zu bewahren. Nach diesem Beweis werktätiger Nächstenliebe wurde Stevie dazu verwendet, in der Küche im Erdgeschoß Geschirr zu waschen und den Stammgästen des Hauses am Belgravia-Platz die Schuhe zu putzen. Diese Tätigkeit bot ganz offenbar keine Zukunft. Die Gentlemen steckten ihm dann und wann einen Schilling zu. Herr Verloc erwies sich als der freigebigste unter ihnen, aber auch seine Gabe mitgerechnet, konnte von Gewinn oder Zukunftsaussichten nicht die Rede sein, so daß, als Winnie ihre Verlobung mit Herrn Verloc ankündigte, ihre Mutter mit einem Blick in die Spülkammer einen Seufzer und die stumme Frage nicht unterdrücken konnte, was aus dem armen Stevie nun wohl werden würde?
Es ergab sich, daß Herr Verloc bereit war, den Jungen zugleich mit der Mutter seiner Frau und der Einrichtung, die das gesamte sichtbare Vermögen der Familie darstellte, mit hinüber zu nehmen. Herr Verloc nahm alles, wie es kam, an seine breite, gutmütige Brust. Die Einrichtung wurde aufs beste im ganzen Hause verteilt; Frau Verlocs Mutter mußte sich aber auf die zwei Hinterzimmer im ersten Stock beschränken. In einem davon schlief der unglückliche Stevie. Zu dieser Zeit hatte ein dünner Flaum, wie ein goldener Nebel, die scharfe Linie seines kümmerlichen Unterkiefers zu umsäumen begonnen. Er half seiner Schwester mit blinder Liebe und Gelehrigkeit in ihren Haushaltspflichten. Herr Verloc war der Meinung, daß ihm einige Beschäftigung gut tun würde. Seine freie Zeit brachte er damit zu, mit Zirkel und Blei Kreise auf ein Stück Papier zu ziehen. Diesem Zeitvertreib gab er sich mit größtem Eifer hin, mit ausgebreiteten Ellenbogen tief über den Tisch gebeugt. Durch die offene Tür des Wohnzimmers hinter dem Laden sah Winnie von Zeit zu Zeit nach ihm, mit einem Blick voll mütterlicher Wachsamkeit.
II
Dies also war das Haus, der Haushalt und der Laden, die Herr Verloc hinter sich ließ, als er sich um halb elf Uhr morgens nach Westen zu auf den Weg machte. Das war für seine Verhältnisse ungewöhnlich früh; seine ganze Persönlichkeit hauchte den Zauber tauiger Frische aus, er trug seinen blauen Tuchüberzieher offen, seine Stiefel glänzten, seine Wangen, frisch barbiert, hatten eine Art Glasur, und sogar seine Augen unter den schweren Lidern sandten, erfrischt nach einer Nacht friedlichen Schlummers, verhältnismäßig muntere Blicke aus. Durch die Gitter des Parkes trafen diese Blicke Männer und Frauen, die in der Allee ritten; Paare, die einträchtig dahingaloppierten; andere, die gemäßigt vorwärtsschritten; müßige Gruppen von drei oder vier; einzelne Reiter, die wie Eigenbrödler wirkten, und einzelne Damen, in großem Abstand gefolgt von Stallburschen mit einer Kokarde auf dem Hut und einem Ledergürtel über dem eng sitzenden Leibrock. Wagen rollten vorbei, vor allem zweispännige Kaleschen, dann und wann auch eine Viktoria, mit irgendeinem Raubtierfell darinnen und dem Antlitz und Hut einer Frau über dem zusammengeklappten Wagendach. Und eine eigene Londoner Sonne – gegen die nichts weiter gesagt werden konnte, als daß sie blutunterlaufen aussah – überstrahlte alles das mit ihrem Glanz. Sie hing in mäßiger Höhe über Hyde Park Corner, wie mit pünktlicher und wohlwollender Wachsamkeit. Sogar das Pflaster unter Herrn Verlocs Füßen hatte eine Altgoldtönung in dem gedeckten Licht, in dem weder Mauer, noch Baum, noch Tier, noch Mensch Schatten warf. Herr Verloc schritt nach Westen, durch eine Stadt ohne Schatten, in einer Atmosphäre von zerstäubtem Altgold. Rotkupfrige Glanzlichter lagen auf Hausdächern, auf Mauerecken, auf Wagenwänden, ja sogar noch auf dem Fell der Pferde und auf dem Rückteil von Herrn Verlocs Überzieher, wo sie entfernt wie Rost wirkten. Doch Herr Verloc war sich nicht im entferntesten bewußt, verrostet zu sein. Er verfolgte durch das Parkgitter mit beifälligen Blicken die Schaustellung des Überflusses und Wohllebens der Stadt. Alle diese Leute mußten beschützt werden; Schutz ist das erste Bedürfnis bei Überfluß und Wohlleben. Sie mußten beschützt werden; und ihre Pferde, Wagen, Häuser, Diener mußten beschützt werden, und die Quelle ihres Wohlstandes mußte beschützt werden, im Herzen der Stadt und im Herzen des Landes; die ganze gesellschaftliche Ordnung, die ihnen ihre gesunde Untätigkeit erlaubte, mußte beschützt werden gegen die blanke Mißgunst ungesunder Arbeit. Das mußte sein – und Herr Verloc hätte sich zufrieden die Hände gerieben, wäre er nicht von Natur jeder überflüssigen Anstrengung abhold gewesen. Seine Untätigkeit war nicht gesund, paßte aber gut zu ihm. Er war ihr sozusagen ergeben, mit einer Art von trägem Fanatismus, oder vielleicht eher mit fanatischer Trägheit. Von fleißigen Eltern geboren, für ein Leben voll Arbeit, hatte er sich der Untätigkeit zugewandt, unter einem Antrieb, der so echt wie unerklärlich und nicht minder zwingend war, als der andere, der einen Mann eine bestimmte Frau unter tausend wählen läßt. Sogar für einen bloßen Demagogen, für einen Volksredner, für einen Arbeiterführer war er zu träge; das alles machte zu viel Mühe. Er brauchte eine vollendetere Art von Ruhe; vielleicht auch war er das Opfer eines philosophischen Glaubens an die Unwirksamkeit jeder menschlichen Anstrengung. Eine solche Art von Untätigkeit hat einen gewissen Grad von Intelligenz zur notwendigen Voraussetzung. Daran fehlte es Herrn Verloc nicht – und bei dem Bewußtsein, daß der menschlichen Gesellschaftsordnung Gefahr drohe, hätte er vielleicht sich selbst zugezwinkert, wäre nicht zu diesem Ausdruck von Skepsis eine Anstrengung nötig gewesen. Seine großen, vorstehenden Augen eigneten sich nicht gut zum Zwinkern. Sie waren eher dazu geschaffen, sich feierlich und majestätisch zum Schlummer zu schließen.
Schlicht und stämmig wie ein Mastschweinchen schritt Herr Verloc seines Wegs, ohne sich zufrieden die Hände zu reiben, oder seinen eigenen Gedanken skeptisch zuzuzwinkern. Er trat mit seinen glänzenden Stiefeln wuchtig das Pflaster und sah, im ganzen genommen, wie ein besserer Handwerker aus, der für sich einen Gang macht. Er konnte alles sein, vom Glaser bis zum Schlosser: ein Arbeitgeber kleinsten Ausmaßes. Doch hatte er auch ein unbeschreibliches Etwas an sich, das kein Handwerker im Lauf seiner Arbeit, und wäre sie noch so unehrlich ausgeübt, erworben haben konnte; dieses Etwas, das allen denen gemeinsam ist, die von den Lastern, den Narrheiten oder niedrigen Ängsten ihrer Mitmenschen leben. Ein Ausdruck innerer Haltlosigkeit, wie ihn die Besitzer von Spielhöllen und verrufenen Häusern zeigen, die Privatdetektive und Spitzel, die Schnapswirte und, ich möchte sagen, auch die Verkäufer von elektrischen Kraftgürteln und die Erfinder von Patentheilmitteln. Dieser letzteren bin ich übrigens nicht ganz sicher, da sich meine Nachforschungen nicht so weit in die Tiefe erstreckt haben; meinetwegen könnte ihr Ausdruck auch ganz teuflisch sein. Es sollte mich nicht überraschen. Was ich aber betonen möchte, ist, daß Herrn Verlocs Ausdruck keineswegs teuflisch war.
Bevor er Knightsbridge erreichte, bog Herr Verloc nach links ab, aus der breiten Verkehrsstraße, die von dem Hin und Her der schütternden Omnibusse und trabenden Geschäftswagen dröhnte, zwischen die fast lautlos und rasch gleitenden Reihen von Droschken. Unter seinem Hut, den er leicht nach hinten gesetzt trug, hatte er sein Haar sorgsam und ehrbar glattgebürstet, denn er hatte bei einer Gesandtschaft zu tun. Und Herr Verloc, ruhig wie ein Fels – ein harmloser Fels – schritt nun durch eine Straße, die am besten mit dem einen Wort »Privat« gekennzeichnet wäre. In ihrer Breite, Leere und Länge lag die Majestät unbeseelter Natur, einer Sache, die nie vergeht. An die Sterblichkeit gemahnte einzig nur der Wagen eines Arztes, der in erhabener Einsamkeit am Randstein hielt. Die blankgeputzten Türgriffe glänzten von weitem, und die sauberen Fenster gaben dunklen, opalartigen Schein. Und alles war ruhig, nur ein Milchwagen ratterte lärmend durch den fernen Hintergrund; ein Fleischerjunge, der mit der hehren Todesverachtung eines olympischen Wagenlenkers fuhr, sauste um die Ecke, hoch über seinen roten Rädern thronend. Eine schuldbewußte Katze tauchte irgendwo aus den Steinen, rannte eine Zeitlang vor Herrn Verloc her und verschwand dann in einem anderen Kellerloch; und ein dicker Schutzmann, dem jegliche Gemütsbewegung fremd schien, als gehörte auch er zur unbeseelten Natur, tauchte scheinbar aus einem Laternenpfahl hervor, ohne Herrn Verloc im geringsten zu beachten. Mit einer Wendung nach links verfolgte Herr Verloc seinen Weg durch eine enge Gasse längs einer gelben Mauer, die aus unerfindlichem Grunde in schwarzen Buchstaben die Inschrift trug: Nr. 1 Chesham Square. Chesham Square war mindestens sechzig Meter weit weg, und Herr Verloc, Weltmann genug, um sich von Londons geheimnisvollen Ortsbezeichnungen nicht täuschen zu lassen, schritt bedächtig fort, ohne Anzeichen von Überraschung oder Entrüstung. Schließlich erreichte er mit geschäftlicher Beharrlichkeit den Platz und überquerte ihn in der Richtung auf die Nr. 10. Diese prangte an einem gewaltigen Einfahrtstor in der hohen, sauberen Mauer zwischen zwei Häusern, deren eines verständlich genug die Nr. 9 trug, während das andere die Nr. 37 aufwies; die Tatsache aber, daß dies letztere zu Porthill Street gehörte, einer in der Nachbarschaft wohlbekannten Straße, war durch eine Inschrift oberhalb der Erdgeschoßfenster verkündet, dort von der wie immer Namen habenden Behörde angebracht, deren Aufgabe es ist, Londons verirrte Häuser unter Aufsicht zu halten. Warum vom Parlament (eine kurze Anfrage würde genügen) nicht die Machtmittel verlangt werden, diese Gebäude zur Rückkehr an ihren Bestimmungsort zu zwingen, bleibt eines der Geheimnisse städtischer Verwaltung. Herr Verloc beschwerte sich den Kopf nicht damit, da er seine Lebensaufgabe in der Beschirmung der gesellschaftlichen Ordnung sah, nicht in deren Verbesserung oder auch nur Beurteilung.
Es war so früh am Tage, daß der Pförtner der Gesandtschaft sich noch in den linken Rockärmel hineinarbeitete, als er hastig aus seiner Loge gestürzt kam. Er trug eine rote Weste und Kniehosen, schien aber verwirrt. Herr Verloc merkte den Flankenangriff, wehrte ihn durch den Vorweis eines Briefumschlages mit dem Wappen der Gesandtschaft ab und schritt vorbei. Den gleichen Talisman zeigte er auch dem Diener, der ihm öffnete und zurücktrat, um ihn in die Halle einzulassen.
Ein helles Feuer brannte in einem hohen Kamin, und mit dem Rücken dazu stand ein älterer Mann im Frack, mit einer Kette um den Hals; er blickte von einer Zeitung auf, die er mit beiden Händen vor seinem ruhigen, ernsten Gesicht ausgebreitet hielt, rührte sich aber im übrigen nicht; doch ein anderer Lakai, in braunen Hosen und Frack mit schmalen gelben Litzen, näherte sich Herrn Verloc, lauschte auf den gemurmelten Namen, wandte sich schweigend und begann davonzugehen, ohne sich ein einzigesmal umzusehen. Herr Verloc, der so durch einen Flur zu ebner Erde, links von dem teppichbelegten Stiegenhaus geführt wurde, sah sich plötzlich in einem ganz engen Raum, der als Einrichtung nur einen schweren Schreibtisch und einige Stühle aufwies. Der Lakai schloß die Türe, und Herr Verloc blieb allein. Er setzte sich nicht; Hut und Stock in einer Hand blickte er umher und strich sich mit der freien Polsterhand über den glatt gebürsteten Kopf.
Eine andere Türe ging lautlos, und Herr Verloc sah starr in ihre Richtung, konnte aber zunächst nur einen schwarzen Anzug, einen kahlen Schädel und einen wehenden grauen Backenbart wahrnehmen, der zu beiden Seiten zweier runzliger Hände niederfiel. Die Persönlichkeit, die eingetreten war, hielt sich einen Pack Papiere vor die Augen, schritt etwas zimperlich zum Tisch und sah sich dabei um. Der Geheime Staatsrat Wurmt, Siegelbewahrer der Gesandtschaft, war sehr kurzsichtig; dieser verdiente Beamte legte die Papiere auf den Tisch und enthüllte dabei ein teigfarbenes Gesicht von trauriger Häßlichkeit, umgeben von reichen, langen, dunkelgrauen Haaren und nach oben von dicken, buschigen Brauen schwer abgeschlossen. Er setzte einen schwarz geränderten Zwicker auf die ziemlich plumpe Nase und schien von Herrn Verlocs Anwesenheit überrascht; unter den drückenden Brauen zwinkerten seine schwachen Augen feierlich durch die Gläser.
Er machte kein Zeichen eines Grußes, auch Herr Verloc, der seinen Abstand zu wahren wußte, tat dies nicht; doch ein feiner Wechsel in den Umrissen seiner Schultern und seines Rückens ließ unter der weiten Oberfläche seines Überziehers eine leichte Beugung von Herrn Verlocs Rückgrat vermuten. Das ganze wirkte bescheiden und ehrerbietig. »Ich habe hier einige ihrer Meldungen«, sagte der Bureaukrat mit überraschend milder und müder Stimme, während er die Spitze seines Zeigefingers nachdrücklich auf die Papiere legte; er machte eine Pause, und Herr Verloc, der seine eigene Handschrift sehr gut erkannt hatte, wartete in atemlosem Schweigen. »Wir sind nicht sehr zufrieden mit der Haltung der hiesigen Polizei«, fuhr der andere fort, mit allen Anzeichen geistiger Ermüdung.
Herrn Verlocs Schultern deuteten, ohne sich eigentlich zu bewegen, ein Zucken an, und zum erstenmal an diesem Morgen, seitdem er sein Heim verlassen hatte, öffneten sich seine Lippen.
»Jedes Land hat seine Polizei«, bemerkte er nachdenklich, doch da der Beamte der Gesandtschaft ihn unverwandt anblinzelte, fühlte er sich verpflichtet, hinzuzufügen: »Gestatten Sie die Feststellung, daß ich keine Möglichkeit habe, auf die hiesige Polizei einzuwirken.«
»Was gewünscht wird,« sagte der Mann mit den Papieren, »ist irgendein entscheidendes Ereignis, das ihre Wachsamkeit wecken müßte. Das läge wohl in Ihrer Macht, oder nicht?«
Herr Verloc antwortete nur mit einem Seufzer, der ihm unwillkürlich entschlüpfte, und versuchte augenblicklich, seinem Gesicht einen heiteren Ausdruck zu geben. Der Beamte blinkerte stärker, wie angegriffen von dem trüben Licht im Zimmer, und wiederholte tonlos:
»Die Wachsamkeit der Polizei – und die Strenge der Behörden! – Die allgemeine Milde des Gerichtsverfahrens hier und das völlige Fehlen von Unterdrückungsmaßnahmen sind ein europäischer Skandal. Was grade jetzt gewünscht wird, ist die Betonung der Rastlosigkeit – der Gärung, die zweifellos vorhanden ist.«
»Zweifellos, zweifellos«, fiel Herr Verloc ein, in einem tiefen, ehrfürchtigen Volksrednerbaß, so grundverschieden von seinem früheren Sprechton, daß sein Gegenüber lebhaft überrascht schien. »Die Gärung hat einen gefährlichen Grad erreicht, meine Meldungen während der letzten zwölf Jahre beweisen das zur Genüge.«
»Ihre Meldungen während der letzten zwölf Jahre«, begann Staatsrat Wurmt in seinem höflichen und leidenschaftslosen Tone, »sind von mir gelesen worden. Ich konnte nicht entdecken, warum Sie sie überhaupt geschrieben haben.«
Eine Zeit lang herrschte trübes Schweigen. Herr Verloc schien seine Zunge verschluckt zu haben, und der andere starrte auf die Papiere auf dem Tisch. Schließlich gab er ihnen einen leichten Stoß.
»Der Zustand, den Sie hier beschreiben, ist, als Grundbedingung für Ihre Anstellung, als bestehend angenommen; nun ist es nötig, nicht zu schreiben, sondern ein entscheidendes Geschehnis zustande zu bringen – ich möchte fast sagen, ein furchterregendes Geschehnis!«
»Ich brauche wohl nicht zu versichern, daß mein ganzes Bestreben darauf gerichtet sein wird«, sagte Herr Verloc mit bebender Überzeugung, in seinem heiteren Gesprächston. Das Bewußtsein aber, hinter den Blendscheiben der Augengläser auf der anderen Seite des Tisches wachsam angeblinkert zu werden, beunruhigte ihn. Er brach kurz ab, mit einer Gebärde unbedingter Ergebenheit. Das wichtige, hart arbeitende, wenn auch nach außen hin unbekannte Mitglied der Gesandtschaft schien plötzlich einen Einfall zu haben.
»Sie sind sehr wohlbeleibt«, sagte er.
Diese Bemerkung, von feiner Psychologie eingegeben und mit dem bescheidenen Zögern eines Beamten vorgebracht, der mit Tinte und Papier vertrauter ist, als mit den Anforderungen des tätigen Lebens, traf Herrn Verloc wie ein scharfer, persönlicher Vorwurf. Er trat einen Schritt zurück.
»Wie? Was belieben Sie zu sagen?« rief er aus, heiser vor Kränkung.
Der Siegelbewahrer der Gesandtschaft, mit der Führung dieser Unterredung betraut, schien sich der Aufgabe nicht länger gewachsen zu fühlen.
»Ich glaube,« sagte er, »Sie sollten lieber mit Herrn Vladimir sprechen. Ja gewiß, Sie sollten mit Herrn Vladimir sprechen. Wollen Sie bitte hier warten«, sagte er und tänzelte hinaus.
Sofort strich sich Herr Verloc mit der Hand über das Haar. Ein leichter Schweiß war auf seiner Stirne ausgebrochen. Er ließ die Luft aus den geblähten Lippen aus, wie ein Mann, der auf einen Löffel heißer Suppe bläst. Als aber der Lakai in Braun stumm in die Türe trat, hatte Herr Verloc sich keinen Zoll breit von der Stelle gerührt, die er während der ganzen Unterredung eingenommen hatte. Er war reglos stehen geblieben, als fühlte er sich von Fallgruben umgeben.
Nun schritt er durch einen langen, von einer einsamen Gasflamme erleuchteten Gang, dann eine Flucht gewundener Treppen empor, durch einen verglasten, lichten Flur im ersten Stock. Der Lakai stieß eine Tür auf und trat beiseite. Herr Verloc fühlte einen dicken Teppich unter seinen Füßen. Der Raum war groß, mit drei Fenstern; und ein junger Mann mit glatt rasiertem, großem Gesicht, der in einem geräumigen Armstuhl vor einem mächtigen Mahagonischreibtisch saß, sagte auf französisch zu dem Staatsrat, der mit den Papieren in der Hand hinausging:
»Sie haben ganz recht, mein Lieber, er ist fett – der Bursche.«
Herr Vladimir, der erste Sekretär, war in den Salons bekannt als angenehmer und unterhaltender Mann. Er war ein Liebling der Gesellschaft. Sein Witz gipfelte in der Herstellung lächerlicher Beziehungen zwischen durchaus nicht zusammengehörenden Gedanken. Und wenn er dieses Spiel trieb, so saß er weit vorgebeugt, die linke Hand erhoben, als wollte er seine spaßhaften Beweise zwischen Zeigefinger und Daumen hochhalten, während sein rundes, glatt rasiertes Gesicht den Ausdruck komischer Verwunderung trug.
In dem Blick, den er jetzt auf Herrn Verloc richtete, lag aber weder Heiterkeit noch Verwunderung. Zurückgelehnt in seinem tiefen Armstuhl, die Ellbogen gespreizt und ein Bein über ein dickes Knie gelegt, sah er mit seinem glatten, rosigen Gesicht wie ein übernatürlich rasch gewachsener Säugling aus, der sich von niemand etwas gefallen lassen will.
»Ich nehme an, Sie verstehen Französisch«, sagte er.
Herr Verloc bejahte heiser. Sein ganzer, großer Körper zeigte eine Neigung nach vorne. Er stand auf dem Teppich mitten im Zimmer, Hut und Stock in eine Hand geklemmt; die andere hing leblos an seiner Seite. Er murmelte bescheiden in tiefem Kehltone einiges, wie, daß er bei der französischen Artillerie gedient habe. Sofort wechselte Herr Vladimir mit launischer Nichtachtung die Sprache und fuhr in englischer Mundart fort, ohne den leisesten Anklang fremder Aussprache:
»O ja, natürlich; – sagen Sie nur, wieviel bekamen Sie für die Beschaffung der Zeichnungen zu den verbesserten Verschlußstücken der neuen Feldgeschütze?«
»Fünf Jahre schweren Kerker in einer Festung«, gab Herr Verloc unerwartet zurück, doch ohne jedes betonte Gefühl.
»Da sind Sie billig davongekommen«, war Herrn Vladimirs Antwort. »Und jedenfalls ist Ihnen recht geschehen, weil Sie sich erwischen ließen. Wie sind Sie dazu gekommen?«
Man hörte Herrn Verlocs heisere Gesprächsstimme von Jugend reden, von einer unglücklichen Neigung zu einer unwürdigen – –
»Aha, cherchez la femme«, geruhte Herr Vladimir zu unterbrechen, nachlässig, doch ohne Freundlichkeit. Es lag sogar eine Spur von Grimm in seiner Herablassung. »Wie lange werden Sie schon von unserer Gesandtschaft verwendet?« fragte er.
»Seit den Tagen des verstorbenen Barons Stott-Wartenheim«, antwortete Herr Verloc unterwürfig und schob betrübt die Lippe vor, als Zeichen des Kummers um den verblichenen Diplomaten. Der erste Sekretär beobachtete schweigend dieses Mienenspiel.
»Ah, seit damals ... nun gut, was haben Sie für sich vorzubringen?« fragte er dann scharf.





























