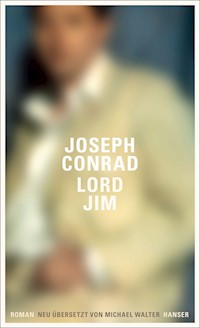9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Josephs Conrads »Geheimagent«, schildert einen Kriminalfall, der die Stadt London zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Aufruhr versetzte. Im Hinterzimmer eines unscheinbaren Ladens, irgendwo im düsteren, feuchten London am Ende des 19. Jahrhunderts, treffen sich seltsame Gestalten: Hier wird die anarchistische Revolution vorbereitet. Mr. Verloc, der Geheimagent, bekommt den Auftrag, die Sternwarte von Greenwich in die Luft zu jagen. Durch einen schrecklichen Unfall verändert sich Verlocs Leben auf dramatische Weise, und seine Frau Winnie, bisher nur arglose Lauscherin an der Tür, wird von der liebenden Gattin zum Racheengel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzt aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Neuauflage einer früheren Ausgabe
ISBN 978-3-492-97958-0
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Secret Agent«, London/New York 1907
© der deutschsprachigen Ausgabe: Haffmans Verlag AG, Zürich 1993
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Vorbemerkung des Autors
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Nachbemerkung des Übersetzers
FÜR H. G. WELLS
Dem Chronisten von Mr. Lewishams Liebe
dem Biographen von Kipps und dem
Historiker der künftigen Zeitalter
ist diese einfache Geschichte aus dem nseunzehnten Jahrhundert
sehr herzlich angetragen
Vorbemerkung des Autors
Der Ursprung von Der Geheimagent: sein Stoff, seine Behandlung, künstlerische Absicht und jeder andere Beweggrund, der einen Autor dazu veranlassen mag, zur Feder zu greifen, kann, so meine ich, auf eine Periode geistiger und emotionaler Rückwirkungen zurückverfolgt werden.
Im Grunde begann ich dieses Buch aus einem Impuls heraus und schrieb kontinuierlich daran. Als es dann schließlich gebunden und den Augen der Öffentlichkeit vorgelegt war, fand ich mich getadelt, es überhaupt verfaßt zu haben. Manche der Ermahnungen waren streng, andere hatten einen bedauernden Unterton. Ich habe sie nicht als Texte vor mir, doch des allgemeinen Tenors, welcher sehr einfach war, erinnere ich mich wohl; ebenso meiner Überraschung über ihre Art. All dies klingt nun wie eine sehr alte Geschichte! Und dennoch ist es noch nicht allzu lange her. Ich muß daraus schließen, daß ich mir im jähre 1907 noch immer viel von meiner ursprünglichen Unschuld bewahrt hatte. Heute scheint mir, daß selbst ein kunstfremder Mensch hatte voraussehen können, daß manche Kritik sich auf die elende Szenerie und die moralische Verkommenheit der Geschichte gründen würde.
Das ist natürlich ein ernster Einwand. Er war nicht allgemein. Es mag sogar undankbar erscheinen, sich unter so viel intelligenter und wohlwollender Würdigung eines solch kleinen Tadels zu erinnern; und ich vertraue darauf, daß die Leser dieses Vorwortes es nicht gleich als verletzte Eitelkeit oder eine natürliche Veranlagung zur Undankbarkeit abtun. Ich möchte unterstellen, daß ein großzügiges Herz meine Wahl sehr gut einer natürlichen Bescheidenheit zuschreiben könnte. Und dennoch ist es nicht eigentlich Bescheidenheit, die mich veranlaßt, zur Illustration meines Falles Tadel auszuwählen. Nein, es ist nicht eigentlich Bescheidenheit. Ich bin mir gar nicht so sicher, daß ich bescheiden bin; doch diejenigen, welche sich so weit durch mein Werk hindurchgelesen haben, werden mir genügend Anstand, Takt, savoir-faire, was auch immer, zubilligen, um nicht aus den Worten anderer ein Lied zum eigenen Ruhme zu machen. Nein! Das wahre Motiv für meine Wahl liegt in einer gänzlich anderen Richtung. Ich hatte schon immer die Neigung, meine Handlungen zu rechtfertigen. Nicht zu verteidigen. Zu rechtfertigen. Nicht darauf zu bestehen, daß ich im Recht sei, sondern einfach zu erklären, daß am Grunde meines Antriebes keine böse Absicht, keine heimliche Verachtung des natürlichen Feingefühls des Menschen lag.
Jene Art der Schwäche ist gefährlich nur insoweit, als sie einen dem Risiko aussetzt, langweilig zu werden; denn im allgemeinen interessieren die Welt nicht die Motive einer offensichtlichen Tat, sondern deren Konsequenzen. Der Mensch mag immer nur lächeln, doch er ist kein forschendes Wesen. Er liebt das Offensichtliche. Vor Erklärungen schreckt er zurück. Dennoch will ich mit den meinen fortfahren. Offensichtlich ist, daß ich das Buch nicht hätte schreiben müssen. Ich stand unter keinerlei Notwendigkeit, mich mit dem Stoff zu befassen; wobei ich das Wort Stoff sowohl im Sinne der Geschichte selbst als auch im weiteren einer besonderen Manifestation im Leben der Menschheit verwende. Dieses räume ich vollkommen ein. Doch der Gedanke, bloße Häßlichkeit lediglich um des Schokkierens willen auszuführen oder gar einfach, um meine Leser mittels eines Frontwechsels zu verblüffen, ist mir niemals in den Sinn gekommen. Indem ich diese Erklärung abgebe, erwarte ich, daß man mir glaubt, nicht nur aufgrund der Augenscheinlichkeit meines allgemeinen Charakters, sondern auch aus dem Grund, welchen jedermann sehen kann, daß nämlich die gesamte Behandlung der Geschichte, ihre inspirierende Empörung und die ihr zugrundeliegende Anteilnahme und Verachtung, meine Distanz zu dem Elend und der Verkommenheit beweisen, welche lediglich in den äußerlichen Umständen des Schauplatzes liegen.
Der Beginn von Der Geheimagent folgte unmittelbar auf eine zwei Jahre währende Periode intensiver Vertiefung in die Aufgabe, jenen entlegenen Roman Nostromo mit seiner weit entfernten lateinamerikanischen Atmosphäre zu schreiben, dazu auch das zutiefst persönliche Spiegel der See. Ersteres ein intensives kreatives Bemühen um das, was meiner Ansicht nach stets meine größte Leinwand bleiben wird, zweiteres ein freimütiger Versuch, für einen Moment die tieferen Vertrautheiten der See und die prägenden Einflüsse fast der Hälfte meines Lebens zu enthüllen. Es war auch eine Periode, in welcher mein Gefühl für die Wahrheit der Dinge von einer sehr intensiven imaginativen und emotionalen Bereitschaft begleitet war, welche, durchaus ganz echt und den Tatsachen getreu, mir doch das Gefühl gab (als die Aufgabe denn bewältigt war), als sei ich dabei zurückgeblieben, ziellos zwischen bloßen Empfindungshülsen und verloren in einer Welt anderer, minderer Werte.
Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das Gefühl hatte, daß ich eine Veränderung brauchte, eine Veränderung in meiner Einbildungskraft, in meiner Vision und in meiner Geisteshaltung. Ich glaube eher, daß eine Veränderung in der Grundstimmung sich schon unbewußt über mich gesenkt hatte. Ich erinnere mich nicht, daß sich etwas Bestimmtes ereignet hätte. Nachdem ich Spiegel der See in dem vollen Bewußtsein abgeschlossen hatte, daß ich in jeder Zeile jenes Buches ehrlich mit mir selbst und mit dem Leser umgegangen war, gab ich mich einer nicht unzufriedenen Pause hin. Dann, als ich mich sozusagen noch im Stillstand befand und gewiß nicht daran dachte, mich größerer Mühen zu unterziehen, um nach etwas Häßlichem zu suchen, kam mir der Stoff von Der Geheimagent in Gestalt einiger weniger Worte, die von einem Freund im zwanglosen Gespräch über Anarchisten oder besser, anarchistische Aktivitäten geäußert wurden; wie zur Sprache gekommen, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Allerdings erinnere ich mich, Bemerkungen über die kriminelle Vergeblichkeit der ganzen Sache, Doktrin, Aktion, Mentalität gemacht zu haben; ebenso über den verachtungswürdigen Aspekt der halbirren Pose gleich der eines schamlosen Schwindlers, welcher das brennende Elend und die leidenschaftliche Leichtgläubigkeit einer Menschheit ausbeutet, die stets auf so tragische Weise der Selbstzerstörung entgegenstrebt. Das war es, was seine philosophischen Scheingründe so unverzeihlich machte. Dann kamen wir auf besondere Vorfälle zu sprechen und erinnerten uns an die schon alte Geschichte des Versuches, das Observatorium in Greenwich in die Luft zu jagen; eine blutige Hirnverbranntheit von solcher Dummheit, daß es unmöglich war, ihren Ursprung durch jedweden vernünftigen oder unvernünftigen Gedankengang zu ergründen. Denn bösartige Unvernunft hat ihre eigenen logischen Gänge. Doch jene Gewalttat konnte geistig auf keinerlei Weise erfaßt werden, so daß man letztlich der Tatsache ins Auge schauen mußte, daß ein Mann für nichts, was auch nur im entferntesten einer Idee glich, sei sie eine anarchistische oder etwas anderes, in Stücke gerissen wurde. Was die Außenwand des Observatoriums betraf, so zeigte sie auch nicht den feinsten Riß.
Ich wies meinen Freund, welcher eine Weile stumm verharrte, auf das alles hin, worauf er dann in seiner für ihn typischen beiläufigen und allwissenden Art bemerkte: »Ach, der Bursche war ein halber Idiot. Seine Schwester beging anschließend Selbstmord.« Das waren die absolut einzigen Worte, die zwischen uns fielen; denn äußerste Überraschung über diese unerwartete Information ließ mich einen Augenblick verstummen, und dann begann er sogleich, von etwas anderem zu reden. Später kam es mir nie in den Sinn zu fragen, wie er zu diesem Wissen gelangt war. Ich bin mir sicher, wenn er nur einmal in seinem Leben einen Anarchisten von hinten gesehen hat, so muß dies das gesamte Ausmaß seiner Verbindungen zur Unterwelt gewesen sein. Gleichwohl war er ein Mann, der gern mit allen möglichen Menschen redete, und vielleicht hatte er jene erhellenden Tatsachen aus zweiter oder dritter Hand, von einem Straßenfeger, einem pensionierten Polizeibeamten, von irgendeinem unbestimmten Mann in seinem Club oder vielleicht gar von einem Staatsminister, den er auf einem öffentlichen oder privaten Empfang kennengelernt hatte.
Über ihre erhellende Qualität konnte kein Zweifel bestehen. Man kam sich vor, als träte man aus einem Wald auf eine Ebene – es war nicht viel zu sehen, doch hatte man viel Licht. Nein, es war nicht viel zu sehen, und offen gestanden versuchte ich eine beträchtliche Zeitlang nicht einmal, etwas zu erkennen. Nur jener erhellende Eindruck blieb. Er blieb nur auf passive Weise befriedigend. Dann, ungefähr eine Woche später, stieß ich auf ein Buch, welches meines Wissens nie größere Bekanntheit erlangt hatte, nämlich die recht knappen Erinnerungen eines Ministerialrates der Polizei, eines offenkundig fähigen Mannes mit einem stark religiösen Charakterzug, welcher seine Stellung zur Zeit der Dynamitanschläge in London, damals in den achtziger Jahren, angetreten hatte. Das Buch war recht interessant, natürlich sehr diskret; den Großteil seines Inhalts habe ich inzwischen vergessen. Es enthielt keine Enthüllungen, es hielt sich nett an der Oberfläche, weiter nichts. Ich werde nicht einmal versuchen zu erklären, warum mich eine kurze Passage von ungefähr sieben Zeilen gefesselt hatte, in welcher der Autor (ich glaube, sein Name war Anderson) einen kurzen Dialog wiedergab, der nach einem unerwarteten Anarchistenanschlag mit dem Innenminister in der Lobby des Unterhauses stattgefunden hatte. Ich glaube, das war damals Sir William Harcourt. Er war äußerst ungehalten, und der Beamte war bemüht, sich zu rechtfertigen. Unter den drei Sätzen, welche zwischen ihnen gewechselt wurden, war derjenige, welcher den größten Eindruck auf mich machte, Sir W. Harcourts Zornesausbruch: »Das ist ja alles gut und schön. Aber Ihre Vorstellung von Geheimhaltung da drüben scheint mir darin zu bestehen, daß Sie den Innenminister im dunkeln lassen.« Recht charakteristisch für Sir W. Harcourts Temperament, doch für sich betrachtet nichts Besonderes. Allerdings muß in dem ganzen Vorfall irgendeine Atmosphäre gelegen haben, denn mit einemmal fühlte ich mich angeregt. Und daraus erfolgte in meinem Kopf etwas, was ein Student der Chemie am besten durch eine Analogie mit der Hinzugabe des winzigsten Tröpfchens der richtigen Substanz, welche den Prozeß der Kristallisierung in einem Teströhrchen mit einer farblosen Lösung darin jäh herbeiführt, verstehen würde.
Zunächst war es für mich eine geistige Veränderung. Sie störte eine beruhigte Phantasie auf, in welcher seltsame Formen, scharf konturiert, jedoch unvollkommen erfaßt, erschienen und Aufmerksamkeit forderten, gleich Kristallen mit ihrer bizarren und unerwarteten Gestalt. Angesichts dieses Phänomens verfiel man ins Nachdenken – sogar über die Vergangenheit: über Südamerika, ein Kontinent der grellen Sonne und der brutalen Revolutionen, der See, der großen Weite des Salzwassers, des Spiegels des umwölkten und des lächelnden Himmels, des Reflektors des Lichtes der Welt. Dann bot sich die Vision einer riesigen Stadt, einer monströsen Stadt, volkreicher denn mancher Kontinent und in seiner von Menschenhand gerichteten Macht wie gleichgültig gegenüber dem umwölkten und dem lächelnden Himmel; eine grausame Verschlingerin des Lichtes der Welt. Darin war Platz genug, um jede Geschichte einzubetten, Tiefe genug für jede Leidenschaft, Vielfalt genug für jeden Schauplatz, Dunkel genug, um fünf Millionen Seelen darin zu begraben.
Auf unwiderstehliche Weise wurde die Stadt zum Hintergrund für die nachfolgende Periode tiefer und tastender Betrachtungen. Endlose Blicke öffneten sich vor mir in unterschiedliche Richtungen. Es würde Jahre brauchen, um den richtigen Weg zu finden! Es schien Jahre zu brauchen! … Langsam wuchs sich die keimende Überzeugung von Mrs. Verlocs mütterlicher Leidenschaft zwischen mir und jenem Hintergrund zu einer Flamme aus, welche ihn mit ihrer geheimen Inbrunst tönte und dafür etwas von ihrer eigenen düsteren Färbung erhielt. Endlich stand die Geschichte Winnie Verlocs von den Tagen ihrer Kindheit bis zum Ende vollständig vor mir, noch unproportioniert, alles war sozusagen noch im Rohentwurf; doch so weit, daß nun damit gearbeitet werden konnte. Es war eine Sache von ungefähr drei Tagen.
Dieses Buch ist jene Geschichte, auf überschaubare Proportionen reduziert, im ganzen Verlauf um die absurde Grausamkeit der Explosion vom Greenwich Park angelegt und kreisend. Damit hatte ich eine Aufgabe, die ich nicht mühselig nennen möchte, die jedoch von absorbierendster Schwierigkeit war. Doch es mußte getan werden. Es war eine Notwendigkeit. Die Figuren, die um Mrs. Verloc gruppiert sind und direkt oder indirekt mit ihrem tragischen Verdacht in Verbindung stehen, daß »das Leben einem genaueren Hinschauen nicht standhält«, sind das Ergebnis eben jener Notwendigkeit. Ich persönlich hatte nie Zweifel an der Wirklichkeit von Mrs. Verlocs Geschichte, doch mußte sie aus ihrem Dunkel in jener gewaltigen Stadt herausgelöst, mußte glaubhaft gemacht werden, weniger bezüglich ihrer Psychologie, als vielmehr bezüglich ihrer Menschlichkeit. Was die Umgebung betraf, so mangelte es nicht an Hinweisen. Ich mußte hart kämpfen, um die Erinnerungen an meine einsamen und nächtlichen Gänge durch ganz London in jüngeren Tagen auf Distanz zu halten, damit sie nicht herbeistürmten und jede Seite der Geschichte überfluteten, während diese eine nach der anderen aus einer Stimmung entstanden, welche im Fühlen und Denken so ernst war wie nur eine, in der ich je eine Zeile schrieb. Insofern finde ich allerdings, daß Der Geheimagent eine absolut ernsthafte Arbeit ist. Selbst der rein künstlerische Zweck, auf einen Gegenstand dieser Art ein ironisches Verfahren anzuwenden, wurde mit Überlegung und in dem ernsten Glauben formuliert, daß allein die ironische Behandlung mich in die Lage versetzen würde, alles, was ich aus Verachtung wie auch aus Anteilnahme zu sagen hätte, auch sagen könnte. Es ist eine der kleineren Befriedigungen meines schriftstellerischen Lebens, daß ich, nachdem ich diesen Entschluß gefaßt hatte, diesen auch, wie mir scheint, bis zum Schluß durchhalten konnte. Hinsichtlich der Charaktere, welche die absolute Notwendigkeit des Falles – Mrs. Verlocs Fall – vor dem Londoner Hintergrund herausbringt, habe ich auch von diesen jene kleinen Befriedigungen erhalten, welche gegenüber der Masse bedrückender Zweifel, welche jeglichen Versuch kreativer Arbeit hartnäckig bedrängen, wirklich viel zählen. Beispielsweise habe ich über Mr. Vladimir (der sich für eine karikaturistische Darstellung geradezu aufdrängte) mit Freude vernommen, ein erfahrener Mann von Welt habe gesagt, daß »Conrad mit jener Sphäre in Kontakt gekommen sein oder ansonsten eine hervorragende Intuition der Dinge haben muß«, weil Mr. Vladimir »nicht nur im Detail möglich, sondern in wesentlichen Zügen vollkommen richtig« sei. Dann berichtete mir ein Besucher aus Amerika, daß alle möglichen revolutionären Flüchtlinge in New York befänden, das Buch sei von einem geschrieben worden, der eine Menge über sie wisse. Dies nahm ich in Anbetracht dessen, daß ich von ihresgleichen noch weniger als der allwissende Freund, der mir die erste Anregung zu diesem Roman gab, zu Gesicht bekommen hatte, als ein sehr großes Kompliment. Gleichwohl besteht kein Zweifel, daß es während der Abfassung des Romans Augenblicke gab, da ich ein extremer Revolutionär war, ich will nicht sagen, überzeugter als sie, aber einer, der ein konzentrierteres Ziel vor Augen hatte als jeder einzelne von ihnen im gesamten Verlauf seines Lebens. Ich sage das nicht, um mich zu brüsten. Ich widmete mich lediglich meiner Sache. Bei allen meinen Büchern habe ich mich stets meiner Sache gewidmet. Ich habe mich ihr bis zur völligen Selbstaufgabe gewidmet. Und auch mit dieser Feststellung will ich mich nicht brüsten. Anders hätte ich es nicht gekonnt. Es hätte mich zu sehr gelangweilt, eine Scheinwelt aufzubauen.
Die Anregungen für gewisse Charaktere in der Geschichte, gesetzestreue wie gesetzlose, kamen von verschiedenen Quellen, welche vielleicht hier und da ein Leser erkannt haben mag. Sie sind nicht sehr im Geheimen. Doch geht es mir hier nicht darum, irgend eine dieser Figuren zu legitimieren, und selbst bezüglich meiner allgemeinen Ansicht über das moralische Verhalten zwischen Verbrecher und Polizei will ich nur sagen, daß sie mir wenigstens vertretbar erscheint.
Die zwölf Jahre, die seit der Veröffentlichung des Buches vergangen sind, haben meine Haltung nicht geändert. Ich bedaure nicht, es geschrieben zu haben. Unlängst haben mich Umstände, welche nichts mit dem allgemeinen Tenor dieses Vorwortes zu tun haben, bewogen, diese Geschichte der literarischen Robe indignierter Verachtung zu entkleiden, welche ihr ordentlich zuzuschneiden mich so viel gekostet hat. Ich wurde sozusagen gezwungen, sie mir nackt und bloß anzusehen. Ich gestehe, sie gibt ein grausliches Skelett ab. Doch nach wie vor stelle ich anheim, daß ich, indem ich Winnie Verlocs Geschichte bis zu ihrem anarchistischen Ende der äußersten Trostlosigkeit, des Wahnsinns und der Verzweiflung erzähle und sie erzähle, wie ich sie hier erzählt habe, nicht die Absicht hatte, einen sinnlosen Anschlag auf die Gefühle der Menschheit zu verüben.
1920 J. C.
Erstes Kapitel
ALS Mr. Verloc am Morgen ausging, überließ er seinen Laden formell der Obhut seines Schwagers. Das konnte er tun, weil das Geschäft zu jeder Zeit sehr schlecht lief und vor dem Abend praktisch überhaupt nicht. Mr. Verloc kümmerte sich nur wenig um sein vorgebliches Geschäft. Und überdies war der Schwager in der Obhut seiner Frau.
Der Laden war klein, ebenso auch das Haus. Es war eines jener verrußten Backsteinhäuser, welche es in großer Zahl gab, bevor das Zeitalter des Neuaufbaus über London heraufzog. Der Laden glich einer quadratischen Schachtel, deren Straßenseite mit kleinen Scheiben verglast war. Untertags blieb die Tür verschlossen; am Abend stand sie diskret, aber verdächtig angelehnt.
Das Schaufenster enthielt Photographien mehr oder minder bekleideter Tänzerinnen; unbestimmbare, wie Arzneimittelchen eingeschlagene Päckchen; verschlossene gelbe Papierumschläge, sehr dünn und in schweren schwarzen Ziffern mit 2/6 ausgezeichnet; ein paar Nummern alter französischer humoristischer Zeitschriften, die wie zum Trocknen an einer Leine aufgehängt waren; eine trüb-blaue Porzellanschale; ein schwarzes Holzkästchen, Flaschen mit Zeichentinte und Gummistempel; ein paar Bücher mit Titeln, die auf Unziemliches hindeuteten; ein paar anscheinend alte Ausgaben obskurer Zeitungen, schlecht gedruckt, mit Titeln wie die Fackel, der Gong – aufrüttelnde Titel. Und die beiden Gasbrenner hinter den Scheiben waren stets niedrig gestellt, sei es um der Sparsamkeit oder um der Kunden willen.
Diese Kunden waren entweder sehr junge Männer, die sich eine Weile vor dem Fenster herumdrückten, bevor sie plötzlich hineinhuschten, oder Männer reiferen Alters, die jedoch irn allgemeinen aussahen, als seien sie nicht bei Kasse. Einige der letzteren hatten den Kragen des Überrockes bis zum Schnurrbart hochgeschlagen und Schmutzspuren unten an den Beinkleidern, die dem Aussehen nach viel getragen und nicht sehr wertvoll waren. Und auch die Beine, die darin steckten, wirkten in der Regel nicht weiter von Belang. Die Hände tief in die Seitentaschen des Überrockes gestoßen, stahlen sie sich seitwärts hinein, eine Schulter voraus, als fürchteten sie, die Glocke auszulösen.
Die Glocke, welche mittels eines geschwungenen Stahlbandes an der Tür hing, war schwierig zu umgehen. Sie war rettungslos gesprungen; abends jedoch rasselte sie bei der geringsten Provokation mit ungehöriger Heftigkeit hinter dem Kunden her.
Sie rasselte; und auf dieses Signal hin pflegte Mr. Verloc durch die staubige Glastür hinter dem Ladentisch aus gestrichenen Kieferndielen aus der Stube dahinter eilig hindurchzustürzen. Seine Augen waren von Natur schwer; er wirkte, als hätte er sich, voll bekleidet, den ganzen Tag auf einem ungemachten Bett herumgewälzt. Ein anderer hätte eine solche Erscheinung entschieden als Nachteil gewertet. In einem Geschäfts unternehmen des Einzelhandels hängt viel vom einnehmenden und liebenswürdigen Äußeren des Verkäufers ab. Doch Mr. Verloc kannte sein Geschäft und blieb von jeglichem ästhetischen Zweifel hinsichtlich seines Erscheinungsbildes unberührt. Mit fester, starräugiger Dreistigkeit, welche die Nötigung mit einer schrecklichen Bedrohung zurückzuhalten schien, machte er sich daran, irgend einen Gegenstand über den Ladentisch zu verkaufen, welcher in schändlicher Offenkundigkeit das Geld, das bei dem Handel den Besitzer wechselte, nicht wert war: beispielsweise eine kleine Pappschachtel, welche offenbar nichts enthielt, oder einen jener sorgsam verschlossenen gelben dünnen Umschläge oder ein fleckiges, in Papier geschlagenes Buch mit einem verheißungsvollen Titel. Hin und wieder geschah es, daß eine der verblichenen, gelben Tänzerinnen an einen Amateur verkauft wurde, als wäre sie lebendig und jung gewesen.
Zuweilen erschien auf den Ruf der gesprungenen Glocke hin auch Mrs. Verloc. Winnie Verloc war eine junge Frau mit voller Büste in einem engen Mieder und mit breiten Hüften. Ihr Haar war sehr ordentlich. Starraugig wie ihr Mann, bewahrte sie hinter der Schutzwehr des Ladentisches eine Miene unergründlicher Gleichgültigkeit. Dann geriet der Kunde von vergleichsweise zarten Jahren plötzlich aus der Fassung, weil er es mit einer Frau zu tun hatte, und äußerte, einen Sturm im Herzen, die Bitte um eine Flasche Zeichentinte, Einzelhandelspreis Sixpence (Preis in Verlocs Laden ein Shilling Sixpence), welche er dann, wieder draußen, verstohlen in die Gosse fallen ließ.
Die Abendbesucher – die Männer mit den hochgeschlagenen Krägen und den herabgedrückten Hüten – nickten Mrs. Verloc vertraut zu und hoben unter gemurmeltem Gruß die Klappe am Ende des Ladentisches, um in die hintere Stube zu gelangen, welche wiederum Zugang zu einem Flur und einer steilen Treppe gewährte.
Die Ladentür war die einzige Möglichkeit des Zutritts zu dem Haus, in welchem Mr. Verloc seinem Geschäft als Verkäufer dubioser Waren nachging, seine Berufung als Beschützer der Gesellschaft ausübte und seine häuslichen Tugenden pflegte. Diese letzteren waren ausgeprägt. Er war ein durch und durch häuslicher Mensch. Weder seine geistlichen noch seine geistigen noch seine körperlichen Bedürfnisse waren derart, daß sie ihn weiters aus dem Hause führten. Zu Hause fand er das Behagen des Körpers und den Frieden des Gewissens, dazu noch die ehelichen Zuwendungen Mrs. Verlocs sowie die ehrerbietige Achtung von Mrs. Verlocs Mutter.
Winnies Mutter war eine kräftige Frau mit großem braunem Gesicht und pfeifendem Atem. Unter einer weißen Haube trug sie eine schwarze Perücke. Ihre geschwollenen Beine verurteilten sie zur Untätigkeit. Sie betrachtete sich als französischen Ursprungs, was wahr sein mochte; und nach etlichen Jahren des Ehelebens mit einem Schankwirt von der gewöhnlicheren Sorte versorgte sie sich in ihrer Witwenschaft, indem sie Herren möblierte Zimmer in der Nähe der Vauxhall Bridge Road an einem Platz vermietete, welchem einstmals ein gewisser Glanz geeignet hatte und der noch immer zum Bezirk Belgravia gehörte. Dieser topographische Umstand gereichte den Inseraten ihrer Zimmer zu einigem Vorteil, doch die Gäste der würdigen Witwe waren nicht gerade von der vornehmen Art. Wie sie auch waren, ihre Tochter Winnie half ihr dabei, sich um sie zu kümmern. Spuren französischer Abstammung, derer sich die Witwe rühmte, zeigten sich auch bei Winnie. Sie zeigten sich in dem äußerst sauberen und kunstvollen Arrangement ihres glänzenden Haares. Winnie hatte auch andere Reize: ihre Jugend, ihre volle, runde Gestalt, ihr klarer Teint, die Provokation ihrer unergründlichen Zurückhaltung, die nie so weit ging, eine Unterhaltung zu verhindern, welche von Seiten des Pensionsgastes mit Lebhaftigkeit, von der ihren mit gleichförmiger Liebenswürdigkeit geführt wurde. Nun muß Mr. Verloc für diesen Zauber empfänglich gewesen sein. Mr. Verloc war ein unregelmäßiger Gast. Er kam und ging ohne jeden weiteren ersichtlichen Grund. Für gewöhnlich traf er in London (wie die Grippe) vom Kontinent ein, nur daß er von der Presse unangekündigt eintraf, und seine Heimsuchungen setzten mit großer Heftigkeit ein. Er frühstückte im Bett und wälzte sich Tag für Tag mit einer Miene stillen Genusses bis zur Mittagszeit darin – und manchmal gar bis zu noch späterer Stunde. Doch wenn er ausging, schien es ihm große Schwierigkeiten zu bereiten, den Weg zu seinem vorübergehenden Zuhause an dem Platz in Belgravia zurückzufinden. Er verließ es spät und kehrte früh zurück – früh erst um drei oder vier morgens, und wandte sich, nachdem er um zehn erwacht war, in den heiseren, versagenden Tönen eines Mannes, der viele Stunden lang ununterbrochen heftig geredet hatte, mit scherzender, erschöpfter Umgänglichkeit an Winnie, sie möge ihm das Frühstückstablett bringen. Seine hervorstehenden, unter schweren Lidern sitzenden Augen rollten liebessinnig und wohlig hin und her, das Bettleinen war bis zum Kinn emporgezogen, und sein dunkler weicher Schnauzbart bedeckte seine dicken Lippen, die manch honigsüßer Neckereien fähig waren.
Nach Meinung von Winnies Mutter war Mr. Verloc ein sehr netter Herr. Von ihrer Lebenserfahrung, die sie in unterschiedlichen »Geschäftshäusern« gesammelt hatte, hatte die gute Frau in ihren Ruhestand ein Ideal des feinen Herrn mitgebracht, wie es von den Gästen der besseren Schankhäuser verkörpert wurde. Mr. Verloc näherte sich diesem Ideal, ja, er erreichte es sogar.
»Natürlich übernehmen wir dein Mobiliar, Mutter«, hatte Winnie bemerkt.
Die Pension sollte aufgegeben werden. Anscheinend war es nicht ratsam, sie weiterzuführen. Es hätte Mr. Verloc zu viel Umstände bereitet. Es wäre für sein anderes Geschäft nicht günstig gewesen. Was dieses Geschäft war, sagte er nicht, doch nach seiner Verlobung mit Winnie unterzog er sich der Mühe, vor Mittag aufzustehen, die Souterraintreppe herabzusteigen und sich mit Winnies Mutter im Frühstücksraum, wo sie ihr bewegungsloses Dasein führte, ein wenig zu unterhalten. Er streichelte die Katze, schürte das Feuer, nahm sein Mittagsmahl ein, das ihm dort serviert wurde. Mit offenkundigem Widerstreben verließ er die dortige leicht muffige Behaglichkeit, blieb jedoch gleichwohl bis zu weit vorgerückter Stunde aus. Niemals erbot er sich, Winnie ins Theater auszuführen, wie ein so netter Herr es eigentlich hätte tun sollen. Seine Abende waren ausgefüllt. Seine Arbeit sei gewissermaßen politisch, sagte er Winnie einmal. Sie müsse, mahnte er sie, zu seinen politischen Freunden sehr nett sein. Und mit ihrem geraden, unergründlichen Blick antwortete sie, daß sie dies natürlich sein werde.
Wieviel mehr er ihr bezüglich seiner Beschäftigung erzählte, war für Winnies Mutter unmöglich zu ermitteln. Das Ehepaar übernahm sie zusammen mit dem Mobiliar. Die armselige Erscheinung des Ladens überraschte sie. Der Wechsel von dem Platz in Belgravia in die schmale Gasse in Soho wirkte sich nachteilig auf ihre Beine aus. Sie schwollen zu enormer Größe an. Andererseits erfuhr sie eine vollkommene Befreiung von materiellen Sorgen. Das schwerfällige, gutmütige Wesen ihres Schwiegersohnes erfüllte sie mit dem Gefühl absoluter Sicherheit. Für die Zukunft ihrer Tochter war offensichtlich gesorgt, und selbst bezüglich ihres Sohnes Stevie brauchte sie sich nicht zu ängstigen. Sie hatte es nicht vor ihr zu verbergen vermocht, daß er eine schreckliche Last war, der arme Stevie. Doch im Hinblick auf Winnies Zuneigung zu ihrem empfindlichen Bruder und auf Mr. Verlocs freundliche und großzügige Veranlagung meinte sie, daß der arme Junge in dieser rauhen Welt recht sicher war. Und im Innersten ihres Herzens mißfiel es ihr vielleicht doch nicht, daß die Verlocs keine Kinder hatten. Da dieser Umstand Mr. Verloc vollkommen gleichgültig zu sein schien und Winnie in ihrem Bruder ein Objekt quasimütterlicher Liebe fand, war dies für den armen Stevie vielleicht ganz gut so.
Denn mit dem Jungen war schwer etwas anzufangen. Er war empfindlich und, mit Ausnahme der leer herabhängenden Unterlippe, auf eine zerbrechliche Weise gut aussehend. Unter unserem hervorragenden System der allgemeinen Schulpflicht hatte er, ungeachtet der unvorteilhaften Erscheinung seiner Unterlippe, Lesen und Schreiben gelernt. Doch als Botenjunge war ihm kein besonderer Erfolg beschieden. Er vergaß seine Aufträge; vom geraden Pfad der Pflicht ließ er sich leicht von den Attraktionen streunender Katzen und Hunde abbringen, denen er durch enge Gassen auf anrüchige Plätze folgte; von der Komödie der Straßen, welche er, zum Schaden der Interessen seines Auftraggebers, offenen Mundes betrachtete; oder von dem Drama gefallener Pferde, dessen Pathos und Gewalt ihn zuweilen veranlaßte, in der Menge, welche sich in ihrer stillen Freude an dem Volksspektakel nicht gern durch Verzweiflungslaute stören ließ, durchdringend aufzuschreien. Wenn er dann von einem ernsten und schützenden Polizisten weggeführt wurde, dann stellte sich häufig heraus, daß der arme Stevie seine Adresse vergessen hatte – wenigstens im Augenblick. Eine brüske Frage löste bei ihm ein Stottern bis hin zum Ersticken aus. Wurde er von etwas Verwirrendem aufgeschreckt, pflegte er furchtbar zu schielen. Allerdings hatte er nie Anfälle (was ermutigend war), und in den Tagen seiner Kindheit konnte er vor den natürlichen Ausbrüchen der Ungeduld seitens seines Vaters stets hinter die kurzen Röcke seiner Schwester Winnie laufen, um dort Schutz zu suchen. Andererseits hätte man argwöhnen können, er verberge einen Vorrat an dreister Ungezogenheit. Als er vierzehn Jahre alt war, entdeckte ihn ein Freund seines verstorbenen Vaters, ein Vertreter einer ausländischen Milchkonservenfirma, welcher ihm eine Gelegenheit als Bürojunge gegeben hatte, an einem nebligen Nachmittag, wie er in Abwesenheit seines Chefs im Treppenhaus damit beschäftigt war, Feuerwerkskörper abzubrennen. In schneller Folge feuerte er eine Reihe wilder Raketen, wütender Feuerräder, laut explodierender Schwärmer ab – und die Angelegenheit hätte sich als sehr ernst erweisen können. Im ganzen Gebäude breitete sich eine schreckliche Panik aus. Würgende Buchhalter, Entsetzen im Blick, hetzten durch die raucherfüllten Gänge; Seidenhüte und ältere Geschäftsmänner sah man getrennt voneinander die Treppen hinabrollen. Stevie schien aus dem, was er getan hatte, keinerlei persönliche Befriedigung abzuleiten. Seine Gründe für diesen originellen Einfall waren schwierig auszumachen. Erst später erhielt Winnie von ihm ein verschwommenes und wirres Geständnis. Anscheinend hatten zwei andere Bürojungen im Gebäude mit Geschichten von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung auf seine Gefühle eingewirkt, bis sie sein Mitgefühl bis zu jener äußersten Raserei aufgestachelt hatten. Doch der Freund seines Vaters entließ ihn natürlich ohne viel Federlesens, weil er wohl noch sein Geschäft ruinieren werde. Nach dieser altruistischen Heldentat wurde Stevie in die Küche im Souterrain gesteckt, wo er beim Spülen helfen und die Stiefel der Herren, welche in der Villa in Belgravia abstiegen, putzen sollte. Es war klar, daß eine solche Arbeit keine Zukunft barg. Die Herren gaben ihm hin und wieder einen Shilling Trinkgeld. Mr. Verloc erwies sich als der großzügigste der Gäste. Doch im ganzen belief sich all das auf nicht sehr viel, weder hinsichtlich seiner Einkünfte noch seiner Aussichten; und als denn Winnie ihre Verlobung mit Mr. Verloc bekanntgab, konnte ihre Mutter nicht umhin, sich mit einem Seufzer und einem Blick auf die Spülküche zu fragen, was wohl nun aus dem armen Stevie werden sollte.
Es erwies sich, daß Mr. Verloc bereit war, ihn zusammen mit der Mutter seiner Frau und dem Mobiliar, welches das gesamte sichtbare Vermögen der Familie darstellte, zu übernehmen. Mr. Verloc nahm alles, wie es kam, an seine breite, gutmütige Brust. Das Mobiliar wurde zum besten aller über das ganze Haus verteilt, Mrs. Verlocs Mutter jedoch wurde in zwei Hinterzimmer im ersten Stock verbannt. Der glücklose Stevie schlief in einem davon. Mittlerweile hatte ein dünner flaumiger Haarwuchs gleich einem goldenen Schleier die scharfe Kurve seines kleinen Unterkiefers verwischt. Er half seiner Schwester mit blinder Liebe und Fügsamkeit bei ihren Haushaltspflichten. Mr. Verloc fand, daß eine Beschäftigung gut für ihn sei. In seiner freien Zeit beschäftigte er sich damit, mit Zirkel und Stift Kreise auf ein Blatt Papier zu zeichnen. Dieser Kurzweil gab er sich, die Ellbogen gespreizt, tief über den Küchentisch gebeugt, mit großem Fleiß hin. Durch die offene Tür der Wohnstube hinter dem Laden warf Winnie, seine Schwester, hin und wieder Blicke mütterlicher Wachsamkeit auf ihn.
Zweites Kapitel
SOLCHERMASSEN waren das Haus, der Haushalt und das Geschäft, welches Mr. Verloc auf seinem Weg gen Westen um halb elf Uhr vormittags zurückließ. Es war ungewöhnlich früh für ihn; seine ganze Person verströmte den Charme fast tauiger Frische; er trug seinen blauen Überrock offen, seine Stiefel glänzten, seine Wangen, frisch rasiert, leuchteten gewissermaßen, und selbst die Augen unter den schweren Lidern, von einer Nacht friedlichen Schlummers erfrischt, sandten Blicke von relativer Wachheit aus. Durch das Parkgitter hindurch erfaßten diese Blicke Männer und Frauen, die auf der Row ritten, Paare, die einträchtig vorüberkanterten, andere, die in gesetztem Gang voranschritten, schlendernde Gruppen zu dreien oder vieren, einzelne Reiter, die ungesellig wirkten, und einzelne Frauen, denen in weitem Abstand ein Groom mit einer Kokarde am Hut und einem Ledergurt über dem eng sitzenden Rock hinterherritt. Kutschen rollten vorbei, zumeist zweispännige Broughams, dazwischen hier und da eine Viktoriachaise mit dem Fell eines wilden Tieres im Innern und dem Gesicht und Hut einer Frau, der sich über das eingefaltete Dach erhob. Und eine eigentümliche Londoner Sonne – gegen welche nichts zu sagen war, außer daß sie blutunterlaufen war – verklärte all das mit ihrem starren Blick. Mit einer Miene pünktlicher und milder Wachsamkeit hing sie in mäßiger Höhe über Hyde Park Corner. Selbst das Pflaster unter Mr. Verlocs Füßen hatte in dem diffusen Licht einen altgoldnen Anstrich, in welchem weder Mauer noch Baum noch Tier noch Mensch einen Schatten warfen. Mr. Verloc ging in einer Atmosphäre alten Goldstaubes durch eine schattenlose Stadt gen Westen. Kupferrot schimmerte es auf Hausdächern, an Mauerekken, auf Kutschenscheiben, selbst auf dem Fell der Pferde und auf dem breiten Rücken von Mr. Verlocs Überrock, was einen Effekt stumpfer Rostigkeit bewirkte. Doch Mr. Verloc war sich nicht im mindesten bewußt, eingerostet zu sein. Durch das Parkgitter hindurch betrachtete er die Zeugnisse des Überflusses und des Luxus der Stadt mit wohlgefälligem Blick. All diese Menschen mußten beschützt werden. Schutz ist das oberste Gebot von Überfluß und Luxus. Sie mußten beschützt werden; und ihre Pferde, Kutschen, Häuser, Diener mußten beschützt werden; und der Quell ihres Reichtums mußte im Herzen der Stadt und im Herzen des Landes beschützt werden; die gesamte gesellschaftliche Ordnung, welche ihrer hygienischen Trägheit dienlich war, mußte vor dem seichten Neid unhygienischer Arbeit geschützt werden. Mußte – und Mr. Verloc hätte sich die Hände vor Befriedigung gerieben, wäre er nicht von Natur aus jeglicher überflüssiger Anstrengung abhold gewesen. Seine Trägheit war nicht hygienisch, doch stand sie ihm sehr gut. Er gab sich ihr gewissermaßen mit einer Art schwerfalligem Fanatismus hin, oder vielleicht eher mit einer fanatischen Schwerfälligkeit. Von fleißigen Eltern in ein Leben harter Arbeit geboren, hatte er die Indolenz aus einem Impuls heraus ergriffen, welcher so tief, so unerklärlich und so gebieterisch war wie jener, der die Vorliebe eines Mannes für eine bestimmte Frau unter tausend leitet. Selbst für einen Demagogen, für einen Arbeiterredner, für einen Arbeiterführer war er zu faul. Das machte zu viel Mühe. Er benötigte eine vollkommenere Form der Muße; es hätte aber auch sein können, daß er das Opfer eines philosophischen Zweifels an der Effektivität jeder menschlichen Anstrengung war. Eine solche Form der Indolenz erfordert, impliziert ein gewisses Maß an Intelligenz. Mr. Verloc mangelte es nicht an Intelligenz – und bei der Vorstellung einer bedrohten gesellschaftlichen Ordnung hätte er sich vielleicht zugezwinkert, wäre jenes Zeichen des Skeptizismus nicht mit einer Anstrengung verbunden gewesen. Seine großen, hervorstehenden Augen eigneten sich nicht gut zum Zwinkern. Sie waren eher von der Art, welche sich mit majestätischem Effekt feierlich zum Schlummer schließt.
Unauffällig und stramm im Stile eines fetten Schweins setzte Mr. Verloc, ohne sich vor Befriedigung die Hände zu reiben oder auch skeptisch ob seiner Gedanken zu zwinkern, seinen Weg fort. Schwer stapfte er mit seinen glänzenden Stiefeln übers Pflaster, und sein allgemeiner Aufzug war der eines wohlhabenden Mechanikers in eigenen Geschäften. Vom Bilderrahmenmacher bis zum Schmied hätte er alles sein können; ein Dienstherr im kleinen. Doch hatte er auch etwas Unbeschreibbares an sich, welches kein Handwerker sich in der Praxis seines Gewerbes hätte aneignen können, wie unehrlich er es auch ausgeübt hätte: Etwas, das Männern gemein ist, welche von den Lastern, den Torheiten oder den gemeineren Ängsten der Menschheit leben; einen moralischen Nihilismus, welcher Inhabern von Spielhöllen und Freudenhäusern gemein ist, Privatdetektiven und Auskunfteiagenten, Getränkeverkäufern und, wie ich meine, den Verkäufern kräftigender elektrischer Gürtel und den Erfindern von Arzneimittelchen. Im Falle der letzteren bin ich mir nicht ganz sicher, da ich meine Untersuchungen nicht in solche Tiefen ausgedehnt habe. Soweit ich weiß, kann der Ausdruck dieser letzteren ausgesprochen diabolisch sein. Es sollte mich nicht wundern. Bekräftigen möchte ich, daß Mr. Verlocs Ausdruck keinesfalls diabolisch war.
Bevor er Knightsbridge erreichte, bog Mr. Verloc aus der belebten Verkehrsader mit ihrem tosenden Lärm der schwankenden Omnibusse und dahintrottenden Packwagen nach links in den nahezu lautlosen, raschen Strom der Hansoms ab. Die Haare unter seinem Hut, welchen er leicht nach hinten gekippt trug, waren sorgfaltig zu respektheischender Glätte gebürstet; denn sein Geschäft trieb er mit einer Botschaft. Und Mr. Verloc marschierte nun, fest wie ein Fels – eine weiche Art Fels –, eine Straße entlang, welche mit aller Angemessenheit privat genannt werden konnte. Mit ihrer Breite, Leere und Ausdehnung eignete ihr die Würde anorganischer Natur, eines Stoffes, welcher niemals stirbt. Die einzige Mahnung an die Sterblichkeit war der Brougham eines Arztes, welcher in erhabener Einsamkeit nahe am Bordstein verharrte. Die polierten Klopfer an den Türen leuchteten, soweit das Auge reichte, die sauberen Fenster schimmerten in einem dunklen, opaken Glanz. Und alles war still. Doch ein Milchkarren klapperte geräuschvoll quer über die ferne Perspektive; ein Fleischerjunge, der mit der edlen Rücksichtslosigkeit eines Wagenlenkers bei den Olympischen Spielen fuhr, sauste um die Ecke, hoch über einem Paar roter Räder sitzend. Eine schuldig wirkende Katze kam unter den Steinen hervor und rannte eine Weile vor Mr. Verloc her, um dann in einen anderen Souterrain zu tauchen; und ein dicker Konstabler, welchem, wie er scheinbar aus einem Laternenpfahl heraustrat, jegliche Gefühlsregung fremd zu sein schien, als wäre auch er Teil der anorganischen Natur, nahm nicht die leiseste Notiz von Mr. Verloc. Indem Mr. Verloc nach links abbog, verfolgte er seinen Weg durch eine schmale Straße an einer gelben Mauer entlang, auf welcher aus unersichtlichem Grund in schwarzen Buchstaben Chesham Square Nr. I geschrieben stand. Der Chesham Square war wenigstens sechzig Yards entfernt, und Mr. Verloc, welcher Kosmopolit genug war, um sich nicht von den geographischen Mysterien Londons täuschen zu lassen, schritt ohne ein Zeichen der Verblüffung oder Empörung weiter. Schließlich erreichte er mit geschäftsmäßiger Beharrlichkeit den Platz und überquerte ihn diagonal zur Nummer 10. Diese gehörte zu einem eindrucksvollen Kutschentor in einer hohen, sauberen Wand zwischen zwei Häusern, deren eines vernünftigerweise die Nummer 9 trug, während das andere mit 37 numeriert war; der Umstand jedoch, daß letzteres zur Porthill Street gehörte, einer in dem Viertel wohlbekannten Straße, wurde von einer Inschrift verkündet, die oberhalb der Erdgeschoßfenster von der überaus tüchtigen Behörde angebracht war, welche auch immer mit der Pflicht betraut ist, Londons streunende Häuser im Auge zu behalten. Warum die Gewalten nicht vom Parlament (ein kurzes Gesetz würde genügen) aufgefordert werden, jene Gebäude zu nötigen, dorthin zurückzukehren, wo sie hingehören, ist eines der Mysterien der Stadtverwaltung. Mr. Verloc belastete seinen Kopf nicht damit, da seine Lebensbestimmung der Schutz der gesellschaftlichen Mechanismen war, nicht jedoch ihre Vervollkommnung oder gar ihre Kritik.
Es war so früh, daß der Torwächter der Botschaft, als er hastig aus seinem Häuschen hervortrat, noch immer mit dem linken Ärmel seiner Uniformjacke rang. Seine Weste war rot, und er trug Kniebundhosen, doch seine Erscheinung war erhitzt. Mr. Verloc, sich des Sturms auf seine Flanke bewußt, wehrte diesen ab, indem er einfach einen mit dem Wappen der Botschaft bedruckten Umschlag von sich hielt, und schritt weiter. Denselben Talisman zeigte er auch dem Diener vor, der die Tür öffnete, und trat zurück, damit dieser ihn in die Eingangshalle einlassen konnte.
In einem hohen Kamin brannte ein reines Feuer, und ein älterer Mann, welcher, angetan mit Abendanzug und einer Kette um den Hals, mit dem Rücken dazu stand, schaute von der Zeitung auf, die er vor seinem ruhigen und strengen Gesicht mit beiden Händen ausgebreitet hielt. Er bewegte sich nicht; doch ein weiterer Lakai in braunen Hosen und mit dünnem gelbem Kord gesäumtem Frack näherte sich ihm, lauschte dem Gemurmel seines Namens und machte sich, nachdem er sich geräuschlos auf dem Absatz umgedreht hatte, davon, ohne sich noch einmal umzublicken. Mr. Verloc, derart in einen Gang im Erdgeschoß links von der großen, mit Teppich ausgelegten Treppe geleitet, wurde unvermittelt durch eine Handbewegung aufgefordert, einen kleinen Raum zu betreten, welcher mit einem schweren Schreibtisch und einigen Stühlen möbliert war. Der Diener schloß die Tür, und Mr. Verloc blieb allein zurück. Er nahm nicht Platz. Hut und Stock in einer Hand haltend, blickte er um sich, wobei er sich mit der anderen schwammigen Hand über den unbedeckten glatten Kopf strich.
Eine weitere Tür öffnete sich geräuschlos, und Mr. Verloc sah, als er den Blick in jene Richtung festigte, zunächst nur schwarze Kleidung. Das kahle Ende eines Kopfes und ein kraftloser dunkelgrauer Backenbart zu beiden Seiten eines Paars runzliger Hände. Der Mensch, der eingetreten war, hielt einen Stoß Papiere vor den Augen und trat mit recht geziertem Schritt an den Tisch, derweil er die Papiere umdrehte. Der Geheime Botschaftsrat Wurmt, Chancelier d’Ambassade, war ziemlich kurzsichtig. Der verdienstliche Beamte entblößte, als er die Papiere auf den Tisch legte, ein Gesicht von teigiger Farbe und melancholischer Häßlichkeit, welches von einer Vielzahl feiner, langer, dünner grauer Haare umringt, von dicken, buschigen Augenbrauen fest abgegrenzt war. Er setzte einen schwarzgerahmten Kneifer auf eine stumpfe und formlose Nase und schien von Mr. Verlocs Erscheinen betroffen. Unter den gewaltigen Augenbrauen blinzelten seine schwachen Augen erbarmungswürdig durch die Gläser.
Er machte kein Zeichen eines Grußes; ebensowenig Mr. Verloc, welcher gewiß wußte, was sich gehört; doch eine leise Veränderung der Umrisse seiner Schultern und seines Rückens deutete ein leichtes Beugen von Mr. Verlocs Rückgrat unter der Fläche seines Überrockes an. Die Wirkung war die unaufdringlicher Ehrerbietung.
»Ich habe hier einige Ihrer Berichte«, sagte der Bürokrat mit unerwartet sanfter und matter Stimme, wobei er die Spitze des Zeigefingers mit Nachdruck auf die Papiere setzte. Er machte eine Pause; und Mr. Verloc, welcher seine eigene Handschrift sehr wohl erkannt hatte, wartete in nahezu atemloser Stille ab. »Wir sind mit der Haltung der Polizei hier nicht zufrieden«, fuhr der andere mit allen Anzeichen geistiger Ermüdung fort.
Die Schultern Mr. Verlocs deuteten, ohne sich eigentlich zu bewegen, ein Zucken an. Und zum ersten Mal, seit er an jenem Morgen sein Haus verlassen hatte, öffnete er die Lippen.
»Jedes Land hat seine Polizei«, sagte er philosophisch. Doch als der Botschaftsbeamte ihn weiterhin stetig anblinzelte, fühlte er sich bemüßigt anzufügen: »Gestatten Sie mir die Beobachtung, daß mir keinerlei Einflußnahme auf die Polizei hier gegeben ist.«
»Was erwünscht ist«, sagte der Mann der Papiere, »ist das Eintreten von etwas Definitivem, was ihre Wachsamkeit anregen müßte. Das schlägt doch in Ihr Fach – habe ich nicht recht?«
Mr. Verloc gab als Antwort nur einen Seufzer von sich, welcher ihm unfreiwillig entwischte, denn sogleich versuchte er, seinem Gesicht einen heiteren Ausdruck zu geben. Der Beamte blinzelte zweifelnd, als beeinträchtigte ihn das trübe Licht im Raum. Undeutlich wiederholte er:
»Die Wachsamkeit der Polizei – und die Strenge der Polizeirichter. Die allgemeine Milde der Gerichtsverfahren hierzulande, dazu das vollkommene Fehlen jeglicher repressiver Maßnahmen sind für Europa ein Skandal. Was im Augenblick erstrebt wird, ist die Akzentuierung der Unruhe – der Gärung, welche unzweifelhaft besteht –«
»Unzweifelhaft, unzweifelhaft«, fiel Mr. Verloc in einem tiefen, ehrerbietigen Baß von einer oratorischen Qualität ein, welche so vollkommen anders als der Ton war, in dem er zuvor gesprochen hatte, daß sein Gesprächspartner zutiefst verblüfft war. »Sie besteht in einem gefährlichen Ausmaße. Meine Berichte über die letzten zwölf Monate machen das genügend deutlich.«
»Ihre Berichte über die letzten zwölf Monate«, hob der Geheime Botschaftsrat Wurmt in seinem sanften und leidenschaftslosen Ton an, »sind von mir gelesen worden. Ich vermag nicht zu erkennen, warum Sie sie überhaupt geschrieben haben.«
Eine Weile herrschte eine traurige Stille. Mr. Verloc schien es die Sprache verschlagen zu haben, und der andere starrte unverwandt auf die Papiere auf dem Tisch. Endlich versetzte er ihnen einen leichten Stoß.
»Die Sachlage, die Sie da enthüllen, soll eigentlich die Grundvoraussetzung Ihrer Verwendung sein. Was in der gegenwärtigen Lage gefordert ist, ist nichts Schriftliches, sondern daß ein klares Faktum zutage gefördert wird – ich würde fast sagen, ein alarmierendes Faktum.«
»Ich muß nicht betonen, daß alle meine Bemühungen auf dieses Ziel hin ausgerichtet sein werden«, sagte Mr. Verloc mit überzeugten Modulationen in seinem heiseren Plauderton. Doch das Gefühl, hinter dem blinden Gleißen jener Augengläser auf der anderen Seite des Tisches wachsam angeblinzelt zu werden, brachte ihn aus der Fassung. Mit einer Geste völliger Ergebenheit unterbrach er sich abrupt. Der nützliche, hart arbeitende, wenngleich obskure Botschaftsangehörige machte eine Miene, als wäre er von einem neu gefaßten Gedanken beeindruckt.
»Sie sind sehr korpulent«, sagte er.
Diese Beobachtung, die eigentlich psychologischer Natur und mit dem maßvollen Zögern eines Büromenschen vorgebracht war, welchem Tinte und Papier vertrauter waren als die Anforderungen des tätigen Lebens, versetzte Mr. Verloc in der Art einer groben persönlichen Bemerkung einen Stich. Er trat einen Schritt zurück.
»Wie? Was beliebten Sie zu sagen?« rief er mit heiserem Unwillen aus.
Der Chancelier d’Ambassade, dem die Durchführung dieser Unterredung anvertraut war, fand das offenbar zu viel.
»Ich finde«, sagte er, »Sie sollten lieber mit Mr. Vladimir sprechen. Ja, ich finde unbedingt, Sie sollten mit Mr. Vladimir sprechen. Seien Sie doch so gut und warten Sie hier«, setzte er hinzu und ging mit gezierten Schritten hinaus.
Sogleich strich sich Mr. Verloc mit der Hand über die Haare. Dünner Schweiß war auf seiner Stirn ausgebrochen. Er ließ aus gespitzten Lippen Luft entweichen wie einer, der auf einen Löffel heißer Suppe bläst. Doch als der Diener in Braun lautlos an der Tür erschien, hatte sich Mr. Verloc keinen Zoll von der Stelle bewegt, die er während der Unterredung inne hatte. Er war reglos verharrt, als fühlte er sich von Fallgruben umgeben.
Er ging einen Gang entlang, der von einer einsamen Gasflamme beleuchtet war, sodann eine gewundene Treppe hinauf und durch einen verglasten und heiteren Korridor im ersten Stock. Der Diener warf eine Tür auf und trat zur Seite. Die Füße Mr. Verlocs fühlten einen dicken Teppich. Der Raum war groß, er hatte drei Fenster; und ein junger Mann mit einem rasierten, großen Gesicht, er saß in einem geräumigen Sessel vor einem mächtigen Mahagoni-Schreibtisch, sagte auf Französisch zu dem Chancelier d’Ambassade, der gerade, die Papiere in der Hand, hinausging:
»Sie haben völlig recht, mon eher. Er ist dick – das Tier.«
Mr. Vladimir, Erster Sekretär, hatte einen Salonruf als angenehmer und unterhaltsamer Mann. In der Gesellschaft war er so etwas wie ein Liebling. Sein Witz bestand darin, possierliche Verbindungen zwischen inkongruenten Vorstellungen zu entdecken; und wenn er in dieser Weise redete, saß er ganz vorn auf seinem Sitz, die linke Hand erhoben, als führte er seine lustigen Demonstrationen zwischen Daumen und Zeigefinger vor, wobei sein rundes und glattrasiertes Gesicht einen Ausdruck fröhlicher Verwirrtheit trug.
Doch in der Art, wie er Mr. Verloc anschaute, lag keine Spur von Fröhlichkeit oder Verwirrtheit. Weit in den tiefen Sessel zurückgelehnt, die Ellbogen rechteckig ausgebreitet, ein Bein über ein dickes Knie werfend, hatte er mit seinem weichen und rosigen Antlitz das Aussehen eines übernatürlich gedeihenden Säuglings, der von niemandem Unsinn duldet.
»Vermutlich verstehen Sie Französisch?« sagte er.
Mr. Verloc erklärte heiser, daß dem so sei. Seine gesamte massige Gestalt war nach vorn geneigt. Er stand mitten im Raum auf dem Teppich, Hut und Stock fest in einer Hand haltend; die andere hing leblos an der Seite herab. Irgendwo tief in seiner Kehle murmelte er unaufdringlich etwas des Inhalts, daß er seinen Militärdienst bei der französischen Artillerie abgeleistet habe. Sogleich wechselte Mr. Vladimir mit verächtlicher Bosheit die Sprache und hob an, idiomatisches Englisch ohne die leiseste Spur eines ausländischen Akzents zu reden.
»Ah! ja. Natürlich. Wollen mal sehen. Wieviel haben Sie dafür bekommen, daß Sie sich die Pläne des Verschlußkopfes ihres neuen Sturmgewehrs verschafften?«
»Fünf Jahre strenge Festungshaft«, antwortete Mr. Verloc unerwartet, jedoch ohne jede Gefühlsregung.
»Damit sind Sie gut davongekommen«, war Mr. Vladimirs Kommentar. »Na, jedenfalls ist es Ihnen recht geschehen, daß Sie sich haben erwischen lassen. Was hat Sie denn zu so etwas veranlaßt – na?«
Man hörte Mr. Verlocs heisere Plauderstimme über die Jugend reden, eine fatale Vernarrtheit in eine unwürdige –
»Aha! Chercbe£ la femme«, gestattete sich Mr. Vladimir zu unterbrechen, unnachgiebig, doch ohne Umgänglichkeit; im Gegenteil, in seiner Herablassung lag eine Spur Erbarmungslosigkeit. »Seit wann sind Sie hier bei der Botschaft beschäftigt?« fragte er.
»Seit der Zeit des Barons Stott-Wartenheim«, antwortete Mr. Verloc in gedämpftem Ton, wobei er zum Zeichen des Kummers über den verstorbenen Diplomaten die Lippen traurig ausstülpte. Der Erste Sekretär beobachtete unverwandt dieses Spiel der Physiognomie.
»Ah! Seit der Zeit … Soso! Was haben Sie zu Ihren Gunsten zu sagen?« fragte er scharf.
Mr. Verloc antwortete etwas überrascht, er wüßte nicht, daß er etwas Besonderes zu sagen hätte. Er sei durch einen Brief hergerufen worden – und geschäftig versenkte er die Hand in der Seitentasche seines Überrokkes, beschloß jedoch angesichts der höhnischen, zynischen Aufmerksamkeit Mr. Vladimirs, ihn dort zu belassen.
»Pah!« sagte letzterer. »Was hat das zu bedeuten, daß Sie sich so hängen lassen? Sie haben nicht einmal die Figur Ihres Berufes. Sie – ein Angehöriger eines hungernden Proletariats – niemals! Sie – verzweifelter Sozialist oder Anarchist – was denn nun?«
»Anarchist«, erklärte Mr. Verloc in gedämpftem Ton.
»Unsinn!« fuhr Mr. Vladimir fort, ohne die Stimme zu erheben. »Sogar den alten Wurmt haben Sie aufgeschreckt. Sie würden keinen Idioten täuschen. Das sind sie nebenbei gesagt alle, Sie jedoch erscheinen mir schlicht unmöglich. Dann haben Sie also Ihre Verbindung mit uns aufgebaut, indem Sie die französischen Gewehrpläne stahlen. Und Sie haben sich erwischen lassen. Das muß für unsere Regierung sehr unangenehm gewesen sein. Sie scheinen nicht besonders pfiffig zu sein.«
Mr. Verloc versuchte, sich heiser zu rechtfertigen.
»Wie ich schon zuvor Gelegenheit hatte zu bemerken, eine fatale Vernarrtheit in eine unwürdige –«
Mr. Vladimir hob eine große, weiße, plumpe Hand.
»Ah, ja. Die unglückselige Zuneigung – Ihrer Jugend. Sie bemächtigte sich des Geldes und verkaufte Sie dann an die Polizei – na?«
Der trauervolle Wechsel in Mr. Verlocs Physiognomie, das augenblickliche Herabsinken seiner gesamten Person gestanden ein, daß dies der bedauerliche Fall sei. Mr. Vladimirs Hand ergriff den Knöchel, der auf seinem Knie ruhte. Die Socke war aus dunkelblauer Seide.
»Sehen Sie, das war nicht sehr klug von Ihnen. Vielleicht sind Sie zu empfänglich.«
Mr. Verloc gab mit einem kehligen, belegten Murmeln zu verstehen, daß er nicht mehr jung sei.
»Oh! Das ist ein Mangel, den das Alter nicht behebt«, bemerkte Mr. Vladimir mit unheilvoller Vertraulichkeit. »Aber nein! Dafür sind Sie ja zu dick. Sie hätten sich nicht so entwickeln können, wenn Sie überhaupt empfänglich gewesen wären. Ich will Ihnen sagen, was meiner Ansicht nach mit Ihnen ist: Sie sind ein fauler Kerl. Wie lange beziehen Sie schon ein Einkommen von der Botschaft?«
»Elf Jahre«, kam nach einem Augenblick trotzigen Zögerns als Antwort. »Ich bin mit verschiedenen Missionen betraut worden, solange Seine Exzellenz Baron Stott-Wartenheim noch Botschafter in Paris war. Danach ließ ich mich auf Anweisung Seiner Exzellenz in London nieder. Ich bin Engländer.«
»Ach was! Wirklich? Na!«
»Gebürtiger Brite«, sagte Mr. Verloc dumpf. »Aber mein Vater war Franzose, und daher –«
»Das brauchen Sie mir nicht zu erklären«, unterbrach ihn der andere. »Sie hätten wohl ganz legal Marschall von Frankreich und Mitglied des Englischen Parlaments sein können – und dann wären Sie unserer Botschaft wahrhaft von Nutzen gewesen.«
Diese Gedankenspielerei rief etwas wie ein schwaches Lächeln auf Mr. Verlocs Gesicht hervor. Mr. Vladimir bewahrte sich eine unerschütterliche Ernsthaftigkeit.