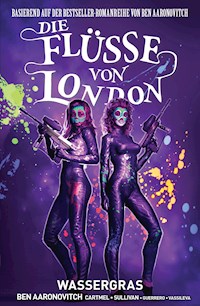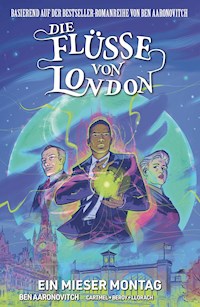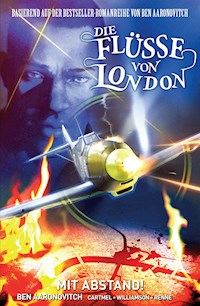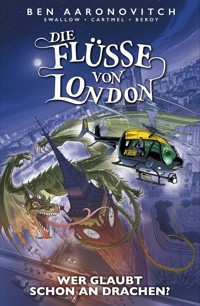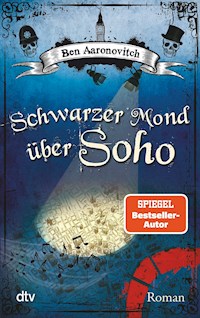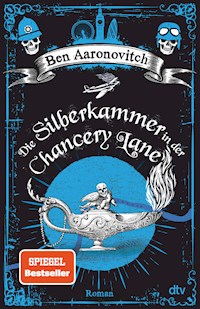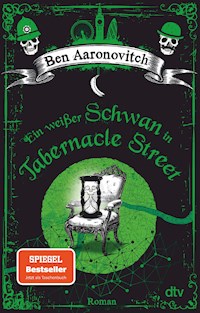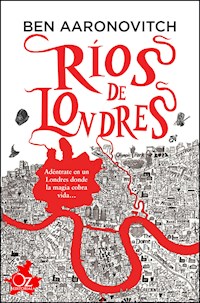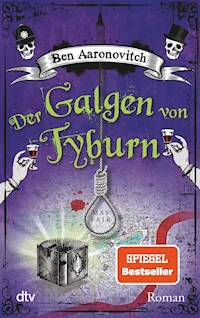Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Goyalit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Neues aus London: Ein Muss für alle Peter-Grant-Fans! Stories aus dem ›Flüsse von London‹-Kosmos: Freuen Sie sich auf originelle, witzige, unheimliche Geschichten über Peter, Nightingale, Abigail, Agent Reynolds und Tobias Winter. Lesen Sie, wer (oder was) in einer einsamen Autobahnraststätte umgeht, wer immer noch auf den Regalen einer bekannten Londoner Buchhandlung herumspukt und was genau eigentlich mit dem Fluss Lugg passiert ist …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Aaronovitch
Der Geist in der British Libray
und andere Geschichten aus dem Folly
Deutsch von Christine Blum
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Charlaine Harris über Die Flüsse von London
Da ich es jedes Mal kaum erwarten kann, bis das nächste Buch von Ben Aaronovitch erscheint, war ich begeistert, als ich gefragt wurde, ob ich ein Vorwort zu dieser Kurzgeschichtensammlung schreiben wolle.
Aaronovitchs Peter Grant ist eine der sympathischsten und interessantesten Figuren der Urban Fantasy. Peter ist als Außenseiter geboren, daher kann es ihn nicht sehr erschüttern, als er durch die Entdeckung seiner magischen Fähigkeiten noch mehr zum Außenseiter wird. Mit dem legendären Nightingale als Mentor erfüllt er fortan einen Job, der ihm geradezu auf den Leib geschrieben ist. Wir können nur mit angehaltenem Atem zuschauen, wie Peter mit bizarren Situationen, seltsamen Menschen und Wesen, die nie Menschen waren, fertig wird, haben teil an seinem Leben und Abenteuern und lernen mit ihm gemeinsam die erstaunlichsten Charaktere kennen.
Die Anregung, für die Welt der Flüsse von London auch Kurzgeschichten zu schreiben, kam ursprünglich von der Buchhandelskette Waterstones. Das heißt, den Großteil dieser Sammlung haben wir ihrer Überredungskunst zu verdanken. Ich ziehe den Hut vor allen, die Ben ermuntert haben, uns zusätzlich zu den großen Abenteuern auch kleinere zu schenken.
Ich bin mir sicher: Die folgenden Geschichten werden Sie ebenso begeistern wie mich.
Charlaine Harris
Vorbemerkung zu den Vorbemerkungen
Willkommen bei der lange ersehnten Flüsse-von-London-Kurzgeschichtensammlung! Da ich, wie die meisten Leute, Vorworte und Einleitungen meistens überspringe, versuche ich diese hier so kurz, unterhaltsam und nützlich wie möglich zu halten.
In diesem Band sind alle Kurzgeschichten versammelt, die ich bisher zur Welt der Flüsse von London geschrieben habe. Die meisten von ihnen wurden erstmals in limitierten Hardcover-Sonderausgaben meiner Romane für die Buchhandelskette Waterstones und den australischen und neuseeländischen Markt veröffentlicht und sind bisher nicht auf Deutsch erschienen.
An den Flüssen von London begann ich im Jahr 2008 zu schreiben, in dem verzweifelten Bemühen, nicht total pleitezugehen. Ganz ehrlich, ich habe nur eine einzige Begabung, und die ist das Schreiben, aber meine Drehbuchautorenkarriere war soeben geplatzt, und nur von einem Buchhändlergehalt kann man in London nicht leben.
Als sich damals in meinem Kopf die Idee von einem Polizisten, Zauberlehrling und Storymagneten namens Peter Grant manifestierte, ahnte ich rein erfahrungshalber, dass sie zugkräftig sein könnte. Was ich nicht ahnte, war, wie verdammt zugkräftig sie werden würde … Nun ja, ein paar Buchverträge später muss ich mein Leben nicht mehr damit fristen, Gedrucktes an den Mann/die Frau/alle anderen zu bringen. Allerdings habe ich immer noch die Angewohnheit, automatisch anderer Leute Bücherregale aufzuräumen.
Das mit den Kurzgeschichten fing dann wegen der Olympischen Spiele 2012 an; die genauen Gründe erläutere ich später.
Ich habe jede der Geschichten mit einer kurzen Vorbemerkung und einem Hinweis auf ihre zeitliche Einordnung in Bezug auf die Romane und Graphic Novels versehen. Und als Antwort auf Ihre nächste Frage »Wie ist denn die genaue Reihenfolge dieser ganzen Bücher?« habe ich hier alle Werke in inhaltlicher Chronologie aufgelistet:
Action at a Distance (Graphic Novel Nr. 7)
Die Flüsse von London
Schwarzer Mond über Soho
Ein Wispern unter Baker Street
Der böse Ort
Autowahn (Graphic Novel Nr. 1)
Fingerhut-Sommer
Die Füchse von Hampstead Heath (Kurzroman)
Nachthexe (Graphic Novel Nr. 2)
Schwarzer Schimmel (Graphic Novel Nr. 3)
Geister auf der Metropolitan Line (Kurzroman)
Der Galgen von Tyburn
Detektivgeschichten (Graphic Novel Nr. 4)
Cry Fox (Graphic Novel Nr. 5)
Water Weed (Graphic Novel Nr. 6)
Die Glocke von Whitechapel
Der Oktobermann (Kurzroman)
The Fey and the Furious (Graphic Novel Nr. 8)
Ein weißer Schwan in Tabernacle Street
Teil einsDie Peter- Grant-Geschichten
Heimspiel
(Rein theoretisch angesiedelt zwischen Die Flüsse von London und Schwarzer Mond über Soho)
Vorbemerkung
Ich solle doch mal etwas über die Olympischen Spiele schreiben, hieß es.
Muss das sein?, fragte ich.
Ja, hieß es, wir wollen 2012 eine Sonderausgabe machen und dabei von der Tatsache profitieren, dass London Olympia-Gastgeber ist.
So, da hatte ich’s.
Bis dahin hatte ich es vermieden, die Bücher zeitlich genauer zu verorten – gerade wegen Olympia. Bücher werden Jahre vor ihrer Veröffentlichung geschrieben, also hätte ich entweder spekulieren müssen, was den Verlauf der Spiele anging, oder eine Geschichte, in der sie erwähnt wurden, erst schreiben können, wenn sie vorbei waren. Mit dem Risiko, dass kein Hahn mehr danach krähen würde, wenn das Buch dann im Laden lag. Olympia? Mann, das ist soo 2012, Opa!
Die Aufgabe, eine Kurzgeschichte speziell über Olympia zu schreiben, löste ich daher, indem ich auf die Londoner Spiele von 1948 zurückgriff, deren Ausgang ja zum Glück unverrückbar feststeht. Ich fing an, ein bisschen zu recherchieren, stieß dabei auf das Basketballfinale Frankreich–USA, und ping, leuchtete die kleine Ideenglühbirne in meinem Kopf auf.
Meiner internen Zeitrechnung nach hatte ich die Flüsse von London, den Schwarzen Mond und Ein Wispern ursprünglich im Jahr 2011 verortet, aber dann hätte der Böse Ort im Olympiajahr 2012 spielen müssen, was ich vermeiden wollte. Ich tat also einfach so, als hätten die ersten drei Bände schon immer im Jahr 2012 gespielt, und hoffte, dass es keiner merken würde.
Daher gehört die Geschichte Heimspiel streng genommen nicht zum Kanon, aber ich mag sie trotzdem.
Dank der multinationalen Bevölkerung dieser Stadt gibt es hier Zuschauer aus jeder teilnehmenden Nation. Das heißt, jede Athletin, jeder Athlet hat hier ein Heimspiel.
Goldmedaillengewinnerin Denise Lewis in ihrem Plädoyer für London als Austragungsort der Olympischen Spiele 2012
In jenem Sommer herrschte bei uns ziemlich miese Stimmung.
Bei der Polizei wird ja grundsätzlich sehr gern gejammert, aber während der Olympiavorbereitungen lief die Met in dieser Disziplin zur absoluten Weltklasse auf. Schon mit der Pensionsreform, den neuen Fitnessanforderungen und dem harten Stellenabbau hatte man uns übel mitgespielt. Und um allem die Krone aufzusetzen, durften wir uns nun also auch noch um die Sicherheit der Olympischen Spiele kümmern.
Nun rede ich zwar von »wir«; ich persönlich hatte allerdings vom Commissioner die inoffizielle Anweisung, jedweden olympischen Einrichtungen so fern zu bleiben, wie es sich mit meiner Arbeit nur vereinbaren ließ. Ich vermute, nach dem Brand in Covent Garden, dem entführten Rettungswagen, der Geschichte am Oxford Circus und dem, was in Kew Gardens passiert – und echt absolut nicht meine Schuld – war, hatten sie ein bisschen Angst vor möglichem Sachschaden.
Als Nightingale wegen einer nicht genauer definierten »Situation« in Aberdeen nach Schottland gerufen wurde, war ich also dazu verdammt, in den weiten Hallen des Folly allein die Stellung zu halten – das heißt, allein bis auf Molly. Ganz allein zu sein wäre weitaus weniger gruselig gewesen, glauben Sie mir. So kam es, dass ich in Rekordzeit dranging, als das Telefon klingelte.
»Folly«, sagte ich.
Am anderen Ende entstand eine kurze Pause.
Dann sagte eine Frauenstimme: »Zentrale hier. Ist da das ECD9?«
»Das waren wir mal«, sagte ich. »Aber inzwischen heißen wir ESA oder SCD vierzehn.«
Die Disponentin seufzte. Die Met strukturiert sich etwa alle drei Jahre komplett um – da kommt kein Mensch mit. Nicht mal die Leute, die die Organigramme schreiben.
»Also, wie Sie momentan auch heißen«, sagte sie, »ich hab hier was für Sie.«
Das kam etwas überraschend. Normalerweise lief beim Folly alles über informelle Mundpropaganda. Wenn ein leitender Beamter beim Aufnehmen einer Straftat den Eindruck bekommt, es handle sich um eine »Situation«, bei der »spezielle« Unterstützung von Vorteil sein könnte, ruft er oder sie uns direkt an. Im Zuge der Planung für die Einsatzbereitschaft bei Olympia war ich zwar einer Anfrage nachgekommen, die operativen Parameter des Folly zu definieren, um einen möglichst schnellen und koordinierten Einsatz zu ermöglichen. Aber ich hätte nie erwartet, dass meine Angaben es bis in die Leitstelle schaffen würden.
»Sind Sie sicher?«, fragte ich.
»Sie sind doch die mit der Magie und so, oder?«, fragte sie zurück. Es klang etwas gereizt.
»Mehr oder weniger«, sagte ich.
»Dann ist es was für Sie. Shoppingpark Green Lanes.«
Viel mehr sagte sie mir nicht, außer dass »spezielle« Unterstützung angefordert worden sei und der Vorfall als »Sierra«, also dringlich eingestuft war – die zweithöchste Alarmstufe. Daher setzte ich mir meine Kojak-Lichtorgel aufs Dach und bewegte mich mit größtmöglicher Geschwindigkeit die Essex Road entlang in der Hoffnung, noch im selben Erdzeitalter am Tatort einzutreffen, in dem ich gestartet war. Eine halbe Stunde später bog ich in die Zufahrt zu dem Shoppingpark ein und wurde von Absperrband, Blaulicht und einer Horde Polizisten empfangen, die in Grüppchen beieinanderstanden und vermutlich eifrig überlegten, wie viele Überstunden sie für den Einsatz angerechnet bekommen würden.
Ich parkte neben einem Rettungswagen, dessen Hecktüren offen standen. Drinnen bekam ein Mann mit Schutzhelm und neonroter Signalweste gerade die Hände verbunden. Eine große, schlanke, athletische weiße Frau mit Adlernase und Sergeantabzeichen stellte sich mir als Sergeant Warwick vor. Sie wirkte nicht sonderlich begeistert, mich zu sehen.
»Sie sind das also?«, fragte sie, nachdem sie mich von oben bis unten gemustert hatte.
»Ja, Sarge. Was hätten Sie sich denn gewünscht?«
»Um ehrlich zu sein«, sagte sie, »jemanden mit nicht ganz so frecher Schnauze.«
Der Shoppingpark Green Lanes steht dort, wo sich einst die berühmte Harringay Arena befand, in der von Eishockey bis zum Moskauer Staatszirkus so ziemlich alles mal stattgefunden hatte. 1949 sang hier Paul Robeson, und hier veranstaltete Billy Graham seine erste britische »Crusade«. Mit einem so geschichtsträchtigen Ort konnte man klarerweise nichts Besseres anfangen, als ihn dem Erdboden gleichzumachen und durch ein Einkaufszentrum im »Stil?-Was-ist-das?«-Stil klassischer Einzelhandelsarchitektur zu ersetzen. Heraus kam ein zweistöckiger Geschäftsklotz mit Flachdach, der auf maximale Nutzungsfläche getrimmt war und sonst nichts.
An einer Ecke befand sich darin ein Costa Coffee, flankiert von einem Fitness First und einer Filiale von Dreams: Ihr führender Bettenspezialist in Großbritannien.
Um etwa Viertel nach zwei Uhr an diesem Nachmittag hatte ein gutgekleideter Mann mitteleuropäischen Aussehens Ende sechzig oder auch älter das Café betreten, war zum Tresen gegangen und hatte angefangen, die Belegschaft zu beschimpfen, in einer Sprache, von der diese vermutete, es sei Französisch.
Die Belegschaft hatte für solche Fälle genaue Verhaltensregeln erhalten, allerdings erinnerte sich niemand, wie sie lauteten. Stattdessen bat eine der Angestellten den Mann höflich, den Laden zu verlassen, während jemand anders die Polizei anrief. An sich eine vielversprechende Strategie – hätte nicht ein weiterer Kunde, der vermutlich ungeduldig auf seinen Kaffee wartete, sich eingemischt, den Störenfried zurechtgewiesen und ihn sogar am Arm gepackt.
»Und da kam Feuer aus den Händen von diesem älteren Herrn«, sagte Matilda Stümpel, studierende Teilzeit-Barista. »Ich meine nicht: seine Hände brannten«, sie warf Sergeant Warwick einen bösen Blick zu. »Es war eher eine Art Feuerball, okay? Er hier glaubt mir«, sagte sie zu Warwick und deutete mit dem Kinn auf mich.
Was in der Tat stimmte.
»Könnte ich mal Ihr Handy sehen?«, fragte ich sie.
Sie zögerte ein wenig, reichte es mir dann jedoch. »Es hat sich sowieso irgendwie ausgeschaltet.«
Ich nahm das Handy auseinander und war nicht überrascht, als ich sah, dass sich die Mikroprozessoreneinheit in ein feines bräunliches Pulver verwandelt hatte.
»Das war ganz neu«, beschwerte sich Matilda Stümpel, als ich das Gerät und so viel wie möglich von dem Pulver in einen Beweisbeutel fallen ließ. »Kriege ich es später wieder?«
Ich erwiderte, das sei eher unwahrscheinlich.
Mit dem Typen, dessen verbrannte Hände gerade behandelt wurden, hielt ich mich nicht auf. Warwick hatte seine Personalien aufgenommen, und die Sanitäter wollten ihn in die Notaufnahme bringen. Ich redete lieber gleich mit den beiden Streifenpolizisten, die aufgrund des Notrufs hergekommen waren.
»Sie waren also als Erste am Tatort?«, fragte ich.
»Genau«, sagte der Größere, Gesprächigere der zwei. Sein Kollege war klein, mit schütter werdendem Haar und ungewöhnlich großen Händen, mit denen er gestikulierte, statt etwas zu sagen.
»Und Sie betraten das Café und gingen auf den Verdächtigen zu?«
»Wie man’s eben macht«, sagte der Gesprächige. Sein Kollege nickte.
»Und dann haben Sie sich umgedreht und sind wieder rausgegangen?«
»Genau.«
»Gab es dafür einen besonderen Grund?«
»Wir fanden«, sagte der Gesprächige, »dass es Zeit für eine Pause war.« Sein Kollege breitete die Hände aus – tja, Pausen müssen sein.
»Haben Sie das einfach so beschlossen, oder hat der Verdächtige vorher noch etwas zu Ihnen gesagt?«
»Er sagte, wir sollten uns doch einen Kaffee holen«, sagte der Gesprächige. Sein Kollege begleitete dies mit einem pantomimischen Schluck aus einer Kaffeetasse mit Untertasse.
»Und da sind Sie rausgegangen?«
»Genau.«
»Um sich einen Kaffee zu holen?«
»Ja.«
»Obwohl Sie doch in einem Café waren?«
Der Schweigsame gab mir durch langsames Kopfschütteln zu verstehen, dass ich das Offensichtliche nicht kapierte. »Musste sein«, sagte er mit erstaunlich tiefem Bariton. »Die Baristas waren ja alle nach draußen gerannt.«
»Es ist so ähnlich wie Hypnose«, erklärte ich Warwick, nachdem wir die beiden noch einen Kaffee trinken geschickt hatten.
Aber das kaufte mir Warwick nicht ab. »So funktioniert Hypnose nicht.«
»Ja, in dem Punkt ist es eben nicht wie Hypnose«, sagte ich. »Also, ist er definitiv allein da drin?«
»Personal und Kundschaft sind vollzählig draußen, das haben wir überprüft.«
»Dann hole ich ihn jetzt wohl besser raus.«
»Sind Sie sicher, dass Sie das machen wollen?«
»Entweder ich, oder wir rufen die bewaffnete Bereitschaft und lassen sie hier rumballern.«
»Keine Chance. Die kann ich unmöglich anfordern – die ist in Dauerbereitschaft für die Spiele, wir würden sie niemals hierherkriegen.«
Die Metvest gibt es in zwei Grundausführungen, eine in schlichtem Weiß, um sie unter der Jacke zu tragen, und eine, die man mit dem Abschluss der Polizeischule bekommt: in Blau, darauf das Wort POLICE in hübsch reflektierender Schrift – jeweils vorne und hinten – sowie eine Menge praktischer Taschen und Clips. Seit ich Zivilbeamter bin, hätte ich dieses Modell eigentlich gegen die schlichte Version eintauschen sollen, aber bei vielen Einsätzen ist es von Vorteil, so polizistenhaft wie möglich auszusehen. Daher steckt sie immer in der Notfalltasche in meinem Ford Asbo, zusammen mit anderen praktischen Sachen aus meiner Uniformzeit plus diversem Kram, den ich eigens für »spezielle« Einsätze hinzugefügt habe.
Ich rüstete mich mit dem gesamten Inhalt der Tasche aus und schnallte mir zudem Dienstgürtel und Taser um. Notizblock und Airwave würde ich zwar kaum brauchen, aber für die Mitbürger ist es so selbstverständlich, dass wir herumwatscheln wie der dicke kleine Bruder von Batman, dass ihnen oft gar nicht auffällt, was wir im Einzelnen mit uns herumschleppen – das kann sehr nützlich sein.
»Ich habe einen zweiten Rettungswagen herbestellt«, sagte Warwick. »Nur für alle Fälle.«
Na, das ist doch tröstlich, dachte ich und machte mich auf den langen Weg über den Parkplatzstreifen vor dem Costa Coffee.
Sobald die anfängliche Erregung über einen Zwischenfall abklingt, sehnen sich die Leute meist danach, dass schnell wieder Ordnung einkehrt. Daher begrüßen sie es, wenn ein Uniformierter auftaucht. Sogar die Täter. Und manchmal – wenn die Sache total aus dem Ruder gelaufen ist und einer dasteht, die Knarre auf diese nette alte Dame gerichtet, und die zwei bis sechs Jahre mit Aussicht auf vorzeitige Entlassung rapide in Richtung Lebenslänglich mit empfohlenem Mindeststrafmaß dreißig Jahre sowie dem eigenen Porträt unter einer fetten Boulevard-Titelschlagzeile zuschlittern sieht – ganz besonders die Täter.
Hier kommt dem Ordnungshüter seine Uniform sehr zupass. Die – und die Fähigkeit, äußerlich seelenruhig und mit dieser handfesten Keine-Sorge-wir-kriegen-das-schon-wieder-hin-Ausstrahlung auf die Gefahrenzone zuzugehen, selbst wenn er sich eigentlich am liebsten hinter einem Schutzschild verkriechen würde.
Tja, und dann kam ich in all meiner Pracht an die Eingangstür, und der Verdächtige war weit und breit nicht zu sehen. Das Costa Coffee bestand nur aus dem einen Raum mit Tischen links und Sofas und gemütlichen Sitzecken rechts. Bei der überstürzten Flucht der Kundschaft waren einige Stühle umgefallen, und es roch nach Kaffee, der langsam in Teppichboden einsickert. Meine Mum hasst Kaffeeflecken. Sie meint, die kriegt man nie wieder raus, nicht mal mit dem hochaggressiven Universal-Fleckentferner, den sie bei ihrem Reinigungsmittel-Großhändler unter dem Ladentisch kauft.
Vorsichtig betrat ich das Café.
»Hallo? Polizei«, rief ich. »Ist da jemand?«
»Ihre Freunde warten wahrscheinlich draußen auf Sie«, sagte eine Stimme von hinter dem Tresen. »Gehen Sie doch lieber wieder zu ihnen raus.«
Seit ich Zauberlehrling bin, hat im Prinzip jeder – und damit meine ich: jeder – mit auch nur einem Hauch magischen Potenzials schon mal versucht, mich magisch zu beeinflussen. Mit der Zeit entwickelt man da eine gewisse Immunität.
»Bei mir klappt das nicht«, sagte ich. »Sorry.«
»Merde«, sagte die Stimme. »Hätten Sie in diesem Fall gern einen Kaffee?«
»Ja, bitte«, sagte ich.
»Ich auch«, sagte die Stimme. »Wissen Sie vielleicht, wie diese Maschinen funktionieren?«
»Ich kann’s versuchen«, sagte ich. »Dann komme ich jetzt um den Tresen herum – wenn das für Sie okay ist?«
»Wenn Sie hier eine Tasse Kaffee zustande bringen, dürfen Sie machen, was Sie wollen.«
Langsam und so wenig bedrohlich wie möglich trat ich hinter den Tresen und wurde erstmals meines Verdächtigen ansichtig.
Er saß auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, so dass er für einen Scharfschützen nicht zu sehen wäre, aber selbst beide Seiten gut im Blick hatte, falls man ihn in die Zange zu nehmen versuchte. Nicht sehr groß, dachte ich, wobei das im Sitzen schwer zu beurteilen war. Und sicher jenseits der siebzig, mit schütterem grauem, seitlich gescheiteltem Haar, blauen Augen und einem schmalen Gesicht, bei dem schon allein aus Materialmangel nie ein Risiko für Hängebacken bestanden hatte.
Ich stellte mich vor.
»Antonin Bobet«, sagte der Mann. »Wer hat Sie ausgebildet?«
»Nightingale.«
»Thomas Nightingale?«, fragte Bobet nach. »Der ist nicht tot?«
»Soweit ich es beurteilen kann, nein«, sagte ich. »Kennen Sie ihn?«
»Wie lange muss ich denn noch auf den Kaffee warten?«, fragte er zurück.
Grundsätzlich gehe ich lieber in ein gutes altes unprätentiöses Snacklokal als in diese Caféketten, aber mein Dad, der seine Jugend weitgehend in den Espressobars von Soho vertrödelt hat, hat dafür gesorgt, dass ich weiß, wie man eine Espressokanne bedient, und bei diesen großen professionellen Vollautomaten ist das Prinzip ja dasselbe – also, mehr oder weniger.
Bobet, bemerkte ich, rückte so weit ab, dass ich ihn nicht bequem mit einem Satz erwischen konnte, und beobachtete mich scharf dabei, wie ich zwei Espressi herausließ.
»Ohne Milch. Beide«, sagte er, als ich nach der Dampfdüse griff.
Ich fragte, ob er Zucker wolle. Er lehnte ab und wies mich an, mich mit dem Rücken zum Tresen ihm gegenüber zu setzen und seinen Kaffee zwischen uns auf den Boden zu stellen. »Nur mit der linken Hand, bitte.«
Da wir über einen Meter weit auseinander saßen, musste ich mich sehr weit vorbeugen, um die Tasse in seiner Reichweite abzustellen. Dabei gelang es mir, meinen eigenen Kaffee zur Hälfte über meine Metvest zu schütten, und ich verbrachte eine unterhaltsame Minute damit, mich, die Weste und den Einsatzgürtel abzuwischen.
Antonin Bobet wartete höflich, bis ich wieder gesellschaftsfähig war, ehe er den ersten Schluck von seinem Kaffee nahm.
»Nicht schlecht«, sagte er.
Ich nippte an meinem. Je länger die Leute ruhig und zivilisiert dasitzen, desto schwerer fällt es ihnen, dann noch in unzivilisiertes Verhalten zu verfallen – das strengt einfach zu sehr an. Als Faustregel kann man davon ausgehen, dass es, wenn man jemanden zwanzig Minuten lang in ein Gespräch verwickeln kann, nicht mehr zu tätlicher Gewalt kommen wird. Üblicherweise.
»Und wer hat Sie ausgebildet?«, fragte ich.
»Maurice Guillaume«, sagte er. »Nicht dass Ihnen der Name etwas sagen wird, nehme ich an.«
»War er Ihr Meister?«
Diese Frage fand er amüsant. »Wie archaisch. Nein, Guillaume war mein Professeur an der Académie. Nennen Sie Nightingale etwa ›Meister‹?«
»Nicht, wenn ich es vermeiden kann.«
»Warum das?«
»Geschichtlich vorbelasteter Begriff.«
Er nickte. »Kann ich verstehen.«
Aber das bezweifelte ich.
»Nun, Monsieur Bobet«, sagte ich, »wir sollten vielleicht überlegen, wie wir aus der Sache hier wieder rauskommen.«
»Glauben Sie, Nightingale wird bald hier sein?«
»Er ist gerade nicht in London. Warum – ist das wichtig?«
»Ich habe einen Menschen getötet«, sagte Bobet. »Ziemlich genau an dieser Stelle hier. Oder jedenfalls ganz in der Nähe. Da das im Jahr 1948 war, denke ich, Nightingale wäre vielleicht etwas interessierter an dem Fall als Sie. Geschichtlich gesehen, verstehen Sie.«
»Ich interessiere mich sehr für Geschichte«, sagte ich. »Erzählen Sie mir doch, was passiert ist.«
»Warum interessiert sich ein junger Mann wie Sie für Geschichte?«
»Damit ich nicht in Gefahr komme, sie zu wiederholen.«
»Dann halten Sie sich fern von Leuten, die vom Vaterland reden«, sagte er. »Wenn Sie meinen Rat hören wollen.«
»Guter Rat.«
»Wie weit weg ist Nightingale denn?«
Ich hob vage die Achseln und bot an, noch einen Kaffee zu machen.
»Nein, bleiben Sie, wo Sie sind«, sagte er. »Und ich erzähle Ihnen eine Geschichte.«
In Frankreich läuft anscheinend manches ein bisschen anders. Auch damals in den längst vergangenen exzentrischen Tagen der Dritten Republik. Antonin Bobet entstammte einer alten Familie in Lyon und war mit vierzehn Jahren dazu ausersehen worden, an die Académie in Paris zu gehen, um dort in den Lehren und Künsten unterwiesen zu werden.
»Auf Latein?« Diese Frage musste ich einfach stellen.
»Die Formae, ja«, sagte er. »Die eigentliche Lehre fand aber auf Französisch statt.«
Und eine Abschlussprüfung gab es auch, und es wurde nach Leistung benotet, und wenn manche alten Familiennamen – zum Beispiel Bobet – überdurchschnittlich häufig in den Listen der erfolgreichen Abgänger auftauchten, dann war das lediglich der Beweis dafür, dass sie Qualität und Tradition aufrechterhielten.
»Doch neben denen, die die Tradition wertschätzten«, sagte Bobet, »gab es auch solche, die gern moderner werden wollten.«
»Wozu zählte Ihr Lehrer?«, fragte ich.
»Er war Pariser«, sagte Bobet. »Bei den Parisern weiß man nie so recht, woran sie glauben. Außer an Paris natürlich.«
Das wiederum klang ziemlich ähnlich, wie es im Folly gewesen sein musste, einschließlich des großen Zusammenbruchs, der für die Franzosen schon 1940 kam. Wobei der Fall der Dritten Republik nicht von allen bedauert wurde – selbst wenn dazu eine Invasion durch die Deutschen nötig war.
»Nach dem Waffenstillstand schlugen wir alle uns auf die eine oder andere Seite«, erzählte Bobet. »Ich entschied mich für Pétain. Professeur Guillaume dagegen für de Gaulle.«
Zu seiner Arbeit für das kollaborative Vichy-Regime sagte Bobet nicht viel, außer – ohne dass ich nachgefragt hätte – zu betonen, irgendjemand habe schließlich für eine gewisse Kontinuität sorgen müssen, damit der französische Staat den Krieg überstand. Dass das gelang, war laut Bobet zum großen Teil den Bemühungen eines gewissen Jean Bichelonne und Leuten wie Bobet zu verdanken.
»Die Gaullisten und Kommunisten interessierte das natürlich nicht«, sagte er. Kollaborateure waren beim Widerstand unerklärlicherweise schlecht angeschrieben, und nach Kriegsende hätte es sehr übel für ihn ausgehen können, hätte nicht gerade noch rechtzeitig sein alter Lehrer interveniert. »Er meinte, mich hinzurichten sei Materialverschwendung.«
Weshalb Bobet, als Professeur Guillaume ihn im Sommer 48 mit nach London nehmen wollte, um die französische Olympiamannschaft zu »unterstützen«, nicht genauer nachfragte, um welche Art von Unterstützung es sich denn bitte handelte.
»Wissen Sie, was das Schlimme an den Engländern ist?«, fragte er. »Sie machen nie das, was man von Ihnen erwartet. Ihre Stadt lag in Trümmern, Ihr Volk hatte kaum genug zu essen, Ihre Regierung war bankrott, und Sie hielten es für eine gute Idee, Olympische Spiele abzuhalten. Unglaublich.« Folglich hatte Bobet nicht viel in Sachen Gastlichkeit erwartet – und wurde nicht enttäuscht. »Vom Essen will ich gar nicht reden.«
»Danke, dass Sie das Thema nicht aufbringen«, sagte ich.
Er warf mir einen scharfen Blick zu.
Professeur Guillaume hatte den Plan, dem französischen Basketballteam zum Sieg zu verhelfen.
»Wie wollte er das anstellen?«
»Er wollte die Füße der Gegner schwerer machen.« Den genauen Zauber kannte Bobet nicht; er hätte ausschließlich Schmiere stehen und, falls nötig, den Fluchtwagen fahren sollen. Die Vorbereitungen waren getroffen, und sie wollten sich gerade zum ersten Spiel aufmachen – Frankreich gegen Iran –, da kam ein Besucher zu ihnen ins Hotel.
»Ihr ›Meister‹. Nightingale.«
»Er hat Sie zurückgepfiffen?«
Bobet schnaubte. »So indiskret war er nicht. Er hieß uns in London willkommen und sagte, er hoffe, wir würden die Spiele im Geiste der olympischen Ideale von Brüderlichkeit und Fairness genießen.«
»Er hat Sie also zurückgepfiffen.«
»Ja.« Und der Pfiff saß, weil Nightingale damals schon einen Ruf als gefährlichster Zauberer Europas hatte. Professeur Guillaume gefiel das alles überhaupt nicht, aber es war nichts zu machen. Und dabei wäre es wahrscheinlich geblieben, wäre es der französischen Basketballmannschaft, beflügelt durch einen Notvorrat an Fleischkonserven aus der Heimat, nicht gelungen, sich bis zum Halbfinale durchzukämpfen, in dem sie Brasilien mit 45 zu 33 schlug, woraufhin sie im Finale gegen die USA stand.
Da hielt es Professeur Guillaume, der die Amerikaner fast genauso wenig ausstehen konnte wie die Engländer, nicht mehr aus. Bobet und er wussten, wie sehr das Folly bei Ettersberg dezimiert worden war, daher beschlossen sie darauf zu setzen, dass Nightingale anderweitig beschäftigt sein würde, und sich in die Harringay Arena zu schleichen, um ihren ursprünglichen Plan durchzuführen.
Da die Arena als Eishockeystadion konzipiert war, gab es darunter einen Maschinenraum. Dort machten sie sich ans Werk. Und dort, zwischen den Rohren und Kompressoren, hatte Bobet seinen Sinneswandel. »Ich sagte, ich hielte unser Vorhaben nicht für richtig. Schließlich waren die Amerikaner mit uns verbündet gewesen, und außerdem verstoße es gegen den olympischen Geist.«
Bei Professeur Guillaume kam das nicht gut an. »Er sagte, von einem Kollaborateur wie mir sei ja nichts anderes zu erwarten, und man solle mir den Kopf kahlscheren, wie ich es als Deutschenflittchen verdiente. Ich erwiderte, ich hielte es für unrecht, unseren Verbündeten gegenüber so kleinlich zu sein, und unsportlich sei es auch. Das fand er sehr lustig. ›Unsportlich‹, brüllte er. ›Hier geht es um Frankreich, was kümmert es Frankreich, ob es unsportlich ist?‹ Und er wollte auf mich losgehen. Da stieß ich ihn mit dem Stoßzauber zurück – ich weiß nicht, wie Sie den auf Englisch nennen – und er stürzte zu Boden.«