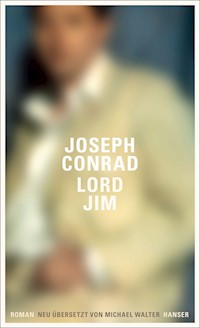9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joseph Conrad, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein Abenteuerroman des Herzens, ein Buch einer Leidenschaft, die in Opfer und Verzicht endet. Ein junger, offener, kluger Seemann, der auszieht und sich in gewagte Beziehungen und Unternehmungen am Rande der hohen Politik und am Rande der Legalität verwickeln lässt. Und Dona Rita, die alle und alles beherrscht: Ziegenhirtin aus einem fernen spanischem Dorf, Gefährtin und Erbin eines signierten Pariser Malers, beinahe auch die Mätresse und ohne Zaudern die tatkräftige Helferin von Don Carlos. Stolz ist sie und gefährdend, fordernd und entsagend, femme fatale und selbstlos Liebende. Sie stehen im Zentrum dieser Geschichte einer Leidenschaft, die nach kurzer Erfüllung in Opfer und Verzicht endet. Joseph Conrad schloß seinen zehnten Roman 1918, in den letzten Phasen des Krieges, ab: das erste Buch, das er ›diktierte‹, wird getragen von einer autobiographischen Glut und einem Erzählen wie ein Sehnsuchtsruf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Ähnliche
Joseph Conrad
Der goldene Pfeil
Eine Geschichte zwischen zwei Bemerkungen
Aus dem Englischen von Walter Schürenberg
FISCHER E-Books
Inhalt
Die englische Originalausgabe erschien 1919 unter dem Titel ›The arrow of gold‹
Für Richard Curle
Celui qui n’a connu que
des hommes polis et raisonnables,
on ne connaît pas l’homme,
on ne le connaît qu’à demi.
Caractères
Vorbemerkung des Autors
Da ich alle kurzen Vorworte zu meinen Büchern als »Vorbemerkungen des Autors« bezeichnet habe, muß dieses um der Einheitlichkeit willen, wenn auch auf die Gefahr einiger Verwirrung hin, den gleichen Titel tragen. ›Der goldene Pfeil‹ ist, wie der Untertitel besagt, eine Geschichte zwischen zwei Bemerkungen. Aber diese Bemerkungen sind dem eigentlichen Aufbau einverleibt und haben die Funktion, die Geschichte vorzubereiten und abzuschließen. Sie liefern das Material zum Verständnis dessen, was die Geschichte an Erfahrung enthält, und sollen dazu dienen, Zeit und Ort sowie gewisse historische Umstände näher zu bestimmen, die für die Existenz der Personen und ihr Handeln während der zwölf Monate, welche die Erzählung umfaßt, die Voraussetzung bildeten. Dies war der kürzeste Weg, die Präliminarien zu einer literarischen Arbeit hinter mich zu bringen, die ihrer Natur nach nicht einfach eine Chronik sein konnte.
›Der goldene Pfeil‹ ist meine erste Veröffentlichung nach dem Krieg. Die Arbeit daran begann im Herbst 1917 und endete im Sommer 1918. Sie verbindet sich in meiner Erinnerung mit den dunkelsten Stunden des Krieges, die – mit dem bekannten Sprichwort zu reden – der Dämmerung vorangingen, der Morgendämmerung des Friedens.
Wenn ich jetzt auf diese Seiten niederblicke, die in den Tagen der Not und Angst geschrieben wurden, scheinen sie mir von einer seltsamen Heiterkeit geprägt. Sie wurden in aller Ruhe geschrieben, wenn auch nicht mit kaltem Blut, und sind wohl die einzige Art von Seiten, die ich in jenen Zeiten voller Bedrohung, aber auch voller Zuversicht, hätte schreiben können.
Das Thema des Buches hatte ich viele Jahre mit mir herumgetragen – nicht so sehr als Besitz meines Gedächtnisses wie als Bestandteil meines Ichs. Es war mir stets gegenwärtig und immer greifbar, aber ich sträubte mich, an die Niederschrift zu gehen, aus einem Gefühl heraus, das ich für bloße Scheu hielt, das aber in Wahrheit ein deutliches Mißtrauen mir selbst gegenüber war.
Wenn man solch eine Frucht der Erinnerung pflückt, läuft man Gefahr, ihren Schmelz zu verderben, zumal wenn die Frucht zu Markte getragen werden soll. Da dies nun ein Produkt meines eigenen Gartens ist, läßt sich mein Widerstreben leicht begreifen, und wenn einige Kritiker ihrem Bedauern Ausdruck gaben, daß dieses Buch nicht fünfzehn Jahre früher geschrieben worden sei, so kann ich ihre Meinung nicht teilen. Ich habe diese Sache erst so spät im Leben aufgegriffen, weil vorher der rechte Augenblick noch nicht gekommen war. Ich meine die richtige Einstellung dazu – etwas, worüber sich nicht diskutieren läßt. Und ich will auch das Bedauern jener Kritiker nicht diskutieren, was mir im Zusammenhang mit literarischer Kritik als denkbar belanglos erschiene.
Ich habe nie versucht, die Ursprünge dieses Buches, das zu schreiben ich so lange gezögert habe, zu verheimlichen; aber manche Rezensenten sonnten sich in dem Triumph, darin meinen Dominic aus ›Der Spiegel der See‹ zu entdecken – unter seinem eigenen Namen (eine wirklich fabelhafte Entdeckung) – und in dem namenlosen kleinen Schiff, auf dem Mr. George seine phantastischen Geschäfte abwickelte und die Schmerzen seiner unheilbaren Wunde zu lindern trachtete, die Balancelle Tremolino wiederzuerkennen. Dieser Scharfblick läßt mich völlig ungerührt. Ja, es ist der selbe Mann und die selbe Balancelle. Aber für die Zwecke eines Buches wie ›Der Spiegel der See‹ konnte ich lediglich die persönlichen Schicksale um die kleine Tremolino gebrauchen. Das vorliegende Buch ist in keinem Sinne der Versuch, ein Thema weiter auszuspinnen, das in früheren Jahren mit leichter Hand und in Verbindung mit einer ganz anderen Art von Liebe angeschlagen worden war. Was die Geschichte der Tremolino in ihrer anekdotischen Form mit der Geschichte des goldenen Pfeils gemeinsam hat, ist gewissermaßen die Einweihung in das Mysterium der Leidenschaft (mittels einer Pflichtaufgabe, die einige Entschlußkraft erfordert). Auf den wenigen Seiten am Ende von ›Der Spiegel der See‹ und in dem ganzen Buch ›Der goldene Pfeil‹ wird nur dies und kein anderes Thema dem Leser vor Augen gerückt. Jene Seiten und dieses Buch bilden zusammen einen vollständigen Bericht, und ich kann meinen Lesern nur das eine versichern, daß er so, wie er hier mit all seinen Mängeln steht, ihnen doch vollständig dargeboten wird.
Ich lasse mich zu dieser ausdrücklichen Feststellung herbei, weil ich zwischen den vielen Äußerungen von Sympathie hie und da einen Beiklang von Argwohn entdeckt habe. Argwohn, der verheimlichten Fakten, zurückgehaltenen Erklärungen und unzulänglichen Motivierungen galt. Aber was man an den Fakten vermißt, ist einfach das, was ich nicht wußte, und was nicht erklärt wird, ist das, was ich selbst nicht begriff, und was sonst noch unzulänglich scheint, ist meiner mangelhaften Intuition zuzuschreiben. Und all das ließ sich nicht vermeiden. Im Falle dieses Buches war ich nicht imstande, diese Mängel durch Anwendung meiner Erfindungsgabe auszugleichen. Die war nie sehr stark; und sie bei dieser Gelegenheit zu gebrauchen, wäre ganz besonders unaufrichtig gewesen. Aus diesem ethischen Beweggrund und nicht aus Ängstlichkeit habe ich mich bewußt strikt in den Grenzen schmuckloser Aufrichtigkeit gehalten und versucht, die Sympathien meiner Leser ohne die Anmaßung hochfliegender Allwissenheit oder die niedere Zuflucht zur Übertreibung der Gefühle zu gewinnen.
1920
J. C.
Erste Bemerkung
Die folgenden Seiten sind Auszüge aus einem handgeschriebenen Konvolut, das offenbar für die Augen nur einer einzigen Frau bestimmt war. Sie muß wohl eine Jugendgespielin des Verfassers gewesen sein. Ihre Wege hatten sich getrennt, als sie noch Kinder oder gerade nicht mehr Kinder waren. Jahre vergingen. Dann wurde die Frau durch irgend etwas an den Gefährten ihrer Jugend erinnert und schrieb ihm: »Ich habe kürzlich von Ihnen gehört. Ich weiß, wohin Sie das Leben verschlagen hat. Selbstverständlich haben Sie Ihren eigenen Weg gewählt. Aber für uns, die Zurückbleibenden, sah es immer so aus, als hätten Sie sich in eine pfadlose Wüste vorgewagt. Wir betrachteten Sie als einen Menschen, den man verlorengeben mußte. Aber Sie sind wieder aufgetaucht, und obwohl wir uns vielleicht nie wieder begegnen werden, heißt meine Erinnerung Sie willkommen, und ich gestehe Ihnen, daß ich gern wüßte, wie es Ihnen auf dem Weg ergangen ist, der Sie dahin geführt hat, wo Sie jetzt sind.«
Und er antwortet ihr: »Ich glaube, Sie sind die einzige noch Lebende, die sich meiner als eines Kindes erinnert. Von Zeit zu Zeit habe ich von Ihnen gehört, aber ich frage mich, was für eine Art von Mensch Sie jetzt sind. Wenn ich es wüßte, würde ich vielleicht nicht wagen, die Feder anzusetzen. Aber ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur, daß wir ein Herz und eine Seele waren. Tatsächlich verstand ich mich mit Ihnen besser als mit Ihren Brüdern. Doch ich bin wie die Taube, die davonflog, in der Fabel von den zwei Tauben. Wenn ich erst einmal zu erzählen anfange, möchte ich auch, daß Sie das Gefühl haben, selbst dabeigewesen zu sein. Vielleicht überschätze ich Ihre Geduld bei meiner Lebensgeschichte, die sich von der Ihren nicht nur in allen Fakten, sondern in ihrem ganzen Geist so sehr unterscheidet. Sie begreifen das vielleicht nicht. Sie mögen sogar entsetzt sein. Alles das sage ich mir; dennoch weiß ich, daß ich der Versuchung erliegen werde! Ich erinnere mich sehr genau, daß Sie in jenen längst vergangenen Tagen, als Sie etwa fünfzehn waren, mich noch immer zu dem bringen konnten, was Ihnen gerade einfiel.«
Er ist der Versuchung erlegen. Er beginnt seine Geschichte für sie mit der minutiösen Schilderung dieses Abenteuers, das sich im Laufe von ungefähr zwölf Monaten abwickelte. In der hier vorliegenden Fassung sind alle Anspielungen auf die gemeinsame Vergangenheit, alle Nebenbemerkungen und umständlichen Erläuterungen an die Adresse der Jugendgespielin ausgemerzt. Und auch so noch ist die ganze Sache recht lang geraten. Anscheinend verfügte er nicht nur über ein gutes Gedächtnis, sondern wußte auch, wie man sich erinnert. Aber darüber mögen die Ansichten geteilt sein.
Dies, sein erstes großes Abenteuer, wie er es nennt, beginnt in Marseille. Dort endet es auch. Dennoch hätte es sich überall sonst ereignen mögen. Das heißt aber nicht, daß die darin verwickelten Menschen einander im leeren Raum hätten begegnen können. Die lokale Atmosphäre war durchaus von Bedeutung. Was die Zeit angeht – sie läßt sich bequem durch die Ereignisse um die Mitte der siebziger Jahre fixieren, als Don Carlos von Bourbon, ermutigt durch die allgemeine Reaktion Europas auf die Ausschreitungen des kommunistischen Republikanertums, mit den Waffen in der Hand in den Bergen und Schluchten von Guipuzcoa zu seinem Gewaltstreich auf den spanischen Thron ausholte. Dies ist wohl das letzte Beispiel eines Kronprätendenten-Abenteuers, das die Geschichte verzeichnen wird, nicht ohne die übliche moralische Mißbilligung, die zugleich das Entschwinden der Romantik schamhaft bedauert. Historiker sind eben auch nur Menschen.
Gleichwohl spielt das Historische in dieser Erzählung gar keine Rolle. Sie will weder moralisch rechtfertigen noch ein Verdammungsurteil fällen. Wenn sie etwas bewirken will, dann vielleicht ein bißchen Sympathie für des Schreibers verlorene Jugend, die er hier am Ende seines unbedeutenden Erdenwandels noch einmal durchlebt. Merkwürdige Existenzen – und doch vielleicht nicht so sehr verschieden von uns. Noch ein paar Worte bezüglich gewisser Umstände mögen angebracht sein.
Es könnte scheinen, er sei recht unvermittelt in dieses lange Abenteuer verwickelt worden. Aber aus einigen Passagen (hier unterdrückt wegen der Vermischung mit Nebensächlichem) geht klar hervor, daß Mills sich schon vor der Begegnung im Café in diesem und jenem Milieu umgetan und sich ein deutliches Bild von dem ehrgeizigen Jüngling gemacht hatte, der ihm in einem ultra-legitimistischen Salon vorgestellt worden war. Auf Grund dessen sah Mills in ihm einen jungen Mann, der mit ausgezeichneten Empfehlungen gekommen war und nun offenbar alles daran setzte, ein exzentrisches Leben zu führen, teils in einem Bohemezirkel (aus dem später wenigstens ein Dichter hervorging) und teils im freundschaftlichen Umgang mit Leuten aus der Altstadt – Steuermännern, Küstenfahrern, Matrosen und Arbeitern aller Art. Er spielte sich ziemlich unmotiviert als Seemann auf und profitierte dabei von einem nicht näher bezeichneten, irgendwie illegalen Unternehmen im Golf von Mexiko. Plötzlich fiel es Mills ein, daß dieser exzentrische junge Mann genau der richtige sei für das, was den legitimistischen Parteigängern eben jetzt am Herzen lag: auf dem Seewege einen Nachschub von Waffen und Munition für die Carlistischen Abteilungen im Süden zu organisieren. Eben darüber sollte Captain Blunt als Abgesandter des Hauptquartiers mit Doña Rita beraten.
Mills nahm unverzüglich Verbindung mit Blunt auf und unterbreitete ihm seine Idee. Der Captain hielt das für die einzig richtige Lösung. Und tatsächlich hatten an jenem Karnevalsabend diese beiden, Mills und Blunt, überall nach unserem Manne gesucht. Sie hatten beschlossen, daß er in die Sache eingeweiht werden solle, wenn es sich machen ließe. Natürlich wollte Blunt ihn zuvor sehen. Er muß von ihm einen günstigen Eindruck gewonnen, ihn aber in anderer Beziehung nicht für gefährlich gehalten haben. Auf so einfache Art wurde der besagte (und zugleich mysteriöse) Monsieur George ins Spiel gebracht – durch die geistige Übereinstimmung zweier Männer, die an sein leibliches Wohl auch nicht einen Gedanken wandten.
Die Absicht der beiden erklärt den vertraulichen Ton, den sie bei der ersten Unterhaltung zu dritt anschlugen, und das unvermittelte Hereinbringen von Doña Ritas Geschichte. Mills wollte natürlich alles darüber hören. Und von Captain Blunt nehme ich vollends an, daß er im Augenblick an nichts anderes denken konnte. Zudem fiel ja die Aufgabe der Überredung Doña Rita zu, denn es war schließlich keine Kleinigkeit, einen Mann – mochte er auch noch so jung sein – für ein so bedenkliches und äußerst gefahrvolles Unternehmen zu gewinnen.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß Mills anscheinend ziemlich skrupellos gehandelt hat. Er selbst hatte wohl im gegebenen Augenblick, als sie gemeinsam zum Prado fuhren, einige Zweifel. Aber vielleicht verstand Mills mit seinem Scharfblick sehr wohl das Wesen des Menschen, mit dem er es zu tun hatte. Womöglich beneidete er ihn sogar. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Mills zu entschuldigen. Der jedenfalls, den wir allenfalls als Mills’ Opfer betrachten dürfen, hat ihm in Gedanken nie den geringsten Vorwurf gemacht. Für ihn ist Mills über jede Kritik erhaben. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür, was eine starke Persönlichkeit über einen jüngeren Menschen vermag.
Erster Teil
I
Es gibt gewisse Straßen, die haben ihre eigene Atmosphäre und sind sozusagen weltberühmt; ihnen gehört die besondere Liebe ihrer Bürger. Eine dieser Straßen ist die Cannebière, und das Witzwort »Wenn Paris eine Cannebière hätte, wäre es ein Klein-Marseille« ist nur der scherzhafte Ausdruck städtischen Bürgerstolzes. Auch ich bin diesem Zauber erlegen. Für mich war das eine Straße, die ins Unbekannte führte.
Es gab da einen Abschnitt, in dem nicht weniger als fünf große Cafés in strahlender Reihe nebeneinander lagen. In eins davon schlenderte ich an jenem Abend hinein. Es war keineswegs nicht voll. Er sah recht eigentlich verlassen aus in seiner Festbeleuchtung, aber es wirkte freundlich. Die wundervolle Straße war empfindlich kalt (es war ein Abend im Karneval), ich hatte nicht das mindeste vor und fühlte mich etwas einsam. Also ging ich hinein und setzte mich an einen Tisch.
Die Karnevalszeit näherte sich ihrem Ende. Alle Welt, hoch und niedrig, war darauf aus, sich noch einmal auszutoben. Arm in Arm und mit einem wahren Indianergeheul streiften Gruppen Maskierter in wildem Gedränge durch die Straßen, während der kalte Mistral in Schauern die Gaslaternen, soweit das Auge reichte, hin und her schwenkte. All das hatte etwas von einem Tollhaus an sich.
Vielleicht fühlte ich mich gerade darum einsam, denn ich war weder maskiert, noch verkleidet, noch laut, noch sonstwie in Einklang mit dem tollhäuslerischen Einschlag des Lebens. Aber ich war nicht traurig. Ich war nur in einer nüchternen Verfassung. Ich war soeben von meiner zweiten westindischen Reise zurück. Meine Augen waren noch voll von der tropischen Pracht, meine Erinnerung war voll von meinen Erlebnissen, gesetzlichen und ungesetzlichen, die auch ihren Reiz und ihr Erregendes hatten, denn sie hatten mich ein wenig erschreckt und nicht wenig amüsiert. Aber sie hatten mich unberührt gelassen. Es waren die Abenteuer anderer Männer, nicht meine. Abgesehen von einem bißchen Verantwortungsgefühl, das ich mir erworben hatte, war ich durch sie nicht gereifter geworden. Ich war ebenso jung wie zuvor. Unbegreiflich jung – immer noch wunderbar gedankenlos – unendlich aufnahmefähig.
Natürlich wendete ich an Don Carlos und seinen Kampf um ein Königreich keinen Gedanken. Warum sollte ich auch? Man denkt nicht gern über Dinge nach, auf die man tagtäglich in den Zeitungen und Unterhaltungen stößt. Seit meiner Rückkehr hatte ich ein paar Besuche gemacht; die meisten meiner Bekannten waren Legitimisten und verfolgten gespannt die Ereignisse an der spanischen Grenze – aus politischen, religiösen oder romantischen Beweggründen. Aber mich interessierte das nicht. Offenbar war ich nicht romantisch genug. Oder war ich vielleicht romantischer als all diese guten Leute? Die Sache schien mir recht gewöhnlich. Nichts weiter als ein Mann, der seinem Beruf als Kronprätendent nachging.
Auf der Titelseite einer Illustrierten, die ich auf einem Nebentisch liegen sah, wirkte er recht malerisch, wie er da auf einem Felsblock saß, ein großer kräftiger Mann mit einem eckig geschnittenen Bart, die Hände auf dem Knauf eines Kavalleriesäbels – und rings um ihn eine wilde Berglandschaft. Er fesselte meinen Blick auf dem sinnig komponierten Holzschnitt. (In jener Zeit gab es noch keine Reproduktionen fader Schnappschüsse.) Das war offenbar die romantische Version für königstreue Gemüter, aber sie weckte meine Aufmerksamkeit.
Just da drangen einige Masken von draußen in das Café, tanzten Hand in Hand in einer Schlange, angeführt von einem dicken Mann mit einer Pappnase. Er machte wilde Hüpfschritte, und hinter ihm etwa zwanzig andere, meist Pierrots und Pierretten, die sich an den Händen hielten und sich zwischen Stühlen und Tischen hindurch herein- und wieder hinausschlängelten: glänzende Augen in den Löchern von Pappgesichtern, keuchender Atem, aber alle in geheimnisvollem Schweigen.
Es waren Leute der ärmeren Schichten (in Kostümen aus weißem Kaliko mit roten Tupfen), aber unter ihnen befand sich ein Mädchen, das ein schwarzes, mit goldenen Halbmonden besticktes Kleid trug, am Hals hochgeschlossen und mit sehr kurzem Röckchen. Die meisten der gewöhnlichen Cafébesucher blickten nicht einmal von ihrem Spiel oder ihren Zeitungen auf. Ich, allein und untätig, starrte zerstreut hin. Das als ›Nacht‹ kostümierte Mädchen trug eine schwarze Samtmaske, die man auf französisch ›un loup‹ nennt. Wie sie in ihrer Zierlichkeit unter diese offenbar rauhe Gesellschaft geraten war, weiß ich nicht. Ihr Mund und Kinn waren unbedeckt und ließen auf eine hübsche Gesichtsbildung schließen.
Sie zogen an meinem Tisch vorbei; die ›Nacht‹ bemerkte vielleicht meinen starren Blick und streckte mir, indem sie ihren Körper aus der schlängelnden Kette vorreckte, eine schmale Zunge wie einen rosigen Stachel heraus. Ich war darauf nicht gefaßt und brachte nicht einmal ein beifälliges »Très joli« heraus, ehe sie sich vorbeiwand und davonhüpfte. Aber da ich auf diese Weise ausgezeichnet worden war, konnte ich nicht umhin, ihr mit den Augen zur Tür zu folgen, wo die Kette der Hände zerriß und alle Masken zugleich hinausstrebten. Zwei Herren, die gerade von der Straße hereinwollten, wurden durch das Gedränge aufgehalten. Die ›Nacht‹ (es war wohl eine eigene Note von ihr) streckte auch ihnen die Zunge heraus. Der größere der beiden (er war im Abendanzug unter einem leichten, weit offenen Paletot) faßte sie leicht unters Kinn, wobei – für mich sichtbar – seine weißen Zähne in dem dunklen hageren Gesicht aufblitzten. Der andere Mann stach sehr von ihm ab; blond, mit glatten rötlichen Wangen und kräftigen Schultern. Er trug einen grauen Anzug, offenbar fertig gekauft, denn er schien zu eng für seinen mächtigen Körperbau.
Dieser Mann war mir keineswegs fremd. Seit einer Woche oder so hatte ich nach ihm geradezu an allen Orten, wo Männer in einer Provinzstadt damit rechnen können, einander zu treffen, Ausschau gehalten. Zum erstenmal erblickte ich ihn (in dem selben grauen Konfektionsanzug) in einem royalistischen Salon, wo er entschieden Aufsehen machte, besonders bei den Frauen. Ich hatte seinen Namen als Monsieur Mills verstanden. Die Dame, die ihn eingeführt hatte, ergriff die erste Gelegenheit, mir ins Ohr zu flüstern: »Ein Verwandter von Lord X.« (Un proche parent de Lord X.) Und dann fügte sie mit einem Augenaufschlag hinzu: »Ein guter Freund des Königs.« Womit sie natürlich Don Carlos meinte.
Ich sah mir den proche parent an; nicht wegen jener Verwandtschaft, sondern weil mich seine behagliche Haltung bei einem so schwerfälligen Körper und in solch enger Kleidung in Erstaunen setzte. Aber schon klärte mich dieselbe Dame weiter auf: »Er ist hier als un naufragé hereingeschneit.«
Da begann ich mich wirklich für ihn zu interessieren. Ich hatte noch nie einen Schiffbrüchigen gesehen. Meine ganze Jungenhaftigkeit regte sich. Ein Schiffbruch war für mich ein Ereignis, das mir unweigerlich früher oder später bevorstand.
Mittlerweile blickte der für mich so bemerkenswerte Mann ruhig umher und sprach nur, wenn er von einer der anwesenden Damen angeredet wurde. Es waren mehr als ein Dutzend Leute in dem Salon, überwiegend Frauen, die feines Gebäck aßen und sich lebhaft unterhielten. Es hätte gut eine – freilich besonders alberne – Zusammenkunft eines Carlistischen Komitees sein können. Das ging mir sogar in meiner jugendlichen Unerfahrenheit auf. Und ich war in diesem Zimmer bei weitem der jüngste. Dieser stille Monsieur Mills schüchterte mich durch sein Alter (vermutlich war er fünfunddreißig), durch seine monumentale Ruhe, seine klaren, wachsamen Augen etwas ein. Aber die Versuchung war zu groß – und impulsiv sprach ich ihn auf das Thema jenes Schiffbruchs an.
Er wandte mir sein großflächiges, angenehmes Gesicht und seinen durchdringenden Blick zu, der (als hätte er mich im Augenblick durchschaut und nichts Unsympathisches entdeckt) einen freundlichen Ausdruck annahm. Zu dem Schiffbruch selbst äußerte er sich nicht weiter. Er sagte mir nur, es sei nicht im Mittelmeer geschehen, sondern auf der anderen Seite von Südfrankreich – im Golf von Biskaya. »Aber dies ist nicht unbedingt der Ort, sich auf eine Geschichte dieser Art einzulassen«, bemerkte er mit einem Rundblick durch das Zimmer und einem feinen Lächeln, das ebenso anziehend wirkte wie alles andere an seiner schlichten, aber vornehmen Erscheinung.
Ich drückte mein Bedauern aus. Ich hätte gern alles darüber gehört. Darauf meinte er, das sei kein Geheimnis, und wenn wir uns vielleicht beim nächsten Mal träfen …
»Aber wo könnten wir uns treffen«, rief ich aus. »Ich komme nicht oft in dieses Haus, müssen Sie wissen.«
»Wo? Nun, unfehlbar auf der Cannebière. Dort gegenüber der Bourse trifft sich alles mindestens einmal am Tag.«
Das stimmte durchaus. Aber obwohl ich an jedem der folgenden Tage nach ihm Ausschau hielt, ließ er sich zu den üblichen Stunden nirgends blicken. Die Gefährten meiner Mußestunden (und gerade damals war ich immer müßig) bemerkten meine Zerstreutheit und zogen mich mehr oder minder deutlich damit auf. Sie verlangten zu wissen, ob sie, die ich erwartete, dunkel oder blond sei; ob dieses faszinierende Wesen, das mich beim Wickel hatte, eine meiner Aristokratinnen oder eine meiner Marinebräute sei: denn sie wußten, daß ich zu diesen beiden – soll ich sagen: Kreisen? – Zugang hatte. Sie hingegen bildeten den Kreis der Boheme, keinen besonders großen – wir waren nur ein halbes Dutzend, angeführt von einem Bildhauer, den wir der Einfachheit halber Prax nannten. Mein Spitzname war »Jung-Ulysses«. Ich hörte das gern.
Aber sie wären – Spott her oder hin – sehr überrascht gewesen, wenn ich sie wegen des stämmigen und sympathischen Mills verlassen hätte. Ich war bereit, jede oberflächliche Gesellschaft Gleichgesinnter aufzugeben, um mich diesem interessanten Mann mit allem erdenklichen Respekt zu nähern. Nicht unbedingt wegen jenes Schiffbruchs. Er interessierte mich und zog mich um so mehr an, weil er sich nicht blicken ließ. Die Befürchtung, er sei vielleicht plötzlich nach England abgereist (oder nach Spanien), versetzte mich in eine lächerliche Niedergeschlagenheit, als hätte ich eine einzigartige Chance versäumt. Und so ermutigte mich ein freudiger Impuls, ihm quer durch das Café mit erhobenem Arm zuzuwinken.
Gleich darauf wurde ich sehr verlegen, als ich ihn mit seinem Freund auf meinen Tisch zukommen sah. Der andere Herr war ungemein elegant. Typisch eine jener Erscheinungen, denen man an einem schönen Maiabend in der Umgebung der Großen Oper in Paris begegnen kann.
Wirklich sehr pariserisch. Und doch kam er mir nicht so vollkommen französisch vor, wie er eigentlich hätte sein müssen, als sei die Nationalität eines Menschen eine Leistung mit verschiedenen Graden der Vortrefflichkeit. Mills hingegen war der vollkommene britische Inselbewohner. Über ihn konnte man nicht im Zweifel sein. Beide hatten ein mildes Lächeln für mich. Der stämmige Mills nahm sich der Vorstellung an: »Captain Blunt.«
Wir reichten uns die Hand. Der Name sagte mir nicht viel. Aber es überraschte mich, daß Mills sich des meinen so gut erinnerte. Ich will mich nicht mit meiner Bescheidenheit brüsten, aber zwei oder drei Tage schienen mir für einen Mann wie Mills mehr als genug, um zu vergessen, daß ich überhaupt existierte. Was den Captain betraf, so war ich bei näherem Hinsehen verblüfft über die peinliche Korrektheit seiner Erscheinung. Kleidung, schlanke Gestalt, schmales sonnengebräuntes Gesicht, Haltung – all das war so gut, daß es der Gefahr der Banalität nur durch die lebhaften schwarzen Augen entging, Augen von einer durchdringenden Schärfe, wie man sie nicht alle Tage im Süden Frankreichs und noch weniger in Italien antrifft. Ein anderer Umstand war, daß er für einen Offizier in Zivil nicht zünftig genug aussah. Auch diese Unstimmigkeit war interessant.
Ihr mögt denken, daß ich meine Eindrücke mit Absicht so fein nuanciere, aber glaubt einem Manne, der ein rauhes, ein sehr rauhes Leben geführt hat, daß gerade die Nuancen der persönlichen Erscheinung, der Bekanntschaften und Ereignisse für das Gedächtnis interessant und wichtig sind wie kaum etwas anderes. Dies ist, müßt ihr wissen, der letzte Abend des Lebensabschnitts, der vor der Bekanntschaft mit jener Frau lag. Es sind gleichsam die letzten Stunden einer früheren Existenz. Ich kann nicht dafür, daß sie sich im entscheidenden Moment mit nichts Besserem verbinden als mit dem trivialen Glanz eines vergoldeten Cafés und dem närrischen Geschrei des Karnevals auf der Straße.
Wir drei indessen (einander nahezu völlig fremd) hatten uns in ausgesprochen geselliger Haltung um den Tisch gesetzt. Ein Kellner erschien, und da geschah es, daß ich bei Gelegenheit meiner Bestellung eines Kaffees als allererstes von Captain Blunt erfuhr, er leide an chronischer Schlaflosigkeit. Mills begann auf seine ungerührte Art seine Pfeife zu stopfen. Ich war mit einemmal entsetzlich verlegen, wurde aber entschieden ärgerlich, als ich unsern Prax in das Café kommen sah, in einem kurzen mittelalterlichen Kostüm, sehr ähnlich dem, das Faust im dritten Akt zu tragen pflegt. Kein Zweifel, daß er damit nur den Faust aus der Oper vorstellen wollte. Ein leichter Umhang flatterte um seine Schultern. Er strebte theatralisch auf unseren Tisch zu, redete mich mit »Jung-Ulysses« an und schlug vor, ich solle mit ihm hinauskommen und ihm helfen, auf dem Straßenasphalt ein paar Margueriten aufzusammeln als Dekoration für ein wahrhaft infernalisches Souper, das gegenüber in der Maison Dorée im ersten Stock vorbereitet wurde. Mit zurechtweisendem Kopfschütteln und indignierten Blicken lenkte ich seine Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß ich nicht allein war. Er trat, gleichsam erstaunt über die Entdeckung, einen Schritt zurück, nahm mit einer tiefen Verbeugung seine federgeschmückte Samtkappe ab (daß die Federn über den Boden streiften) und wankte von der Bühne, die linke Hand am Griff des Theaterdolchs in seinem Gürtel.
Inzwischen hatte der weltgewandte und doch schlichte Mills sich mit dem Anzünden seiner Bruyère beschäftigt, und der distinguierte Captain lächelte vor sich hin. Ich war fürchterlich verstimmt und entschuldigte mich für die aufdringliche Störung; ich sagte, der junge Mann sei ein Bildhauer mit großer Zukunft und übrigens völlig harmlos, aber er habe zuviel Nachtluft eingeatmet, die ihm offensichtlich zu Kopf gestiegen sei.
Mills blickte mit seinen freundlichen, aber ungemein forschenden blauen Augen durch die Rauchwolke, mit der er sein großes Haupt umkränzt hatte, zu mir hin. Das Lächeln des schlanken, dunklen Captains nahm einen wohlwollenden Ausdruck an. Ob er erfahren dürfe, weshalb ich von meinem jungen Freund als »Jung-Ulysses« angeredet worden sei? Und unmittelbar daran schloß er mit höflichem Scherz die Bemerkung, Ulysses sei ein schlauer Bursche gewesen. Mills ließ mir keine Zeit zu einer Antwort. Er warf ein: »Dieser alte Grieche war ein berühmter Wanderer – der erste Seemann in historischer Zeit.« Er schwenkte vage seine Pfeife gegen mich.
»Ah! Vraiment!« Der höfliche Captain schien ungläubig, als bekümmere ihn etwas. »Sind Sie ein Seemann? In welchem Sinne, bitte?« Wir sprachen französisch, und er benutzte den Ausdruck homme de mer.
Wieder schaltete sich Mills gelassen ein. »In dem gleichen Sinne, in dem Sie ein Kriegsmann sind.« (Homme de guerre.)
Nun zum erstenmal hörte ich von Captain Blunt eine seiner lapidaren Erklärungen. Er hatte deren zwei, und dies war die erste. »Ich lebe von meinem Schwert.«
Das kam auf eine außerordentlich stutzerhafte Art heraus, die mir in diesem Zusammenhang die Sprache verschlug. Ich konnte ihn nur anstarren. Etwas natürlicher fügte er hinzu: »Zweites Kastilisches Reiterregiment.« Dann mit entschiedenem Nachdruck auf spanisch: »En las filas legítimas.«
Mills ließ sich ungerührt wie Jupiter aus seiner Wolke vernehmen: »Er ist auf Urlaub hier.«
»Natürlich schreie ich das nicht von allen Dächern«, wandte sich der Captain bewußt an mich, »ebensowenig wie unser Freund sein Schiffbruchsabenteuer. Wir dürfen die Langmut der französischen Behörden nicht zu sehr strapazieren! Das wäre nicht korrekt – und auch nicht sehr sicher.«
Ich war mit einemmal höchlich entzückt von meiner Gesellschaft. Ein Mann, der »von seinem Schwert lebte«, vor meinen Augen, zum Greifen nahe! Ich war nicht zu spät auf die Welt gekommen! Und gegenüber am Tisch mit seinem Air von aufmerksamem, ungerührtem Wohlwollen, das ihn an sich schon interessant machte, saß der Mann mit der Schiffbruchsgeschichte, die man nicht jedem auf die Nase binden durfte. Warum nur?
Das wurde mir völlig klar, als er mir dann erzählte, er sei auf dem Clyde an Bord eines kleinen Dampfers gegangen, den ein Verwandter von ihm, »ein sehr vermögender Mann«, wie er bemerkte, (wahrscheinlich Lord X., dachte ich) gechartert habe, um der Carlistischen Armee Waffen und anderes zu liefern. Und es handelte sich nicht um einen Schiffbruch im gewöhnlichen Sinne. Alles ging ganz glatt bis zum letzten Augenblick, als plötzlich die Numancia (ein republikanisches Panzerschiff) aufgetaucht war und sie unterhalb von Bayonne an die französische Küste gejagt hatte. In knappen Worten, aber sichtlich das Abenteuer genießend, beschrieb uns Mills, wie er nur mit seiner Geldkatze und einem Paar Hosen bekleidet, an den Strand geschwommen war. Granaten fielen ringsum, bis ein winziges französisches Kanonenboot von Bayonne kam und die Numancia aus den Hoheitsgewässern verscheuchte.
Er erzählte sehr amüsant, und ich war fasziniert von der Vorstellung, wie dieser ruhige Mann von der Brandung umhergeworfen wurde und ganz außer Atem, in dem erwähnten Kostüm, an der schönen Küste Frankreichs auftauchte – ein richtiger Waffenschmuggler. Indessen war er niemals verhaftet oder des Landes verwiesen worden, da er ja hier vor meinen Augen saß. Aber wieso und warum er sich so weit von der Szene seines Meeresabenteuers entfernt hatte, war eine interessante Frage. Und ich stellte sie ihm mit naivster Taktlosigkeit, worüber er sich nicht schockiert zeigte. Er sagte mir, die Konterbande an Bord dürfte, da das Schiff nur gestrandet und nicht gesunken sei, zweifellos in guter Verfassung sein. Französische Zollbeamte bewachten das Wrack. Wenn ihre Wachsamkeit auf irgendeine Weise – hm – abgelenkt oder auch nur vermindert werden könnte, würden gewisse spanische Fischerboote in aller Stille bei Nacht eine Menge dieser Gewehre und Munition abholen können. Am Ende doch noch für die Carlisten gerettet. Er meinte, es würde sich machen lassen …
Ich kehrte den Fachmann heraus und sagte, das lasse sich in ein paar vollkommen ruhigen Nächten (freilich einer Seltenheit an jenem Küstenstrich) gewiß machen.
Mr. Mills fürchtete die Elemente nicht. Hingegen war es der höchst unangebrachte Diensteifer der französischen Zollbeamten, mit dem man so oder so fertigwerden mußte.
»Himmel!« rief ich entgeistert, »die französischen Zöllner können Sie nicht bestechen. Das ist doch keine südamerikanische Republik.«
»Ist es eine Republik?« murmelte er, ganz mit dem Rauchen seiner Pfeife beschäftigt.
»Nun, etwa nicht?«
Er murmelte wieder: »Ach, gar so wenig.« Darauf lachte ich, und ein Anflug von Humor ging über Mills’ Gesicht. Nein. Bestechung komme nicht in Frage, lenkte er ein. Aber in Paris gab es reichlich Sympathien für die Legitimisten. Eine geeignete Persönlichkeit konnte sie in Bewegung setzen, und ein bloßer Wink von höherer Stelle an die Beamten, sich nicht übermäßig um das Wrack zu kümmern …
Das Amüsanteste war der kühle vernünftige Ton, in dem das erstaunliche Projekt vorgebracht wurde. Mr. Blunt saß ganz teilnahmslos da und ließ seine Augen hierhin und dahin durch das ganze Café schweifen, und als er dann emporblickte auf den rosigen Fuß irgendeiner fleischigen, perspektivisch stark verkürzten Göttin, die da in einer gewaltigen Komposition im italienischen Stil an die Decke gemalt war, ließ er wie beiläufig die Worte fallen: »Sie wird das ganz leicht für Sie bewerkstelligen.«
»Noch jeder carlistische Agent in Bayonne hat mir das versichert«, sagte Mr. Mills. »Ich wäre stracks nach Paris gefahren, nur sagte man mir, sie habe sich hierher geflüchtet, um auszuruhen, überanstrengt, unzufrieden. Keine sehr ermutigende Nachricht.«
»Diese Eskapaden sind wohlbekannt«, murmelte Mr. Blunt. »Sie werden sie wohlauf finden.«
»Ja. Man sagte mir, daß Sie …«
Ich fiel ein: »Sie meinen, daß eine Frau eine solche Angelegenheit für Sie in Ordnung bringen soll?«
»Kleinigkeit für sie«, bemerkte Mr. Blunt lässig. »Auf solche Sachen verstehen sich Frauen am besten. Sie haben weniger Skrupel.«
»Und mehr Wagemut«, warf Mr. Mills nahezu flüsternd ein.
Mr. Blunt schwieg einen Augenblick, dann: »Sie sehen«, wandte er sich in überlegenem Ton an mich, »wenn’s bloß ein Mann ist, sieht er sich womöglich Hals über Kopf die Treppe hinuntergeworfen.«
Ich weiß nicht, weshalb mich diese Bemerkung schockiert haben sollte. Unmöglich, denn sie stimmte einfach nicht. Doch er gab mir keine Zeit zu irgendeiner Erwiderung. Er fragte mich mit äußerster Höflichkeit, was ich von den südamerikanischen Republiken wisse. Ich gestand, das sei sehr wenig. Im Umherstreifen im Golf von Mexiko hatte ich hier und da einen Einblick getan; unter anderem war ich ein paar Tage in Haiti gewesen, das, weil eine Negerrepublik, natürlich einzigartig war. Daraufhin begann Captain Blunt sich über Neger im allgemeinen zu verbreiten. Er sprach kenntnisreich, intelligent und mit einer Art liebevoller Verachtung. Er verallgemeinerte, ging ins Detail, erzählte Anekdoten. Ich war gefesselt, ein bißchen ungläubig und gewaltig überrascht. Was konnte dieser Mann mit dem Äußeren eines Flaneurs, das ihn wie einen Verbannten in einer Provinzstadt wirken ließ, und mit seinen Salonmanieren – was konnte er schon über die Neger wissen?
Mills, der schweigend, mit seinem Air eines klugen Beobachters dasaß, schien meine Gedanken zu lesen, schwenkte leicht seine Pfeife und erklärte: »Der Captain stammt aus South-Carolina.«
»Oh«, murmelte ich, und dann, nach der winzigsten Pause, vernahm ich die zweite von Mr. J. K. Blunts Erklärungen.
»Ja«, sagte er, »je suis Américain, catholique et gentilhomme«, in einem Ton, der so wenig zu dem Lächeln paßte, mit dem er seine Worte begleitete, daß ich nicht wußte, ob ich das Lächeln ebenso erwidern oder die Worte mit einer feierlichen kleinen Verneigung quittieren sollte. Natürlich tat ich keins von beidem, und damit fielen wir in ein sonderbares vieldeutiges Schweigen. Es bezeichnete unser endgültiges Abgehen von der französischen Sprache. Ich sprach als erster wieder und schlug vor, meine Gefährten sollten mit mir zu Abend speisen, nicht gegenüber, wo es zu turbulent sei mit mehr als einem »infernalischen« Souper, sondern in einem anderen, gepflegteren Lokal in einer Nebenstraße, abseits der Cannebière. Es schmeichelte mir ein wenig, sagen zu können, daß ich einen ständigen reservierten Ecktisch im ›Salon des Palmiers‹ habe, oder aber im ›Salon Blanc‹, wo die Atmosphäre legitimistisch sei und sehr anständig obendrein – sogar in der Karnevalszeit. »Neun Zehntel der Leute dort«, sagte ich, »würden Ihre politischen Ansichten teilen, wenn das ein Anreiz ist. Kommen Sie. Feiern wir«, ermunterte ich die beiden.
Mir war nicht besonders zum Feiern zumute. Ich wollte lediglich in ihrer Gesellschaft bleiben und mich von einer unerklärlichen Hemmung befreien, die ich an mir wahrnahm. Mills blickte mich fest an, mit einem kleinen freundlichen Lächeln.
»Nein«, sagte Blunt. »Wozu sollen wir dahin gehen? Man wird uns nur zu später Stunde hinausbefördern, nach Hause, wo die Schlaflosigkeit wartet. Können Sie sich etwas Abscheulicheres vorstellen?«
Er lächelte die ganze Zeit, aber seine tiefliegenden Augen vertrugen sich nicht mit der Miene launiger Höflichkeit, die er aufzusetzen versuchte. Er hatte einen anderen Vorschlag. Warum sollten wir uns nicht in seine Wohnung begeben? Er hatte dort alles Nötige für ein selbsterfundenes Gericht, für das er in der ganzen Königlichen Kavallerie berühmt war, und das wolle er für uns kochen. Es würden sich auch höchstwahrscheinlich ein paar Flaschen Weißwein finden, die wir aus venezianischen Pokalen trinken könnten. Ein festliches bivouac, in der Tat. Und er würde uns nicht nach Mitternacht an die Luft setzen. Er nicht. Er könne ohnehin nicht schlafen.
Muß ich sagen, daß ich von der Idee begeistert war? Nun, ja. Aber irgendwie zögerte ich und blickte auf Mills, der so viel älter war als ich. Er stand wortlos auf. Damit war es entschieden; denn keine dunkle Vorahnung, die sich zudem auf nichts Bestimmtes gründete, konnte gegen das Beispiel seiner ruhigen Sicherheit aufkommen.
II
Die Straße, in der Mr. Blunt wohnte, bot sich unseren Augen als eng und still, als menschenleer und dunkel dar; doch die wenigen Gaslaternen reichten aus, um ihr auffälligstes Merkmal zu enthüllen: ragende Fahnenstangen über den geschlossenen Portalen vieler Häuser. Es war die Konsulatsstraße, und ich bemerkte zu Mr. Blunt, daß er, am Morgen hinaustretend, die Flaggen fast aller Nationen überblicken könne – ausgenommen seine eigene. (Das amerikanische Konsulat lag in der anderen Hälfte der Stadt.) Er murmelte zwischen den Zähnen, er werde sich hüten, seinem eigenen Konsulat zu nahe zu kommen.
»Haben Sie Angst vor dem Hund des Konsuls?« witzelte ich. Der Hund des Konsuls wog etwa anderthalb Pfund und war stadtbekannt, weil man ihn überall auf dem Arm des Konsuls zu sehen bekam, zu allen Stunden, besonders aber zur Stunde der mondänen Promenade auf dem Prado.
Doch ich merkte, daß mein Scherz unangebracht war, als Mills mir leise ins Ohr brummte: »Das sind doch alles Yankees.«
»Natürlich«, stammelte ich verwirrt.
Bücher sind nichts. Ich entdeckte, daß ich mir bis jetzt nie klargemacht hatte, daß der amerikanische Bürgerkrieg keine gedruckte Historie war, sondern eine erst zehn Jahre zurückliegende Tatsache. Natürlich. Er war ein Gentleman aus South Carolina. Ich schämte mich ein wenig meines Mangels an Taktgefühl.
Mittlerweile hatte Captain Blunt, der mit seinem aus der Stirn zurückgeschobenen chapeau-claque der gewöhnlichen Vorstellung von einem modischen Flaneur entsprach, einige Schwierigkeiten mit seinem Hausschlüssel; denn das Haus, vor dem wir haltgemacht hatten, war keines jener vielstöckigen Häuser, die den größten Teil der Straße einnahmen. Es hatte nur eine Reihe Fenster über dem Erdgeschoß. Blinde Mauern, die sich daran anschlossen, deuteten auf das Vorhandensein eines Gartens. Die dunkle Front bot keine besonderen architektonischen Merkmale, und in dem flackernden Licht einer Straßenlaterne sah es ein wenig weltverloren aus. Um so mehr war ich überrascht, in eine mit schwarz-weißem Marmor ausgelegte Halle zu kommen, die in der Dunkelheit eine palastartige Weite zu haben schien. Mr. Blunt drehte nicht erst den einzigen kleinen Gasleuchter an, sondern ging uns voraus über die schwarzweißen Marmorplatten, am Fuß der Treppe vorbei und durch eine Tür aus dunkel schimmerndem Holz und mit schwerem Bronzegriff. Dies sei der Zugang zu seinen Gemächern, sagte er; aber er führte uns gleich weiter in das Studio am Ende des Ganges.
Der Raum war eher klein und wirkte wie ein Anbau auf der Gartenseite des Hauses. Eine mächtige Lampe brannte hell. Der Fußboden war zwar nur aus Fliesen, aber die wenigen Teppiche, die umherlagen, waren – wenn auch sehr abgewetzt – äußerst kostbar. Es stand auch ein sehr schönes, mit rosageblümter Seide bezogenes Sofa darin, ein gewaltiger Diwan mit vielen Kissen, ein paar prächtige Sessel verschiedener Art (aber alle sehr abgenutzt), ein runder Tisch und inmitten all dieser erlesenen Möbel ein kleiner gewöhnlicher Eisenofen. Jemand mußte ihn noch kürzlich versorgt haben, denn es bullerte darin, und die Wärme des Raumes war sehr willkommen nach den durch Mark und Bein gehenden Windstößen des Mistral draußen.
Mills warf sich ohne ein Wort auf den Diwan und starrte, auf einen Ellbogen gestützt, gedankenvoll in eine ferne Ecke, wo im Schatten eines mächtigen geschnitzten Kleiderschranks eine richtige Modellpuppe stand, ohne Kopf oder Hände, aber mit herrlich geformten Gliedern, in scheuer Haltung verschränkt, als sei sie durch sein Starren verwirrt.
Während wir saßen und die bivouac-Bewirtung genossen (das Gericht war wirklich ausgezeichnet, und unser Gastgeber wirkte noch in einer schäbigen grauen Jacke wie ein vollendeter Elégant), schweiften meine Augen immer wieder in jene Ecke. Blunt merkte das und meinte, die Kaiserin übe wohl eine starke Anziehung auf mich aus.
»Sie stößt mich ab«, sagte ich. »Ein windiges Knochengerippe, das unser Festmahl zu belauern scheint. Und warum nennen Sie die Puppe Kaiserin?«
»Weil sie in den Gewändern einer byzantinischen Kaiserin tagelang einem Maler gesessen hat … Ich frage mich nur, wo er diese kostbaren Stoffe aufgetrieben hat … Sie kannten ihn, nehme ich an?«
Mills neigte gemessen den Kopf, dann ließ er aus einem venezianischen Pokal etwas Wein seine Kehle hinabrinnen.
»Dieses Haus ist voller Kostbarkeiten. Desgleichen alle seine anderen Häuser und auch seine Pariser Wohnung – jener mysteriöse Pavillon, ganz versteckt irgendwo in Passy.«
Mills kannte den Pavillon. Der Wein hatte vermutlich seine Zunge gelöst. Auch Blunt verlor etwas von seiner Reserviertheit. Aus ihrer Unterhaltung ergab sich für mich das Bild einer exzentrischen Persönlichkeit: ein sehr vermögender Mann, nicht gerade einsam, aber äußerst verschlossen, ein Sammler schöner Dinge, ein Maler, den nur sehr wenige kannten und von dem die Öffentlichkeit erst recht keine Notiz nahm. Aber ich hatte inzwischen meinen venezianischen Kelch mit einiger Regelmäßigkeit geleert (die von dem eisernen Ofen ausgestrahlte Hitze war gewaltig; sie dörrte einem die Kehle aus, und der strohfarbene Wein schien mir nicht stärker als ein durch Essenzen wohlschmeckend gemachtes Wasser), so daß die Stimmen und die Eindrücke, die sie vermittelten, für mein Gemüt etwas Phantastisches bekamen. Plötzlich sah ich, daß Mills in Hemdsärmeln dasaß. Dabei hatte ich gar nicht bemerkt, daß er sein Jackett ausgezogen hatte. Blunt hatte seine schäbige Jacke aufgeknöpft und ließ unter dem blaurasierten Kinn sehr viel gestärkte Hemdbrust nebst der weißen Frackschleife sehen. Er hatte etwas seltsam Anmaßendes – oder es kam mir nur so vor. Viel lauter als ich eigentlich beabsichtigt hatte, wandte ich mich an ihn:
»Haben Sie diesen außerordentlichen Mann gekannt?«
»Um ihn persönlich zu kennen, mußte man entweder sehr distinguiert sein oder viel Glück haben. Mr. Mills hier …«
»Ja, ich hatte Glück«, fiel Mills ein. »Für die Distinktion sorgte mein Vetter. So kam es, daß ich zu seinem Pariser Haus, dem sogenannten Pavillon, Zutritt erhielt – zweimal.«
»Und auch Doña Rita zweimal sahen?« fragte Blunt mit einem unbestimmten Lächeln und spürbarem Nachdruck.
Mills antwortete ebenso nachdrücklich, aber mit ernster Miene: »Ich gerate nicht leicht in Begeisterung, wenn es sich um Frauen handelt, aber sie verdiente ohne Zweifel unter all den unbezahlbaren Dingen, die er in jenem Haus angehäuft hatte, die größte Bewunderung – das bewundernswerteste …«
»Ah! Aber sie war ja auch von all den Dingen das einzige, das lebte«, gab Blunt mit dem allerleisesten spöttischen Unterton zu bedenken.
»Unsagbar lebendig«, bestätigte Mills. »Aber nicht aus Unrast, in Wahrheit rührte sie sich kaum je von der Couch zwischen den Fenstern fort – Sie wissen.«
»Nein. Ich weiß nichts. Ich bin nie dort gewesen«, verkündete Blunt mit jenem weißen Aufblitzen der Zähne, das so merkwürdig beziehungslos war und einen nur verwirrte.
»Aber sie strahlte Leben aus«, fuhr Mills fort. »Leben in Fülle und von besonderer Art. Mein Vetter und Henry Allègre hatten viel miteinander zu besprechen, so daß ich mich ganz ihr widmen konnte. Beim zweiten Besuch waren wir schon wie alte Freunde – komisch, wenn man bedenkt, daß wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder begegnen würden, nicht in dieser noch in jener Welt. Ich möchte mich nicht auf theologische Fragen einlassen, aber mir scheint, in den Elysischen Gefilden wird sie in einer sehr erlesenen Gesellschaft ihren Platz haben.«
Alles das brachte er mit Sympathie im Ton und in seiner ungerührten Haltung vor. Blunt ließ wiederum befremdlich seine weißen Zähne blitzen und murmelte:
»Ich würde sagen: gemischte Gesellschaft.« Dann lauter: »Wie zum Beispiel …«
»Wie zum Beispiel Kleopatra«, erwiderte Mills ruhig. Und nach einer Pause: »Die auch nicht eigentlich hübsch war.«
»Ich hätte eher an die La Vallière gedacht«, warf Blunt so unbeteiligt hin, daß man nicht wußte, was davon zu halten war. Vielleicht begann ihn das Thema zu langweilen. Aber das konnte auch Pose sein, denn sein ganzes Wesen ließ sich nicht klar durchschauen. Ich jedenfalls war keineswegs gleichgültig. Eine Frau ist immer ein interessantes Thema, und ich war für diesen Gegenstand durchaus empfänglich. Mills erwog die Sache eine Zeitlang mit gelassenem Wohlwollen, schließlich meinte er:
»Ja, Doña Rita läßt, soweit ich sie kenne, in all ihrer Schlichtheit so viele Deutungen zu, daß sogar diese möglich ist«, sagte er. »Ja. Eine romantische La Vallière im Ruhestand … die übrigens einen großen Mund hatte.«
Ich fühlte mich zu einer Äußerung veranlaßt.
»Haben Sie die La Vallière auch gekannt?« fragte ich etwas impertinent.
Mills lächelte nur. »Nein. Ganz so alt bin ich denn doch nicht«, sagte er. »Aber es gehört nicht viel dazu, Fakten dieser Art über eine historische Person zu kennen. Es gab da einen zeitgenössischen Spottvers; darin wurde Ludwig XIV. beglückwünscht als Besitzer von – ich weiß nicht mehr, wie es ging – als Besitzer von
… ce bec amoureux
Qui d’une oreille à l’autre va,
Tra là là.
So ungefähr. Es muß ja nicht gerade von einem Ohr zum anderen sein, aber tatsächlich deutet ein breiter Mund darauf hin, daß jemand großzügig denkt und fühlt. Hüten Sie sich, junger Mann, vor Frauen mit kleinen Mündern. Hüten Sie sich auch vor den anderen, versteht sich; aber ein kleiner Mund ist ein fatales Zeichen. Nun, die royalistischen Parteigänger können Doña Rita nicht den geringsten Mangel an Großzügigkeit vorwerfen, soweit ich höre. Wie sollte ich auch über sie urteilen? Ich habe sie alles in allem, sagen wir, sechs Stunden gekannt. Das genügte, um das Verführerische ihrer angeborenen Intelligenz und ihrer blendenden Gestalt zu erkennen. Und all das offenbarte sich mir so überstürzt«, schloß er, »denn sie hatte das, was ein Franzose einmal ›die fürchterliche Gabe der Vertraulichkeit‹ genannt hat.«
Blunt hatte gedankenvoll zugehört. Er nickte zustimmend.
»Ja!« Mills’ Gedanken weilten immer noch in der Vergangenheit. »Und wenn sie Auf-Wiedersehen sagte, konnte sie im selben Moment einen ungeheuren Abstand zwischen sich und dem anderen schaffen. Ein leichtes Strecken der untadeligen Gestalt, ein Wechsel des Gesichtsausdrucks: es war, als würde man von einer im Purpur Geborenen huldvoll entlassen. Noch wenn sie einem die Hand reichte – wie es mir geschah –, war das wie über einen breiten Fluß hinweg. Vielleicht ist sie wirklich eins jener unnahbaren Wesen. Was meinen Sie, Blunt?«
Das war als direkte Frage gemeint, aber aus irgendeinem Grunde (als sei der Radius meiner Empfindsamkeit schon jetzt erweitert) berührte sie mich unangenehm oder beunruhigte mich sogar. Blunt schien die Frage nicht gehört zu haben. Doch nach einer Weile wandte er sich an mich.
»Dieser grobschlächtige Mann«, sagte er in einem Ton vollendeter Höflichkeit, »ist so fein wie eine Nadel. Alle diese Reden über das Verführerische und dann dieser abschließend geäußerte Zweifel nach nur zwei Besuchen, die alles in allem nicht mehr als sechs Stunden gedauert haben können, und das vor mehr als drei Jahren! Aber Henry Allègre – dem sollten Sie diese Frage stellen, Mr. Mills.«
»Ich verfüge nicht über das Geheimnis, die Toten zu erwecken«, erwiderte Mills gutmütig. »Und wenn – ich würde zögern. Mir scheint, das hieße, sich bei einem Menschen, den man nur flüchtig im Leben gekannt hat, eine Freiheit herausnehmen.«
»Und doch ist Henry Allègre der einzige Mensch, den man über sie befragen kann, nach dieser ununterbrochenen, jahrelangen Gemeinschaft, seit er sie entdeckt hatte; diese ganze Zeit, jeder atemerfüllte Moment bis, buchstäblich, bis zu seinem letzten Atemzug. Ich will nicht sagen, daß sie ihn bemutterte. Dafür hatte er seinen Vertrauten. Er konnte Weiber um sich nicht ertragen. Aber diese ertrug er offenbar nicht außer Sichtweite. Sie ist die einzige Frau, die ihm je zu einem Bild gesessen hat, denn er duldete sonst kein Modell in seinem Haus. Daher hat auch das ›Mädchen mit dem Hut‹ und hat die ›Byzantinische Kaiserin‹ jenes familiäre Fluidum, obwohl keine von beiden faktisch ein Porträt von Doña Rita ist … Sie kennen meine Mutter?«
Mills neigte seinen Oberkörper ein wenig vor, und ein flüchtiges Lächeln schwand von seinen Lippen. Blunts Augen fixierten buchstäblich die Mitte seines leeren Tellers.
»Dann wissen Sie vielleicht auch von den künstlerischen und literarischen Konnexionen meiner Mutter«, fuhr Blunt in einem unmerklich veränderten Ton fort. »Meine Mutter hat schon als Mädchen von fünfzehn Jahren Verse geschrieben. Sie schreibt immer noch Verse. Sie ist immer noch fünfzehn – ein verwöhntes Musenkind. So ersuchte sie einen ihrer Dichterfreunde – keinen geringeren als Versoy selbst –, für sie einen Besuch in Henry Allègres Haus zu arrangieren. Zuerst glaubte er, nicht richtig gehört zu haben. Für meine Mutter, müssen Sie wissen, ist ein Mann, der sich um der Launen einer Frau willen kein Bein ausreißt, nicht ritterlich. Aber Sie kennen das vielleicht? …«
Mills schüttelte amüsiert den Kopf. Blunt, der seine Augen von seinem Teller zu ihm erhoben hatte, nahm den Faden sehr behutsam wieder auf.
»Sie gibt keine Ruhe, sich nicht und ihren Freunden nicht. Meine Mutter ist auf eine ausgefallene Art verrückt. Sie verstehen, daß alle diese Maler, Dichter und Sammler – und Händler mit altem Kitsch«, fügte er zwischen den Zähnen hinzu, – »mit denen meine Mutter sich umgab, mir nicht liegen; aber Versoy lebte mehr wie ein Mann von Welt. Eines Tages traf ich ihn in der Fechtschule. Er war wütend. Er bat mich, meiner Mutter auszurichten, dies sei der letzte Ritterdienst. Die Aufgaben, die sie ihm stelle, seien zu schwierig. Aber immerhin gefiel er sich nicht wenig darin, mit dem Einfluß zu glänzen, den er im quartier hatte. Er wußte, meine Mutter würde alles der Damenwelt weitererzählen. Er ist ein boshaftes, hitziges Kerlchen. Sein Kopf glänzt wie eine Billardkugel. Ich glaube, er poliert ihn jeden Morgen mit einem Tuch. Natürlich kamen sie nicht weiter als bis in das große Empfangszimmer, einen riesigen Salon mit drei Säulenpaaren in der Mitte. Die Flügeltüren oben an der Treppe waren weit aufgetan wie für einen königlichen Besuch. Sie müssen sich meine Mutter vorstellen, ihre weißen Haare irgendwie à la dix-huitième frisiert und ihre funkelnden schwarzen Augen, wie sie in diese Pracht eindrang, eskortiert von einer Art kahlköpfigem, verdrießlichem Eichhörnchen – und Henry Allègre, der ihnen entgegenkam wie ein gestrenger Fürst mit der Grabesmiene eines Kreuzritters, große weiße Hände, gedämpfte weiche Stimme, halbgeschlossene Augen, als blicke er von einem Balkon auf sie herab. Sie kennen diesen Trick an ihm, Mills?«
Mills ließ seinen geblähten Backen eine gewaltige Rauchwolke entströmen.
»Auch er war wütend, das kann ich wohl sagen«, fuhr Blunt gleichmütig fort. »Aber er war äußerst höflich. Er zeigte ihr all die ›Schätze‹ im Raum, Elfenbein- und Email-Arbeiten, Monstrositäten aller Art aus Japan, aus Indien, aus Timbuktu … was weiß ich … Er trieb seine Herablassung so weit, daß er das ›Mädchen mit dem Hut‹ in den Salon herunterbringen ließ – halbfertig, ungerahmt. Sie stellten es auf einen Stuhl, damit meine Mutter es betrachten könnte. Die ›Byzantinische Kaiserin‹ war auch schon da, hing an der Stirnwand – ganze Figur, goldener Rahmen von einer halben Tonne Gewicht. Meine Mutter überschüttete zunächst den ›Meister‹ mit Dank und versenkte sich dann ehrfürchtig in das ›Mädchen mit dem Hut‹. Dann seufzte sie: ›Es müßte Diaphanéité heißen, wenn es das Wort gibt. Ah! Das ist das Äußerste an Modernität!‹ Sie hob plötzlich ihr Lorgnon und blickte zur Stirnwand hin. ›Und da – die Inkarnation von Byzanz! Wer war sie, diese schmollende, wunderschöne Kaiserin?‹
›Mir schwebte so etwas vor wie Theodosia‹, ließ sich Allègre vernehmen. ›Eine ehemalige Sklavin – von irgendwo.‹
Meine Mutter kann wunderbar taktlos sein, wenn sie ihre Anwandlung hat. Ihr fällt also nichts Besseres ein, als den ›Meister‹ zu fragen, warum er sich für jene beiden Gesichter von dem selben Modell habe inspirieren lassen. Zweifellos war sie stolz auf ihr gutes Auge. Die Bemerkung war auch wirklich scharfsinnig. Allègre hingegen erblickte darin eine kolossale Unverschämtheit; aber er antwortete in seinem seidigsten Ton:
›Vielleicht weil ich in jener Frau etwas von der Frau überhaupt, etwas Überzeitliches erblickte.‹
Meine Mutter hätte sich selbst sagen können, daß sie sich da ziemlich weit aufs Eis vorgewagt habe. Sie ist äußerst intelligent. Ja, sie hätte es wissen müssen. Aber Frauen können manchmal unbegreiflich dumm sein. Und so ruft sie aus: ›Dann ist dieses Geschöpf ein Wunder!‹ Und in dem Gefühl, etwas Angenehmes zu sagen, fährt sie fort, daß nur die Augen eines Entdeckers so vieler Wunderwerke der Kunst etwas so Wunderbares im Leben hätten entdecken können. Vermutlich konnte Allègre sich jetzt nicht mehr beherrschen; vielleicht wollte er auch nur meiner Mutter die vielen ›Meister‹ heimzahlen, mit denen sie ihn zwei Stunden lang bombardiert hatte. Mit schneidender Höflichkeit regt er an: ›Da Sie schon meine armselige Sammlung mit einem Besuch beehren, möchten Sie sich vielleicht Ihr eigenes Urteil über die Inspiration zu diesen beiden Gemälden bilden. Sie ist oben und gerade beim Umkleiden nach unserem Morgenritt. Aber sie wird nicht lange brauchen. Vielleicht ist sie zunächst etwas überrascht, auf diese Art heruntergerufen zu werden, aber wenn man sie mit ein paar Worten vorbereitet, und da es ja nur um der Kunst willen …‹
Kaum je sind zwei Menschen tiefer bestürzt gewesen. Sogar Versoy gesteht, daß er seinen steifen Hut mit einem Plumps fallen ließ. Ich bin, hoffe ich, ein ehrerbietiger Sohn, aber ich muß sagen, diesen Abgang über die große Treppe hinab hätte ich erleben mögen. Ha, ha, ha!«
Er lachte höchst unehrerbietig, und dann zuckte es in seinem Gesicht.
»Dieser unerbittliche Mensch, Allègre, begleitete sie zeremoniös hinunter und half meiner Mutter mit aller Höflichkeit in die vor der Tür wartende Droschke. Kein Wort kam mehr über seine Lippen, und er machte eine tiefe Verbeugung, als die Droschke abfuhr. Meine Mutter war so konsterniert, daß sie sich drei Tage lang nicht davon erholte. Ich frühstückte fast täglich mit ihr und konnte mir gar nicht denken, was geschehen war. Dann eines Tages …«
Er blickte über den Tisch, sprang mit einem Wort der Entschuldigung auf und verließ das Studio durch eine kleine Tür in der Ecke. Dabei wurde mir plötzlich bewußt, daß ich für diese beiden Männer bisher gleichsam gar nicht existiert hatte. Die Ellbogen auf den Tisch gestützt, umklammerte Mills mit den Händen vor dem Gesicht seine Pfeife, aus der er hin und wieder eine Wolke paffte, wobei er dumpf ins Zimmer starrte.
Ich fühlte mich zu einer Frage bewogen und flüsterte: »Sind Sie mit ihm gut bekannt?«
»Ich weiß nicht, worauf er hinaus will«, antwortete er trocken. »Aber was seine Mutter betrifft, sie ist keineswegs so ätherisch. Ich wittere dahinter ein Geschäft. Womöglich die hintergründige Absicht, Allègre ein Bild für irgendwen zu entlocken. Mag sein, für meinen Vetter. Oder einfach zu erkunden, was er besaß. Die Blunts haben ihr ganzes Vermögen verloren, und in Paris gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein bißchen Geld zu machen, ohne mit etwas in Konflikt zu kommen. Nicht mal mit dem Gesetz. Und Mrs. Blunt stellte wirklich einmal etwas vor – in den Tagen des Zweiten Kaiserreichs – und daher …«
Offenen Mundes lauschte ich all diesen Eröffnungen, zu denen mir meine westindischen Erlebnisse keinen Zugang bieten konnten.
Aber Mills rief sich zur Ordnung und schloß in verändertem Ton: »Doch man kann nicht wissen, worauf sie es abgesehen hatte, je nachdem. Sie ist übrigens makellos ehrbar. Eine entzückende, aristokratische alte Dame. Nur eben arm.«
Ein Poltern an der Tür ließ ihn verstummen, und unmittelbar darauf erschien Mr. John Blunt, Hauptmann der Kavallerie im legitimistischen Heer, Koch erster Güte (zumindest für dieses eine Gericht) und großzügiger Gastgeber; er hielt zwischen den Fingern seiner Hand die Hälse von vier weiteren Flaschen Wein.
»Ich bin gestolpert und hätte beinahe alles zerschmissen«, bemerkte er beiläufig. Aber sogar ich in all meiner Unschuld glaubte keinen Augenblick an die Zufälligkeit dieses Stolperns. Während des Aufkorkens und Einschenkens herrschte tiefes Schweigen; aber keiner von uns nahm das ernst – ebensowenig wie sein Stolpern.
»Eines Tages«, hob er mit seiner merkwürdig belegten Stimme wieder an, »faßte meine Mutter den heroischen Entschluß, mitten in der Nacht aufzustehen. Dazu müssen Sie aber die Ausdrucksweise meiner Mutter kennen. Es hieß, daß sie gegen neun Uhr aufgestanden und angekleidet sein würde. Diesmal war nicht Versoy zu ihrer Begleitung kommandiert, sondern ich. Sie können sich vorstellen, wie entzückt ich war …«
Es war mir vollkommen klar, daß Blunt sich ausschließlich an Mills wandte: weniger an den ganzen Mann als vielmehr an seinen Verstand. Mills schien sozusagen ein Eingeweihter zu sein und ein wichtiger Faktor in der Rechnung. Ich konnte natürlich auf nichts dergleichen pochen. Wenn ich überhaupt etwas aufzuweisen hatte, so eine völlige Frische der Empfindungen und eine beglückende Ahnungslosigkeit, nicht so sehr darüber, was das Leben einem bieten kann (zumindest davon hatte ich einige Vorstellungen), als vielmehr darüber, was es in seinem Kern enthält. Ich wußte sehr wohl, daß ich in den Augen dieser Männer herzlich wenig bedeutete. Und doch wurde meine Aufmerksamkeit von dieser Einsicht nicht beeinträchtigt. Zwar ging es bei dem Gespräch um eine Frau, aber ich war noch in jenem Alter, da dieses Thema an sich nicht überwältigend interessant ist. Durch die Abenteuer und Schicksale eines Mannes wäre meine Einbildungskraft wahrscheinlich mehr angestachelt worden. Wenn mein Interesse dennoch nicht erlahmte, so lag das an Mr. Blunt selbst. Das Spiel seines weiß aufblitzenden Lächelns und der spürbar bittere Ton, in dem er sprach, faszinierten mich wie ein moralischer Mißklang.
So hielt ich mich denn – in dem Alter, da man an sich gut schläft, manchmal aber das Schlafbedürfnis als eine bloße Schwäche des noch fernen Altseins empfindet – mühelos wach und fühlte mich als Neuling amüsiert von allem Kontrast, den diese Persönlichkeiten, die enthüllten Fakten und ihre Moral zu den rauhen Erfahrungen meines westindischen Abenteuers bildeten. Und über all diesem schwebte eine weibliche Figur, die ich mir nur in fließenden Umrissen vorstellen konnte, bald mit der Grazie eines jungen Mädchens, bald mit dem Nimbus einer reifen Frau, aber beide Male von ganz unbestimmtem Charakter. Denn diese Männer hier hatten sie gesehen, während sie mir nur ›vorgestellt‹ wurde, nicht faßbar, in flüchtigen Worten, in dem wechselnden Tonfall einer unvertrauten Stimme.
Jetzt zeigte man sie mir im Bois de Boulogne zur frühen Stunde der ultramondänen Welt (wie ich es verstand) auf einem leichten Fuchs, zur Linken jener Henry Allègre, der einen dunkelbraunen mächtigen Gaul ritt, und auf der anderen Seite einer von Allègres Bekannten (wirkliche Freunde hatte der Mann nicht), einer jener hochvornehmen Besucher des mysteriösen Pavillons. Und so war die andere Seite des Rahmens, in dem jene Frau einem in der Perspektive der Großen Allee erschien, nicht immer die gleiche. An dem Morgen, da Mr. Blunt seine Mutter zur Befriedigung ihrer unwiderstehlichen Neugier (die er aufs höchste mißbilligte) zu begleiten hatte, erschienen zur Linken der Frau oder des Mädchens nacheinander ein Kavalleriegeneral in roten Breeches, dem sie zulächelte, und ein ehrgeiziger Politiker in einem grauen Anzug, der sehr lebhaft mit ihr sprach, sie jedoch plötzlich verließ, um sich einer Persönlichkeit anzuschließen, die einen roten Fez trug und auf einem Schimmel ritt; und dann bot sich dem verärgerten Mr. Blunt und seiner neugierigen Mutter (obwohl ich wirklich nichts Schlimmes dabei finden konnte) eine neue Gelegenheit, einen guten Blick zu erhaschen. Der dritte war diesmal der Königliche Prätendent (Allègre hatte ihn vor kurzem porträtiert), dessen herzhaftes, sonores Lachen schon lange zu hören war, ehe das berittene Trio in langsamem Schritt unmittelbar an den Blunts vorbeikam. Das Gesicht des Mädchens war gerötet. Sie lachte nicht. Ihr Ausdruck war ernst und ihr Blick nachdenklich gesenkt. Blunt gab zu, daß bei dieser Gelegenheit der bezwingende Charme und die Kraft ihrer Persönlichkeit ebenbürtig flankiert waren von jenen prächtig berittenen, paladinartigen Begleitern, von denen der eine etwas älter war als der andere, beide zusammen aber wundervoll in den verschiedenen Stadien ihres Mannestums harmonierten. Mr. Blunt hatte Henry Allègre nie zuvor aus solcher Nähe gesehen. Allègre ritt auf der Seite des Fußweges, auf dem Blunt seiner Mutter (sie hatten ihren Fiaker verlassen) pflichtschuldigst den Arm bot und sich fragte, ob dieser verflixte Kerl wohl die Unverschämtheit haben würde, seinen Hut zu lüften. Aber er tat es nicht. Vielleicht bemerkte er sie nicht. Allègre war kein Mann, der seine Blicke schweifen ließ. Sein Bart war silbern meliert, aber er selbst wirkte so fest und sicher wie ein Standbild. Nicht ganz drei Monate danach war er gestorben.
»Woran denn?« fragte Mills, der schon eine ganze Weile seine Haltung nicht verändert hatte.
»Oh, eine kleine Verletzung. Aber er siechte dahin. Sie waren nach Korsika unterwegs. Ihre jährliche Pilgerfahrt. Wohl eine Sentimentalität. Nach Korsika nämlich hatte er sie entführt – ich meine, ganz zu Anfang.«
Ein ganz leichtes Zucken ging über Mr. Blunts Gesichtsmuskeln. Ganz leicht; aber ich bemerkte es, denn ich starrte den Erzähler nach der Art einfältiger Seelen unentwegt an; ein stechender Schmerz, der sicherlich geistiger Art gewesen sein mußte. Auch schien er sich mühsam aufzuraffen, ehe er fortfuhr: »Vermutlich ist Ihnen bekannt, wie er an sie geriet?« und das in einem ungenierten Ton, der überraschend schlecht zu solch einem Weltmann und beherrschten Salonmenschen paßte.
Mills richtete sich auf, um ihn einen Moment starr anzublicken. Dann lehnte er sich in seinem Sessel zurück und fragte interessiert – ich meine, nicht neugierig, ich meine, interessiert: »Weiß das irgend jemand außer den beiden Betroffenen?« Dabei schien sich seine Ungerührtheit erneut (oder verstärkt?) wiederherzustellen. »Ich frage, weil man nie etwas darüber gehört hat. Ich erinnere mich, eines Abends in einem Restaurant einen Mann gesehen zu haben, der mit einer Dame hereinkam – einer wunderschönen Dame – so ausnehmend schön, als sei sie aus Mohammeds Paradies entführt worden. Für Doña Rita läßt sich das bei weitem nicht so prägnant sagen. Aber wenn wir schon so über sie sprechen, ich fand immer, sie sähe aus, als hätte Allègre sie im Vorhof irgendeines Tempels gefunden und ergriffen … im Gebirge.«
Ich war entzückt. Noch nie zuvor hatte ich von einer Frau auf diese Weise sprechen hören, einer wirklich lebenden Frau, nicht einer Frau in einem Buch. Es war zwar keine Poesie, und doch schien es sie den Visionen zuzuordnen. Und ich hätte mich daran verloren, hätte nicht Mr. Blunt sich höchst unerwartet an mich gewandt.
»Ich sagte Ihnen schon, der Mann ist so fein wie eine Nadel.« … Und dann zu Mills: »Aus einem Tempel? Das kennen wir.« Seine dunklen Augen blitzten: »Und muß es wirklich in den Bergen sein?« fügte er hinzu.