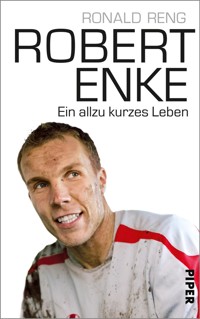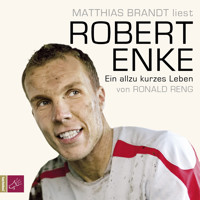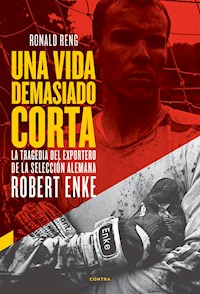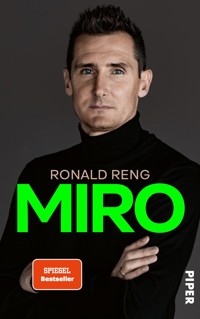15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Aufstieg, Erfolg und Scheitern dreier ganz normaler Fußballjungs Nur eines unterscheidet Fotios, Marius und Niko von ihren Freunden in der nordbayrischen Provinz: Sie spielen alle drei unwiderstehlich gut Fußball. Noch bevor sie 14 werden, nehmen die Profiklubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth sie in ihre Leistungszentren auf. Von da an führen ihre Leben in neue, unvermutete Richtungen. - Ein Buch über drei fantastische Jungs, die dribbeln wie Messi und von großen Karrieren träumen. Ronald Reng hat die drei begleitet, hat neun Jahre lang Dramatik und Glück, Einsichten und schwere Entscheidungen miterlebt, das Scheitern und Gelingen eines großes Traums.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de© Piper Verlag GmbH, München 2021Covergestaltung: Rothfos & GablerCovermotiv: Niko Reislöhner: © SpVgg Greuther Fürth | Fotios Katidis: © 1. FC Nürnberg | Marius Wolf: © 1. FC NürnbergKonvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Prolog: Der große Aufbruch
Teil 1
Was bisher geschah
(bevor so ein Typ vorbeikam und meinte, er könne über Foti, Marius und Niko ein Buch schreiben)
1 Spielen
2 Ach ja, Schule ist auch noch
3 Was ist eigentlich ein Talent?
4 Jeder Fußballer braucht einen Herrn Bischoff
5 Mein Berater checkt das ab
»Was feiern wir, Trainer?«, fragte ich.
»Das Leben, Kaiser. Wir feiern das Leben!«
Dietmar Hamann, Didi Man
Prolog: Der große Aufbruch
Das Klingelschild mit seinem Namen klebt Foti mit Honig an der Sprechanlage fest. Er hat keinen Klebstoff zur Hand. Er ist 16. Über Klingelschilder und wie man sie befestigt musste er bislang noch nicht nachdenken. Was zählt, was ihn irgendwie richtig mit Freude erfüllt, ist, dass da jetzt sein Name an der Haustür steht. Sie haben ihm, gemeinsam mit einem anderen Jungen aus der Fußballakademie, eine eigene Wohnung gegeben, wie einem Erwachsenen, direkt am Trainingsgelände, die Miete zum Großteil bezahlt vom Verein. So viel halten sie von ihm als Fußballer. Der Honig klebt übrigens richtig gut.
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss eines achtstöckigen Hochhauses aus den Siebzigerjahren und hat drei Zimmer. Es hieß, sie würden zu dritt hier wohnen, aber so wie es aussieht, teilt sich Fotios Katidis sein neues Zuhause nur mit einem anderen Jungen aus dem Fußballinternat des TSV 1860 München, Sebastian. Sebastians Nachname auf dem vom Hausmeister in Auftrag gegebenen Klingelschild wurde falsch geschrieben, Liegl statt Wiegl. Fotis Name stimmt.
Essen dürfen sie gegenüber, im Jugendhaus des TSV 1860. Sie gehen hinüber und schauen, was es gibt, und manchmal kehren sie dann wieder um, zurück in die Wohnung, um selbst zu kochen, denn »Nudeln können wir besser«, findet Foti. Kochen ist irgendwie gar nicht so schlecht, in der eigenen Küche; dieses Gefühl, für sich selbst zu sorgen, etwas Erwachsenes zu machen. Außer Nudeln können sie Rührei.
Sie haben auch schon einmal gegrillt, in dem Stückchen Garten, das zur Wohnung gehört. Den Grill kaufte Foti an der Tankstelle, vorne bei der Zufahrt zum Trainingsgelände, einen Einweggrill. Die Tankstelle ist das nächste Geschäft von ihrer Wohnung aus, falls Geschäft das richtige Wort dafür ist.
Morgens muss er noch zur Schule, er wiederholt die zehnte Klasse am Adolf-Weber-Gymnasium an der Kapschstraße, er will sich dort auch richtig anstrengen, aber eigentlich ist er wegen des Fußballs in München.
Morgens um sechs, vor der Schule, geht Foti laufen. Es gibt eine herrliche Laufstrecke, direkt vom Hochhaus weg, unter dicht belaubten Bäumen an der Isar entlang. Aber Foti ist neu in der Stadt, keiner hat ihm von der Strecke erzählt. Er läuft auf dem Rasenplatz des TSV 1860, morgens um sechs, 40 Minuten, circa 30 Runden. Der Trainer fand, Foti wiege zu viel, 73 Kilo bei 1,75 Meter. »Am besten gehst du frühmorgens auf nüchternen Magen laufen, da verbrennst du am meisten Kalorien«, sagte der Trainer. Sebi, sein Mitbewohner, geht manchmal mit Foti laufen, aus reiner Solidarität, morgens um sechs. Nach drei, vier Wochen sieht der Trainer Foti beim Umziehen zufällig mit nacktem Oberkörper in der Umkleidekabine. Er kneift ihm in die Rippen. »Da ist ja nichts, du bist ja gar nicht dick.« Allein Fotis kräftige Muskulatur ist es, die sein verhältnismäßig hohes Gewicht ausmacht. Foti hatte es schon beim Wiegen gewusst, sich aber nichts zu sagen getraut. »Dann musst du natürlich nicht mehr laufen«, sagt der Trainer.
Sechs Uhr am Morgen ist nicht gerade Fotis Lieblingszeit, doch er regt sich nicht auf, dass er sich einen Monat lang grundlos in aller Früh zum Laufen geschleppt hat. Er will die Sachen beim TSV 1860 gut machen.
Zwar hat er auch schon zu Hause im Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins gespielt, beim 1. FC Nürnberg. Aber das hier ist noch einmal eine andere Dimension. Von einem Klub nur für den Fußball in eine ferne Stadt geholt zu werden, eine Wohnung und einen richtigen Vertrag zu erhalten, ist ein Zeichen. Jetzt wird es ernst mit seinem Versuch, Fußballprofi zu werden. Jetzt geht es richtig los.
Er schreibt Marius eine Whatsapp-Nachricht. »Willst du mit uns Nudeln essen?«
Marius wohnt schon seit einem Jahr im Hochhaus, Grünwalder Straße 108, in einer Ein-Zimmer-Wohnung in einem der oberen Stockwerke. Er ist 18. Sein Weg ähnelt dem von Foti, auch er kam aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg zu 1860 München, auch er bekam eine eigene Wohnung, nur eben alles ein Jahr früher. Das macht ihn zum Kenner des Münchener Lebens.
Er kennt zum Beispiel die Verkäuferin an der Tankstelle mit Namen, Christiane. »Da gibt es fünf Semmeln für einen Euro«, sagt Marius. Im ersten Moment klingt das nicht besonders gut, Brötchen von der Tankstelle. Muss er am Essen sparen, reichen die 400 Euro im Monat nicht, die er als Spesen von 1860 bekommt? »Nein, nein«, beeilt sich Marius zu sagen, »die Semmeln an der Tankstelle sind einfach super.« Er kauft auch belegte Brötchen dort.
In seiner Wohnung hat er mithilfe des Vaters ein großes London-Bild aufgehängt, es zeigt einen der berühmten roten Doppeldeckerbusse, den 38er nach Victoria, im belebten Straßenverkehr.
Als Marius das erste Mal Fotis Wohnung betrat, staunte er. Da hing dasselbe Bild. Ihre Eltern hatten es für sie jeweils bei IKEA gekauft.
Eigentlich ist es richtig cool, eine Wohnung ganz für sich zu haben, und Marius zeigt sie den Freunden auch gerne vor. Bloß hasst er es, allein zu sein. Wenn er alleine in der Wohnung Fernsehen schaut, fängt er irgendwann immer an, daran zu denken, dass er allein ist.
Letztes Jahr, in Marius’ erstem in München, ist ein Mitspieler bei ihm eingezogen, der Leuges. Also nicht offiziell eingezogen, der Leuges kam einfach irgendwann vorbei, zum Zocken, und weil es spät wurde, blieb der Leuges auf dem Sofa über Nacht. Daraus wurde, ohne dass sie groß darüber redeten, eine Gewohnheit. Der Leuges lebt weit draußen bei seinen Eltern, in Bergkirchen, hinter Dachau, da war es sowieso angenehmer, wenn er bei Marius übernachtete, nur fünf Minuten von der Sportschule entfernt und direkt am Trainingsplatz. An den Wochenenden fuhr der Leuges dann heim, Wäsche wechseln. Diese Saison allerdings spielt der Leuges nicht mehr bei 1860, sondern beim FC Augsburg, Jungs aus den Nachwuchsleistungszentren wechseln die Vereine neuerdings, als ob sie schon Profis wären. Oft kommt der Leuges aber trotzdem noch vorbei, oder Marvin kommt, Passi, Julian. Wenn er unter vielen Freunden ist, geht es Marius gut. Er ist beliebt bei den Jungs. Der Marius ist saulustig, sagen sie, der meldet sich verlässlich, der ist auch großzügig. Er ist »der Vollbruder«. Das Wort hat Daniel Leugner erfunden, also der Leuges. »Bruder« zueinander zu sagen ist das neue Ding, es kommt aus Amerika. Vollbruder, dachte sich der Leuges, wäre die ultimative Steigerung; ein würdiger Ausdruck für den besten Bruder.
Marius schaut jetzt auch ein bisschen nach Foti. In den ersten zwei, drei Wochen in München hatte sich Foti einsam gefühlt. Die Jungs in der U19-Mannschaft beim TSV 1860 taten cool. Sie redeten darüber, »wie geil Snus wirkt, es macht dich richtig aggressiv, wenn du es vor dem Spiel nimmst«. Mit Foti redeten sie kaum. Fotis Eltern sagten ihm, »es dauert ein bisschen, bis man sich an einem neuen Ort einlebt«, und vielleicht hatten sie einfach recht. Nach ein paar Wochen bezog der erste aus der Mannschaft Foti mit ein, Felix Bachschmid war’s, die Bachstelze. Nun ruft Marius öfters an, ob Foti mitwolle, wenn die Jungs mal in die Stadt gehen, also an den trainingsfreien Tagen um 17 Uhr zum Marienplatz fahren, um zu sehen und hoffentlich auch gesehen zu werden.
Foti und Marius sehen beide, auf ganz unterschiedliche Art, verdammt cool aus.
Foti, dichtes, glänzend schwarzes Haar, freundliche Mandelaugen und offener Blick, trägt mit Vorliebe schwarze T-Shirts mit extrem weitem Ausschnitt, was den muskulösen Oberkörper betont. Yezuz steht in glitzernden silbernen Buchstaben auf dem Rücken eines Shirts. Marius, blond, hoch aufgeschossen, ein junger Meister des festen Blicks, trägt falsche Brillanten in den Ohrläppchen, einen weiten schwarzen Kapuzenpullover und eine Plastikfolie über dem Unterarm. Sie soll ein frisches Tattoo schützen. Auf seinem Kapuzenpullover ist ein Bild des toten Jesus aufgedruckt, der von einem Jünger getragen wird.
Manchmal, wenn sie Geld haben, gehen sie am trainingsfreien Nachmittag nicht nur durch die Fußgängerzone, sondern auch ins Hugo’s. Da gehen angeblich die Profis des FC Bayern hin.
Marius, der sich kümmert, bot Foti sogar an, ihm vor dem Training etwas von seinem schwedischen Kautabak abzugeben, falls er es einmal probieren wolle. »Mit Snus bist du echt bissiger in den Zweikämpfen.« Das war echt nett vom Marius, aber Foti lehnte dankend ab. Er will die Sachen gut machen.
Einmal ist er trotzdem mit den Jungs in einen Klub gegangen, es war noch die Zeit vor den Meisterschaftsspielen, der nächste Tag war trainingsfrei und er neugierig. Wobei, was heißt Klub, sie gingen ins Crash. Ein Bauernladen, sagt Foti. Es sieht dort teilweise aus wie in einem Westernsaloon, die Sitzecken aus massivem Holz. Es ist halt einer der wenigen Klubs in München, in die man auch unter 18 reinkommt. Jeder über 18 erhält ein Bändchen, um zu kennzeichnen, dass er Alkohol trinken darf. Foti lieh sich heimlich das Bändchen von Marius, damit er sich auch eine Jacky Cola holen konnte. Bloß sah dann einer der Sicherheitstypen wenig später, dass vor Marius, Foti und Felix Weber drei Jacky Cola standen, aber nur zwei der Jungs ein Bändchen trugen. Foti flog aus dem Laden.
Er stand vor der Tür in der Ainmillerstraße und wartete, was nun passieren würde. Offenbar gar nichts. Er rief Marius auf dem Handy an. »Ey, komm mal raus!«
Gemeinsam berieten sie, was zu tun sei. Dann kam ihnen eine Idee, so eine von der Art wie mit dem Honig und dem Klingelschild. Foti tauschte mit Marius die Kleidung. Das ging schon, auch wenn Marius 13 Zentimeter größer war als er, eins achtundachtzig. In Marius’ Jeanshemd und mit dessen Baseballmütze sah Foti aus wie ein anderer Mensch, und tatsächlich, der Sicherheitstyp erkannte in ihm nicht den Rausgeschmissenen wieder, als Foti wieder reinwollte.
Wenn die Eltern anrufen, wie es ihnen in München gehe, sagen Marius und Foti »alles bestens«. Es ist September 2013, der TSV 1860 München ist nach fünf Spieltagen Tabellenführer der U19-Jugend-Bundesliga Gruppe Süd/Südwest. Foti hat als Jüngster in der Mannschaft gleich im ersten Spiel ein Tor geschossen, gegen den FC Augsburg. Wie Marius spielt, »ist ja geisteskrank«, sagt der Leuges, zwei Tore und sagenhafte sechs Torvorlagen in fünf Partien, wie geht der ab, Bruder?
Den Eltern fällt bei ihren Besuchen allerdings auch auf, dass in Marius’ Wohnung jetzt nicht unbedingt jeden Tag das Geschirr aufgeräumt ist und Foti erst einmal »Berlin bei Tag und Nacht« schaut, wenn er Mathe lernen sollte. Doch das sind so Erwachsenenthemen.
Irgendwann wollen sie das ja auch besser machen, nehmen sich Marius und Foti vor.
Das sind genau ihre Themen, findet Petra Steinhöfer: Marius dazu bewegen, nicht nur Semmeln von der Tankstelle zu frühstücken, einen Zahnarzt für Foti in München finden; den Jungs helfen, ihren Alltag so zu bewältigen, dass sie optimal Fußball spielen können. Petra Steinhöfer ist 55, sie trägt Bluse und Damenmantel, aber die Jungs sagen »die Petra« zu ihr. Sie ist ihre Beraterin. Spielerberater ist die offizielle Berufsbezeichnung, wobei sie den Begriff Begleiterin für ihre Arbeit passender fände. Sie will Jugendlichen und deren Familien auf dem Weg durch die Fußballakademien der Bundesligaclubs helfen und dann natürlich, falls sie tatsächlich Profi werden, auch an der Vermittlung von gut dotierten Verträgen verdienen.
Die Idee reifte über Jahre in ihr, als sie zu Hause in Weißenburg, in Mittelfranken, von Eltern wegen der Fußballkarriere ihrer Söhne ständig um Rat gefragt wurde. Denn Petra Steinhöfer ist in Weißenburg »die Mutter des Fußballers«.
Dabei hat sie zwei Söhne und eine Tochter. Aber Markus Steinhöfer ist Bundesligaprofi. Der Einzige in den Jahren um 2010 aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, wo die Dörfer kleine Flecken bilden zwischen golden glänzenden Feldern auf rollenden Hügeln, im Süden das Altmühltal, Richtung Nürnberg die fränkischen Seen.
Nicht nur die Freunde, auch ganz entfernte Bekannte fragten Petra Steinhöfer im Supermarkt oder in der Buchhandlung nach Autogrammkarten, nach Neuigkeiten von Markus, und nicht selten wollten sie einen Tipp. Wie schaffe ihr Sohn es in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg? Sollte ihr Sohn in die Jugendelf der Spielvereinigung Ansbach wechseln, käme er dort vielleicht weiter?
Manchmal dachte Petra Steinhöfer, die sollen mich alle in Ruhe lassen mit ihrem Fußball. Immer öfter dachte sie: Vielleicht ist das meine Berufung? Eine Begleiterin für Fußballkinder in Nachwuchsleistungszentren zu sein. Vielleicht ließe sich daraus sogar ein Beruf machen?
Als mich Petra Steinhöfer 2013 nach einer meiner Lesungen anspricht, führt sie bereits seit zwei Jahren eine Agentur namens Tutor zur Beratung von Fußballspielern. Sie betreue gut zehn Jugendspieler. »Könnte man auch mal ein Buch drüber schreiben«, sagt sie, so wie das Dutzende Leute nach meinen Lesungen sagen, weil sie 18-jährig mal mit den Profis von Darmstadt 98 trainieren durften, den Ersatz-Torwart des FC Augsburg zum Nachbarn haben oder einen angeblich niemals stinkenden Fußballschuh erfunden haben.
»Ja, interessante Idee«, antworte ich Frau Steinhöfer, so wie ich das Dutzenden Leuten höflich sage.
Aber diesmal meine ich es.
So ein Projekt hatte es noch nie gegeben: eine Frau, die aus ihrer Erfahrung als Fußballmutter heraus beschließt, Spielerberaterin zu werden und speziell Jungs und ihre Familien auf deren langem Weg durch die Nachwuchszentren zu begleiten. So viele Fragen kommen mir sofort in den Sinn: Wie ist das Leben eines Jungen, der sechs von sieben Nachmittagen in der Woche dem Fußball widmet, der mit völliger Hingabe von klein auf alles einem äußerst vagen Ziel unterordnet? Wie ist es für die Familie, die Geschwister, wenn sich so viel um die Hoffnungen eines Jungen dreht? Wird einer der Jungs es wirklich zum Profi schaffen?
Die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) der Proficlubs sind in Deutschland eine junge Institution, in den Jahren nach 2000 eingeführt, um die Ausbildung von Fußballprofis zu intensivieren. Die deutsche Weltmeistergeneration von 2014 wurde in den NLZ groß, Toni Kroos, Mario Götze, Manuel Neuer. In den Nachwuchsakademien trainieren die Jugendlichen, was den Zeitaufwand und die Qualität der Übungen betrifft, wie die Profis. Bloß dass sie nebenher noch die Schule bewältigen sollen. Realistisch betrachtet ist es heute der einzige Weg, um Fußballprofi zu werden. Und davon träumen in Deutschland 2013 offenbar sehr viele, die Kinder wie deren Eltern.
Jede Gesellschaft, jede Zeit hat ihre eigenen Sehnsuchtsfiguren. Im alten Rom waren es die Feldherren, in den Sechzigerjahren die ersten Rockstars, irgendwann, vor vielen Jahrhunderten, galten angeblich sogar einmal Schriftsteller als die tollsten Typen. Ungefähr zwischen 2002 und 2018 gibt es in Deutschland anscheinend nichts Größeres, als Fußballprofi zu werden.
In den Zeitungen ist in Bezug auf die neuartigen Nachwuchsleistungszentren entweder das Lob überschwänglich, wie viel besser die Kinder dort gefördert würden als früher – oder es ist von »verlorener Jugend« und »Kinderhandel« die Rede. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Und wie wird es Petra Steinhöfer ergehen, wo das auch heute noch eine Kuriosität ist: eine Frau im Männerfußball.
Das alles könnte man ja in einem Buch herausfinden.
2013 treffe ich drei Jungen aus Petra Steinhöfers Agentur zum ersten Mal, Fotios Katidis, Marius Wolf und Niko Reislöhner, zwischen 16 und 18 Jahre alt. Ich will sie so lange begleiten, bis abzusehen ist, was aus ihnen wird, selbst wenn es Jahre dauert. Ich lerne gleich einmal, was black fashion ist. »Das ist, wenn Sie sich ganz in Schwarz kleiden und dazu als Kontrast weiße oder rote Turnschuhe tragen«, erklärt mir Foti, und ich weiß schon: Es wird super mit den dreien. Nur ob ihre Geschichte tatsächlich ein Buch hergeben wird, kann ich nicht wissen. Ihr Fußballtraum könnte schon in einem Jahr vorbei sein. Jeden Juni wieder, wenn die Fußballsaison endet, werden Kinder und Jugendliche aus den Nachwuchsleistungszentren weggeschickt, weil ihr Potenzial nicht mehr genüge. Für einige ist der Traum schon mit 13 wieder passé, für manche mit 19. Andere nehmen ihren Platz ein, bis auch die allermeisten von ihnen wieder verabschiedet werden. Von den rund 26 000 Talenten, den Auserwählten, die zwischen 2010 und 2020 in den Nachwuchsakademien der deutschen Proficlubs lernten, wurden wohl allenfalls fünf Prozent Profis. Da ist kein Junge gescheitert, niemand hat versagt, es entspricht einfach der statistischen Logik: In Deutschland gibt es nur rund 2000 Stellen für Profifußballer, um die sich Spieler aus der ganzen Welt bewerben.
Um die allerbesten zu finden, wird systematisch eine große Zahl an Talenten aufwendig ausgebildet, für die kein Bedarf vorhanden ist.
Das wissen mehr oder weniger alle, die in eines der 57 deutschen Nachwuchsleistungszentren eintreten. Bloß alle verdrängen es.
Sonntags bei Familie Reislöhner in Stopfenheim gibt es Braten mit Klößen, zum Nachtisch Erdbeeren, und für Niko legt die Mutter ein Tütchen auflösbares Magnesium hinzu. Sie hat gelernt, an den Fußball mitzudenken. Magnesium ist wichtig, damit er keine Muskelkrämpfe bekommt.
Niko überragt seine Eltern und den zwei Jahre älteren Bruder Timo um gewiss eine Kopflänge, über eins achtzig, mit 16, »keine Ahnung, wo er es herhat«, sagt die Mutter, »alle in der Familie sind klein und lebhaft, nur Niko ist groß und ruhig.« Niko hört es sich ruhig an.
Der Vater macht den Tisch für das Essen frei von seinem Papierkram. Rechnungen und Kostenvoranschläge schreibt er oft sonntags. Während der Woche kommt er nicht dazu. »Marmor, Fliesen, Naturstein, alles verlegen« steht auf dem roten Kastenwagen vor der Haustür. Die Aufträge führen ihn weit über den Weißenburger Raum hinaus, bis rauf nach Nürnberg, 70 Kilometer entfernt. Eigentlich hat er zu viel Arbeit. Albert Reislöhner lehnt trotzdem keinen Auftrag ab. »Kann ich nicht«, glaubt er, »denn dann spricht’s sich rum: Der Reislöhner hat es nicht mehr nötig.«
Über Fußball reden sie sonntags eigentlich nicht so viel, über Fußball reden sie im Auto, samstags auf der Heimfahrt von Nikos Spielen, und bestenfalls ist das Thema dann abgeschlossen für die Woche. Heute jedoch hat der Vater einen Tipp: »Du musst auch mal einen ausschwanzeln!« Ausschwanzeln bedeutet im fränkischen Dialekt offenbar ausdribbeln.
Niko lässt nicht erkennen, was er von der Empfehlung hält. Er weiß natürlich, was der Vater meint. Er solle sich manchmal etwas Verwegenes zutrauen, dem Gegner einfach davonlaufen, als Außenverteidiger ganz nach vorne. Niko ist doch so schnell, unter vier Sekunden im 30-Meter-Test, mit 16. In der Männer-Bundesliga sind einige langsamer.
Wie soll er dem Vater erklären, dass er das nicht mag, den Draufgänger markieren. Was, wenn er beim Ausschwanzeln den Ball verliert? Er fühlt sich wohl, wenn er die Vorgaben des Trainers gewissenhaft erfüllt. In bestimmten Momenten des Spiels bestimmte Positionen besetzen und bestimmte Pässe spielen.
Niko trägt ein klassisch elegantes Poloshirt zur kurzen Jeans, ohne Aufdrucke vom toten Jesus oder sonst wem.
Nun aber, Anfang August 2013, wird er mit der U17-Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth erstmals in der Jugend-Bundesliga spielen, da geht es richtig los. »Da muss ich doch mal sagen, den schwanzel ich jetzt!«, rät der Vater, also er habe früher immer wild und furchtlos gespielt, bei ihnen auf dem Dorf, bei der DJK Stopfenheim. Aus der Zeit stammt der Spitzname des Vaters, Hackl. Hackln heißt in der fränkischen Fußballsprache Foulen. Selbst seine eigene Mutter nennt Albert Reislöhner bis heute Hackl.
Nach dem Sonntagsessen geht Niko gerne auf sein Zimmer, ein eigenes Reich im Dachgeschoss. Er hat sich eine Bettdecke auf das Sofa gelegt. Falls er beim Fernsehen einschläft. Neben der Couch steht eine Elektrogitarre in ihrem Ständer. Das Gitarrenspielen hat er sich selbst beigebracht, ein paar Rocksongs, je härter desto besser, die Noten gibt es im Internet. Er hat die Gitarre seit einem Jahr nicht mehr angerührt.
Irgendwie verschwand das Musizieren einfach so aus seinem Alltag. Keine Zeit mehr, wäre wohl die einfachste Erklärung.
Um 15.31 Uhr nimmt er unter der Woche den Zug von Weißenburg. In der Regel läuft Niko direkt von der Schule zum Bahnhof. Seine Mutter hält sich zu Hause bereit, den Tank des Autos zumindest halbwegs gefüllt, darauf achtet sie. Falls der Zug mal wieder Verspätung hat oder ausfällt, springt sie ein und fährt Niko zum Training nach Fürth. Im Schnitt kommt das einmal im Monat vor. Mit dem Zug um 20.42 Uhr ist Niko zurück. Seine Freunde sieht er mittwochs und sonntags. Da ist fußballfrei.
Sie treffen sich in der Hütte beim Buckel. Überall in Stopfenheim stehen kleine Hütten, in den Gärten, am Weiher, am Sportplatz. Niko kann nicht sagen, ob das in anderen Dörfern ähnlich ist, in Stopfenheim jedenfalls baut sich jede Clique unter den Jugendlichen ihre eigene Hütte. Das sind nicht irgendwelche windschief zusammengekloppte Unterstände, sondern da werden richtige Miniatur-Häusle gebaut, mit akkurat verlegtem Holzboden, eingebauter Eckbank und Bar, das Flachdach mit Schweißband abgedichtet. Niko gehörte erst zur Hütte am Sportplatz, dann ist er zu der beim Buckel gewechselt. Da hören sie Frei.Wild. Feinde deiner Feinde ist so ein geiles Lied, »für uns gab es nur einen Weg/den wir zusammen gehen«.
Nach einem Jahr haben sie die Eckbank und Bar aus ihrer Hütte rausgeworfen, um wieder etwas zum Bauen und Basteln zu haben. Viele Jugendliche in Stopfenheim wie Nikos Bruder Timo brauchen nur ein Holz oder ein Moped sehen und müssen sofort daran herumschrauben. Niko interessiert das nicht so. Aber selbstverständlich hat er mitangepackt, bei der Hütte vom Buckel, auch wenn er nicht so oft dabei war wegen des Fußballs. Ihn stört es nicht, dass er die Freunde nur sporadisch sieht. Letztes Jahr hatte er auch eine Freundin, aus Pleinfeld, ehrlich gesagt nur, um mal eine zu haben. Eingeschränkt fühlt er sich jedenfalls nicht. Er findet eher, dass er etwas Besonderes hat mit dem Fußball. Gegen Teams wie Bayern München zu spielen und zu spüren, alle geben alles, das ist wie einen Frei.Wild-Song zu leben, »wir haben uns durchgeschlagen/durch die Straßen, durch Asphalt/und es war die beste Schule/innen warm und außen kalt«.
Im 15.31er-Zug von Weißenburg kann er Hausaufgaben machen, theoretisch. Ein gelegentlicher Mitfahrer, mit dem er dann doch lieber geplaudert hat statt gelernt, fehlt neuerdings. Foti Katidis fuhr zum Training in die Akademie des 1. FC Nürnberg, während Niko in das Nachwuchsleistungszentrum von Greuther Fürth fuhr. Wie es Foti wohl in München geht? Muss cool sein, direkt am Trainingsplatz zu wohnen, nicht mehr ewig pendeln zu müssen, sagt Niko, und vielleicht vergisst er, während er das sagt, für einen Moment tatsächlich, dass er das nicht machen möchte. Von zu Hause weggehen.
Bei Foti, im Hochhaus direkt am Trainingsplatz, gibt es ein Problem. Die Klingel funktioniert nicht. Die Jungs drücken auf das coole Klingelschild und denken, warum macht der Blödmann nicht auf. Dabei hört Foti gar nicht, dass jemand klingelt. Er sagt den Jungs, sie müssten ihm eine Whatsapp-Nachricht schicken, wenn sie vor der Haustür stünden, aber natürlich vergisst es der eine oder andere und drückt ewig auf die Klingel.
Foti und sein Mitbewohner beschließen, das Klingelschild wieder abzunehmen, bis die Klingel repariert ist. Dann wären Besucher gezwungen, sich per Whatsapp zu melden. Im Alltag, zwischen Training und Schule, vergessen Foti und Sebi die kaputte Klingel allerdings wieder, bis Fotis Mutter bei einem Wochenendbesuch sagt, »sollen wir das Schild nicht endlich mal abmontieren?« Weil sie sowieso so wenig für ihren Foti machen kann, seit er in der Ferne lebt, greift Olga Katidis selbst zu einem Messer, um das Klingelschild zu entfernen. Sie fährt damit hinter das Schild, sie drückt dagegen, aber was ist denn da los, sie muss richtig Kraft aufwenden. »Das ging ja kaum ab«, sagt sie, wieder in der Wohnung, zu Foti. »Mit was habt ihr das denn festgeklebt?«
Teil 1
Was bisher geschah
(bevor so ein Typ vorbeikam und meinte, er könne über Foti, Marius und Niko ein Buch schreiben)
1 Spielen
Olga und Ioannis Katidis interessierten sich nicht für Fußball. Oder vielleicht sollte Ioannis das im Plusquamperfekt sagen: Sie hatten sich nicht für Fußball interessiert.
Seit ihr Sohn 2009 in die Akademie des 1. FC Nürnberg eingetreten war, schaltete Ioannis bei Champions-League-Partien den Fernseher ein und sagte zu Foti und dessen Bruder Mari: »Schaut euch das doch mal an.« Da konnten sie etwas lernen, glaubte der Vater.
Wenn eine Partie von Real Madrid gezeigt wurde, setzte sich Foti schon mal dazu. Cristiano Ronaldo war der Größte. »Der macht ’ne Show«, sagte Foti. Das war, in Fotis Worten, offenbar etwas Positives, Großartiges. »Mit Show meine ich, dass er die Gegner ein bisschen verarscht mit seinen Tricks.« Ihn wunderte auch, wie Ronaldo das machte. Wenn er in der U15-Regionalliga Süd gegen die 14-jährigen des VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt spielte, schien gar keine Zeit zu sein, Tricks anzubringen. Sofort attackierte ein Gegner. Foti überrannte die Gegner, er schlug Haken, aber er machte doch keine doppelten Übersteiger wie Ronaldo, er war doch nicht irre. Niemand riskierte verrückte Tricks in der U15-Regionalliga Süd.
Vielleicht hatte der Vater recht, und man konnte vom Zusehen lernen, wann genau Ronaldo den Trick anbrachte, mit welchem Abstand zum Gegner, bei welcher Geschwindigkeit, noch in der Beschleunigung oder erst im Höchsttempo. Doch Fußballschauen war so langweilig, fand Foti.
Er wollte auch einmal so ein Trikot anziehen. Als Dreijähriger begann Marius im Team der Achtjährigen beim VfB Einberg zu spielen. Rechts hinter dem Schützen sein Cousin Philipp. [1]
Die Zeit wurde ihm ewig lang, wenn er 90 Spielminuten nur still sitzen und zuschauen sollte. Irgendwie verlor er dabei immer die Konzentration. Es passierte doch oft minutenlang nichts Interessantes in einem Fußballspiel. Ein Youtube-Video mit Ronaldos Show war etwas anderes. Da bekam er Ronaldos spektakulärste Szenen zusammengeschnitten serviert und in Zeitlupe verewigt, das schaute er sich manchmal dreimal hintereinander an. Aber ein Fußballspiel anschauen? Foti wollte Fußball spielen.
Die Wege von Niko, Marius und Foti werden sich kreuzen und trennen, wieder überschneiden und unterscheiden, aber ihr Anfang war derselbe. Da war diese unbändige Lust zu spielen.
»Ich will auch mal so ein richtiges Trikot tragen!«, rief Marius, wenn er bei der Kindermannschaft seines Cousins zuschaute. Marius’ Vater trainierte das Team bei ihnen im Dorf, also gab Martin Wolf seinem Sohn eines der bunten Trikots und wechselte Marius fortan immer für die letzten Spielminuten ein. Das Trikot für die Achtjährigen des VfB Einberg reichte Marius bis zu den Unterschenkeln. Er war drei.
Als seinem Cousin Philipp sein Borussia-Dortmund-Trikot aus der 95/96er-Saison zu klein wurde, schenkte er es Marius. Jetzt sei er Dortmund-Fan, erklärte Marius und blieb es. Mit acht oder neun begann er auf den Vater einzureden, dass er ins Stadion wolle, nach Dortmund. Natürlich wusste er nicht ganz genau, wie weit es nach Dortmund war, mit acht oder neun. Der Vater, dem diese Leidenschaft bekannt vorkam, wenn er an die eigene Kindheit dachte, fuhr mit Marius hin, 430 Kilometer eine Strecke.
Niko spielte den ganzen Nachmittag Fußball; wenn er niemanden fand, dann eben alleine in der Garageneinfahrt. Seine Mutter sagte nicht, er solle endlich mit dem Lärm aufhören, sie sagte: »Nimm auch mal den rechten Fuß«, den schwächeren. Elke Reislöhner war Fußballtrainerin. Sie trainierte die Kleinsten im Dorf. Wenn die Knirpse der DJK Stopfenheim 10:0 oder 6:2 führten, gab die Mutter Niko ein Zeichen, vom Feld zu kommen, damit auch die Schwächeren ihre Spielzeit bekamen. Das war ihr wichtig; anders als vielen Männern unter den Trainerkollegen, fand sie. »Niko, du kommst jetzt runter!«, rief die Mutter noch einmal und hatte das dumme Gefühl, dass die ganze Welt sie anstarrte, also 30 Eltern und Großeltern aus Stopfenheim. Denn Niko spielte einfach weiter. Er wollte noch das 11:0 oder 7:2 schießen.
Olga und Ioannis Katidis, in deren Leben Fußball keine Rolle spielte, meldeten Foti mit sieben oder acht Jahren beim FC/DJK Weißenburg an. Das machten Kinder doch, Fußball spielen.
In der Kindermannschaft der DJK spielten Mädchen und Jungs, mal gewannen sie 3:1, mal verloren sie 0:8, aber Ioannis dachte bei jedem Spiel dasselbe: »Hoffentlich läuft er sich nicht tot.« Foti rannte nach vorne, er konnte wahnsinnig gut mit dem Ball dribbeln. Und schon rannte er wieder zurück, um der Abwehr zu helfen. Hatte er nicht schon einen ganz roten Kopf, oder kam es dem Vater nur so vor? Foti selbst kam nicht auf die Idee, dass er sich überanstrengen könnte. Nur so machte Fußball doch Spaß. Wenn er überall war.
Der Vater hatte kein Interesse an Fußball gehabt, jedoch ein Gespür für Bewegung und Talent. Seine Jugend, zu Hause in Griechenland, hatte er zu einem gewissen Teil in Schwimmbädern verbracht. Fünfmal die Woche trainierte er, 240 Bahnen pro Training, das machte sechs Kilometer am Tag Kraul, Brust, Rücken, Delfin. Mit dem Blick des ehemaligen Leistungssportlers war Ioannis klar, dass Foti auch auf einem anderen Niveau Fußball spielen könnte.
Eine Jugendelf des FC Bayern München ist zu einem Turnier in Stopfenheim zu Gast, und dieser 16-Jährige schräg neben Niko soll nicht schlecht sein. Thomas Müller heißt er. Aber Niko, mit der Kapitänsbinde am Arm, ist nicht beeindruckt. [2]
In Deutschland kann ein Fußballtalent fast nicht mehr übersehen werden. Selbst in den abgelegensten Landkreisen gibt es mittlerweile Trainingsstützpunkte des Deutschen Fußball-Bundes, engagierte Amateurklubs und private Fußballschulen, die talentierte Kinder sichten und fördern. In diesem Netz begannen die Nachwuchsleistungszentren der Proficlubs nach 2006 mit einer nie gekannten Dringlichkeit nach Talenten im jüngsten Alter zu suchen; just zu der Zeit, als Niko, Marius und Foti zwischen zehn und zwölf waren.
Profis selbst auszubilden war der letzte Schrei im deutschen Fußball geworden. Die Weltmeisterschaft 2006, als die deutsche Nationalelf mit etlichen jungen Spielern aufregenden und erfolgreichen Fußball gespielt hatte, hatte die Vereinsmanager emotional gepackt: Sie wollten ihre eigenen Schweinsteigers und Podolskis. Der Fußballboom tat ein Übriges: Es floss so viel frisches Geld in den Sport, dass sich die Vereine eine aufwendigere Jugendarbeit leisten konnten. Die Nachwuchsleistungszentren der großen Vereine wie Bayern München, VfL Wolfsburg oder Bayer 04 Leverkusen verfügten um 2010 über Jahresbudgets von drei, vier Millionen Euro; so viel wie mancher schwächere Zweitligist für seinen gesamten Profikader. Es wurden Internate gebaut, Physiotherapeuten eingestellt, mit neuen Lehren wie Life-Kinetik experimentiert und mit der Konkurrenz um Zwölfjährige gekämpft.
In diesem Umfeld des grassierenden Talentefiebers gerieten Niko, Marius und Foti mit ungefähr zwölf Jahren unvermeidlich in das Blickfeld der regionalen Proficlubs 1. FC Nürnberg und Greuther Fürth. Niko verfügte über eine außergewöhnliche Schnelligkeit und spielte, was in dem Alter extrem selten war, mit beiden Füßen nahezu gleich gut. Das hatte ihn seine Mutter ja immer üben lassen. Foti war einfach nicht vom Ball zu trennen. Marius sah Dinge auf dem Fußballfeld, die sonst niemand sah, oder wie kam er auf die verwegene, fabelhafte Idee, den Ball genau an die Stelle zu passen, wo eben noch niemand, aber nun der Mitspieler völlig frei stand?
Der 1. FC Nürnberg bat Marius 2007 in seine Akademie. Um Niko und Foti buhlten Greuther Fürth und Nürnberg.
Fürth lud Foti ein, ein Spiel ihrer Zweitligamannschaft im Stadion anzuschauen. Nürnberg lud ihn daraufhin ein, Balljunge bei einer Profipartie zu sein. Sie wussten ja nicht, dass er Zuschauen langweilig fand. Foti entschied sich schließlich für Nürnberg, weil das der Verein war, über den die Kinder in Weißenburg redeten.
Niko entschied sich für Fürth. Die hatten früher angefragt. Außerdem hatten die Nürnberger in einem Spiel gegen seine Kindermannschaft ihren Ausgleich in letzter Spielminute so triumphierend gefeiert, dass er beleidigt war. Zu den Affen ging er nicht, sagte Niko, natürlich nur zu seiner Mutter, nicht zum Nürnberger Jugendtrainer.
Ehrlich gesagt waren Niko die Spielvereinigung Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg bis dahin ziemlich egal gewesen. Das waren doch bloß irgendwelche Proficlubs, die häufig verloren. Bayern München, davon träumte er!
Ein paar Mal war der Vater mit ihm nach München gefahren. An der Kirche in Stopfenheim startete jeden zweiten Samstag der Bus der Red Dogs. Die Erwachsenen luden Bierkästen ein, alle trugen Rot, rote Schals, rote Nylontrikots, viele auch rote Gesichter. Offenbar waren die Red Dogs der zweitgrößte Bayern-Fanklub Deutschlands, hatte man Niko jedenfalls so gesagt, mit über 5000 Mitgliedern, wo doch Stopfenheim nur 844 Einwohner hatte. Auf der zweistündigen Busfahrt lauschte er den Gesängen, »so wie einst Real Madrid/ein Team wie aus Granit«, und im Stadion blieb sein Blick gebannt an Zé Roberto hängen. Wie elegant Zé Roberto den Ball annahm und den Fuß im Moment des Aufpralls ganz leicht zurückzog, damit der Ball ganz nah bei ihm blieb.
Als Niko mit 13 erfuhr, dass Nürnberg und Greuther Fürth ihn in ihre Nachwuchsakademie aufnehmen wollten, vermischte sich das für ihn schlagartig mit dem FC Bayern. Er träumte nicht konkret, ich beginne bei Fürth, und wenn ich dort hervorsteche, holen mich vielleicht die Bayern. Er fühlte nur, in ein Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins aufgenommen zu werden, das war der Traum. Dort spielten die, die Profis wurden.
Ansonsten dachte er, ähnlich wie Foti und Marius, dass er in einem Nachwuchsleistungszentrum einfach weiter Fußball spielen würde, so wie sie es in ihren Dorf- und Kleinstadtclubs getan hatten. Was sollte Fußball denn anderes sein als ein Spiel?
2 Ach ja, Schule ist auch noch
Mist.
Seine Mutter wollte wissen, ob er schon den Englischtest zurückbekommen hatte.
Bevor Marius überhaupt überlegen konnte, was er sagen sollte, sagte er schon: »Nein, noch nicht.«
Die Schuldgefühle stellten sich augenblicklich ein, warum bekam man vom Lügen bloß immer so einen blöden roten Kopf? Aber das ging vorüber. Das schlechte Gefühl ließ sich verdrängen, sobald es zum Fußballtraining ging.
Im Auto auf dem Weg zum Training sollte er im Idealfall für die Schule lernen. Marius redete meistens mit seinem Mitspieler Andi Baier über die Bundesliga oder über ein neues Cristiano-Ronaldo-Video auf Youtube.
Haarschnitte waren auch gelegentlich ein Thema. Marius setzte in dem Bereich die Trends. Der Friseursalon, den seine Mutter bei ihnen zu Hause betrieb, übte eine magische Anziehungskraft auf ihn aus. Mal probierte er alle Geltöpfchen durch, mal bat er die Mutter, ihm Streifen in die Haare zu rasieren. 13 Jahre später wird sich ein Mitspieler von damals noch daran erinnern, wie er Marius mit zwölf das erste Mal sah. Die Haare! »Die waren weiß gefärbt«, sagt Pascal Köpke.
Niemand, weder die Jungs noch die Eltern der Mitspieler beim 1. FC Nürnberg, wäre auf die Idee gekommen, dass Marius verschlossen war; im Gegenteil. Er redete ja auch über alles, bloß über Probleme nicht. Das ging irgendwie nicht. Über verhauene Englischtests oder andere unangenehme Themen sprach er mit niemandem. Er war einer, der die Dinge mit sich selbst ausmacht, fand Marius.
Am Abend, zurück vom Training, stopfte die Mutter die Wäsche in die Waschmaschine, damit Marius auch am nächsten Tag frische Trainingskleidung hatte. Aus einer Hosentasche ragten ein paar zusammengefaltete DIN-A4-Blätter. Was war das jetzt wieder, es reichten schon die Papiertaschentücher, die sie manchmal aus der Wäsche fischen musste.
Einen Moment starrte die Mutter perplex auf den Englischtest. Was machte der in einer Hosentasche? Warum war der überhaupt hier, Marius hatte doch gesagt, sie hätten die Schularbeit noch nicht zurück.
Dann glaubte sie, alles zu verstehen. Marius wollte ihr die Fünf in Englisch nicht verschweigen, aber er schaffte es nicht, den Eltern davon zu erzählen. Also fand er innovative Wege, ihr die Schularbeit zukommen zu lassen.
Im Februar 2009, drei Monate vor seinem 14. Geburtstag, wurde Marius von Herrn Rektor Bänisch an der Realschule Neustadt bei Coburg ins Büro gebeten. Angesichts seiner Noten im Halbjahreszeugnis stelle sich die Frage, ob Marius das zweite Halbjahr überhaupt noch in der achten Klasse bestreiten wollte oder nicht besser jetzt schon eine Klasse zurückgehen sollte. Der Rektor bat Marius, die Lage mit seinen Eltern zu besprechen. Marius kam nach Hause und erklärte seinen Eltern, er habe entschieden, die Klasse zu wiederholen. Er hatte das schon mit sich selbst ausgemacht.
Die Probleme in der achten Klasse waren in seinem zweiten Jahr beim 1. FC Nürnberg entstanden. Der Zusammenhang ließ sich nicht übersehen.
Marius war, ganz anders als seine Schwester, nie ein begeisterter Schüler gewesen. Aber richtige Schwierigkeiten hatte er bis zur siebten, achten Klasse nicht gehabt; bis 25 Stunden die Woche für das Training, die Spiele, die Fahrten draufgingen.
Marius war ein Jahr älter als Foti und zwei Jahre älter als Niko. Beziehungsweise Marius war ein 95er, Foti ein 96er und Niko ein 97er. In den Nachwuchsleistungszentren klassifizierten sie die Jungs stets nach ihren Geburtsjahrgängen. Marius machte zwangsläufig viele Erfahrungen als Erster von den dreien. Sie waren ins Nachwuchsleistungszentrum gegangen, um es als Fußballer zu schaffen, aber schnell wurde klar, dass damit noch eine andere Frage verbunden war. Würden sie die Schule noch schaffen?
In allen drei Fällen schien offensichtlich, dass der Fußball sie schulisch in besondere Schwierigkeiten brachte. Es fehlte ihnen schlichtweg Zeit zu lernen. Sie standen gegen 6.45 Uhr auf, gingen zur Schule, aßen zu Mittag, fuhren zum Training, und waren gegen 20, 21 Uhr wieder zu Hause.
Ganz genau war weder den Jungs noch ihren Eltern klar gewesen, worauf sie sich da eingelassen hatten. Es hatte einfach toll geklungen: für Nürnberg oder Fürth spielen.
Foti und Niko kämpften noch Jahr für Jahr erfolgreich gegen das Sitzenbleiben an.
Beide waren die Ersten in ihren Familien, die aufs Gymnasium gingen. Niko hatte das unbedingt gewollt. Foti hatte es halt einfach gemacht.
Sein Ziel hatte Foti schon mit 12, 13 klar definiert: In allen Fächern mit minimalem Aufwand eine Vier erreichen (und in Sport natürlich eine Eins). Niko versuchte, in allen Fächern so gut wie möglich zu sein, aber gut genug zu sein war auf dem Gymnasium nicht so einfach, das hatten ihm die Eltern schon vorher gesagt. Doch deswegen wollte er es umso mehr schaffen. Er nahm Nachhilfeunterricht beim Lemmermeier Simon, einem vier Jahre älteren Nachbarjungen. Die Reislöhners nannten Personen nach alter bayerischer Tradition ordentlich mit dem Nachnamen zuerst. Vom Lemmermeier Simon fuhr die Mutter Niko für die Französisch-Nachhilfe zu einer Französin nach Weiboldshausen. So war der Mittwochnachmittag ausgefüllt, sein fußballfreier Tag.
Die Schule war das Wichtigste. Das hatten die Familien Katidis, Reislöhner, Wolf vom ersten Kennenlernen an unzählige Male von den Trainern und Planern im Nachwuchsleistungszentrum gehört. Die Schule ging immer vor.
»Die Schule interessiert bei Greuther Fürth keine Sau«, stellte Albert Reislöhner nach Nikos erstem Jahr in der Fußballakademie fest. »Es hieß, die Zeugnisse würden vom Verein kontrolliert. Die Zeugnisse? Die wollte nie jemand sehen. Spätestens nach einem Jahr war mir klar, es geht nur um die Leistung auf dem Fußballplatz, und die Schule hat sich nach dem Sport zu richten.«
Foti und Marius mussten beim 1. FC Nürnberg sehr wohl ihre Zeugnisse den Trainern zeigen. Wie diese dann mit schlechten Noten umgingen, ob der Trainer sie weglächelte oder den Spieler regelmäßig anspornte, in der Schule zuzulegen, war individuell sehr unterschiedlich. Undenkbar war, dass ein Junge ein Training ausfallen ließ, um für die Schule zu lernen. »Wenn du gesagt hättest, er muss für die Nachhilfe einmal die Woche zu Hause bleiben, dann hätte er am Samstag nicht gespielt«, sagt Elke Reislöhner. »Deswegen haben wir das nie auch nur angefragt, niemals! Denn wenn ich den Jungen daheim lasse, dann strafe ich ihn, dann nehme ich ihm das Spiel am Samstag.« Sie hatte eine Erfahrung gemacht, die ihr reichte. Zu Beginn von Nikos zweitem Jahr in Fürth fuhren sie wie jedes Jahr während der bayerischen Schulferien in den Urlaub nach Bulgarien, 540 Euro die Woche für ein Familienzimmer, das war unschlagbar. In den ersten drei Spielen der Saison saß Niko auf der Ersatzbank, weil er in der Vorbereitung zwei Wochen in die Ferien gefahren war. Andere hatten sich in der Zeit im Training angestrengt. Darüber konnte man sich aufregen, fühlte Elke Reislöhner, aber man fuhr besser damit, wenn man es als gegeben hinnahm. Der Fußball im Nachwuchsleistungszentrum, der Traum der Jungen, verlangte völlige Hingabe.
Manche Leistungszentren wie das des TSV 1860 München gaben sich selbst die Regel vor, kein Kind mit einer Anfahrt von über 45 Minuten aufzunehmen. Kein Leistungszentrum schaffte es, diesen guten Vorsatz einzuhalten. Die Angst, ein Talent an die Konkurrenz zu verlieren, war größer. Foti, Niko und Marius benötigten für ihre Fahrten zum Training in Nürnberg und Fürth allesamt über eine Stunde. Für Kinder aus der Provinz wie sie gab es nur die zwei Möglichkeiten: entweder die lange Anfahrt. Oder den Fußballtraum vergessen.
Das Gefühl, abgelegen zu leben, hatte Marius’ Vater in der eigenen Jugend verinnerlicht. »Drei Seiten um uns herum waren zu«, sagt Martin Wolf. Die Grenze zur DDR lag wie ein Hufeisen um Coburg und die umliegenden Dörfer wie Einberg. Ein Freizeitvergnügen war es, mit den Freunden zur Grenze zu radeln und zu schauen, wie die DDR-Grenzsoldaten sie anschauten, durch ihre Ferngläser. Daran dachte er manchmal: dass er seinen Kindern Marius und Maren doch mehr Möglichkeiten bieten wollte, als er damals für sich gesehen hatte. Von Einberg zum Training nach Nürnberg waren es 115 Kilometer, 75 Minuten eine Strecke, seit die Autobahn fertiggestellt war.
Heike Wolf nahm an manchen Nachmittagen neuerdings keine Kunden mehr in ihrem Friseursalon an. Da musste sie Marius nach Nürnberg fahren. Ihr Mann war oft auf Montage. Als Maschinentechniker stellte Martin Wolf mit seinen Kollegen riesige Fräsmaschinen auf, irgendwo in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Natürlich schneite es immer genau dann heftig in Franken, wenn er unterwegs war, und Heike zu Hause alles alleine regeln musste, die Arbeit, den Haushalt, die Kinder, die Trainingsfahrt. Um fünf Uhr stand Heike Wolf an solchen Tagen auf. Bevor sie den Kindern das Frühstück machte, musste sie die Einfahrt zum Haus von dem ganzen Schnee freischippen. Die Kunden, die zu ihr in den Friseursalon kamen, wollten schließlich ordentlich parken können. Die Kunden erwarteten, dass Heike Wolf sie freundlich und entspannt bediente.
Zum Glück wohnte ein Mitspieler, Andi Baier, in der Nähe, so konnten sich die Familien beim Fahren abwechseln. Marius’ Opa Rolf sprang auch ein, sooft es sein Schichtdienst als Pförtner beim Porzellanfigurenhersteller Göbel zuließ.
Siggi, der Vater von Andi Baier, war der Briefträger vom Frankenwald. Gerade in den Wochen vor Weihnachten schaffte er es manchmal nicht, Andi rechtzeitig um 15 Uhr zum Treffpunkt beim ALDI in Ebersdorf zu bringen. Er war noch mit seinen Briefen und Päckchen unterwegs. Opa Rolf rief an, »Siggi, wo biste?« Erst in Neufang? Na, dann fuhr der Opa lieber selbst noch durch die dichten Wälder und ewigen Hügel zum Haus der Baiers nach Friesen, um Andi abzuholen. Bloß die 20 Minuten waren weg, die musste er jetzt aufholen. Wenn sie zu spät kamen, wurden die Jungs bestraft, wer zu spät zum Training kam, saß am Samstag auf der Ersatzbank. Das hatte Opa Rolf einmal erlebt, dabei war es doch gar nicht die Schuld von Marius und Andi gewesen, sondern die der Post.
Sie würden auf der Rückfahrt für die Schule lernen, sagten Marius und Andi auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt, nach der körperlichen Anstrengung überwältigt von der Wärme im Wagen, schliefen sie ein.
Aber wen interessierte wirklich, ob eine Drei oder Vier in Geschichte im Zeugnis stand, wer wusste überhaupt noch zwei Monate nach der Zeugnisvergabe, ob er eine Drei oder Vier in Kunst hatte? Was interessierte, war das Spiel gegen Jahn Regensburg nächsten Samstag, fanden Marius, Foti, Niko. Wenn die Eltern ganz ehrlich waren, schlich sich dieses Denken bei ihnen mit der Zeit im Nachwuchsleistungszentrum auch ein. Alles war gut, wenn es im Fußball richtig und in der Schule halbwegs lief.
Er würde sich in der Schule auch bessern, versprach Marius, wirklich. Auf den Fahrten nach Nürnberg fragten Andi Baier und er sich nun Englischvokabeln ab.
Zumindest für ein paar Tage.
3 Was ist eigentlich ein Talent?
Martin Wolf fragte sich im Winter 2008, ob es auch Allergien gegen Wiener Würstel gab. Dann war er nämlich gerade dabei, eine zu entwickeln. Er konnte keine Wiener mehr sehen! Aber er aß schon wieder ein Paar. Es gab nichts anderes bei den Hallenturnieren, bei denen Marius mit der U13-Mannschaft des 1. FC Nürnberg Wochenende für Wochenende startete. Jetzt war er einmal nicht auf Montage und verbrachte jeden Sonntag in stickigen Turnhallen, das war auch eine Art Bohrinsel-Aufenthalt. Nach sieben Stunden in der Turnhalle fühlte sich Martin Wolf erschöpft, ohne etwas getan zu haben, und dennoch zog es ihn am nächsten Sonntag fasziniert und glücklich wieder in die nächste Halle. Wenn die Jungs samstags frei hatten, meldete sich Marius freiwillig als Balljunge für das Profispiel beim 1. FC Nürnberg. »Jetzt müssen wir schon wieder nach Nürnberg fahren!«, rief der Vater entsetzt. Natürlich fuhr er Marius hin.
Fußball hatte Martin Wolf immer begeistert. Die Montage, als sie bei SMS Demag in Mönchengladbach eine Walzmaschine aufstellten, war sein Lottogewinn gewesen. Nach der Arbeit konnten sie zu den Heimspielen seiner Borussia auf dem Mönchengladbacher Bökelberg gehen. Seinen eigenen Sohn so fein Fußball spielen zu sehen war noch einmal eine unerwartete Steigerung.
Zu sehen, wie Kinder etwas außergewöhnlich beherrschten, zu sehen, wie das eigene Kind etwas unheimlich gut konnte, war gigantisch. Opa Rolf gelingt es am besten, das Gefühl in Worte zu fassen: »Dein Körper spielt immer mit. Wenn du Marius spielen siehst, spürst du das im ganzen Körper.«
Mit ihrem Talent hatten Marius, Foti und Niko in ihren Heimatvereinen anstrengungslos, wie gottgegeben herausgeragt. Das erste Spiel im Nachwuchsleistungszentrum war daraufhin ein Schock, sagt Elke Reislöhner. »Die sind hier ja alle mehr oder weniger genauso gut!«, ging ihr auf. »Da brauchte ich schon einen Moment, um mich daran zu gewöhnen.«
In dem Augenblick, als Nikos Mutter erstmals die vielen Begabungen in einer einzigen Akademiemannschaft sah, offenbarte sich die große Frage der modernen Talentsuche. Wie erkennt man die, die Profi werden?
»Bei 14-Jährigen und Jüngeren kannst du das in der Regel gar nicht erkennen«, sagt Wolfgang Schellenberg. Er trainierte 2010 beim 1. FC Nürnberg die U15 mit Marius.
Der größte Anhaltspunkt bei der Sichtung eines Talents war dessen Ballspiel. In welcher Schnelligkeit konnte ein Kind sauber die Grundtechniken am Ball ausführen, stoppen, passen, dribbeln, flanken, schießen. Jeder kennt aus seiner Kindheit den einen Jungen im örtlichen Amateurfußballclub, der pro Spiel vier oder mehr Tore schoss. Oft kamen diese vermeintlich herausragenden Kinder für die Profiakademien jedoch nicht infrage. Denn sie erzielten ihre Tore vielleicht mehr mit Kraft als mit verschiedenen Schusstechniken, bei ihren Dribblings waren sie schnell, konnten den Ball allerdings nicht eng am Fuß führen. Das Spiel aber würde mit jeder Altersstufe und jeder Leistungsklasse schneller werden. Wer in den technischen Bewegungsabläufen nicht brillant war, würde irgendwann vom Tempo überfordert werden.
Alle Kinder in den Akademiemannschaften brachten motorisch beim Ballspiel enorme Anlagen mit, deswegen waren sie ausgewählt worden. Doch um ein Profifußballer zu werden, waren zudem so viele andere Talente nötig, Spielintelligenz, Geschwindigkeit, Athletik, Durchsetzungsvermögen, mentale Wettkampfhärte, Lernfähigkeit und einiges mehr. Diese Komponenten würden sich, anders als die Grundtechniken, erst in den Jahren zwischen 14 und 21 entwickeln. Das hieß, man nahm ein Kind wegen seines Potenzials in ein Nachwuchsleistungszentrum auf und hatte wenig Ahnung, was herauskam. Welcher Junge würde sich in den nächsten fünf Jahren wie stark weiterentwickeln, wer würde stagnieren? Und wer würde, nachdem er einmal stagnierte, plötzlich einen Riesensprung machen? Das war die reine Ungewissheit.
»Deshalb ging es für mich als U15-Trainer immer nur darum, möglichst viele Spieler weiterzubringen«, sagt Wolfgang Schellenberg. Foti und Niko waren bis zur U15 immer unter den Besseren ihres Teams, die konnten die Trainer einfach laufen lassen, aber bei Marius zeigte sich, was Schellenberg meint.
Hätte Schellenberg seine U15 wie ein Profitrainer knallhart nach aktuellem Leistungsvermögen aufgestellt, wäre Marius’ Platz sehr oft die Ersatzbank gewesen. Er ließ sich als Außenstürmer öfters von robusten Abwehrspielern Richtung Seitenauslinie abdrängen, wo er keine Gefahr war. Aber das war erklärbar. Marius war ein Junge unter Heranwachsenden, 1,65 Meter gegen 1,79 Meter. »Marius war in meiner Mannschaft wahrscheinlich der Kleinste. Natürlich hatte er deswegen Probleme, sich durchzusetzen«, sagt Schellenberg. »Aber wusste ich, ob er sein Leben lang klein und schmächtig blieb und deshalb athletisch im Spitzenfußball keine Chance haben würde – oder ob er in zwei Jahren einen Riesenwachstumsschub bekam? Was ich sah, war sein Potenzial: Fußballerisch gehörte er zu den Besten, und zwar nicht nur in puncto Ballbehandlung. Der hatte Witz auf dem Platz, der war frech, der traute sich trotz seiner Schmächtigkeit was.«
So ließ Schellenberg ihn immer wieder spielen. Der Trainer hatte einen Stamm von sechs, sieben Jungen, die praktisch durchweg spielten, weil sie ihre Anlagen vehement auf dem Platz zeigten, Niklas Stark, Stephan Schreiber, Patrick Erras hießen die auffälligsten. Gleichzeitig gewährte Schellenberg einer zweiten Gruppe von acht bis zehn Jungen durch Ein- und Auswechslungen ausreichend Spielpraxis, damit möglichst viele von ihnen sich verbesserten, auch wenn ihre Anlagen oft nur zu erahnen, noch nicht voll zu sehen waren. Zu dieser Gruppe gehörte Marius.
Alle U15-Trainer sagen, das Resultat interessiert mich wenig, mich interessiert die Weiterentwicklung der Jungs. Es wird erwartet, dass sie das sagen. Wolfgang Schellenberg musste tatsächlich nicht auf das Resultat achten. Denn seine U15 mit Marius gewann sowieso immer. Sie begannen die Saison 2009/10 mit einem 15:0 über den FC Amberg und beendeten sie mit einem 9:0 über den 1. FC Haßfurt. 24 Siege und zwei Unentschieden standen in der Bayernliga Nord zu Buche, der höchsten Spielklasse für 14-Jährige. Für viele Ausbilder im erwachten deutschen Nachwuchsfußball machten solche eindeutigen Spiele keinen Sinn mehr. Die Mannschaften der Profiakademien waren den besseren Amateurteams ihrer Region hoffnungslos enteilt. Ab der folgenden Saison wurde deshalb in der U15 eine weitergehende höchste Spielklasse eingeführt, die Regionalliga Süd, in der Foti und Niko dann gegen lauter andere Profiakademien spielen würden. Wolfgang Schellenberg aber nannte es »ein Glück«, dass seine U15 noch in einer schlechteren Spielklasse antrat, der Bayernliga Nord. »Ich konnte frei, ohne Angst vor einer Niederlage, überlegen, wen kann ich wie fördern, ich konnte die momentan vermeintlich Schwächeren unbeschwert einsetzen oder Marius zum Beispiel auch mal als Mittelstürmer ausprobieren.« Wenn etwas nicht funktionierte, gewannen sie eben mal nur 2:1 statt 9:0.
Sie waren selbst schuld, dass niemand mehr die potenziellen Profis unter den 14-Jährigen in einer Akademiemannschaft eindeutig identifizieren konnte, ging es Wolfgang Schellenberg auf. Sie hatten das Training und Scouting in den Nachwuchsleistungszentren so sehr verbessert, dass der Abstand zwischen den herausragenden und den sehr guten Talenten geschmolzen war. Es gab nun eine Masse Talente, die alle irgendetwas Besonderes hatten. »Ich weiß noch, wie ich 20 Jahre zuvor als junger Mann aus Burghausen nach München kam und zum ersten Mal ein E-Jugendspiel des FC Bayern sah«, erzählt Schellenberg: »Da waren zwei Zehnjährige, Thomas Hitzlsperger und Daniel Jungwirth, da dachte ich: Boah, wenn ich solche Spieler einmal trainieren könnte! Solche Talente hatte ich in Burghausen noch nie gesehen, das war eine andere Welt. Aus heutiger Sicht muss ich sagen: Die stachen natürlich auch deshalb so heraus, weil das allgemeine Trainingsniveau noch viel niedriger war, Talent allein also viel mehr den Unterschied machte.«
Ab und an gab es diese Hitzlspergers vom anderen Stern auch noch 2010. Beim VfB Stuttgart spielte ein 96er, also Fotis Jahrgang, von dem alle Kinder redeten, wenn sie sich nur einmal mit ihm gemessen hatten. Er war ihr persönlicher Ronaldo. Er spielte schon bald bei den Älteren, also in Marius’ Jahrgang, um nicht unterfordert zu sein, und war trotzdem zu gut. Die Ballannahme, der Antritt, der Schuss, alles erledigte er in einer höheren Geschwindigkeit. »Timo Werner«, sagte sich Fotis Vater. »Den Namen werde ich nicht vergessen. Der wird Profi.« Da hatte er ihn einmal gesehen, einen 13-Jährigen bei einem Turnier in Blaustein.
Timo Werner war die Sensation, die Ausnahme. Wer ansonsten versuchte, die besonderen Talente in der Akademie eines Bundesligisten herauszustellen, sagte etliche Male »und der natürlich auch noch, und der …«.
Von den 26 000 Talenten, die in einem Jahrzehnt die 57 deutschen Nachwuchsleistungszentren frequentierten, waren bis zur U15 rund 10 000 schon wieder verabschiedet worden. Ihre Zeit in den Akademien hatte von acht bis zwölf oder elf bis dreizehn Jahre gedauert. Vermeintlich Talentiertere ersetzten sie. Mehr als einmal wird es eine falsche Entscheidung gewesen sein, weil niemand voraussagen konnte, wie sich der weggeschickte 13-Jährige entwickelt hätte. Der beste Trainer konnte es nur schätzen, annehmen.
Aber das interessierte Niko, Marius und Foti nicht. Sie waren die, die dabei waren.
4 Jeder Fußballer braucht einen Herrn Bischoff
Im Training wurde Marius zum Einäugigen. Der neue Trainer verteilte Augenklappen, ganz in Schwarz, so wie sie Piraten in Spielfilmen oder Augenpatienten in Krankenhäusern trugen. Das eine Auge bedeckt, sollten die Jungs das Torschusstraining absolvieren.
So schulten sie nicht nur die Schusstechnik, sondern gleichzeitig ihre Wahrnehmung, erklärte ihnen der Trainer. Wussten sie überhaupt, dass jeder Mensch ein Führungsauge hatte? Ein Auge wurde faul, weil das andere die Hauptaufgabe des Sehens übernahm. Wenn sie das Führungsauge mit der Klappe verdeckten, zwangen sie das faule Auge zur Arbeit. Beim Fußball mussten sie ständig aus den Augenwinkeln registrieren, was um sie herum passierte, peripheres Sehen hieß das. Dazu brauchten sie zwei starke Augen.
Die Idee für solche Trainingsformen stammte aus den Rehabilitationsprogrammen von Schlaganfallpatienten. Therapeuten hatten nach Übungen gesucht, die Gehirn und Motorik gleichzeitig forderten. Ein erfindungsreicher Fußballlehrer aus München, Horst Lutz, hatte aus der Schlaganfalltherapie Trainingsübungen für Fußballer abgeleitet. Life-Kinetik taufte er sein Konzept.
Zum Beispiel sollten die Spieler, während sie mit dem Fußball dribbelten, gleichzeitig einen Tennisball im hohen Bogen von einer Hand in die andere werfen, immer hin und her, im vollen Lauftempo. So lernten sie zu dribbeln, ohne auf Ball und Fuß zu achten. Im Spiel hätten sie den Blick frei für Gegner und Mitspieler.
Es kam Marius vor, als ob ihr neuer Trainer in der U16-Mannschaft des 1. FC Nürnberg, Michael Bischoff, Dutzende solcher neuen, aufregenden Ideen mitbrachte.
»Mexiko!«, rief der neue Trainer Marius im Spiel zu. »Mexiko!«, schrie Niklas Stark, ihr Kapitän, damit es alle hörten.
Was war jetzt los? Was war mit Mexiko?, konnten sich Gegner und Zuschauer nur fragen.
Marius und seine Angriffspartner jagten da schon wie verrückt Ball und Gegner in deren Abwehr. So wie es die Mexikaner bei der Weltmeisterschaft 2010 getan hatten.
Mexiko war ihr Codewort, um ein plötzliches, unbarmherziges Pressing zu starten.
Der neue Trainer hatte etliche Geheimlosungen eingeführt. »Bremen!« hieß »Achtung, die spielen auf Abseits!«, »Messi!« hieß, »dreh dich mit dem Ball am Fuß, du hast keinen Gegner im Rücken«.
Marius spürte mit 15 zunächst einfach nur, welche große Freude das Training bei Michael Bischoff machte. Die tiefere Erkenntnis kam ihm erst Jahre später, als er mehr Erfahrungen gesammelt hatte. Was ihm in der Saison 2010/11 widerfuhr, ist das größte Glück für jeden Fußballer. Du knüpfst eine Beziehung zu einem Trainer, die dich aufblühen lässt.
Vor allem eine Sache schien bei Michael Bischoff in der U16 anders als bei all den qualifizierten Trainern zuvor. Er zeigte ein ungekanntes Interesse an jedem einzelnen Spieler; als ob er nicht nur eine Mannschaft trainierte, sondern sich als Individualförderer für jeden Einzelnen sah. »Der Herr Bischoff hat sich tiefer mit einem beschäftigt«, sagt Marius’ Freund aus der Fahrgemeinschaft, Andi Baier. »Und menschlicher.«
Der Zufall wollte es, dass Marius und Foti in derselben Saison, 2010/11, erlebten, wie ein Trainer ein Talent beflügeln kann. Niko dagegen kümmerte sich noch nicht um Trainer. Für ihn waren Trainer einfach da. Mal schrie ein Trainer herum, mal lobte ein anderer mehr, aber seinen Weg beeinflusste ein Trainer nicht entscheidend, glaubte Niko im Jahr 2011, mit 13, 14.
»Foti, du kannst noch torgefährlicher werden«, sagte sein Trainer in jenem Jahr, Michael Wimmer.
»Wie meinen Sie das, Herr Wimmer? Wie kann ich noch torgefährlicher werden?«, antwortete Foti, und Michael Wimmer fragte sich zum ersten Mal in seiner jungen Trainerkarriere: Ja, wie meine ich das eigentlich?
Dieser unverstellte 14-Jährige brachte ihn dazu, darüber nachzudenken, wie man taktische und technische Details Jugendlichen tatsächlich am besten vermittelte. »Ich war damals in meinen Anfangsjahren als Trainer und hatte mir bis zu dem Zeitpunkt keine größeren Gedanken gemacht: Wie erklärt man etwas? Ich dachte einfach, ich kann das doch, erklären«, sagt Michael Wimmer.
Er war 30, die Frisur noch jugendlich lang, einer von denen, die als Fußballer kurz vor einer Profikarriere gestanden hatten und der sich als Trainer daheim in Dingolfing mehr oder weniger autodidaktisch ausgebildet hatte. Es war sein erstes Jahr in einem Nachwuchsleistungszentrum, als er den 96er-Jahrgang in der U15 des 1. FC Nürnberg übernahm; zum ersten Mal hauptberuflich Trainer. Neuerdings beschäftigten die Bundesligaclubs mindestens bis zur U15 hinunter Trainer in Vollzeit. Die Gehälter reichten in der Regel von 1500 bis 6000 Euro.
Michael Wimmer imponierte es, dass Foti immer wieder fragte. Denn Fragen war doch eigentlich peinlich in dem Alter. »Aber Foti war es wirklich egal, was die anderen dachten.« Den Rückweg bei den Torschussübungen nutzte Foti, um mit dem Ball Finten zu üben. Niemand machte das. Nach dem Torschuss ging man langsam zurück und stellte sich erneut in der Reihe an. Foti glaubte zu wissen, was einige Mitspieler über ihn in dem Moment dachten.
Ist der krank?
Sollten sie es denken. Er wollte mit dem Ball spielen, und er wollte mit dem Ball lernen, da war so eine Spielfreude in ihm.
Die coolen Jungs im Team, Chris Uwadia, Alex Toncic und der Dino Kardovic, akzeptierten ihn sowieso als ihresgleichen. Niemand würde sich trauen, über seinen Eifer zu lästern. Er war zu gut.
Foti nahm den Ball auf, im Testspiel gegen den SSV Ulm 1846, noch am eigenen Strafraum. Er rannte los. Eigentlich ließ er die Gegner gar nicht aussteigen, sondern er stürmte schlichtweg an ihnen vorbei. Irgendwann, nach circa sieben Sekunden, war er am gegnerischen Strafraum angekommen. »Scheiße«, dachte er in einem Anflug von Panik. »Wenn du jetzt die Torchance vergibst, sieht das nach diesem Monsterdribbling ziemlich dämlich aus.« Er schoss. Der Schuss war ganz passabel, mit Innenrist Richtung linkes, unteres Toreck. Der Ulmer Torwart flog vergeblich.
»Messi!«, riefen die Mitspieler, als sie schreiend und jubelnd herbeiliefen, »Messi, Messi, Messi!« Noch nach dem Schlusspfiff nannten sie ihn Lionel Messi. Foti war es egal, dass der Vergleich mit dem besten Dribbler der Welt beim nächsten Training schon wieder vergessen war. Er war doch sowieso Ronaldo-Fan, nicht von Messi.
Es war sein extremstes Tor, nach einem Dribbling über 60 Meter. Und es war gleichzeitig nur eine gewöhnliche Szene für Foti in der U15. »Ich habe viele Bilder von ihm im Kopf, wie er einfach durchbricht, an einem Gegner vorbei, am nächsten, nicht aufzuhalten«, sagt Michael Wimmer zehn Jahre später. In der Zwischenzeit hat er Hunderte weitere und ganz andere Spieler trainiert. Er ist Assistenztrainer der Bundesligamannschaft des VfB Stuttgart geworden. Aber einen herausragenden Fußballer und tollen Jungen vergisst ein Trainer nie. »Wenn Foti Raum sah und Tempo aufgenommen hatte, war es damals nicht möglich, ihn zu stoppen. Im Training hatte ich oft das Gefühl, er schleppt den Gegner einfach mit, er zieht ihn hinter sich her, ohne langsamer zu werden.«
Foti war 1,74 Meter groß und körperlich weit entwickelt, von Natur aus ein Athlet.
Marius, ein Jahr älter, holte endlich auf. Mit 15 Jahren maß er 1,72 Meter. Er war nicht mehr der Kleinste im Team. Nur noch der Drittkleinste. Marius wog 54 Kilogramm. Foti 68 Kilo, bei mehr oder weniger gleicher Größe.
Michael Bischoff wollte zum Beginn der Saison mit jedem einzelnen seiner Spieler ein persönliches Gespräch führen. Er benötigte ein paar Wochen, bis er alle durchhatte. Er nahm sich für jeden Spieler mindestens eine Stunde Zeit, oder so lange es eben dauerte, sodass sich nicht mehr als zwei, drei Gespräche am Tag ergaben.
Ein junger Gott namens Foti. [3]
Mit 43 trug Bischoff die moderne Version der Glatze, den Schädel vollrasiert, was jünger, nicht älter aussehen lässt. Er hatte bei der AOK in der Privatkundenakquise gearbeitet und irgendwann für sich erkannt: Die Arbeit war entspannter und auch erfolgreicher, wenn er nicht versuchte, mit aller Macht seine Krankenversicherungen zu verkaufen, sondern sich wirklich für die Kunden, die Menschen interessierte.
»Schau, Marius«, sagte Michael Bischoff irgendwann während ihres anderthalbstündigen Gesprächs zum Saisonbeginn, »du bist schmächtiger als die Verteidiger. Meinst du nicht, dass der Schiedsrichter dich schützt, Foul pfeift, wenn du angegangen wirst? Dann gibt es Elfmeter für uns. Aber damit es so weit kommt, musst du da rein in den Strafraum.«
Bei seinen Freunden war Marius immer der Laute, Lustige. Erwachsene, die er noch nicht gut kannte, sah er mit großen Augen an, nickte viel und antwortete oft nur: »Ja, genau.«
»Marius, es spielt für mich keine Rolle, ob du beim Dribbling den Ball verlierst«, fuhr Bischoff fort, »ich werde dich nie anschreien, wenn du hängen bleibst. Mir ist nur wichtig, dass du es versuchst. Du kannst das so wunderbar, aus vollem Lauf abrupt abkappen und diagonal in den Strafraum ziehen.«