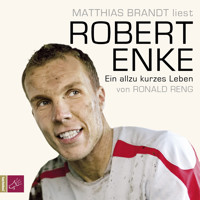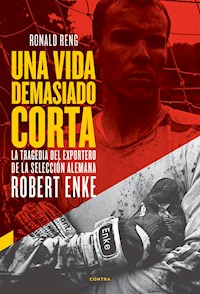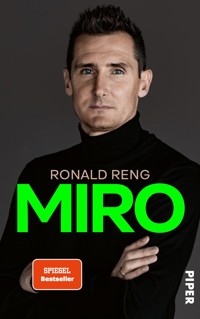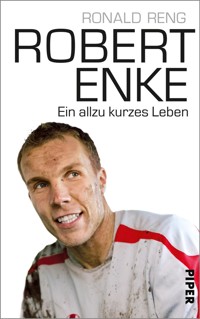
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Unter allen Fußballern war Robert Enke eine außergewöhnliche Persönlichkeit im deutschen Tor. Als überwältigendes Talent mit 20 berufen, für den legendären FC Barcelona zu spielen, war er mit 25 ein vergessenes Talent und etablierte sich schließlich, als es fast zu spät schien, noch als Weltklassetorwart. Ronald Reng erzählt von Erfolgen und Misserfolgen, aber vor allem erzählt er die Geschichte hinter dem öffentlichen Menschen: Robert Enke hatte immer ein offenes Ohr für die Sorgen derer, die ihn umgaben. Und blieb selbst nicht verschont von großen Schicksalsschlägen wie dem Tod seiner kleinen Tochter. Sein Freitod berührte und erschütterte Deutschland weit über die Welt des Fußballs hinaus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Mit 30 Abbildungen
ISBN 978-3-492-95135-7
Aktualisierte E-Book-Ausgabe, Dezember 2014
© Piper Verlag GmbH, München 2010, 2014 Vorwort erstmals erschienen 2010 Umschlag: www.buero-jorge-schmidt.de Umschlagabbildung: Kai Stuht / Periscope Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
»Durch diese milden Sommertage, die gemacht schienen, um sich wohlzufühlen und zu vergnügen, wird er geprüft: was eigentlich geprüft wird, weiß er nicht mehr genau. Manchmal scheint es, als wäre die Prüfung nur um ihrer selbst willen da, um zu sehen, ob er durchhält.«
J. M. Coetzee, Die jungen Jahre
PROLOG
Die nachlassende Kraft der Poesie
Sie hätte gerne ein Gedicht, sagt Teresa, und für eine Sekunde, die eine Ewigkeit dauert, wird es still im Haus.
Robert Enke sieht seine Frau fragend an, unsicher, ob sie das ernst meint. Ein Gedicht soll er ihr zum Geburtstag schenken? »Das wäre doch mal schön«, sagt Teresa beiläufig und denkt schon bald nicht mehr daran.
Er dagegen wird die Idee nicht mehr los.
Es ist einige Jahre her, seit er das letzte Mal ein Gedicht gelesen, geschweige denn geschrieben hat. Er versucht, sich daran zu erinnern. Ein Gedicht, findet er, muss sich reimen, ein schönes Gedicht, glaubt er, sei wie ein angedeutetes Lächeln, mit feinem Humor zwischen den Zeilen. Mit dieser Idee im Kopf beginnt Robert Enke zu schreiben.
An manchem Nachmittag lügt er Teresa an, er ginge kurz in sein Büro, Steuerunterlagen abheften, Banküberweisungen erledigen. Dann sitzt er mit Kugelschreiber und einem Schmierblatt am Schreibtisch. Der Blick schweift in den Garten. Ein einziges riesiges Fenster bildet die Rückseite seines Büros, es ist ein behagliches Gefühl, wenn im Frühling die Sonnenstrahlen durch die Scheibe auf ihn fallen. Jetzt im Winter allerdings ist es am Schreibtisch weniger angenehm. Die Heizung in seinem Büro funktioniert nur leidlich. Ihr Haus in Empede, auf dem flachen niedersächsischen Land, ist ein umgebauter Bauernhof. Sein Büro war der Stall.
Krumm und ruppig sehen die Worte aus, die er auf das Papier bringt, er benutzt die wertvollen Finger eines Fußballtorwarts nur selten zum Schreiben. Doch in seinem Kopf formen sich die Worte immer schneller zu Reimen, eine Freude ergreift ihn, nicht so flutartig wie das Glück, wenn er einen schwierigen Schuss über die Torlatte lenkt, eher sanft, aber doch so intensiv, dass Robert Enke immer mehr schreiben muss, im Büro, im Hotel am Abend vor einem Bundesligaspiel, auf Schmierzetteln, auf Rechnungsrückseiten. Manchmal, wenn er kein Papier zur Hand hat, tippt er seine Einfälle ins Handy. Als der große Tag, der 18. Februar 2009, gekommen ist, hat er ein Gedicht mit 104 Zeilen geschrieben.
Er gratuliert Teresa noch im Bett zum Geburtstag. Während sie ins Bad geht, schleicht er hinaus in die Diele und lässt die Hunde ins Freie. Sie haben neun, dazu zwei Katzen. Teresa hat sie in ihren Jahren in Südeuropa auf der Straße aufgelesen. Zu ihrem vorherigen Geburtstag wünschte sie sich ein Hausschwein. Er entschied sich, es für einen Witz zu halten.
Er zündet im Wohnzimmer Kerzen an.
»Lass uns das mit den Geschenken doch heute Nachmittag machen, wenn wir mehr Ruhe haben«, sagt Teresa, als sie hereinkommt.
Er schüttelt den Kopf, es dauere nicht lange, er bittet sie, sich doch nur kurz an den alten Bauerntisch zu setzen, er drückt sie sanft an den Schultern auf den Stuhl und hört dabei nicht auf, vor Vorfreude zu lächeln. Dann nimmt er auf der anderen Seite des Tischs Aufstellung.
Er legt sein Gedicht vor sich. Aber er spricht frei.
Zum Geburtstag, was soll es sein?
Ein Diamant, ganz groß und rein?
Oder doch die Uhr vom Juwelier?
Bielert ist nicht teuer, glaube mir.
Wie wäre es mit einem Schwein für das Haus?
Das schließt der Robbi komplett aus.
Katzen, Pferde oder ein Hund,
nein, jetzt wird’s mir doch zu bunt.
Es muss doch noch was anderes geben,
wonach Teresa strebt im Leben.
Ja, sie wünscht sich ein Gedicht!
Mir treibt’s ein Lächeln ins Gesicht.
Endlich mal nicht groß, viel, teuer,
trotzdem ist es mir nicht geheuer.
Teresa ist still vor Glück. Strophe für Strophe trägt er ihr halbes Leben vor, der Umzug nach Empede, ihre Tierliebe, auch der Tod ihrer Tochter Lara, die mit einem schweren Herzfehler auf die Welt kam und mit zweieinhalb Jahren nach einer Operation starb, Dann kam Lara mit halbem Herzen / das bereitete uns Schmerzen / doch sie war stark, und man bedenke / es handelt sich um eine Enke. Als sein Vortrag zu Ende ist, hat Teresa Tränen in den Augen. Sie sagt nur einen Satz: »Bitte lies es mir noch einmal vor.«
Er beginnt von vorne, alle 26 Strophen, 104 Zeilen. Am Ende reimt er:
Man fragt sich, wie geht es jetzt weiter
auf unserer langen Lebensleiter?
Bleibt der Opi, bleibt er nicht?
Ist ein Umzug bald in Sicht?
Ich mache mir keine großen Sorgen,
das Heute geht, es kommt das Morgen.
Nur eins ist sicher, hör auf mich:
Ich brauche und ich liebe Dich!
Robert Enke ist 31, Torwart der deutschen Fußball-Nationalelf, stark, frohen Mutes, glücklich. Es wird der letzte Geburtstag sein, den Teresa mit ihm erlebt.
Am Dienstag, den 10. November 2009, ruft er »Hallo, Ela!« aus der Küche, als die Haushälterin um neun Uhr zu ihnen kommt. Er gibt seiner zweiten Tochter Leila, die zehn Monate alt ist, einen Kuss auf die Stirn und verabschiedet sich von Teresa. An der Magnettafel in der Küche hat er sich mit Filzstift notiert, was noch alles zu erledigen ist, vier Karten für das Bayern-Spiel. Dann ist er aus der Tür. Er habe zweimal Einzeltraining, morgens mit dem Fitnesstrainer, nachmittags mit dem Torwarttrainer von Hannover 96, gegen 18 Uhr werde er zurück sein, wie immer. Das hat er Teresa gesagt.
Aber es ist kein Training an diesem Dienstag verabredet.
Ich erreiche ihn kurz nach halb eins auf seinem Handy im Auto. Ich soll zwei Anfragen ausrichten, ein befreundeter englischer Journalist will ihn interviewen, die Deutsche Olympische Sportbibliothek möchte ihn für ihre Jahrestagung im Januar als Gastredner gewinnen, Mensch, jetzt bin ich schon dein Sekretär, der dir Anfragen überbringt, will ich scherzen. Doch er ist kurz angebunden am Telefon; natürlich, er ist im Auto zwischen den zwei Trainingseinheiten, denke ich, er will sicher zum Mittagessen ins Espada oder Heimweh, wie immer. »Ich rufe dich heute Abend zurück, Ronnie, okay?«, sagt er, und ich erinnere mich nicht mehr, wie er sich verabschiedet.
Abends rufen dann nur viele andere Leute bei mir an.
Sein Selbstmord an diesem frischen Herbstabend vereinte Menschen, die ihm nahe waren, und Leute, die seinen Namen nie zuvor gehört hatten, in jenem Zustand, wenn man sich innerlich roh, wie aufgerissen fühlt. In den Tagen danach grenzte die Anteilnahme oft an Hysterie; dass in London die Times Robert Enke die halbe Titelseite widmete, in China das Staatsfernsehen in den Hauptnachrichten berichtete und die Nachrichtenagenturen die Zahl der Gäste der Trauerfeier wie Rekorde verkündeten (»So viele wie noch nie in Deutschland seit Bundeskanzler Konrad Adenauers Begräbnis«), solche Dimensionen waren nur noch damit zu erklären, dass heutzutage alles, auch der Tod, zum Event wird. Im Innersten aber blieb ein echter Schmerz, eine tiefe Lähmung. Robert Enkes Tod offenbarte den meisten von uns, wie wenig wir von dieser Krankheit Depression verstehen. Den anderen von uns, und das waren erschreckend viele, wurde schlagartig bewusst, wie wenig wir über Depressionen sprechen können. Genau wie Robert Enke hatten sie immer geglaubt, ihre oder die Krankheit eines Familienangehörigen verheimlichen zu müssen.
Die Fakten stehen regelmäßig in der Zeitung: Mehr Leute sterben jedes Jahr durch Selbstmord wegen Depressionen als bei Autounfällen. Aber mehr als eine diffuse Vorstellung, dass für manche Menschen die Traurigkeit zu schwer zu ertragen sei, gaben uns diese Zahlen nicht. Und wenn die Schlagzeilen dicker wurden, weil Berühmtheiten wie Marilyn Monroe oder der Schriftsteller Ernest Hemingway sich umbrachten, dann schien dies – auch wenn man es nicht laut sagte – doch irgendwie seine Logik zu haben: Künstlern traut man das zu. Denn gehört Melancholie, eine düstere Seite, nicht unausweichlich zur Kunst?
Robert Enke aber war Deutschlands Nummer eins. Der Torwart ist der letzte Halt, ruhig und kalt in den heißesten Situationen, imstande, Stress und Ängste in den extremsten Momenten zu kontrollieren. Profisportler wie er leben uns jedes Wochenende wieder den Traum vor, alles sei machbar, und Robert Enke schenkte dem Publikum mehr als die meisten Fußballer die Illusion, jedes Hindernis sei überwindbar: Er fand mit 29 Jahren noch den Weg ins Tor der Nationalmannschaft, nachdem er nach einer ersten Depression vier Jahre zuvor schon arbeitslos gewesen und dann in der Zweiten Liga gestrandet war; ihm und Teresa gelang es, nach Laras Tod 2006 ein Leben parallel zum Schmerz zu finden. Und in einem Moment, in dem er nach unseren äußerlichen Wertvorstellungen doch das Glück endlich wiederentdeckt hatte, als er eine Familie mit Tochter hatte sowie die Aussicht, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika im Tor zu stehen, bricht die Depression Anfang August 2009 schlimmer denn je aus.
Welche Kraft muss diese Krankheit besitzen, wenn sie einen wie ihn in den Trugschluss lockt, der Tod sei eine Lösung? Welche Finsternis muss ihn umgeben, wenn ein einfühlsamer Mensch wie er nicht mehr erkennt, welches Leid er anderen mit seinem Tod zufügt, denen, die er liebt, genauso wie dem Lokomotivführer, vor dessen Zug er sich an jenem Novemberabend stellt?
Wie lebt es sich mit Depressionen oder nur mit der Ahnung, sie könnten jeden Moment wiederkommen? Mit der Angst vor der Angst?
Die Antworten wollte Robert Enke gerne selber geben.
Er wollte dieses Buch schreiben, nicht ich.
Wir kannten uns seit 2002, ich berichtete gelegentlich für Zeitungen über ihn, auf einmal lebten wir in derselben Stadt, Barcelona. Wir trafen uns immer öfter, ich hatte das Gefühl, dass uns dieselben Dinge im Leben wichtig waren: Höflichkeit, Ruhe, Torwarthandschuhe. Irgendwann sagte er: »Ich habe ein Buch von dir gelesen, fand ich super!« Ich errötete von dem Lob und antwortete panisch, nur um mit etwas vermeintlich Keckem dem Gespräch schnell eine andere Richtung zu geben: »Eines Tages schreiben wir gemeinsam eines über dich.« Meine Verschämtheit wuchs, als ich merkte, er verstand meinen spontanen Spruch als ernsthaften Vorschlag.
Danach erinnerte er mich immer wieder einmal an unser Projekt, »ich habe mir Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse«. Heute weiß ich, warum ihm die Biografie so sehr am Herzen lag: Wenn seine Torwartkarriere vorbei war, würde er in der Biografie endlich von der Krankheit erzählen können. Ein Torwart, der letzte Halt, darf in unserer Leistungsgesellschaft nicht depressiv sein. So wandte Robert Enke ungeheure Kraft auf, um seine Depressionen geheim zu halten. Er sperrte sich in seiner Krankheit ein.
So muss ich seine Geschichte nun ohne ihn erzählen.
Es ist schwer vorstellbar, dass ich jemals wieder auf solch schonungslos offene Interviewpartner treffen werde wie auf der Reise durch Roberts Leben. Freunde von ihm erzählten plötzlich von ihren eigenen schwarzen Gedanken. Seine Torwartkonkurrenten, die sich, ein Gesetz des Profisports, doch in Interviews die Maske des Unverwundbaren aufsetzen sollen, redeten auf einmal über ihre Zweifel und Ängste.
Der Tod eines geliebten Menschen löst in den meisten von uns den Drang aus, ehrlich zu sein, Gutes zu tun, die Dinge ändern zu wollen. Doch in erster Linie bringt ein öffentlicher Tod eines hervor: unsere menschliche Hilflosigkeit.
Wir wussten nicht einmal, wie wir angemessen trauern sollten. Grausam wogten die Diskussionen durch Deutschland, ob die Trauerfeier im Fußballstadion von Hannover noch pietätvoll oder schon Teil eines Events war. Auch Roberts Mutter störte sich daran, dass der Sarg im Stadion aufgebahrt war. »Da dachte ich mir: Mensch, er ist doch nicht Lenin!«, sagt Gisela Enke, als wir in ihrer Küche in Jena sitzen. Robert, sportlich-elegant im samtblauen Pullover mit V-Ausschnitt unter dem grauen Anzug, hält sie fest im Arm auf einem der vielen Fotos über dem Esstisch. Aber wie sie hier sitzt, eine energiegeladene, herzliche Frau, lehrt sie uns alle Demut: Sie hat verstanden, dass es absurd ist, sich darüber zu streiten, wie gelungen die Trauerfeier war, sie hat ihren Frieden gefunden im Wissen, dass alle das Beste wollten; dass wir gerade auch dann, wenn wir beseelt sind, Gutes zu tun, sehr viel falsch machen.
Viele haben seinen Tod falsch verstanden: Er habe sich umgebracht, weil er sein Leben nicht mehr aushielt. Es gab Nachahmungstäter, weil sie sich in den Irrsinn hineingesteigert hatten, dann seien sie wie er, dann seien sie ihm nahe. Welch ein tragisches Missverständnis. Die meisten depressiven Menschen, die einen Selbstmordversuch begehen, wollen nicht sterben. Sie wollen nur, dass diese Finsternis endlich verschwindet, die ihre Gedanken bestimmt. Robert Enke ging es wohl nicht anders. »Wenn du nur einmal eine halbe Stunde meinen Kopf hättest, dann würdest du verstehen, warum ich wahnsinnig werde«, sagte er einmal zu Teresa.
Es spielt keine Rolle, wie viele solcher Erklärungen ich finde, die Fragen, die immer wiederkehrenden, sich im Kreise drehenden Fragen, lassen sich von keiner Antwort aufhalten.
Ist etwas in seiner Kindheit passiert, das ihn anfällig für Depressionen machte? Was ging ihm an jenem Novemberdienstag durch den Kopf, als er acht Stunden lang mit seinem Auto umherfuhr, ehe er auf die Zuggleise trat?
Die Fragen melden sich unerbittlich wieder, auch am Tag nach Teresas 34. Geburtstag, der gleichzeitig ihr erster Geburtstag ist; der erste ohne ihn. Wir sitzen in der Küche in Empede, Leila vergnügt sich mit dem Lieblingsspiel aller einjährigen Kinder: Sie räumt die Küchenschränke aus.
Die Geburtstagsfeier am Vorabend war erträglich gewesen. Das sind Teresas neue Maßeinheiten: erträglich oder unerträglich. Viele Nachbarn kamen mit ihren Kindern vorbei und brachten selbst gebackenen Kuchen, Blumen, beste Wünsche, ohne dass ihnen Teresa, ohne dass ihnen irgendjemand etwas gesagt hatte. In der Küche versammelte sich ein Dutzend Freunde. Die Glückwunschkarten lese sie lieber erst später, sagte Teresa. Und kurz wurde es still. Wie falsch vermeintlich exakte Wörter klingen können: Glückwunschkarten.
Nun, am Morgen danach, sind die Gäste wieder abgereist. Die Leere im Haus, diese absolute Abwesenheit, ist wieder spürbar, und zwangsläufig muss Teresa an den Geburtstag davor denken, ihren 33., der auf eine Art immer auch ihr letzter bleiben wird. Als Robert ihr das Gedicht schenkte.
Teresa hat noch an die Kraft der Poesie geglaubt, als ihn die Depression im Spätsommer 2009 erwischte. »Schreib mir doch mal wieder ein Gedicht«, sagte sie ihm am Telefon, als er Anfang September in Köln auf einem Lehrgang der Nationalelf im Hotelzimmer lag und die Angst vor dem neuen Tag, die Furcht, irgendjemand erwarte irgendetwas von ihm, ihn nicht aus dem Bett kommen ließ. Abends schob er einen Stuhl auf den Balkon seines Hotelzimmers, im Hintergrund leuchtete der Kölner Dom, und Robert Enke dichtete wieder auf dem Handy:
Sitze auf dem Balkon,
mein Kopf ist ein Ballon.
So schwer wie Blei und Stein,
das kann doch so nicht sein.
Er spürte die Freude nicht mehr, die schöne Worte auslösen können, die Zufriedenheit, die es verschafft, Gedanken aufzuschreiben. Sein Gedicht war ihm gleichgültig.
Auch in seinem Tagebuch, das er während seiner Depression führte, wurden die Einträge immer knapper, je heftiger die Krankheit ihm zusetzte. Auf der letzten Seite steht ein einziger Satz in riesigen Buchstaben. Es sollte vermutlich eine Mahnung an ihn selbst sein, aber heute liest sich sein Satz wie eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns:
»Vergiss nicht diese Tage.«
EINS
Ein Glückskind, eigentlich
An einem Sonntagnachmittag ging Robert Enke zum Jenaer Westbahnhof und begann zu warten. Der Fernzug aus Nürnberg fuhr ein, Passagiere stiegen aus, und er ließ sich keine Enttäuschung anmerken, als sie alle an ihm vorbei vom Gleis gingen. Er wartete weiter. Zwei Stunden später traf der Vorabendzug aus Süden ein. Wieder ließ er alle Ankommenden gespielt beiläufig an sich vorbeiziehen. Es war Winter, Dezember 1995, nicht die optimale Jahreszeit, um im zugigen Bahnhof den halben Sonntag den Zügen hinterherzuschauen. Er entschied sich, bis zur nächsten Zugankunft ins Kino zu gehen. Er lebte noch bei seiner Mutter im Plattenbau in der Liselotte-Herrmann-Straße, vor vier Monaten war er 18 geworden, ein Alter, das fast jedes eigenwillige Verhalten entschuldigt und in dem, nach eigener Meinung, sich doch eigentlich immer nur die anderen eigenartig verhalten.
Teresa kam sonntags immer mit dem letzten Zug aus Bad Windsheim ins Sportgymnasium nach Jena zurück. Auch in ihrem zweiten Jahr in Jena fuhr sie noch jedes Wochenende zu ihren Eltern nach Franken. Sie legte einen Schritt zu, um aus dem eisigen Bahnhof zu gelangen, als sie ihn auf der Bank entdeckte. Sie saß neben Robert in der Schule. Als sie, eine Fremde aus Bayern, anderthalb Jahre zuvor in die zwölfte Klasse des Sportgymnasiums gekommen war, hatte es nur zwei freie Plätze zur Auswahl gegeben, alleine in der letzten Reihe oder neben Robert. Sie kamen gut miteinander aus, fand sie, nur über seine Frisur würde sie an seiner Stelle noch einmal nachdenken. Seit er neben der Schule bei den Profifußballern von Carl Zeiss Jena trainierte, trug er die blonden Haare nach deren Modeverständnis seitlich kurz, oben lang, »wie ein Vogelnest auf dem Kopf«.
Robert mit Teresa und seiner Familie nach einem Spiel des Sportgymnasiums Jena gegen eine Thüringer Auswahl. [1]
»Hallo, was machst du denn hier?«, fragte sie ihn auf dem Bahnsteig, es war nach 22 Uhr.
»Ich warte auf jemanden.«
»Ach so. Na dann, noch einen schönen Abend.«
Sie lächelte ihm kurz zu und hastete weiter.
»Mann!«, rief er ihr hinterher. »Auf dich warte ich natürlich!«
Und zwar schon seit über fünf Stunden, erzählte er ihr kurz darauf, als sie im French Pub etwas tranken.
Er hatte niemandem davon erzählt, dass er einfach einmal auf Teresa am Bahnhof warten würde. Seine Gefühle, seine wichtigen Entscheidungen machte er alleine mit sich aus. Noch wochenlang, während er und Teresa sich näherkamen, erzählte er seinen Freunden nichts davon. Es überraschte sie allerdings nicht, dass die beiden dann ein Paar wurden, dass Robert Enke auch das schaffte. »Wir unterhalten uns noch oft darüber«, sagt einer der Jugendfreunde, Torsten Ziegner, »dass der Robert ein richtiges Sonnenkind war, dem alles gelang, den nichts aus der Bahn werfen konnte, der immer gut gelaunt war.« Torsten gibt dem Wasserglas vor ihm eine Drehung, um die kurze Stille nicht zu groß werden zu lassen. Und jeder für sich im Wohnzimmer von Andy Meyer, einem weiteren Freund von damals, denkt augenblicklich dasselbe. Wie seltsam es klingt, an Robert Enke heute als Sonnenkind zu denken.
Das Tageslicht, vom Schnee reflektiert und greller gestimmt, fällt durch das Fenster des Einfamilienhauses in Jena-Zwätzen, einem Neubaugebiet draußen vor der Stadt. Es ist 13 Uhr, Andy ist gerade aufgestanden. Ein Rest Müdigkeit liegt noch in seinen Augen. Er ist Krankenpfleger und hatte Nachtschicht. Bei Torsten sitzt die Jeans locker, sportlich-leger, die Jacke mit kleinen Karos und Stehkragen würde den Rockstars von Oasis gefallen. Er ist Fußballprofi, mit 32 wieder beim FC Carl Zeiss Jena in der dritten Liga, ein schmaler, drahtiger Athlet. Man sieht Andy und Torsten, Anfang 30, und spürt schnell die Wärme, den Humor der Jugend; von damals. »Wir haben gleich gemerkt, dass wir dieselben Interessen haben; das heißt vor allem dieselben Desinteressen«, sagt Torsten. »Mehr als alles andere«, sagt Andy, »haben wir gelacht.«
Immer zu viert waren sie damals, Mario Kanopa, den es als Lehrer an die holländische Grenze verschlagen hat, Torsten Ziegner, Andy Meyer und Robert Enke, den sie Enkus nannten, den sie weiter Enkus nennen, weil er für sie der von damals geblieben ist. »Aber doch«, redet Andy schließlich tapfer gegen die Stille an, »eigentlich denke ich das noch heute, trotz allem: Der Enkus war das Glückskind.«
Er wuchs zwischen den Wäschestangen auf. Sie trafen sich nachmittags im Innenhof, über die Stange hieß das Spiel der Siedlung. Einer stand zwischen zwei Wäschestangen im Tor, lupfte den Ball über die gegenüberliegende Stange, auf der anderen Seite wartete der Spielpartner, um den Ball volley auf das Tor zu schießen.
Von Ferne ist seine Heimat, die Trabantenstadt Lobeda, noch heute das Erste, was man von Jena sieht. 40 000 Menschen sollten hier wohnen, mehr als ein Drittel der Einwohner Jenas. 17 000 sind geblieben. Zwischen den 15-stöckigen Plattenbauten an den kommunistischen Boulevards stehen in den Seitenstraßen etliche niedrigere Mietblöcke, die sich von denen in Frankfurt-Schwanheim oder Dortmund-Nordstadt nicht unterscheiden. Während die beiden deutschen Staaten sich permanent an ihre Unterschiede erinnerten, ähnelte sich in den Achtzigern zwischen diesen Mietblöcken das Jungenleben in Ost und West. Wäschestangen regierten die Welt von Jena-Lobeda bis Frankfurt-Schwanheim.
Von den Erwachsenensorgen, sagt Andy Meyer, hätten sie erst nach dem Zusammenbruch der DDR erfahren; vielleicht hätten sie sie als Kinder aber auch einfach langweilig gefunden und deshalb ignoriert. Dass Andys Vater nicht Lehrer werden durfte, weil er nicht in der Partei war; dass Roberts Vater Anfang der Sechziger als 400-Meter-Hürdenläufer aus der Leistungssportförderung flog, weil er Postkarten von seinem in den Westen geflüchteten Bruder erhielt.
Sie unterbrachen das Fußballspielen im Innenhof nur für besondere Anlässe – wenn sie zum Fußballtraining mussten. Andy Meyer, der ein paar Blöcke weiter wohnte, war früh vom großen Klub der Stadt, dem FC Carl Zeiss, gesichtet worden. Er war sieben Jahre alt gewesen und es gewohnt, mit Carl Zeiss immer zu gewinnen. Deshalb erinnert sich Andy besonders an die eine Niederlage. Auf dem holprigen Sportplatz Am Jenzig, zu Füßen des Jenaer Hausbergs, verlor der FC Carl Zeiss 1:3 gegen den SV Jenapharm. Große Klubs haben ihre Art, sich solche Niederlagen nicht gefallen zu lassen, selbst in Kinderteams: Helmut Müller, der Trainer von Carl Zeiss, ging sofort nach dem Spiel zu den Eltern des Stürmers von Jenapharm, der alle drei Tore erzielt hatte, und sagte ihnen, der Sohn solle sich doch augenblicklich Carl Zeiss anschließen. Es war Robert Enke.
In jeder Sportlerbiografie findet sich ein Moment, bei dem die einen sagen: Was für ein Zufall! Und die anderen: Das also nennt man Schicksal. Muhammad Ali wurde mit Zwölf sein Swinn-Fahrrad gestohlen, und der Polizist, der seine Anzeige aufnahm, riet ihm, statt zu heulen doch Boxer zu werden. In der D-Jugend des FC Carl Zeiss Jena, in der Robert Enke mittlerweile einen passablen Offensivspieler gab, wurde der Vater von Thomas, dem Torhüter, beruflich nach Moskau versetzt. Die brauchten einen neuen Torwart. »Der Trainer hatte keine Idee«, sagt Andy Meyer, »also musste jeder mal zur Probe ins Tor. Bei mir hatte sich das Thema schnell erledigt. Unser Glückskind wurde zweimal angeschossen und war fortan die Nummer eins.«
Robert Enke (links) zu Fasching. [2]
Ohne zu wissen wie, machte er alles richtig, der kräftige Absprung, die Handhaltung mit den gespreizten Daumen beim Fangen, die Entscheidung, die eine Flanke aus dem Himmel zu holen und sich bei der nächsten nicht daran zu wagen.
Er entdeckte ein neues, ein betörendes Gefühl. Wenn er flog, wenn er den Druck des hart geschossenen Balls in seinen Händen spürte, dann wusste er, wie sich Glück anfühlt.
Wobei er doch, ehrlich gesagt, »die meiste Zeit gar nichts tat«, sagt sein Vater. »Carl Zeiss war in den Kindermannschaften so überlegen, dass der Torwart sich langweilte. Aber ihm hat es gepasst.« Ein sanftes Lächeln, für Sekunden frei von Schmerz, entwischt dem Vater bei dieser Erinnerung. »Da musste er nicht so viel laufen.«
Dirk Enke hat dasselbe Lächeln wie sein Sohn. Ungewöhnlich langsam, als wolle es sich vornehm zurückhalten, breitet es sich im Gesicht aus. Der Vater sagt, er habe Angst vor dem Moment gehabt, für die Biografie über Robert zu sprechen; davor, dass die Erinnerungen zu stark werden. Deshalb lässt er in seiner Wohnung am Marktplatz, hoch über den Dächern von Jena, erst einmal die Dias sprechen. Jemand hat ihm kürzlich – Dirk Enke sagt »danach« – einen Projektor geschenkt, damit er die alten DDR-Dias aus Roberts Kindheit noch einmal anschauen kann. Die drei Kinder beim Zelturlaub an der Ostsee, Anja, Gunnar und Robert, der Nachzügler, der neun Jahre nach der Schwester, sieben Jahre nach dem Bruder zur Welt kam. »Die Stellplatzgenehmigung für ein Zelt bekam man in der DDR eigentlich erst ab vier Kindern«, sagt der Vater, aber es gab Dinge, die seien auch in einem Überwachungsstaat nicht so ganz genau überwacht worden. »Wir haben einfach immer vier angegeben, keiner hat nachgezählt.« Der Projektor klickt weiter, Robert mit seiner dritten Oma. »Meine richtige Oma« nannte er Frau Käthe, eine Rentnerin von nebenan, die oft auf ihn aufpasste, deren Nähe er noch als Jugendlicher suchte. Als Kind zählte er immer auf: »Ich habe eine dicke Oma, eine dünne Oma und eine richtige Oma.«
Irgendwann sind die Dias zu Ende. Irgendwann hatten auch im Leben des Glückskindes die schönen Bilder eine Pause.
Er war elf, als er von der Schule in die Liselotte-Herrmann-Straße zurückkam. Der Vater stand mit einer Tasche in der Hand vor der Tür.
»Papi, wo willst du denn hin?«
Dirk Enke schaffte es nicht zu antworten. Er ging wortlos, mit wässrigen Augen zum Auto. Der Sohn lief zu seiner Mutter in die Wohnung.
»Was ist denn passiert?«
Die Mutter schluckte. »Wir haben uns ein wenig gestritten. Dein Vater zieht erst einmal auf die Hütte nach Cospeda.«
Es gab eine neue Frau im Leben des Vaters.
Robert fragte die Mutter jeden Tag, wochenlang: »Mama, wie geht es dir denn?« Gisela Enke konnte in seinem Gesicht sehen, wie er sich vor einer traurigen Antwort fürchtete.
Doch die Eltern wollten nicht glauben, dass ihre Ehe zu Ende ging. Sie sahen sich weiter, »und wir haben das nicht nur wegen der Kinder gemacht«, sagt die Mutter, »ich war dreißig Jahre mit Dirk zusammen, wir hatten uns als Jugendliche kennengelernt«. Im Sommer fuhren sie gemeinsam an den Balaton in den Urlaub. Robert saß auf dem Rücksitz und sagte laut, aber beiläufig, als ob er zu niemandem Bestimmten rede, »na, wenn es zur Versöhnung beiträgt, fahren wir halt an den Balaton in den Urlaub«. Mehr als glücklich klang er angestrengt hoffnungsvoll.
Wieder geeint wurde die Familie dann überraschend von einer größeren Vereinigung. »Die Wende hat uns noch einmal zusammengeschmiedet«, sagt die Mutter. Der Rausch der Montagsdemonstrationen, die Aufregung der herannahenden großen Veränderungen schuf vor der staatlichen erst einmal ihre familiäre Einheit. Dirk Enke zog wieder zu Hause ein, zur Silberhochzeit gingen sie auf Fahrradtour am Rhein bei Koblenz.
Die Enkes gehörten zu denen, die die Wiedervereinigung ohne Skepsis begrüßten. Der Vater wusste den größten Teil seiner Familie auf der westlichen Seite der Grenze. »Mein Gefühl war: endlich!« Die Jungen zwischen den Wäschestangen waren bei der Wende zwölf, dreizehn. Sie sind die letzte Generation, die bewusst noch beide deutsche Staaten erlebt hat, die erste, die in beiden Staaten erwachsen wurde. Er könne sich noch erinnern, wie Robert und er mit ihrer Carl-Zeiss-Jugendelf zu Ehren von DDR-Staatspräsident Erich Honecker bei einer Parade den Löbdergraben rauf- und runtermarschieren mussten, sagt Andy Meyer, »und was wir toll fanden, war, dass es nachher Essensmarken für Bockwürste gab«. Ähnlich beiläufig nahmen sie die neue Zeit zur Kenntnis. Sie spielten einfach weiter, über die Veränderungen hinweg. Sie nahmen sich nicht einmal eine Halbzeitpause für die Wiedervereinigung. »Einschneidend war daran für uns Kinder nichts«, sagt Andy. Er lacht, etwas fällt ihm ein. »Das Fußballtraining lief doch weiter.«
In Lobeda, dem einstigen sozialistischen Traum vom Schöner Wohnen, zeigte sich nun allerdings ein neues Proletariat. Damit mussten sich die Kinder sehr wohl arrangieren. Türken aus Westdeutschland gingen mit Teppichen hausieren, im Glauben, die Ossis marktwirtschaftlich übers Ohr hauen zu können. Jugendliche aus der Trabantenstadt schlossen sich auf einmal zu Banden zusammen und nannten sich rechtsradikal.
»Lass niemanden herein«, mahnte die Mutter den Sohn, der nach der Schule regelmäßig alleine zu Hause war, weil beide Eltern arbeiteten, sie als Lehrerin für Russisch und Sport, der Vater als Psychotherapeut an der Städtischen Klinik.
Vorsichtig machte Robert die Tür auf, als es klingelte. Der Großonkel Rudi, Universitätsprofessor für Latein, kam zu Besuch.
»Guten Tag, sind die Eltern zu Hause?«
Der Junge sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an.
»Du erkennst mich nicht, oder? Ich bin dein Großonkel Rudi.«
»Das kann ja jeder sagen«, rief Robert, schob den verdutzten Professor aus der Tür und knallte sie zu.
Ein anderes Mal lauerten ihm die rechten Halbstarken auf dem Nachhauseweg von der Schule auf. Sie packten ihn, sie schubsten ihn. Bevor sie ihn schlugen, erkannte ihn einer. »Hört doch auf, das ist doch Robert Enke.« Er war zwölf. Er war offensichtlich schon berühmt als der Torwart. Sie ließen ihn gehen.
Doch die Angst wich nicht. Er sehnte sich nach einer Schutzhaut: Er flehte die Mutter an, sie solle ihm eine Bomberjacke kaufen. Darin würden die Rechten ihn fälschlicherweise für einen der Ihren halten und in Ruhe lassen. »Ich war zunächst entsetzt, dass er denen so nachgeben wollte«, sagt die Mutter, »aber, okay, dachte ich, wenn er dann keine Angst mehr hat. Er trug die Jacke dann auch nur ein paar Wochen.«
Als im vereinten Deutschland die erste Desillusionierung einkehrte, verlor die Wiedervereinigung 1994 auch ihre Kraft, die Ehe der Enkes zusammenzuhalten.
Die Familie saß sonntags im Wohnzimmer, als der Vater innerlich Anlauf nahm.
»Ich muss euch etwas sagen.«
Die Mutter wusste es schon. Die andere Frau in seinem Leben war nie ganz verschwunden.
»Gisela und ich trennen uns. Ich ziehe aus.«
Robert sprang vom Sofa auf und rannte aus der Tür.
»Gunnar, lauf, hol den Jungen zurück!«, rief die Mutter. Der Bruder fand ihn auf der Straße. Er weigerte sich zu reden.
Niemand sollte ihm etwas anmerken. Er hatte sich angewöhnt, Traurigkeit mit sich selbst auszumachen.
Den drei Freunden erschien er unverdrossen als ihr Sonnenschein. »Der Enkus warf ein Glas Wasser um, und alle wurden nass, nur er nicht, so war es doch immer«, sagt Andy. Die Lehrerin erwischte Robert Enke während einer Biologiearbeit beim Abschreiben. Er bekam eine Sechs. Aber als die Zeugnisse verteilt wurden, stand bei ihm in Biologie ein Befriedigend. Er war auffallend hilfsbereit, besonnen und ein begabter Torwart, diese Kombination stimmte seine Lehrer offensichtlich milde.
Er wusste, er kam in der Schule ohne großen Aufwand ganz gut durch, und strebte nicht nach mehr.
Die Freunde trafen sich nun oft bei Mario Kanopa und Torsten Ziegner auf dem Internatszimmer. Mit 14 waren die beiden vom Land ins Sportgymnasium gekommen, in den Namen ihrer Heimatvereine lag noch der Klang einer dörflichen Welt, weit weg von Jena: Von der BSG Traktor Frauenprießnitz kam Mario, Torsten von der BSG Mikroelektronik Neuhaus/Rennweg. Oft genug zankten sie sich in ihrem kleinen Internatszimmer. Wenn ihn etwas störte, polterte Torsten gleich los. Diese Impulsivität brachte Mario auf. Der Enkus verstand sich mit jedem von ihnen bestens; wenn er dabei war, kamen alle gut miteinander aus.
In der Eingangshalle des Sportgymnasiums hingen immer öfter Zeitungsartikel über sie aus. 1993 fuhren Robert Enke, Torsten Ziegner und Mario Kanopa mit der thüringischen Auswahl nach Duisburg zum traditionellen B-Jugendpokal der Bundesländer. Hinter der Seitenlinie standen die Späher der Profivereine. Bei dem jährlichen Turnier in der Sportschule Wedau werden in der Wahrnehmung der Fußballszene aus 15-Jährigen erstmals potenzielle Profis. Zunächst hielt es die Thüringer Elf für einen schönen Witz, was in Duisburg passierte, am Ende »lachten wir uns über uns selbst tot«, erinnert sich Torsten Ziegner. In einer absurden Wiederholung glich ein Spiel dem anderen. Regelmäßig wirkten sie wie die unterlegene Elf. Nie verloren sie. »Es war«, sagt Torsten, »als ob Robert alleine spielte.« Er wurde immer größer. Mit jedem gehaltenen Torschuss erschien er den Stürmern, die vor ihm auftauchten, riesiger. Er erreichte den höchsten Geisteszustand eines Torwarts: Auf einmal überkommt dich in all der Hektik dieses Spiels die absolute Ruhe. So fest ihn die Stürmer auch treten, du glaubst, der Ball gehorcht nur dir. Eine allgewaltige Sicherheit füllt dich aus und macht dich noch größer, immer größer. 0:0, 0:0, 1:0, 4:0 lauteten Thüringens Ergebnisse in Duisburg. Gegen ihn schoss man kein Tor.
Die Jugendmannschaft von CZ Jena auf einer Tunesien-Reise, der Zweite von vorne links ist Robert Enke, der Zweite von vorne rechts sein Freund Mario Kanopa. [3]
Im selben Jahr erreichte Carl Zeiss Jena das Endspiel der deutschen B-Jugendmeisterschaft, was in den nächsten 15 Jahren kein Klub mit ähnlich bescheidenen Möglichkeiten nachmachen würde. Der Klubpräsident lud das Team in eine Bar namens Sockenschuss; zu einer Runde Cola. Sie verloren das Finale 1:5 gegen Borussia Dortmund. Aber selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung schickte einen Reporter, um das Internat in einem Bericht zu würdigen. Die Internatsleiterin gab über ihre Fußballer zu Protokoll: »Sie sind nicht besonders ordentlich, sie essen alles, treten fast immer als Mannschaft auf und haben ein ausgeprägtes Selbstvertrauen.«
Später werden die vier Freunde das gesamte Spektrum dessen abdecken, was aus einem talentierten Fußballer werden kann: Robert Enke wird Nationaltorwart. Torsten wird local hero, Kapitän, Spielmacher bei Carl Zeiss Jena in der Zweiten und Dritten Liga. Mario wird mit 22 nach einer schweren Verletzung seine Profikarriere beenden und studieren, in der Bilanz steht: ein Zweitligaspiel, ein Tor. Andy bekommt mit 15 von Carl Zeiss gesagt, es tue ihnen leid, aber es reiche nicht mehr, und wird fortan nur noch zum Spaß in kleineren Teams spielen.
Damals träumten sie gemeinsam.
Vor 30 000 Schulkindern spielten Robert Enke, Torsten Ziegner und Mario Kanopka mit der deutschen Jugend-Nationalelf gegen England im legendären Wembley-Stadion. Sie waren 15. Das Spiel endete 0:0, der Daily Telegraph, Margaret Thatchers Lieblingszeitung, berichtete: »Eine Kombination aus phantastischen Torwarttaten und armseligen Torschüssen verhinderte Englands Sieg.« Robert Enke war gemeint.
Er lag noch am Boden, nachdem er einen furiosen Schuss von Stephen Clemence im Flug abgewehrt hatte, als bereits Jay Curtis zum Nachschuss ansetzte. Er sprang auf, es ging zu schnell für das Publikum, um zu verstehen, wo seine Hand herkam. Aber er wehrte auch diesen Schuss ab.
Er wurde entdeckt. Deutscher Jugendfußballer des Monats, ein ganzseitiger Bericht im Kicker. Der Stern porträtierte ihn in einem Sonderheft »Die 16-Jährigen« als Protagonisten seiner Generation. »Oft denke ich nicht über die Welt nach«, sagte Robert Enke, sehr 16-jährig, dem Stern, »aber manchmal habe ich ein Gefühl, als ob sie untergeht.«
Auf der Tribüne des Wembley-Stadions saß Dirk Enke mit einigen anderen Eltern der Mitspieler. Der Fußball wurde für den Vater das Band zu seinem Sohn.
Seit er ausgezogen war, versuchte er zu jedem Spiel zu kommen. Er beobachtete die anderen Väter, er sah, wie manche ihre Kinder bei Fehlern anbrüllten, und wenn den Kindern eine Aktion gelang, brüllten sie schon wieder, jetzt schieß doch, pass den Ball, schneller, schieß doch! Dirk Enke saß still, aufmerksam am Spielfeldrand. Er fand, er machte es richtig. »Dirk war ein toller Vater«, sagt die Mutter. »Aber nach der Trennung hatte er es schwer mit den Kindern.«
Nach den Spielen redeten Vater und Sohn.
Stark gehalten.
Danke.
Wie du den einen Ball aus dem Winkel holst.
Fast wäre ich nicht mehr drangekommen, mir hat es die Fingerspitzen weggehauen, so fest war der Schuss.
Und der Torsten, der Ziege wieder, Wahnsinn!
Du weißt doch, wie er ist.
Ich dachte am Ende, Mensch, Ziege, bist du verrückt? Ein Gegner will an ihm vorbei – und der Ziege rennt den Kerl einfach um, rennt frontal in den Gegner rein. Und das macht er dreimal! Normal sieht er drei Rote Karten.
Papa, ich muss in die Umkleidekabine.
Sie lächelten sich an im angestrengten Versuch so vieler Väter und Söhne, über den Sport dem anderen seine Nähe zu versichern; mit dem Gespräch über Fußball die Sprachlosigkeit zwischen ihnen zu übertünchen. »Dirk und Robert haben viel zu selten wirklich geredet«, sagt die Mutter. »Ich war ja auch nicht in der Lage, in der Familie zu streiten, mal etwas Negatives zu sagen. Und ich denke, Robert konnte das auch nicht. Da war immer so eine vornehme Zurückhaltung in unserer Familie.«
Wenngleich ihm gelegentlich die Worte fehlten, so besaß der Vater ein Auge. Während die Mutter ihrem älteren Sohn Gunnar noch tagelang gutmütig glaubte, er habe ihre Gitarre bei einem Freund vergessen, bemerkte der Vater die Verdruckstheit des Sohnes. Er fand heraus, dass Gunnar die Gitarre verkauft hatte.
Der Vater erkannte Roberts gehetzten Gesichtsausdruck, als er erstmals in der A-Jugend, bei den 18-Jährigen, spielen musste. Er war noch immer 16. Die Trainer schickten ihn in die höhere Altersklasse, damit er einmal richtig gefordert wurde; für die Gleichaltrigen sei er doch zu gut. Er hielt auch in der A-Jugend tadellos. Aber er nahm es nicht so wahr.
Für einen 16-Jährigen sind 18-Jährige die Großen. Die meisten 16-jährigen Torhüter, die bei den Älteren spielen müssen, haben Angst. Denn der Torwart wird in letzter Instanz immer nur an seinen Fehlern gemessen, und wie kann er keinen Fehler machen, wenn die gegnerischen Stürmer so groß und kräftig sind? Wie werden die Großen, Starken in seinem Team auf ihn herabschauen, wenn er versagt?
Robert Enke weinte, als er nach dem Spiel mit seinem Vater alleine war, und sagte, er wolle nicht mehr in der A-Jugend spielen. »Papa«, sagte er, »du wärst mir doch nicht böse, wenn ich mit dem Fußball aufhören würde?«
Die Freunde kennen diesen Robert nicht. »In den Jugendteams gab es immer Verrückte, die auf die Schwächsten eingedroschen haben, da hat der Enkus sicher auch mal die Pfeile und Spitzen abbekommen«, erzählt Torsten, »aber ihn konntest du nicht runterziehen, im Gegenteil. Wir hatten damals den Eindruck, den Enkus bringt nichts aus der Ruhe. Er war schon als 17-Jähriger im Tor so souverän wie andere nach zehn Jahren als Profi.«
Die Mutter erlebte in der Episode mit der A-Jugend einen ganz anderen Robert als der Vater. »Ich erinnere mich noch, wie er nach einem Abendessen aufstand und zu mir sagte: ›Mutter, ich muss was klären.‹« Er nahm die Straßenbahn zum Ernst-Abbe-Sportfeld und sagte Ronald Prause, dem A-Jugend-Trainer, dass er wieder in der B-Jugend spielen wolle. Ein Junge von 16 Jahren, selbstbewusst und charmant genug, dem autoritären Trainer zu erklären, was er wollte.
Doch Dirk Enke ist Psychotherapeut. Er hat einen anderen Blick. Zu Hause, sagt die Mutter, habe sie schon einmal gerufen: »Scheiß Psychos!«, wenn die Schwägerin und der Schwager zu Besuch waren, beide auch Psychologen, »und sie mir zu dritt erklären wollten, wie ich war. Aber«, sagt sie, »der Dirk hatte schon einen Riecher.«
Der Vater legt Messer und Gabel beim Mittagessen am Marktplatz von sich, er reibt die flachen Hände über die Oberschenkel. Dann sagt er: »Ich dachte mir, was passiert da gerade? Hat er Probleme mit seinen Mitspielern? Nein, es wurde schnell klar, es findet etwas in ihm statt: Die Angst vor Fehlern setzte ihm zu, dieses Denken: Wenn ich nicht der Beste bin, bin ich der Schlechteste. Damals als B-Jugendlicher in der A-Jugend muss diese Qual begonnen haben.«
Aber es war doch nur ein einmaliger Moment; ein kurzer Augenblick der Angst, wie ihn Hunderte Jugendtorhüter erleben!
»Doch die Seele erinnert sich immer an diese Grenzerfahrung.«
Als 17-jähriger Schüler, mit einer Sondergenehmigung vom Deutschen Fußball-Bund, unterschrieb Robert Enke bei Carl Zeiss Jena einen Profivertrag für die Zweite Liga. Mutter und Vater begleiteten ihn ins Büro des Vereins. Ernst Schmidt, der Geschäftsführer, und Hans Meyer, der Trainer, erwarteten sie. Sein spezieller Hang, ein Gespräch sofort mit launigen Ansichten zu dominieren, würde Meyer später zu einem Entertainer der Bundesliga machen. In der Geschäftsstelle hatte er dem 17-jährigen Torwart auch gleich etwas von Jenas mythischem Torhüter der Fünfzigerjahre zu erzählen. »Der Harald Fritzsche war hier über zehn Jahre lang an keinem einzigen Tor schuld«, sagte Meyer. »Zumindest, wenn man ihn fragte.«
Der Vater horchte auf. Wusste Meyer von Roberts quälerischen Selbstvorwürfen nach Fehlern? Wollte der Trainer ihm eine Botschaft schicken? Mach dich mal nicht verrückt.
Robert Enke teilte seine Leben. Er bekam in der Schule Einzelunterricht, um vormittags als Ersatztorwart mit der Zweitligaelf trainieren zu können, er war jetzt ein Profisportler mit all dem Ernst, mit all dem Nichtabsteigendürfen des Berufs – und gleichzeitig begann sonntags am Jenaer Westbahnhof mit Teresa eine unbeschwerte Jugend.
Sie kampierten bei seiner Mutter auf einer Matratze im Wohnzimmer und sagten ihr, sie müssten für das Abitur lernen. Manchmal gingen sie abends aus, er trank vielleicht ein Bier mit Limonade, »und ich tanzte auf den Tischen«, sagt Teresa, was vermutlich nicht wörtlich zu nehmen ist. Doch er fühlte, dass sie die Lebensfreude besser zeigen konnte.
Ihr ging alles so leicht von den Lippen, die Herzlichkeit, die Neugierde, die Entscheidungsfreudigkeit. Er glaubte, sie sei viel stärker als er.
»Ich habe nie gelernt, so zu feiern wie du«, sagte er, als ob er sich verteidigen müsste. Ihr gefiel gerade sein zurückhaltender, sanfter Charme. Sein Gesicht war das des ewigen lieben Jungen.
Sie war mit zwei älteren Brüdern auf dem Dorf in Franken groß geworden, der Vater hatte ihnen allen seine Leidenschaft für den Modernen Fünfkampf mitgegeben, Schwimmen, Fechten, Reiten, Schießen, Laufen. Zu Hause im Kinderzimmer schossen Teresa und ihr Bruder heimlich mit der Luftpistole auf Playmobilmännchen, »schau mal, wenn du sie auf der Brust triffst, zerspringen sie in tausend Teile«, sagte der Bruder, stolz über seine Entdeckung. Offiziell kam Teresa wegen des Sports nach Jena auf das Gymnasium. Dass es auch darum ging, dem bayrischen Schulsystem mit dem verfluchten Latein zu entfliehen, musste sie ja nicht sagen. »Zieh keine Markenklamotten an, damit du nicht als Besserwessi rüberkommst«, gaben ihr die Freunde aus dem Westen mit auf dem Weg. »Und dann sah ich am ersten Tag an der neuen Schule, dass sie nur Markenklamotten trugen.«
Ost und West, die Gegensätze, die in jener Zeit so viele sehen wollten, waren für sie kein Thema; nur gelegentlich Anlass zum gemeinsamen Lachen. Als Robert den Heiligabend bei Teresas Familie verbrachte, zeigte er wegen seiner atheistischen DDR-Erziehung bei der Weihnachtsgeschichte Lücken. »Wer war denn das, der Josef?«
Sein Fußballsport interessierte Teresa wenig. Fußball stand für sie für enttäuschende Teenager-Samstagabende, »wenn ich zu Hause die Serie Beverly Hills schauen wollte und nicht konnte, weil meine Brüder den Fernseher wegen der Sportschau in Beschlag nahmen«.
Auch deshalb erzählte er ihr gar nicht von seinen ersten Profispielen, bis sie irgendwann, viel später, danach fragte. Er fand, darüber rede man nicht von sich aus, das sei Angeberei.
Carl Zeiss Jena hielt sich bemerkenswert gut in der Hinrunde der Saison 1995/96. Im Mittelfeld fiel gelegentlich ein 21-Jähriger namens Bernd Schneider durch seine Eleganz auf; ein paar Jahre später würde er als der technisch beste deutsche Fußballer gelten. Die Elf hatte sich in der Tabelle im vorderen Mittelfeld eingependelt, als es im Herbst zwei heftige Niederlagen hintereinander setzte, 1:4 in Duisburg, 0:4 gegen den VfL Bochum. Der Torwart Mario Neumann hatte schon glücklichere Tage erlebt. Am 11. November 1995 spielte Carl Zeiss bei Hannover 96. Gute Torhüter, heißt es, bräuchten mehr als alles andere Erfahrung, und Robert Enke war 18. Trainer Eberhard Vogel stellte ihn erstmals ins Tor.
Das Beeindruckendste war die Leere im Stadion. 6000 Zuschauer verloren sich auf den 56 000 Plätzen. Da fielen die eigenartigen Flutlichtmasten noch mehr auf. Wie gigantische Zahnbürsten wuchsen sie in den Himmel. Es war Fußball, bevor der Sport ein Event, die Volksparty wurde.
Das Spiel lief, Robert Enke wartete. Hin und her ruckte der Kampf im Mittelfeld, er konzentrierte sich, weil gleich der Gegner an seinem Strafraum erscheinen könnte, und dann ging es doch wieder in die andere Richtung. Dann, plötzlich, eine halbe Stunde war schon vorbei, ein Kopfball von Hannovers Reinhold Daschner. Auch ein fast leeres Stadion konnte auf einmal laut klingen. Robert Enke stand schon genau dort, wo der Kopfball hinflog, und fing ihn sicher.
Es dauerte nicht einmal zwei Minuten, ehe er nach seiner ersten bemerkenswerten Tat sein erstes Gegentor im Profifußball kassierte. Die Ostthüringer Zeitung fand recht ungewöhnliche Worte, um ihn in Schutz zu nehmen: »Am 1:0 für Hannover hatte Jenas Verteidiger Dejan Raickovic, aber keinesfalls Robert Enke eine Aktie.«
Es blieb der Kleinkram eines Torwarts zu erledigen, ein paar Eckbälle entschärfen, die Abschläge genau platzieren. Einmal entlockte er dem Stadion noch ein Raunen. Er begrub einen Schuss von Kreso Kovacec unter sich. Am Ende stand ein 1:1, ein Spiel, das die Zuschauer bereits zu vergessen begannen, als sie die Stadiontreppen hinausgingen, und ein junger, glücklicher Torwart, der beim Gang in die Umkleidekabine noch einmal einen Schrecken bekam. Über ihm donnerte es auf dem Tunneldach aus Plexiglas. Sein Vater hing über dem Tribünengeländer und schlug von oben stolz gegen das Dach des Spielereingangs, um ihm zu sagen, Mensch, Junge!
Er würde selbstverständlich im Tor bleiben.
Am Samstag darauf war seine Mutter mit einer Freundin in die Berge um Jena gefahren. Sie hatten das Radio eingeschaltet. »Mir wurde schlecht«, sagt Gisela Enke.
»Freistoß für Lübeck am linken Flügel«, rief der Reporter im Radio, »Behnert flankt, Enke ist draußen, er hat den Ball – und lässt ihn durch die Hände gleiten! Tor für Lübeck! Ein krasser Torwartfehler!«
Es war in Momenten wie diesem, da sich Andy Meyer bestätigt sah: Der Enkus war das Glückskind. Denn wenn er schon einmal danebengriff, was sowieso fast nie vorkam, gewann sein Team prompt, und niemand redete mehr über den Torwartfehler.
3:1 besiegte Jena den VfB Lübeck.
Wenn er sich anstrengte, konnte Robert Enke sehen, was Andy meinte: Sein Fehler war unerheblich gewesen. Aber später, viele Jahre danach, gestand er, wie er das als junger Torwart wirklich sah: »Ich konnte mir einen Fehler nicht verzeihen.« Die Mitspieler sagten, macht nichts, der Trainer sagte, das passiert jedem einmal, nächsten Samstag geht es weiter, natürlich bleibst du im Tor, doch »ich hatte die ganze nächste Woche lang den Fehler vor Augen, ich bekam ihn nicht aus dem Kopf«.
Robert im Tor von CZ Jena bei der deutschen B-Jugendmeisterschaft. [4]
Er ging die gesamte Woche nicht in die Schule. Er sagte, er sei krank.
Es ist die Tortur der Torhüter: der unhaltbare Anspruch an sich selbst, fehlerlos zu sein. Vergessen kann keiner von ihnen seine Fehler. Aber ein Torwart muss verdrängen können. Ansonsten kommt das nächste Spiel und bricht über ihm zusammen.
Carl Zeiss musste zum Derby nach Leipzig. Der Vater traf auf der Tribüne eine Bekannte aus alten Leichtathletik-Tagen. Sie setzten sich nebeneinander. Sie hielt zum VfB Leipzig, aber in der dritten Spielminute schrie selbst sie mitleidig: »Oh nein!«
Robert Enke hatte einen Weitschuss aus zwanzig Metern, mit wenig Effet, mit nicht besonders viel Kraft dahinter, unter dem Bauch ins Tor rutschen lassen.
Ein Torwart muss jetzt so tun, als sei gar nichts passiert.
In der 34. Spielminute rannte Leipzigs Stürmer Ronny Kujat alleine auf ihn zu. In solchen Momenten scheint das Spiel plötzlich in Zeitlupe abzulaufen. Der Torwart registriert jede Fußbewegung des Stürmers, die Zuschauer verharren mit offenen Mündern. Der Torwart wartet eingefroren auf den Stürmer, er darf sich jetzt nicht bewegen, wer hier zuerst zieht – er die Hand oder der Stürmer den Fuß –, hat meistens verloren, denn der andere kann sein Manöver durchschauen. Kujat schoss. Robert Enke flog. Er wehrte den Ball ab. Es war die beste Parade seiner noch kurzen Profikarriere. Aber er genoss sie wohl schon nicht mehr.
In der Halbzeitpause sagte er verzweifelt zum Trainer: »Bitte wechseln Sie mich aus.«
»Darauf muss man auch erst einmal kommen«, sagt der Vater.
Ein Profi macht das nicht. Ein Profi kennt keine Schwäche.
Eberhard Vogel, der Trainer, erwiderte Robert Enke in der Halbzeitpause in Leipzig, er solle keinen Blödsinn reden, und ließ ihn bis zum Abpfiff weiterspielen. Danach stellte er ihn nie wieder ins Tor.
Die Mutter bemerkte, wie er zu Hause kaum noch redete, wie er nach dem Essen in sein Zimmer ging und die Tür hinter sich schloss. »Aber das kannte ich von Dirk doch auch schon so nach einem schlechten Hürdenrennen.«
Nach einer Woche entdeckte Robert Enke zögerlich das Lächeln wieder und fuhr zum Westbahnhof. Er dachte damals nicht darüber nach, er sah keinen Zusammenhang, aber in den restlichen sechs Monaten der Saison, in denen er wieder der junge Ersatztorwart war, von dem niemand etwas erwartete, war er auch wieder fröhlich, ausgeglichen. Er dachte allenfalls, es müsse an Teresa liegen.
Der Trainer hatte offen über den Vorfall in Leipzig geredet. »Dem Jungen fehlt jetzt das Selbstvertrauen. Er wollte, dass ich ihn in der Halbzeit rausnehme. Aber so einfach ist das nicht«, sagte Vogel den Sportreportern direkt nach dem Spiel.
Zehn Jahre später hätte dies das Ende für einen Torhüter sein können: Er machte einen Anfängerfehler und bettelte danach, zur Halbzeit verschwinden zu können. Die Nachricht wäre durch das Internet gegangen, über das Deutsche Sportfernsehen und unzählige anderen Medien verbreitet worden, die aus Zweitligaspielen mittlerweile ein Ereignis machen. Ein Ruf hätte sich in der klatschsüchtigen Profifußballszene zementiert: Der ist labil. Damals aber blieb die Nachricht in einer 16-Zeilen-Randmeldung in der Ostthüringischen Zeitung hängen.
Die Bundesligavereine, die bei seinen bemerkenswerten Jugend-Länderspielen auf ihn aufmerksam geworden waren, interessierten sich ungebrochen für ihn. Einige hatten in den zurückliegenden Jahren bei den Eltern vorgesprochen, darunter ein Herr von Bayer Leverkusen, der sagte: »Guten Tag, Reiner Calmund hier«, und dann Punkt und Komma nicht benutzte, der in vierzig Sekunden zehn Sätze unterbrachte. Den besten Eindruck hinterließen die Gesandten von Borussia Mönchengladbach. Denn anders als etwa Leverkusen oder der VfB Stuttgart, anders als üblich, schickte die Borussia nicht nur den Sportdirektor, sondern auch den Torwarttrainer.
Vor dem Abitur gehe er nicht fort, hatten ihm die Eltern auferlegt, nun aber rückte der Sommer 1996 näher, das Ende der Schulzeit.
Teresa überlegte laut, wo sie gemeinsam zur Universität gehen könnten, sie dachte an ein Lehramtsstudium oder Tiermedizin.
»Was hältst du von Würzburg?«
»Na ja, ich spiele ja auch noch Fußball.«
»Ist das denn so wichtig? Aber gut, in Würzburg gibt es sicher auch einen Verein.«
»Nein, also, ich meine Profifußball. Es gibt da einige Angebote.«
»Und?«
»Die bieten ja auch nicht das schlechteste Gehalt. In Mönchengladbach könnte ich 12 000 Mark im Monat verdienen.«
Also, dachte sich Teresa, da habe sie jetzt vielleicht doch ein klein wenig naiv geklungen dank ihrer Ignoranz in Sachen Fußball.
Wenige Tage, nachdem der Vater und Robert sich das erste Mal in Mönchengladbach mit den Machern der Borussia getroffen hatten, klingelte bei Dirk Enke das Telefon.
Pflippen am Apparat. Er sei der Berater von Günter Netzer gewesen, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Mehmet Scholl gehörten zu seinen Klienten. »Ich könnte Ihrem Sohn helfen.«
Gewöhnlich nahm ein Fußballagent einen Spieler unter Vertrag und kümmerte sich dann für ihn um die Vereinssuche. Damals aber ging es oftmals noch etwas bequemer für die Handvoll Agenten, die den Markt beherrschten. Über ihre Informanten in den Bundesligavereinen erfuhren sie, wenn der Klub einen jungen Fußballer verpflichten wollte, der noch ohne Berater war. Postwendend bot sich der Agent dem Spieler an. So lief es mit Norbert Pflippen und Borussia Mönchengladbach in den Achtzigern und Neunzigern wohl gerne einmal.
Pflippen, der Flippi, hatte eine Stärke: Er war einer der Ersten im Geschäft gewesen. So hielt sich jahrzehntelang sein Ruf, er sei einer der Besten.
Der Flippi besuchte die Enkes in Jena. Ein Mann mit fleischigen Unterarmen und hemdsärmligen Umgangsformen, sparte er nicht mit Anekdoten, wie er den Günter damals zu Real Madrid gebracht habe und den Lothar zu Inter Mailand. Es war eine Zeit, in der noch kaum ein Jugendspieler einen Berater hatte, und da bot sich dieser Mann aus den höchsten Sphären des Fußballs Robert Enke an. Ein bisschen fühlten sich die Enkes geehrt. Recht sympathisch war der Flippi in seiner launigen Art auch. Sie sahen darüber hinweg, dass er am Ende dann doch recht plump wurde. »Wenn wir ins Geschäft kommen«, raunte Pflippen dem Vater zu, »schenke ich Ihnen ein kombiniertes Telefon-Fax. Und«, er wandte sich an Robert, »du bekämst ein Auto von mir.«
Noch vor der mündlichen Abiturprüfung in Geografie, Thema: Gesteine, unterzeichnete Robert Enke im Mai 1996 einen von seinem Berater Norbert Pflippen ausgehandelten Dreijahresvertrag beim Erstligisten Borussia Mönchengladbach.
Einige Zeit zuvor hatte auf der A2 von Dortmund Richtung Osten der Motor eines kleinen Peugeots Funken geschlagen. Dann war unter der Motorhaube Rauch aufgestiegen. Mit so einem Auto zu fahren sei lebensgefährlich gewesen, das Öl und Kühlwasser seien leer, Ventile verstopft, erklärte der ADAC-Pannenhelfer den Enkes. Torsten Ziegner und Mario Kanopa waren nach einem Jugendländerspiel in Bocholt auch an Bord.
Dafür könne er aber nichts, rief der Flippi, dass sich der Gebrauchtwagen, den er Robert Enke geschenkt hatte, in solch einem Zustand befand.
ZWEI
Der Knall
Er lag am Boden, den Kopf im stellenweise schon braunen Gras. Er richtete den Blick auf, und in drei Metern Entfernung, auch auf Höhe der Grashalme, warteten zwei graublaue Augen auf ihn. Na, komm schon, sagten die Augen, starr vor Konzentration: Dir werde ich es zeigen.
Sie sollten sich gemeinsam aufwärmen.
Bäuchlings lagen sie sich im Strafraum des Trainingsplatzes gegenüber und warfen sich beidhändig den Ball zu. Ihre Körper waren wie biegsame Wippen, rhythmisch schwangen sie hoch und runter, nur ein kurzes, ersticktes Klatschen war zu hören, wenn der Ball im weichen Schaumstoff ihrer Torwarthandschuhe versank. Es reicht doch, dachte sich Robert Enke nach einigen Minuten, es ist doch nur Aufwärmen, warum hört er nicht endlich auf?
Robert Enke brauchte eine Woche in Mönchengladbach, um zu begreifen, dass Uwe Kamps nie aufhören würde. Er wollte ihn, Enke, den neuen Ersatztorwart, den potenziellen Rivalen, aufgeben sehen; ihn besiegen, in der kleinsten Aufwärmübung, jeden Tag.
Kamps hatte bereits über 300 Bundesligapartien für Borussia Mönchengladbach bestritten, er war 32, der Liebling der Fans und eigentlich, nach dem Training, doch umgänglich. Robert Enke war 19, der dritte Torwart, ein Junge. Er sollte in den ersten Jahren von Kamps lernen, und irgendwann würde er dann reif für die Nummer eins sein, hatte ihm Dirk Heyne gesagt, der Torwarttrainer, wegen dem er die Borussia anderen Bundesligisten vorgezogen hatte, der ihm sympathisch und kompetent erschien.
Er schaute zu Heyne. Der Torwarttrainer schwieg. Aber er hatte doch gesehen, was Kamps machte!
»Okay«, sagte der Torwarttrainer, »jetzt schießt euch den Ball auf Brusthöhe zu.«
Kamps schoss und schoss immer härter, immer fester, immer schneller. Er wollte sehen, wie Enke den Ball fallen ließ.
Abends, mit Abstand zum Training, lachte Robert Enke innerlich über die Erlebnisse, nicht ohne Sympathie für Kamps, was für ein Typ. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zum Training, erschien ihm die Sache wieder ernst. Er fragte sich, ob ein Bundesligatorwart so sein musste wie Kamps, und vor allem, ob er jemals so sein könnte.
Druck machen war das Bundesligamotto der Neunziger. Immer mussten alle Druck machen, der Trainer den Spielern, die Ersatzspieler dem Trainer über die Presse, der Ersatztorwart der Nummer eins, die Nummer eins den Ersatztorhütern und der Sportdirektor sowieso allen. Der Einzige, der Robert Enke in Jena jemals unter Druck gesetzt hatte, war er selbst gewesen.
Manchmal ging er nach dem Training in Mönchengladbach in den Kraftraum, weil man ihm sagte, das sei wichtig, weil das die meisten Mitspieler taten. Er hatte sich früher praktisch nie an die Fitnessmaschinen gesetzt, sie bedeuteten ihm nichts. Er musste nicht zusätzlich trainieren, er hatte das Talent. Im Kraftraum gab es keine Fenster. Kamps war meistens schon mit Jörg Neblung da, dem Athletiktrainer. Die beiden maßen sich im Bankdrücken. Neblung, ein ehemaliger Zehnkämpfer, hatte mit seinen langen Beinen aufgrund der Hebelwirkung eigentlich keine Chance, so viel Gewicht zu drücken wie der kleine, bullige Kamps, aber der Sportler in Neblung lebte, er pumpte, er drückte, er legte 120 Kilo vor, und Kamps zog nach, er wollte ihn übertreffen, unbedingt, jedes Mal. Robert Enke tat, als ob er gar nicht hinschaute.
»Na, soll ich dir die Gewichte runternehmen?«, sagte Kamps, als er sah, dass sich Enke an einer Hantel versuchte, »am besten nimmst du nur die Stange, damit du dich nicht überhebst.« Kamps lachte, wie man über gute Witze lacht.
So sollte ein gutes Verhältnis unter Torhütern sein, fand Kamps; sportlich fair, herzlich hart.
»Uwe genoss es, aus allem einen Wettkampf zu machen«, sagt der Athletiktrainer Neblung. »Er hatte eine hochprofessionelle Einstellung, er verließ immer als Letzter das Trainingsgelände. Nur mit solch einer Berufsauffassung konnte ein Profi Erfolg haben, da waren wir uns damals sicher.« Mit seinem kompromisslosen Trainingsfleiß hatte Kamps seine natürlichen Nachteile überwunden, eigentlich schien er zu klein für einen Torwart, doch trotz seiner Größe von nur 1,80 Metern hielt er sich schon ein Jahrzehnt unerschütterlich im Tor der Borussia.
Der Athletiktrainer versuchte, den neuen Torwart zu einem ähnlichen Krafttraining wie Kamps zu überreden. Enke besaß eine breite Schulterachse, aber die dünnen Arme und Beine eines ungeformten Teenagers. »In ihm schlummerte ein Athlet«, sagt Neblung. Der Athletiktrainer hatte als ehemaliger Leichtathlet bei den Fußballern zunächst einen schweren Stand, denn Leichtathlet wurde man doch, weil man nichts am Ball konnte. Nach und nach waren mehr Spieler zu ihm gekommen, »Jörg, wir müssen dehnen«; »ey, Neblung, ich will was für meine Schnelligkeit tun«. In seinem dritten Jahr bei der Borussia war er in der Elf endlich halbwegs etabliert, da insistierte er nicht, als sich Robert Enke beharrlich einem gezielten Athletiktraining verweigerte. Er war doch nur der dritte Torwart. »Er trat nicht wirklich in Erscheinung«, sagt Neblung.
Als Schüler war er auf andere zugegangen. Als dritter Torwart wurde er zum Beobachter.
Borussia Mönchengladbach hatte in der Saison zuvor den DFB-Pokal gewonnen, die erste Trophäe seit sechzehn Jahren. Die Pokalsieger hatten Heldenverträge erhalten. Finanziell waren die Gehaltserhöhungen von beängstigendem Wagemut, aber Manager Rolf Rüssmann dachte zuerst an mögliche Erfolge und danach an Kreditrückzahlungsmodelle. Jäh war die Erwartung erwacht, dies könnten noch einmal die Siebzigerjahre werden, als der Verein das Utopia der Avantgarde war. Mit langhaarigen Spielern und freigeistigem Fußball hatte die Borussia Meisterschaften in Serie erobert. Nun besaß Mönchengladbach mit dem Weltklassemann Stefan Effenberg, mit Martin Dahlin oder Christian Hochstätter wieder Figuren. Sie demonstrierten ihren Stellenwert auch gerne.
Im Bus vom Trainingsplatz in Rönneter zurück zu den Duschen im Stadion am Bökelberg musste Robert Enke stehen. Es gab nicht genug Sitzplätze. Die Jüngsten blieben im Gang. Sollten erst einmal etwas leisten, fanden die Älteren.
Als der Bus von der Kaldenkirchener scharf in die Bökelbergstraße einbog, stieß Robert Enke mit einem anderen der stehenden Jungen zusammen, Marco Villa. Villa war 18 und schmächtig. Als ihn Trainer Bernd Krauss zu Beginn der Saison in den Angriff schickte, weil die Etablierten keine Siege brachten, schoss Villa drei Tore in seinen ersten sieben Erstligaspielen. Das gab es noch nie in 33 Jahren Bundesliga. Wer etwas leistete, wer richtig Druck machte, der wurde auch mit 18 akzeptiert, erkannte Robert Enke an Villa.
Villa schmierte den Älteren Seife in die Unterhose, während diese in der Dusche standen. Und die Älteren lachten.
Er tat es nicht, um aufzumucken. Er wollte nur Spaß haben. »Ich habe nicht viel nachgedacht«, sagt Marco Villa. »Im Prinzip wollte ich nur aufgenommen werden bei den Etablierten im Team wie Effenberg oder Kalle Pflipsen. Ich wollte so sein wie sie.«
Als Kamps Villa eines Tages von oben herab belehrte, antwortete er: »Weißt du, Uwe, es gibt Spieler, die respektiert werden, und solche, die gerne respektiert werden möchten. Du gehörst zu den zweiten.« »Uiuiui!«, rief Christian Hochstätter, der mit 33 gerne den Stammesältesten des Teams gab.
Wenn Villa sich mit 18 erlaubte, was kein 18-Jähriger sich bei der Borussia erlauben durfte, grinsten die Älteren innerlich, und der Große Effenberg schlug ihm auf die Schultern. Villa schoss Tore, und zudem gibt es Menschen, die jeder sofort mag, ohne genau zu verstehen, warum. Marco Villa gehört dazu.
Robert Enke machte nie Scherze mit Seife und Unterhosen. Aber er war auf wunderbar schwerelose Art glücklich, wenn andere in seiner Nähe albern waren.
Manager Rolf Rüssmann betrat die Umkleidekabine.
»Hat mal einer Gesichtscreme? Meine Haut ist so trocken.«
»Hier«, sagte Außenverteidiger Stephan Passlack.
Fünf Minuten später war Rüssmanns Gesicht in eine Kunststoffmaske gepresst. Passlack hatte ihm Haargel gegeben.
Nach dem Training war Robert Enke schnell zu Hause. Es waren nur fünf Minuten vom Bökelberg zu ihrer Wohnung im Loosenweg. Er blieb nicht, wenn die anderen Fußballer noch etwas essen gingen. Er dachte, dass er nicht dabei sein sollte, der Neuling, der dritte Torwart.
Drei- und vierstöckige Mietblöcke aus ockerbraunen Klinkersteinen stehen im Loosenweg nebeneinander, hier läuft die Stadt aus. In den Gärten wehen heute Deutschlandfahnen. Damals standen Porzellangänse mit Schleifchen um den Hals auf dem Rasen des Gemeinschaftsgartens.
Obwohl Robert bereits zur Gehaltsklasse der Besserverdienenden gehörte, überwiesen Teresas Eltern monatlich die Hälfte der Miete. So wie es sich nach ihren Vorstellungen im Studium der Tochter gehörte.
Jeden Tag fuhr Teresa die dreißig Kilometer zur Universität nach Düsseldorf, Studiengang Lehramt, Fächer Sport und Deutsch, und nach den Vorlesungen fuhr sie wieder nach Hause. Sie wollte bei Robert sein, auch schienen die anderen Studenten bereits feste Freundeskreise in den Wohnheimen gefunden zu haben. Sie wusste nicht recht, wie sie sich integrieren sollte. Plakate kündigten eine große Mensaparty an, und sie beschloss, mit Robert zu dem Fest zu gehen.
Die meiste Zeit standen sie allein da.
Sie musste plötzlich an ihre alte Schulfreundin Chris aus Bad Windsheim denken. Melancholisch schickte sie der alten Freundin eine SMS: »Weißt du noch, wie wir mit 13 immer im Café Ritter saßen und uns das Universitätsleben vorstellten, mit der täglichen Frage: Gehen wir in eine Vorlesung oder doch ins Café?«
Nur der Studentenjob erinnerte sie an ihre ursprüngliche Idee vom Universitätsleben. Sie arbeitete in einem Schuhgeschäft. »Leider habe ich dreißig Prozent Rabatt bekommen, da war das verdiente Geld noch im Laden schnell wieder ausgegeben.«
Er staunte, wie leichtherzig sie ihr Geld für Schuhe ausgab. Ihm fiel es schwer, sich etwas Teures zu kaufen. Auf sein Geld, fand er, müsse man aufpassen.
»Entschuldigung«, sagte der Bankangestellte, als Teresa einmal Geld vom gemeinsamen Konto abhob, »aber bei Ihrem Kontostand frage ich mich gerade, ob Ihr Freund und Sie das Geld nicht mal irgendwie anlegen wollen?«
Robert Enkes Gehalt ging auf sein Girokonto, und dort ließ er es liegen. Er hatte Flippis gebrauchten Peugeot gegen einen kleinen Audi getauscht, er kaufte sich zweimal im Jahr Kleidung, Sommer wie Winter im Schlussverkauf, und hatte ansonsten wenig Wünsche, die man sich mit Geld erfüllte. Er lag gerne mit Teresa zu Hause auf dem Sofa.
Wenn sie für die Universität lernte, schaltete er den Fernseher ein oder las Zeitung, gelegentlich einen Kriminalroman, aber er ging nicht aus. Er wartete darauf, dass sie mit dem Lernen fertig wurde.
Als Teresa ein Jahrzehnt später am Tag nach seinem Tod mit ihren offenen Worten über Roberts Depressionen die Öffentlichkeit bewegte, werden viele in ihr die starke Frau gesehen haben, die doch hinter jedem starken Mann stehe. Ihre Freunde dagegen haben in all den Jahren davor das Gefühl gehabt, dass die beiden einfach immer füreinander da waren. In Mönchengladbach, zum ersten Mal gemeinsam alleine in einer fremden Stadt, entstand eine vollkommene Nähe zwischen ihnen. »Wir gehen ja auch mal ohne Frauen aus«, sagt Torsten Ziegner, der Ziege, der Freund aus Jena, »das gab es beim Enkus eigentlich nicht. Wenn du mit dem Enkus verabredet warst, warst du mit ihm und Teresa verabredet.«
Sie waren glücklich in der frischen Unabhängigkeit von den Eltern, mit all den Erfahrungen dieser Lebensphase, die einem später auf so milde Art peinlich sind: das unkontrollierte Herumgammeln, der Wäscheständer als Kleiderschrankersatz, der erste selbst gekaufte Badvorleger. Aber die Liebe und die große Freiheit des eigenständigen Lebens konnten ein Unbehagen nur überdecken, nicht tilgen. »Wir waren zwei 19-Jährige, die eigentlich in eine Wohngemeinschaft gehörten, die Monate zuvor noch Teil einer Gruppe in Jena gewesen waren«, sagt Teresa. »Und plötzlich waren wir in diese fremde Kleinstadt ohne Studentenszene geworfen worden, wo wir keine Freunde hatten und sie auch nicht so leicht fanden.« Manchmal fragte sie sich: Das also war das Erwachsenenleben?
Jeden sechsten Freitag putzte Teresa oder Robert das Treppenhaus. Die anderen fünf Mietparteien im Haus hatten beschlossen, die zwanzig Mark für die Putzfrau zu sparen. Einmal kam Teresa freitags spät von den Vorlesungen, Robert war zu einem Spiel mit Borussias Reserveelf unterwegs. Sie würde die Treppe samstags putzen, dachte Teresa. Am Freitagabend klingelte es an ihrer Tür.
Corinna, eine ordentliche Nachbarin, stand vor Teresa.
»Die Treppe ist nicht geputzt!«
»Ich weiß. Robbi ist nicht da, und ich bin ziemlich müde von der Universität. Ich mache es morgen, gleich in der Früh.«
»Die Treppe muss freitags geputzt werden!«
Corinna klingelte immer öfter. Die Treppe sei an den Rändern nicht richtig geputzt. Jemand sei mit dreckigen Schuhen über die noch nasse Treppe gelaufen.
Robert gab sich Mühe, der Frau unverändert mit zurückhaltender Höflichkeit zu begegnen. Teresa zog nach ein paar Wochen freitags eingeschüchtert die Schuhe unten am Hauseingang aus und ging in Strumpfsocken die Treppen hinauf in den dritten Stock.