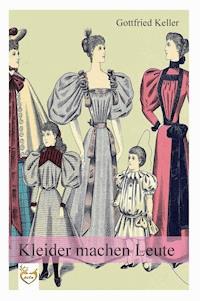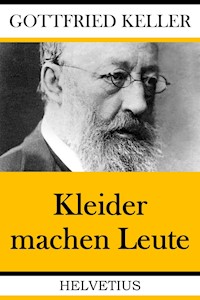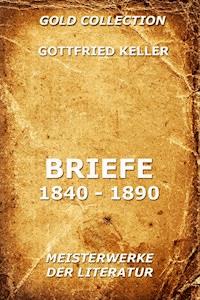Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der grüne Heinrich von Gottfried Keller ist ein teilweise autobiographischer Roman, der neben Goethes Wilhelm Meister und Stifters Nachsommer als einer der bedeutendsten Bildungsromane der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts gilt. In seiner ersten Fassung beginnt der Roman mit dem Auszug Heinrichs aus der Schweiz. Seine Mutter packt ihm den Koffer, er nimmt Abschied von den Handwerkern, die im Haus der verwitweten Mutter wohnen; es wird deutlich, dass sie alleinstehend ist. Auf der Reise begegnet Heinrich in Süddeutschland einem Grafen mit Frau und Tochter, "überbürgerlichen Wesen", die ihn faszinieren. In München findet er ein Zimmer, packt seinen Koffer aus - und in demselben befindet sich ein Manuskript, in dem Heinrich seine Kindheitserinnerungen festgehalten hat, und die werden nun eingeblendet ... (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1342
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der grüne Heinrich (Erste Fassung)
Gottfried Keller
Inhalt:
Gottfried Keller – Biografie und Bibliografie
Der grüne Heinrich (Erste Fassung)
Vorwort
Erster Band
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Eine Jugendgeschichte
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zweiter Band
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Dritter Band
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Vierter Band
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Der grüne Heinrich (Erste Fassung), Gottfried Keller
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849618445
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Gottfried Keller – Biografie und Bibliografie
Hervorragender Dichter, geb. 19. Juli 1819 in Zürich, gest. daselbst 16. Juli 1890, widmete sich zuerst der Landschaftsmalerei und verweilte zu seiner künstlerischen Ausbildung 1840–42 in München; von bitterer Not gezwungen, kehrte er in die Heimat zurück, wo er sich bald darüber klar wurde, daß er mehr zur Poesie als zur Malerei begabt war. Die erste Sammlung seiner »Gedichte« (Heidelb. 1846) fand den Beifall berufenster Kenner, wie Varnhagen, und mit Hilfe eines Züricher Staatsstipendiums konnte K. 1848 für mehrere Jahre nach Heidelberg gehen, um an der Universität und im Verkehr mit Ludwig Feuerbach, Hermann Hettner u. a. seine Bildung zu ergänzen und zu vollenden. 1850 zog er nach Berlin, zunächst um seine Kenntnis des Theaters zu bereichern, denn er wollte Dramatiker werden. Er blieb daselbst bis Dezember 1855, gewann allerdings viel Einsicht in die dramatische Kunst, vollendete aber keinen seiner dramatischen Entwürfe; dagegen gelangen ihm zahlreiche lyrische Erzeugnisse, die er in einer zweiten Sammlung: »Neue Gedichte« (Braunschw. 1851), vereinigte, und vor allem der große autobiographische Roman: »Der grüne Heinrich« (das. 1854–55, 4 Bde.; neue Bearbeitung, Stuttg. 1879–80), mit dem er sich in die vorderste Reihe der deutschen Dichter stellte. Er hat darin die Geschichte seines eignen Irrtums in der Berufswahl sowie seiner künstlerischen und religiösen Entwickelung in ungemein gedankenreicher Weise und poetischer Fülle dargestellt. Bald darauf erschien der erste Band seiner Erzählungen »Die Leute von Seldwyla« (Braunschw. 1856; mit den Meisterstücken: »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, »Die drei gerechten Kammacher«), die wegen der Anmut ihres Humors, der Tiefe ihrer Poesie und der Kraft der Gestaltung die Bewunderung aller Einsichtigen errangen, aber nur sehr langsam den Weg zum großen Publikum fanden. 1861 wurde K. zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich ernannt und blieb es bis 1876 in so reger amtlicher Tätigkeit, daß ihm dichterisches Schaffen kaum möglich war. Erst nach seinem Rücktritt konnte er alte und neue poetische Pläne ausführen, und nun erst kam die Blütezeit seines literarischen Ruhmes. Noch kurz vorher waren die reich vermehrte 2. Auflage seiner »Leute von Seldwyla« (Stuttg. 1873–74, 4 Bde.; 36. Aufl. 1904) sowie die höchst anmutigen und geistvoll heitern »Sieben Legenden« (das. 1872, 28. Aufl. 1903) erschienen, in denen ein ganz neuer Ton der Ironie gegen die Kirche angeschlagen war. Nun schrieb K. die oben erwähnte Neubearbeitung seines »Grünen Heinrich« (29. Aufl. 1903), dessen erster tragischer Schluß einem tröstlichern, kontemplativen Ende weichen mußte (vgl. Leppmann, G. Kellers »Grüner Heinrich« von 1854/55 u. 1879/80, Berliner Diss., 1902), und eine neue Sammlung: »Züricher Novellen« (Stuttg. 1878, 2 Bde.; 32. Aufl. 1903), darin die Meisterwerke: »Der Landvogt von Greifensee« und »Das Fähnlein der sieben Aufrechten«. In dem folgenden Novellenzyklus »Das Sinngedicht« (Berl. 1882, 28. Aufl. 1903) fand jene lebensfreudige Gesinnung des Dichters, die allen seinen Werken eigentümlich ist, erhöhten Ausdruck; und gegen die unerfreulichen Auswüchse der Zeit schwang er die Geißel des satirischen Humors in dem Roman »Martin Salander« (das. 1886, 24. Aufl. 1903), der sich durch Klarheit der Komposition und Schönheit der Gestaltung auszeichnet. Eine mit den im Laufe der Jahre entstandenen neuen Versen vermehrte Ausgabe seiner Lyrik veranstaltete K. in den »Gesammelten Gedichten« (Berl. 1883; 17. Aufl. 1903, 2 Bde.); hier erschien er als ein männlich herber, zur Satire geneigter, aber inniger Sänger ganz eigner Art. Kellers Poesie wurzelt tief im heimisch schweizerischen Volkscharakter, den er stets mit glühender Liebe umfaßte, auch seine Sprache behielt die schweizerische Färbung bei. Er ist ausgezeichnet durch echt männliche ideale Gesinnung, kernigen Humor, anschauliche und originelle Phantasie und durch ein großartiges Darstellungsvermögen. Als epischer Dichter gehört er zu den ersten Meistern des Jahrhunderts. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Klassiker des 19. Jahrhunderts« (in Band 11). Die Ausgabe seiner »Gesammelten Werke« (Berl. 1889–90, 10 Bde.; seitdem mehrfach aufgelegt, zuletzt Stuttg. 1904), besorgte K. noch selbst. Nach seinem Tod erschienen: »Nachgelassene Schriften und Dichtungen« (Berl. 1893) und »Gottfried Kellers Leben. Seine Briefe und Tagebücher«, herausgegeben von Jakob Bächtold (Berl. 1892–96, 3 Bde. in mehreren Auflagen; dazu als Nachtrag die »Gottfried Keller-Bibliographie«, das. 1897; kleine Ausgabe der Biographie, ohne die Briefe und Tagebücher, das. 1898); den »Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Gottfried K.« veröffentlichte Köster (das. 1904). Vgl. F. Th. Vischer, Altes und Neues, Heft 2 (Stuttg. 1881); Brahm, Gottfried K. (Leipz. 1883); Brenning, Gottfried K. nach seinem Leben und Dichten (Brem. 1891); Kambli, Gottfried K. nach seiner Stellung zu Religion und Christentum etc. (St. Gallen 1892); Frey, Erinnerungen an Gottfried K. (2. Aufl., Leipz. 1893); Brun, Gottfried K. als Maler (Zürich 1894); E. v. Berlepsch, Gottfried K. als Maler (Leipz. 1894); H. v. Treitschke in Bd. 4 seiner »Historischen und politischen Aufsätze« (das. 1897); A. Köster, Gottfried K., sieben Vorlesungen (das. 1899); F. Baldensperger, G. K., sa vie et ses œuvres (Par. 1899); Ricarda Huch, Gottfried K. (6. Aufl., Berl. 1904).
Der grüne Heinrich (Erste Fassung)
Vorwort
Von diesem Buche liegt der erste Band schon seit zwei Jahren, der zweite seit einem Jahre fertig gedruckt, während die Beendigung des dritten und vierten Bandes durch verschiedenes Ungeschick bis vor kurzem verzögert wurde. Absicht und Motive blieben dabei unverändert dieselben wie am ersten Tage der Konzeption, während in der Ausführung während mehrerer Jahre der Geschmack des Verfassers sich notwendig ändern mußte, oder ehrlich herausgesagt: ich lernte über der Arbeit besser schreiben. Die ersten Bogen dieses Romanes datieren noch aus dem Jahr 1847, die letzten entstanden in diesen Tagen, und die Entstehungsweise des Ganzen gleicht derjenigen eines ausführlichen und langen Briefes, welchen man über eine vertrauliche Angelegenheit schreibt, oft unterbrochen durch den Wechsel und Drang des Lebens. Man läßt den Brief ganze Zeiträume hindurch liegen, man wird vielfältig ein anderer; aber wenn man das Geschriebene wieder zur Hand nimmt, fährt man genau da fort, wo man aufgehört hatte, und wenn sich auch in dem, was man betont oder verschweigt, der Wechsel des Lebens kundtut, findet sich doch, daß man gegen den, an welchen der Brief gerichtet, und in dieser Sache der alte geblieben ist. Man hat den Brief mit einer gewissen redseligen Breite begonnen, welche eher von Bescheidenheit zeugt, indem man sich kaum Stoffes genug zutraute, um den ganzen schönen Bogen zu füllen. Bald aber wird die Sache ernster; das Mitzuteilende macht sich geltend und verdrängt die gemütlich ausgeschmückte Gesprächigkeit, und endlich zwingt sich von selbst, und noch gedrängt durch die äußeren Ereignisse und Schicksale, nicht eine theoretische, sondern im Augenblick praktische Ökonomie in die in der Eile besonnene Feder, so daß nur das Wesentliche sich lösen darf aus dem Fluge der Gedanken, um sich gegen den Schluß des Briefes hin wenigstens soviel Raum zu erkämpfen, als nötig ist, mit der warmen Liebe des Anfanges zu endigen. So entsteht freilich nicht ein streng gegliedertes Kunstwerk, aber vielleicht ein um so treuerer Ausdruck dessen, was man war und wollte mit dem Briefe. Eine andere Frage aber ist es nun, ob das Gleichnis hinreiche, eine gewisse Unförmlichkeit vorliegenden Romanes zu entschuldigen oder zu beschönigen. Ich bin weit entfernt, dies versuchen zu wollen; einzig und allein möchte ich durch das Gleichnis die Hoffnung andeuten, der geneigte Leser werde wenigstens, wenn auch nicht den Genuß eines reinen und meisterhaften Kunstwerkes, so doch den Eindruck einer wahr empfundenen und mannigfach bewegten Mitteilung davontragen. – Besagte Unförmlichkeit hat ihren Grund hauptsächlich in der Art, wie der Roman in zwei verschiedene Bestandteile auseinanderfällt, nämlich in eine Selbstbiographie des Helden, nachdem er eingeführt ist, und in den eigentlichen Roman, worin sein weiteres Schicksal erzählt und die in der Selbstbiographie gestellte Frage gewissermaßen gelöst wird. Der eine dieser Teile ist viel zu breit, um als Episode des andern zu gelten, und so bleibt nur zu wünschen, daß die Einheit des Inhaltes beide genugsam möge verbinden und die getrennte Form vergessen lassen. Über den eigentlichen Inhalt weiß ich hier nichts zu sagen, als daß man das Buch leider als ein Tendenzbuch wird ansehen können, während es in der Tat nur insofern ein solches ist, als es mit Absicht nichts verschweigt, was in den notwendigen Kreis seines Stoffes gehört. Stoff und Form aber will ich hiemit bescheidenst dem ungewissen Stern jedes ersten Versuches anheimstellen.
Berlin 1853
Der Verfasser
Erster Band
Erstes Kapitel
Zu den schönsten vor allen in der Schweiz gehören diejenigen Städte, welche an einem See und an einem Flusse zugleich liegen, so daß sie wie ein weites Tor am Ende des Sees unmittelbar den Fluß aufnehmen, welcher mitten durch sie hin in das Land hinauszieht. So Zürich, Luzern, Genf; auch Konstanz gehört gewissermaßen noch zu ihnen. Man kann sich nichts Angenehmeres denken als die Fahrt auf einem dieser Seen, z.B. auf demjenigen von Zürich. Man besteige das Schiff zu Rapperswyl, dem alten Städtchen unter der Vorhalle des Urgebirges, wo sich Kloster und Burg im Wasser spiegeln, fahre, Huttens Grabinsel vorüber, zwischen den Ufern des länglichen Sees, wo die Enden der reichschimmernden Dörfer in einem zusammenhängenden Kranze sich verschlingen, gegen Zürich hin, bis, nachdem die Landhäuser der Züricher Kaufleute immer zahlreicher wurden, zuletzt die Stadt selbst wie ein Traum aus den blauen Wassern steigt und man sich unvermerkt mit erhöhter Bewegung auf der grünen Limmat unter den Brücken hinwegfahren sieht. Das ganze Treiben einer geistig bedeutsamen und schönen Stadt drängt sich an den leicht dahinschwebenden Kahn. Soeben versammelt sich der gesetzgebende Rat der Republik. Trommelschlag ertönt. In einfachen schwarzen Kleidern, selten vom neuesten Schnitte, ziehen die Vertreter des Volkes auf den Ufern dahin. Auch die Gesichter dieser Männer sind nicht immer nach dem neusten Schnitte und verraten durchschnittlich weder elegante Beredsamkeit noch große Belesenheit; aber aus gewissen Strahlen der lebhaften Augen leuchtet Besonnenheit, Erfahrung und das glückliche Geschick, mit einfachem Sinn das Rechte zu treffen. Von allen Seiten wandeln diese Gruppen, je nach den Tagesfragen und der verschiedenen Richtung begrüßt oder unbegrüßt vom zahlreichen emsigen Volke, nach dem dunklen schweren Rathause, das aus dem Flusse emporsteigt. Stolz neben diesen Gestalten hin rasseln diplomatische Fremdlinge über die Brücken in wunderlichem Aufputze, und ihre komischen Livreen ergötzen, wie billig, einen Augenblick lang das einfache Volk. Zwischendurch steuert der deutsche Gelehrte mit gedankenschwerer Stirne nach seinem Hörsaal; sein Herz ist nicht hier, es weilt im Norden, wo seine tiefsinnigen Brüder, in zerrissenen Pergamenten lesend, finstere Dämonen beschwörend, sich ein Vaterland und ein Gesetz zu gründen trachten. Ausgeworfen von der Gärung dieses großen Experimentes, begegnet ihm der Flüchtling mit unsichern, zweifelhaften Augen und kummervollen Mienen und vermehrt die Mannigfaltigkeit und Bedeutung dieses Treibens. Jetzt ertönt das Getöse des Marktes von einer breiten Brücke über unserm Kopfe; Gewerk und Gewerb summt längs des Flusses und trübt ihn teilweise, bis die rauchende Häusermasse einer der größten industriellen Werkstätten voll Hammergetönes und Essensprühen das Bild schließt. Aus dem pfeilschnell vorübergeflossenen Gemälde haben sich jedoch zwei Bilder der Vergangenheit am deutlichsten dem Sinne eingeprägt rechts schaute vom Münsterturme das sitzende riesige Steinbild Karls des Großen, eine goldene Krone auf dem Lockenhaupt, das goldene Schwert auf den Knien, über Strom und See hin; links ragte auf steilem Hügel, turmhoch über dem Flusse, ein uralter Lindenhain, wie ein schwebender Garten und in den schönsten Formen, grün in den Himmel. Kinder sah man in der Höhe unter seinen Lautgewölben spielen und über die Brustwehr herabschauen. Aber schon fährt man wieder zwischen reizenden Landhäusern und Gewerben, zwischen Dörfern und Weinbergen dahin, die Obstbäume hangen ins Wasser, zwischen ihren Stämmen sind Fischernetze ausgespannt. Voll und schnell fließt der Strom, und indem man unversehens noch einmal zurückschaut, erblickt man im Süden die weite schneereine Alpenkette wie einen Lilienkranz auf einem grünen Teppich liegen. Jetzt lauscht ein stilles Frauenkloster hinter Uferweiden hervor, und da nun gar eine mächtige Abtei aus dem Wasser steigt, so befürchtet man die schöne Fahrt wieder mittelalterlich zu schließen; aber aus den hellgewaschenen Fenstern des durchlüfteten Gotteshauses schauen statt der vertriebenen Mönche blühende Jünglinge herab, die Zöglinge einer Volkslehrerschule. So landet man endlich zu Baden, in einer ganz veränderten Gegend. Wieder liegt ein altes Städtchen mit mannigfachen Türmen und einer mächtigen Burgruine da, doch zwischen grünen Hügeln und Gestein, wie man sie auf den Bildern der altdeutschen Maler sieht. Auf der gebrochenen Veste hat ein deutscher Kaiser das letzte Mahl eingenommen, eh er erschlagen wurde; jetzt hat sich der Schienenweg durch ihre Grundfelsen gebohrt.
Denkt man sich eine persönliche Schutzgöttin des Landes, so kann die durchmessene Wasserbahn allegorischerweise als ihr kristallener Gürtel gelten, dessen Schlußhaken die beiden alten Städtchen sind und dessen Mittelzier Zürich ist, als größere edle Rosette.
So haben Luzern oder Genf ähnliche und doch wieder ganz eigene Reize ihrer Lage an See und Fluß. Die Zahl dieser Städte aber um eine eingebildete zu vermehren, um in diese, wie in einen Blumenscherben, das grüne Reis einer Dichtung zu pflanzen, möchte tunlich sein indem man durch das angeführte, bestehende Beispiel das Gefühl der Wirklichkeit gewonnen hat, bleibt hinwieder dem Bedürfnisse der Phantasie größerer Spielraum, und alles Mißdeuten wird verhütet.
Unser See bildet scheinbar ein weites ovales Becken, welches aus den bläulichen Farbenabstufungen des umgebenden Gebirges nur ahnen läßt, daß in der Ferne da und dort das Wasser in Buchten ausläuft und in den verschiedenen Seitentälern neue Seen bildet. Aus dem Hintergrunde der klaren Gewässer steigt die mächtige Gletscherwelt empor, senkt sich dann, im Kranze um den See herum, zum flachern Gebirge herab, bis sich dieses in zwei schönen Bergen schließt, welche den mäßigen Strom zwischen sich durchtreten lassen, in das ebene Land hinaus. Am jenseitigen Berge, der seinen sonnigen runden Abhang, dem Süden zugewendet, aus dem See erhebt, liegt die Stadt hingegossen, fast von seinem Scheitel bis in das Wasser herunter, daß ihr steinerner Fuß sich noch in die spülende Flut hineintaucht. Vom diesseitigen Berge aber, welcher aus schroffen waldbewachsenen Felsen besteht, kann man in die Stadt hinein und hinüber schauen, wie in einen offenen Raritätenschrein, so daß die kleinen fernen Menschen, die in den steilen alten Gassen herumklimmen, sich kaum vor unserm Auge verbergen können, indem sie sich in ein Quergäßchen flüchten oder in einem Hause verschwinden. Es ist eine seltsame Stadt, mit einem altergrauen Haupte und neuen glänzenden Füßen. Denn der Verkehr und das tätige Leben haben unten am Ufer, wo die befrachteten Schiffe ab- und zugehen, nichts Altes und Unbequemes gelassen und die Steinmasse fortwährend erneuert, während das Alter sich am Berge hinaufflüchtete, mitten an demselben, auf einem platten Vorsprunge in der kühlen byzantinischen Stadtkirche ausruhte und oben zuletzt auf der halbzerfallenen Burg stehenblieb. Seinen innigen Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Leben beweist es jedoch in den riesenhaften Burglinden, welche ewig grün ihre Aste zu einem mächtigen Kranze verschlingen hoch über der Stadt, unmittelbar unter dem Himmel. Wo der Fluß sich schon merklich verengt und seine eigene Strömung annimmt, steht noch ein malerisches festes Brückentor und sendet eine lange hölzerne Brücke herüber, bedeckt von einem altertümlichen Dache, dessen Gebälke mit Schnitzwerk und verblichenen Schildereien überladen ist. Diesseits empfängt sie wieder ein grauer Turm, und aus diesem hervor führen mehrere Wege, teils dem Flusse entlang nach der Fläche hinaus, teils auf jähen Steigen auf den Felsenberg. An dessen Mitte ragt ebenfalls ein beträchtliches Plateau hinaus; es trägt, wie es oft bei Flußstädten vorkommt, eine Art Anhängsel oder kleinern Teil der Stadt, bestehend aus einem Kastell und ehemaligen Kloster, deren innere Räume und Höfe vollständig mit Gräbern angefüllt sind, da sie der Stadt schon seit Jahrhunderten zum Kirchhofe dienen. Die Gebäude aber enthalten ein Irrenhaus, ein Armenhaus oder Hospital und dergleichen mehr. Seltsam und düster haben sich Tod und Elend zwischen dem alten winklichten Gemäuer eingenistet, aus dessen Dunkelheiten die herrliche schimmervolle Landschaft das Auge um so mehr blendet. Und über die Gräber hin führt der Weg dann vollends, sich durch efeubewachsene Nagelflühe emporwindend, auf den Berg, wo er sich in einem weitgedehnten prächtigen Buchenwalde verliert.
Unter einer offenen Halle dieses Waldes ging am frühsten Ostermorgen ein junger Mensch; er trug ein grünes Röcklein mit übergeschlagenem schneeweißen Hemde, braunes dichtwallendes Haar und darauf eine schwarze Samtmütze, in deren Falten ein feines weiß und blaues Federchen von einem Nußhäher steckte. Diese Dinge, nebst Ort und Tageszeit, kündigten den zwanzigjährigen Gefühlsmenschen an. Es war Heinrich Lee, der heute von der bisher nie verlassenen Heimat scheiden und in die Fremde nach Deutschland ziehen wollte; hier heraufgekommen, um den letzten Blick über sein schönes Heimatland zu werfen, beging er zugleich den Akt eines Naturkultus, wie es häufig bei hoffnungsreichen und enthusiastischen Jünglingen geschieht.
Sowenig, außer dem tiefen ruhigen Strömen des Flusses, ein Ton in dieser Frühe hörbar wurde, ebensowenig war an der weiten tiefen himmlischen Kristallglocke der leiseste Hauch eines Wölkleins zu sehen. Der weite See verschmolz mit den Füßen des Hochgebirges in eine blaugraue Dämmerung; die Schneekuppen und Hörner standen milchblaß in der Frühe. Als Heinrich an den Rand des Waldes trat, überflog der erste Rosenschimmer der nahenden Sonne die geisterhaften Gebilde; über dem letzten einsamen Eisaltar glimmte noch der Morgenstern.
Indem unser Knabe starr nach ihm hinsah, tat er einen jener stummen, flüchtigen Gebetseufzer, die, wenn sie in Worte zu fassen wären, ungefähr so lauten würden Das ist sehr schön, o Gott ich danke dir dafür, ich gelobe, das Meinige auch zu tun! Wo und wer du auch seist, habe Nachsicht mit mir, du weißt, wie alles kommt in deiner Welt, übrigens mache mit mir, was du willst!
Die Brust des jungen Menschen hob und senkte sich sehr stark; aber seine Seele war so keusch, daß er vor allem pathetischen Verweilen, vor aller Selbstgefälligkeit solcher Augenblicke floh, ehe sich obige wenigen Sätze in seinem Sinne deutlich entwickeln konnten. Also drehte er sich wie der Blitz auf seinem Absatze herum und eilte, nach Norden und Westen zu schauen. Die Sonne war aufgegangen; während im Süden die Alpenkette nun im fröhlichsten hellsten Golde glänzte, hatte das westliche und nördliche flache Land, gegen das Rheingebiet hin, die Rosenfarbe des Morgens angenommen, besonders wo sich die laublosen, für diese Farbe empfänglichen Waldungen und violetten Brachfelder dehnten; was junggrünes Saatland war, schimmerte mehr silbergrau in der Ferne. Von Schnee war außer dem Gebirge keine Spur mehr zu finden; aber das wenige Grün war noch trocken und taulos.
Die Tiefe des Himmels und mit ihr das Gewässer waren jetzt blau und das Land sonnig geworden. Nur der untere Teil der Stadt und der Fluß lagen noch im Schatten, und letzterer ging tief grün, und bloß die länglich ziehenden Spiegel seiner Wellen warfen von ihren glattesten Stellen etwas Blau zurück.
Heinrich Lee sah in seine Vaterstadt hinüber. Die alte Kirche badete im Morgenschein, hie und da blitzte auch ein geöffnetes Fenster, ein Kind schaute heraus und sang, und man konnte aus der Tiefe der Stube die Mutter sprechen hören, die es zum Waschen rief. Die vielen Gäßchen, durch mannigfaltiges steinernes Treppenwerk unterbrochen und verbunden, lagen noch alle im Schatten, und nur wenige freiere Kinderspielplätze leuchteten bestreift aus dem Dunkel. Auf allen diesen Stufen und Geländern hatte Heinrich gesessen und gesprungen, und die Kinderzeit dünkte ihm noch vor der Türe des gestrigen Abends zu liegen. Schnell ließ er seine Augen treppauf und – ab in allen Winkeln der Stadt herumspringen, die traulichen Kinderplätze waren alle still und leer wie Kirchenstühle am Werktag. Das einzige Geräusch kam noch vom großen Stadtbrunnen, dessen vier Röhren man durch den Flußgang hindurch glaubte rauschen zu hören; die vier Strahlen glänzten hell, ebenso was an dem steinernen Brunnenritter vergoldet war, sein Schwertknauf und sein Brustharnisch, welch letzterer die Morgensonne recht eigentlich auffing, zusammenfaßte und sein funkelndes Gold wunderbar aus der dunkelgrünen Tiefe des Stromes herauf widerscheinen ließ. Dieser reiche Brunnen stand auf dem hohen Platze vor dem noch reichern Kirchenportale, und sein Wasser entsprang auf dem Berge diesseits des Flusses, auf welchem Heinrich jetzt stand. Es war früher sein liebstes Knabenspiel gewesen, hier oben ein Blatt oder eine Blume in die verborgene Quelle zu stecken, dann neben den hölzernen Röhren hinab, über die lange Brücke, die Stadt hinauf zu dem Brunnen zu laufen und sich zu freuen, wenn zu gleicher Zeit oben das Zeichen aus der Röhre in das Becken sprang; manchmal kam es auch nicht wieder zum Vorschein. Er pflückte eine eben aufgehende Primel und eilte nach der Brunnenstube, deren Deckel er zu heben wußte; dann eilte er die unzähligen Stufen zwischen wucherndem Efeugewebe hinunter, über den Kirchhof, wieder hinunter, durch das Tor über die Brücke, unter welcher die Wasserleitung auch mit hinüberging. Doch auf der Mitte der Brücke, von wo man unter den dunklen Bogen des Gebälkes die schönste Aussicht über den glänzenden See hin genießt, selbst über dem Wasser schwebend, vergaß er seinen Beruf und ließ das arme Schlüsselblümchen allein den Berg wieder hinaufgehen. Als er sich endlich erinnerte und zum Brunnen hinanstieg, drehte es sich schon emsig in dem Wirbel unter dem Wasserstrahle herum und konnte nicht hinauskommen. Er steckte es zu dem Federchen auf seiner Mütze und schlenderte endlich seiner Wohnung zu durch alle die Gassen, in welche überall die Alpen blau und silbern hineinleuchteten. Jedes Bild, klein oder groß, war mit diesem bedeutenden Grunde versehen vor der niedrigen Wohnung armer Leute stand Heinrich still und guckte durch die Fensterlein, die, einander entsprechend, an zwei Wänden angebracht waren, quer durch das braune Gerümpel in die blendende Ferne, welche durch das jenseitige Fenster der Stube glänzte. Er sah bei dieser Gelegenheit den grauen Kopf einer Matrone nebst einer kupfernen Kaffeekanne sich dunkel auf die Silberfläche einer zehn Meilen fernen Gletscherfirne zeichnen und erinnerte sich, daß er dieses Bild unverändert gesehen, seit er sich denken mochte.
So spielte dieser Jüngling wie ein Kind mit der Natur und schien seine bevorstehende, für seine kleinen Verhältnisse bedeutungsvolle Abreise ganz zu vergessen. Allein plötzlich fiel es ihm schwer aufs Herz, als er nun vor seinem düstern Vaterhause stand und die Mutter ihm ungeduldig aus dem Fenster winkte. Schnell eilte er die engen Treppen hinauf, den Wohngemächern der Haushaltungen vorbei, die alle im Hause wohnten.
»Wo bleibst du denn so lang?« empfing ihn die Frau Lee, eine geringe Frau von etwa fünfundvierzig Jahren, an welcher weiter nichts auffiel, als daß sie noch kohlschwarze schwere Haare hatte, was ihr ein ziemlich junges Ansehen gab; auch war sie um einen Kopf kleiner als ihr Sohn.
»Da habe ich schon angefangen, deinen Koffer zu packen, weil du sonst vor Abgang der Post nicht mehr fertig würdest.«
Heinrich guckte in den Koffer; mit richtigem Sinn hatte die gute Frau Mappen und Bücher auf den Boden gebreitet; nur hatte sie mit weniger Zartheit verschiedene Bogen und Papiere nicht genugsam zusammengeschichtet, so daß einige derselben an den Wänden des Koffers gekrümmt wurden, was der Sohn eifrig verbesserte. Für Papier haben die meisten Hausfrauen überhaupt nicht viel Gefühl, weil es nicht in ihren Bereich gehört. Die weiße Leinwand ist ihr Papier, die muß in großen, wohlgeordneten Schichten vorhanden sein, da schreiben sie ihre ganze Lebensphilosophie, ihre Leiden und ihre Freuden darauf. Wenn sie aber einmal ein wirkliches Briefchen schreiben wollen, so findet sich kaum ein veraltetes Blatt dazu, und man kann sich alsdann mit einem hübschen Bogen Postpapier und einer wohlgeschnittenen Feder sehr beliebt bei ihnen machen.
Auch hier erwies es sich, daß die Mutter eigentlich die schweren Gegenstände zuunterst gepackt hatte, um die zwölf schönen neuen Hemden zu schonen, welche sie jetzt hineinlegte.
»Trage doch recht Sorge für deine Hemden«, sagte sie, »ich habe das Tuch selbst gesponnen; siehst du, diese sechs sind fein und schön, sie stammen aus meinen jüngeren Jahren, diese sechs hingegen sind schon gröber, meine Augen sind eben nicht mehr so scharf. Alle aber sind schneeweiß, und wenn du auch, während sie noch gut sind, feinere Kleider anschaffen könntest, so darfst du doch meine Wäsche dazu tragen, weil es anständige und ehrbare Leinwand ist. Wechsle recht gleichmäßig ab, wenn du sie der Wäscherin gibst, damit nicht ein Teil zuviel gebraucht wird, und verfasse immer einen genauen Waschzettel. Und daß du mir nur das Weißzeug und dergleichen mehr estimierst als bisher und nichts verzettelst! Denn bedenke, daß du von nun an für jedes Fetzchen, das dir abgeht, bares Geld in die Hand nehmen mußt und es doch nicht so gut bekömmst, als ich es verfertigt habe. Wenigstens untersteh dich nicht mehr und wische deine kotigen Schuhe auf Spaziergängen mit neuen Taschentüchern ab, welche du nachher wegwirfst, wie du neulich getan hast! Halte auch deine zwei Röcklein gut und ordentlich und hänge sie immer in den Schrank, anstatt sie zu Hause anzubehalten und halbe Tage lang so zu lesen, wie ich dich schon oft ertappt habe. Besonders wenn du sie ausbürstest, fahre nicht mit der Bürste darauf herum wie der Teufel im Buch Hiob, daß du alle Wolle abschabst!«
»Das verwünschte Kleiderputzen«, entgegnete hierauf der Sohn, welcher unterdessen beim Ausbreiten der Kleidungsstücke seine Hände auch immer unnützerweise im Koffer hatte, »das verwünschte Kleiderputzen wird überhaupt nun ein Ende nehmen; denn wenn man in der Fremde ist und sich eine ordentliche Wohnung mieten muß, so bekommt man die Bedienung mit in den Kauf. Es reut mich jeder Augenblick, den ich mit dem widerlichen Geschäft zugebracht habe.«
»Das ist wieder der Hans Obenhinaus!« rief etwas heftig die Mutter, »Bedienung! ich sage dir, lasse dich lieber nicht bedienen, wenn du dich dadurch billiger einrichten kannst. Ich sehe nicht ein, warum du nicht selbst deine Sachen in Ordnung halten solltest, während du sonst stundenlang in die Berge hineinstarrst!«
»Das verstehst du halt nicht!« hätte Heinrich fast gesagt, fand es aber für gut, die Worte zu verschlucken und sich dafür mit dem festen Vorsatze zu wappnen, hinfüro keine Schuhbürste mehr anrühren zu wollen. Das undankbare Kind vergaß hiebei gänzlich, wie rührend ihn die Mutter oft überrascht hatte, wenn er beim Antritt irgendeiner kleinen Reise, oder wenn Fremde im Hause waren, seine Schuhe glänzend gewichst fand, just wenn er mit Seufzen und falscher Scham vor dem Besuche an das verhaßte Geschäft gehen wollte.
Indessen war Frau Lee besorgt, noch eine Menge Kleinigkeiten auf die geschickteste Weise in dem Koffer unterzubringen. Dann brachte sie ein mächtiges Stück feine Seife, wohl eingewickelt, eine zierliche Nadelbüchse, Faden und Knöpfe aller Art in einem artigen Schächtelchen, eine Schere, eine gute neue Kleiderbürste, unterschiedliche Tuchabschnitzel, welche seinen Kleidungsstücken entsprachen, zusammengerollt und mit einem Bindfaden vielfach umwunden, und die sie ihm ja nicht zu verlieren empfahl, indem ein gewandter Schneider die Existenz eines Rockes mit dergleichen manchmal um ein volles Jahr zu fristen vermöge. Sie geriet hiebei wieder in einigen Konflikt mit dem Sohne, welcher alle vorhandenen Lücken für die verschiedenen Bruchstücke einer alten Flöte, für ein Lineal, eine Farbenschachtel, einen baufälligen Operngucker usw. in Beschlag nehmen wollte. Ja, er machte, obgleich er kein Mediziner war, doch einen vergeblichen Versuch, einen defekten Totenschädel, mit welchem er seinem Kämmerchen ein gelehrtes Ansehen zu geben gewußt hatte, noch unter den Deckel zu zwängen. Die Mutter jagte ihn aber mit widerstandsloser Energie von dannen, und man behauptet, daß das greuliche Möbel nicht lange nachher einem ehrlichen Totengräber bei Nacht und Nebel nebst einem Trinkgelde übergeben worden sei.
Sie schlossen mit Mühe den vollgepfropften Koffer; denn auch das Kind der unbemitteltsten Eltern, wenn es aus den Armen einer treuen Mutter scheidet, nimmt immer noch etwas weniges über seine Bedürfnisse hinaus mit und ist in einem gewissen Sinne wohlausgestattet. Die Tage sind traurig, wo diese Ausstattung, diese warme Hülle sich nach und nach auflöst und verliert und mit bitteren, oft reuevollen Erfahrungen durch wildfremdes Zeug ersetzt werden muß.
Während Heinrich noch eine große, schwere Mappe einwickelte, die ganz mit Zeichnungen, Kupferstichen und altem Papierwerk angefüllt war, sein wanderndes Museum, besorgte seine Mutter das Frühstück und ermahnte ihn, unterdessen noch bei den Hausgenossen Abschied zu nehmen. Das Haus gehörte ihr und war ein hohes altes bürgerliches Gebäude, dessen unterstes Geschoß noch in romanischen Rundbogen, die Fenster der mittleren im altdeutschen Stil und erst die zwei obersten Stockwerke modern, doch regellos gebaut waren. Alles war düster und geschwärzt. Drei oder vier Handwerkerfamilien bewohnten seit langen Jahren in guter Eintracht mit der Frau Hausmeisterin das Haus. Bei ihnen trat Heinrich nacheinander ein und sagte sein Lebewohl. Die braven Leute wünschten ihm mit herzlicher Teilnahme alles Glück und ermahnten ihn, nicht zu lange in der Welt herumzufahren, sondern bald wieder zu ihnen und zu der Mutter zurückzukehren. Die glückliche Festtagsruhe, in welcher er die zufriedenen und nach nichts weiter verlangenden Menschen antraf, trat ihm ans Herz, und er bat sie, seiner Mutter, die nun ganz allein sei, mit Rat und Tat beizustehen. Die ernsthaften Hausväter, den sonntäglichen Seifenschaum um Mund und Kinn, versicherten, daß seine Bitte unnötig sei, holten bedächtig aus ihren bescheidenen Pulten einen harten Taler hervor und drückten denselben dem Scheidenden mit diplomatischer Würde verdeckt in die Hand. Obgleich er, nach der Behauptung seiner Mutter, ein Obenhinaus war, so durfte er doch durch diese bürgerliche schöne Sitte sich nicht beleidigt finden. Auch lag ein rechter Segen in diesem sauer erworbenen und mit ernstem Entschlusse geschenkten Gelde; es schien Heinrich die ersten Tage seiner Reise hindurch, wo er es zuerst gebrauchte, um seine Hauptkasse zu schonen, als ob es gar nicht ausgehen wollte.
Endlich saß er seiner Mutter beim Frühstück gegenüber, auf dem Stuhle, auf welchem der dreijährige Knabe schon geschaukelt hatte. Es war nun alles getan und vorbereitet; ein Mann hatte den Koffer nach der Post geholt – es war eine Totenstille in der Stube. Die Morgensonne umzirkelte die altertümlichen, ererbten Porzellantassen, welche Heinrich schon zwanzig Jahre lang durch die Hände seiner Mutter gehen sah, ohne daß je eine zerbrochen wäre. Es war ein feierlicher Moment gewesen, als er für würdig erfunden ward, sein Kinderschüsselchen mit einer dieser bunten und vergoldeten Tassen versuchsweise zu vertauschen.
Frau Lee hätte ihrem Sohne noch gern allerlei gesagt; aber sie konnte mit ihm gar nicht sentimental sprechen, sowenig als er mit ihr. Endlich sagte sie schüchtern und abgebrochen:
»Werde nur nicht leichtsinnig und vergiß nicht, daß wir eine Vorsehung haben! Denke an den lieben Gott, so wird er auch an dich denken, und mach, daß du bald etwas lernst und endlich selbständig werdest; denn du weißt genau, wieviel du noch zu verbrauchen hast und daß ich dir nachher nichts mehr werde schicken können, das heißt, wenn es dir übel ergehen sollte, so schreibe mir ja, solange du weißt, daß ich selbst noch einen Pfennig besitze, ich könnte es doch nicht ertragen, dich im Elend zu wissen.«
Der Sohn schaute während dieser Anrede stumm in seine Tasse und schien nicht sehr gerührt zu sein. Die Mutter erwartete aber keine andern Gebärden, sie wußte schon, woran sie war, und fühlte sich etwas erleichtert. Ach, du lieber Himmel! dachte sie, eine Witwe muß doch alles auf sich nehmen; diese Ermahnungen zu erteilen, dazu gehört eigentlich ein Vater, eine Frau kann solche Dinge nicht auf die rechte Weise sagen; wenn das arme Kind nicht zurechtkommt, wie werde ich die Sorge mit dem gehörigen klugen Ernste vereinigen können?
Heinrich aber war jetzt mit seinen Gedanken schon weit in der Ferne; die Neugierde, die Hoffnung, Lebens- und Wanderlust hatten ihn mächtig angewandelt, und die Ungeduld übernahm ihn. Er sprang auf und sagte »Jetzt muß ich gehen, leb wohl, Mutter!« Die Tränen stürzten ihr in die Augen, als sie ihm die Hand gab, und er fühlte, als er vor ihr her die vier Treppen hinabeilte, daß sein Gesicht ganz heiß wurde, aber er bezwang sich. Die Hausgenossen kamen auch noch unter die Haustüre, wo Heinrich allen zumal noch die Hand gab, ohne seine Mutter dabei stark auszuzeichnen, wenn man einen letzten flüchtigen und wehmütigen Blick, den er auf sie warf, ausnehmen will. Das Volk, das mit der äußeren Sorge sein Leben lang zu kämpfen hat, erweist sich selbst wenig sichtbare Zärtlichkeit. Von verwandtschaftlichen Umarmungen und Küssen ist wenig zu finden; niemand küßt sich als die Kinder und die Liebenden und selbst diese mit mehr Dezenz als die gebildete und sich bewußte Gesellschaft. Daß Männer einander küßten, wäre unerhört und überschwenglich lächerlich. Nur große Ereignisse und Schicksale können hierin eine Ausnahme bewirken.
Als Heinrich Lee mit schnellen Schritten nach dem Posthause hinlief und einige Minuten darauf, oben auf dem schwerfälligen Wagen sitzend, über die Brücke und neben dem Flusse das enge Tal entlangfuhr, mit begeisterten Augen das offene Land erwartend, die Primel noch auf seiner Mütze da konnte dieser sonderbare Bursche für die Hälfte der Zuschauer etwas vorteilhaft Anregendes, aber gewiß auch für die andere Hälfte etwas ungemein Lächerliches haben. Feingefühlig und klug sah er darein, jedoch sein Äußeres war zugleich seltsam und unbeholfen. Was er eigentlich war und wollte, das müssen wir mit ihm selbst zuerst erfahren und erleben; daß man es in jenem Augenblick nicht recht wissen konnte, machte seiner Mutter genugsamen Kummer.
Sie war auf ihre Stube zurückgekehrt. Ein tiefes Gefühl der Verlassenheit und der Einsamkeit überkam sie, und sie weinte und schluchzte, die Stirn auf den Tisch gelehnt. Der frühe Tod ihres Mannes, die Zukunft ihres sorglosen Kindes, ihre Ratlosigkeit, alles kam zumal über ihr einsames Herz. Ein mächtiges Ostermorgengeläute weckte und mahnte sie, Trost in der Gemeinschaft der vollen Kirche zu suchen. Schwarz und feierlich gekleidet ging sie hin; es ward ihr wohl etwas leichter in der Mitte einer Menge Frauen gleichen Standes; allein da der Prediger ausschließlich das Wunder der Auferstehung sowie der vorhergehenden Höllenfahrt dogmatisierend verhandelte, ohne die mindesten Beziehungen zu einem erregten Menschenherzen, so genoß die gute Frau vom ganzen Gottesdienste nichts als das Vaterunser, welches sie recht inbrünstig mitbetete, dessen innerste Wahrheit sie aufrichtete.
Die Erinnerung an empfangene Liebe, als ein Zeugnis, daß man einmal im Leben liebenswürdig und wert war, ist es vorzüglich, welche die Sehnsucht nach der früheren Jugend nie ersterben läßt. Wer nicht das Glück hatte, eine aufknospende zarte und heilige Jugendliebe zu genießen, der hat dagegen gewiß eine treue und liebevolle Mutter gehabt, und in den spätern Tagen bringen beide Erinnerungen ungefähr den gleichen Eindruck auf das Gemüt hervor, eine Art reuiger Sehnsucht. Wer aber in jeder Weise verwaist und einsam aufgewachsen ist, der kann wohl sagen, daß er um einen Teil des Lebens zu kurz gekommen sei.
Zweites Kapitel
Indem eine Grundlinie der Landschaft nach der anderen sich verschob und veränderte und aus dem heitern Ziehen und Weben ein ganz neuer Gesichtskreis hervorging, welcher allmählich wieder in einen neuen sich auflöste, war Heinrich, mit hellen Jugendaugen aufmerkend, seinem eigenen Wesen zurückgegeben. Die verlassene Mutter und Heimat bildeten wohl eine zarte und weiche Grundlage in seinem Gemüte; doch auf ihr spielten mit ungebrochenen Farben alle Bilder der neuen Welt, welche ihm aufging. Denn obgleich schon ziemlich die weite Welt in leicht erfaßten Bildern seinem innern Sinne vorbeigezogen war und besonders sein Künstlergedächtnis die Formen und Gestalten der fernsten Zonen bewahrte, so war ihm doch jetzt die kleinste Neuheit, welche durch jede weitere Stunde Wegs gebracht wurde, das Nächste und Wichtigste. Eine neue Art von bemalten Fensterladen oder Wirtshausschildern, eine eigentümliche Gattung von Brunnensäulen oder Dachgiebeln in diesem oder jenem Dorfe, besonders aber die bald vor-, bald seitwärts, bald fern, bald nah, immer frisch auftauchenden Bergzüge und Erdwellen machten ihm die größte Freude. Es war ein windstiller, lieblicher Frühlingstag. Lange Zeit sah er eine milde weiße Wolke über dem Horizonte stehen, zu seiner Rechten oder auch zur Linken, wie der Wagen eben fuhr; die sanften, bald fern blauen, bald nah grünen oder braunen Wogen der Erde flossen still darunter hin, sie aber blieb immer dieselbe, bis sie endlich, als er sie eine Weile vergessen hatte und wieder suchte, auch verschwunden war. Am meisten freute ihn jedoch, wenn er, immer mehr sich von der Geburtsstadt entfernend, stets noch an einem ihm unbekannten Orte ein bekanntes Gesicht vorübergleiten sah, das er sonst an Wochenmärkten oder Festtagen in der beschränkten Stadt bemerkt hatte; wohl zehn Stunden von zu Hause weg, sah er sogar an einem Brunnen noch ein schönes falbes Pferd trinken, welches ihm zu Hause schon öfters aufgefallen war, als vor ein buntes Wägelchen gespannt, auf welchem ein dicker Müller saß. Richtig ließ sich auch der Müller im Sonntagsstaate sehen, und Heinrich wußte nun, wo das falbe Pferd zu Hause war. Dieses waren alles noch Zeichen der Heimat, freundliche Begleiter und sozusagen die letzten Türsteher, welche ihn wohlwollend entließen.
Aber nicht nur in der äußeren Umgebung, auch an sich selbst empfand er den Reiz eines neuen Lebens. Dann und wann begegnete ein reisender Handwerksbursch, ein alter zitternder Mann, ein verlaufenes bleiches Bettlerkind dem dahinrollenden Wagen. Während keiner der andern Reisenden sich regte, wenn die demütig Flehenden mühsam eine Weile neben dem schnellen Fuhrwerke hertrabten, suchte Heinrich immer mit eifriger Hast seine Münze hervor und beeilte sich, sie zu befriedigen. Dabei fiel es ihm nicht schwer, es mit einer Miene zu tun, welche den Bettler gewissermaßen zu ihm heraufhob, statt noch mehr abwärts zu drücken, und je nach dem besondern Erscheinen des Bittenden leuchtete aus Heinrichs Augen ein Strahl des Verständnisses, der unbefangenen Teilnahme, eines sinnigen Humores oder auch ein Anflug mürrischen, lakonischen Vorwurfes; immer aber gab er, und die von ihm Beschenkten blieben oft überrascht und nachdenklich stehen. Weil Gewohnheit und Sitte nur eine kleine Gabe, ein Unmerkliches verlangen, so hielt er es um so mehr für würdelos, je einen Armen erfolglos bitten zu lassen, möge nun geholfen werden oder nicht, möge Erleichterung oder Liederlichkeit gepflanzt werden; ein gewisser menschlicher Anstand schien ihm unbedingt zu gebieten, daß mit einer Art Zuvorkommenheit diese kleinen Angelegenheiten abgetan würden. Er hatte noch nicht die Kenntnis erworben, daß bei dem faulen und haltlosen Teile der Armen durch wiederholtes Abweisen jenes Gekränktsein und dadurch jener Stolz geweckt werden müssen, welche endlich Selbstvertrauen hervorbringen.
Allein bisher war es ihm nur spärlich vergönnt, dem Zuge seines Herzens zu folgen. Indem er als einziges Kind bei seiner vorsichtigen und haushälterischen Mutter lebte, welche, während er seinen Träumen nachhing, ihm sozusagen den Löffel in die Hand gab, geschah es selten, daß er mit etwelcher Münze versehen, und wenn er es war, so brannte sie ihm in der Hand, bis er sie ausgegeben hatte. So kam es, daß ihn immer ein Schrecken überfiel, sobald er von fern einen Bettler ahnte und ihm auszuweichen suchte. Konnte dies nicht geschehen, so ging er rasch abweisend vorbei, und wenn der Bettler nachlief, hüllte er seine Verlegenheit in einen rauhen, unwilligen Ton, wobei aber sein weißes Gesicht eine flammende Röte überlief. Er konnte so rechte Unglückstage haben, wo er viele und verschiedenste arme Teufel antraf, ohne einem einzigen etwas geben zu können, und er mußte fortwährend ein böses Gesicht machen; denn als er einst ganz gemütlich und vertraulich einem großen Schlingel gesagt hatte, er besäße selbst kein Geld, forderte ihn dieser höhnisch auf, mit ihm betteln zu gehen. In allem diesen lag nun freilich, wie viele Leute sagen würden, mehr ein unbefugter Hochmut als eine demütige Barmherzigkeit; vielleicht aber könnte man auch sagen Es ist die königliche Gesinnung eines ursprünglichen und reinen Menschen, welche, allgemein verbreitet, die Gesellschaft in eine Republik von lauter liebevollen und wahrhaft adelig gesinnten Königen verwandeln würde; es ist die immerwährende Erhebung des Herzens, welche nach der Tat trachtet; es ist die göttliche Einfalt, welche nur ein Ja und ein Nein kennt und letzteres verwahrt und verbirgt wie ein schneidendes Schwert.
Wenigstens fahr Heinrich wie ein wahrer König in die helle Welt hinaus. Er war nun sich selbst überlassen und konnte in den Kreis seines Geschickes aufnehmen, was sein leichtes Herz begehrte; und indem er gewissenhaft den Armen seinen Kreuzer mitteilte, rechnete er dieses zu den seinem Leben nötigen Ausgaben. Er dachte übermütig Zwei Pfennige sind immer genug, um den einen wegzuschenken! und so trug er wenige Taler in der Tasche, aber ein Herz voll Hoffnung und blühenden Weltmutes in der Brust. Wäre er ein König dieser Welt gewesen, so hätte er vermutlich viele Millionen »verschleudert«, so aber konnte er nichts vergeuden als das wenige, was er besaß seines und seiner Mutter Leben.
Gegen Mittag fuhr der Postwagen durch ein großes ansehnliches Dorf, wie sie in der flachern Schweiz häufig sind, wo Fleiß und Betriebsamkeit, im Lichte fröhlicher Aufklärung und unter oder vielmehr auf den Flügeln der Freiheit, aus dem schönen Lande nur eine freie und offene Stadt erbauen. Weiß und glänzend standen die Häuser längs der breiten sauberen Landstraße, dehnten sich aber auch in die Runde, mannigfaltig durch Baumgärten schimmernd. Auch vor dem geringsten war ein Blumengärtchen zu sehen, und im ärmsten derselben blühten eine Hyazinthe oder einige Tulpen hervor, Pflanzen, welche sonst nur von Vermöglicheren gezogen wurden. Es ist aber auch nichts so erbaulich, als wenn durch einen ganzen Landstrich eine fromme Blumenliebe herrscht. Ohne daß die Hausväter im geringsten etwa unnütze Ausgaben zu beklagen hätten, wissen die Frauen und Töchter durch allerlei liebenswürdigen Verkehr ihren Gärten und Fenstern jede Zierde zu verschaffen, welche etwa noch fehlen mag, und wenn eine neue Pflanze in die Gegend kommt, so wird das Mitteilen von Reisern, Samen, Knollen und Zwiebeln so eifrig und sorgsam betrieben, es herrschen so strenge Gesetze der Gefälligkeit und des Anstandes darüber, daß in kurzer Zeit jedes Haus im Besitze des neuen Blumenwunders ist. So sind in neuerer Zeit eine der schönsten Erscheinungen die Georginen. Vor zehn oder fünfzehn Jahren blühten sie nur noch in den stattlich umhegten Gärten der Reichen, in der Nähe der Städte oder vor glänzenden Landhäusern; dann verbreiteten sie sich unter dem Mittelstande, sich zugleich in hundertfarbigen Arten entfaltend durch die Kunst der Gärtner, und jetzt steht ein Strauch dieser merkwürdigen Blume, wo nur ein Fleck Erde vor der Hütte des ländlichen Tagelöhners frei ist. Wie die flüchtig wandernden Stammväter eines später großen Weltvolkes sind die ersten einfachen Exemplare der Georginen aus dem fernen Reiche der Montezumas herübergekommen, und schon bedecken ihre Enkel zahllos unsere Gärten, aus der Tiefe ihrer Lebenskraft entwickeln sie eine endlose Farbenpracht, wie sie die Hochebenen Mexikos nie gesehen haben. Kinder des neuweltlichen Westens, herrschen sie nun neben den Kindern des alten Ostens, den Rosen, wie sonst keine Blume. Freilich noch immer geben diese allein den süßen Duft und jenes kühlende Rosenwasser, welches krankgeweinte Augen erfrischt, und noch immer eignen sie sich am besten dazu, einen vollen Becher zu schmücken. Aber darin wetteifern die bunten Scharen Amerikas mit dem glühenden Rosenvolke des Morgenlandes, daß sie mit unverwüstlicher Lebenslust unser Herz bis an das Ende des Jahres begleiten und ihre samtenen Brüste öffnen, bis der kalte Schnee in sie fällt.
Hell und aufgeweckt erschien das Dorf, durch welches die Reisenden fuhren, in vielen Erdgeschossen erblickte man die Abzeichen von Gewerben Uhrmachern, Kürschnern, sogar Goldschmieden, und von Krämereien, welche man sonst nur in den Städten findet; einige Häuser erschienen so herrisch, die Gärten davor so wohlgepflegt, daß man in den Besitzern mit Recht reiche Dorfmagnaten vermutete. Doch wenn auch der eine, gleich einem Deputierten der französischen Bourgeoisie, im eleganten Schlafrock, die Zigarre im Munde, aus dem Fenster schaute, so stand dafür der andere in bloßen weißen Hemdsärmeln auf der Hausflur, und seine braunen Hände verkündeten, ungeachtet des städtischen Hauses, den rüstigen Ackersmann, ja, vor einem seiner Fenster hing zum Durchlüften die Uniform eines gemeinen Soldaten, während aus der Dachluke seines Knechtes diejenige eines Unteroffiziers in der Frühlingsluft flaggte. Bei all dieser Stattlichkeit war nun aber das Schulhaus doch das schönste Gebäude im Dorfe, welches in der ganzen Gegend öfter der Fall war. Auf einem freien geebneten Platze ragte es mit hohen blinkenden Fenstern empor und verriet heitere geräumige Säle; von seiner Front schimmerte in kolossalen goldenen Buchstaben das Wort Schulhaus. Hier, auf dem sonnigen Vorplatze und auf der breiten steinernen Treppe, welche fast tempelartig den ganzen vordern Sockel bekleidete, mochte der Ort sein, welchen sonst die alten Dorflinden bezeichnen; denn eine Gruppe älterer und jüngerer Männer unterhielt sich hier behaglich, sie schienen zu politisieren; aber ihre Unterredung war um so ruhiger, bewußter und ernster, als sie vielleicht, dieselbe betätigend, noch am gleichen Tage einer wichtigen öffentlichen Pflichterfüllung beizuwohnen hatten. Die Physiognomien dieser Männer waren durchaus nicht national über einen Leisten geschlagen, auch war da nichts Pittoreskes, weder in Tracht noch in Haar- und Bartwuchs, zu bemerken; es herrschte jene Verschiedenheit und Individualität, wie sie durch die unbeschränkte persönliche Freiheit erzeugt wird, jene Freiheit, welche bei einer unerschütterlichen Strenge der Gesetze jedem sein Schicksal läßt und ihn zum Schmied seines eigenen Glückes macht. So erschienen hier die einen von rastloser Arbeit gebräunt und getrocknet, zäh und hart, andere in Energie und Gewandtheit aufblühend, andere wieder von Spekulation gefurcht. Alle aber waren äußerlich ruhig, ungebeugt und sahen kundig und auch ziemlich prozeßerfahren in die Welt.
So übereinstimmend mit seinen rührigen Bewohnern nun das schöne Dorf dastand, um so fremdartiger ragte die Kirche aus ihm hervor. Dem Stile oder besser Nichtstile nach stammte sie aus dem achtzehnten Jahrhundert, ein ovales nüchternes Gebäude mit kreisrunden Fenstern, förmlichen Löchern, war nicht alt und nicht neu, weder der verbrauchte Baustoff noch die mageren geschmacklosen Verzierungen, sowenig als der gedankenlose Turm, taten die mindeste Wirkung; man ahnte schon von außen die langweiligen hölzernen Bankreihen und die kleinliche Gipsbekleidung des Innern, den unförmlich bauchigen Taufstein, das lächerliche braune Kanzelfaß; ohne Begeisterung gebaut und keine erweckend, verkündete das Gebäude den untröstlichen Schlendrian, mit welchem es gebraucht wurde. Es sah aus wie ein unnützes sonderbares Möbel in einem Hause, welches der Besitzer aber eigensinnig um keinen Preis veräußern will, weil er seit langen Jahren gewohnt ist, seinen Hut darauf zu stellen, wenn er nach Hause kehrt, oder, wenn man ein wenig artiger sein will, weil sein Firnis auf eine ihm angenehme Weise den Sonnenblick auffängt und auf den Stubenboden wirft.
Aus diesem herzlos unschönen Gebäude nun bewegte sich ein langer Zug sechszehnjähriger Konfirmandinnen quer über die Straße, von einem dicken jovialen Pfarrherrn angeführt, so daß der Postwagen anhalten mußte, bis alle vorbei waren. Schwarz gekleidet, mit gebeugten Häuptern, die tränenden Augen in weiße Taschentücher gedrückt, wallten die zarten Gestalten paarweise langsam vorüber, die keuschen Lippen noch feucht von dem Weine, welchen man ihnen als Blut zu trinken, in der Kehle noch das Brot, welches man ihnen als Menschenfleisch zu essen gegeben hatte. Diese dunkle Mädchenschar mit dem rotnasigen Pfarrer an der Spitze kam Heinrich vor wie ein Flug gefangener Nachtigallen aus dem Morgenlande, welche ein betrunkener Vogelhändler zum Verkauf umherführt. Der Zug schlängelte sich aber auch traumhaft genug unter dem klaren Himmel und durch Land und Leute hin.
Wenn wir solche Dinge in der Weise schildern, wie sie sich dem jungen Wanderer eindrückten, so wird man in derselben nicht die rücksichtslose Art der Jugend verkennen, welche mit einer gewissen, übrigens gesunden Unbestechlichkeit zwischen dem scheinbaren und dem wirklich Anstößigen durchaus keinen Unterschied zugeben will. Da religiöse Gegenstände vor allem nur Sache des Herzens sind, so bringt dieses in seiner aufwachenden Blütezeit das Recht zur Geltung, die Überlieferungen mit seinen angebornen reinen Trieben in Einklang zu setzen. Wer erinnert sich nicht jener glücklichen Tage, wo man, im geräuschvollen schwindelnden Kreisen dieses Rundes erwachend, mit den neuen feinen Fühlhörnern der jungen Seele um sich tastend, von keiner Autorität Notiz nehmen und den Maßstab seines unverdorbenen Gefühles auch an das Ehrwürdigste und Höchste legen will? Wer will wohl bestreiten, daß vielleicht, wenn das Ursprüngliche und also auch wohl Göttliche, das in der jungen Menschenseele liegt, nicht in das hanfene, dürrgeflochtene Netz eines Katechismus, heiße er, wie er wolle, abgefangen würde, die schneidende blutige Kritik des Mannesalters und die wildesten Kämpfe verhütet würden? Heinrich hegte eine besondere Pietät gerade für die Begriffe Brot und Wein, das Brot schien ihm so sehr die ewig unveränderte unterste Grundlage aller Erden- und Menschheitsgeschichten, der Wein aber die edelste Gabe der geistdurchdrungenen lebenswarmen Natur zu sein, daß nichts ihn so geeignet dünkte zur Feier eines gemeinsamen symbolischen Mahles der Liebe als edles weißes Weizenbrot und reiner goldener Wein. Daher war es ihm auch anstößig, diese wichtigen, aber einfachen und reinlichen Begriffe mit einer heidnisch-mystischen und, wie ihm vorkam, widermenschlichen Mischung zu trüben. Auf das Historische des vorhandenen Sakramentes konnte er nun um so weniger Rücksicht nehmen, als ihm die theologischen Einsichten und Kenntnisse abgingen.
Als die Sonne sich bereits zu neigen anfing, machte der Wagen an einem Dorfe wieder halt, damit die Pferde gewechselt werden konnten. Heinrich trat mit den andern Reisenden in das Gasthaus, um eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Der eine wählte ein Glas Wein, der andere eine Schale Kaffee, der dritte verlangte schnell etwas Kräftiges zu essen, es ging geräuschvoll zu mit Genießen, Geldwechseln und Bezahlen; alle taten wichtig, zerstreut oder nur auf sich achtsam und liefen stumm aneinander vorbei in der Stube umher. Auch Heinrich, spreizte sich, ließ es sich schmecken und zum Überfluß noch eine schlechte Zigarre geben, welche er ungeschickt in Brand zu stecken suchte. Da gewahrte er in einem Winkel der Stube eine ärmliche Frau mit ihrem jungen Sohne, welcher ein großes Felleisen neben sich auf der Bank stehen hatte. Beide waren ihm als Nachbarsleute bekannt. Er grüßte sie und vernahm, daß auch dieser junge Bursche, welcher das Handwerk eines Malers und Lackierers erlernt hatte, heute die Reise in die Fremde antrat, daß seine Mutter, die Feiertage benutzend, lange vor Tagesanbruch sich mit ihm auf den Weg gemacht und sie so, die Fuß- und Feldwege aufsuchend, bis hierher gekommen seien, wo sie sich nun trennen wollten. Die gute Frau gedachte dann bis zur völligen Dunkelheit noch ein Stück Weges zurückzuwandern und bei bekannten Landleuten über Nacht zu bleiben. Sie tranken einen blassen dünnen Wein und aßen Brot und Käse dazu; doch war es eine Freude zu sehen, wie sorglich die Frau die »Gottesgabe« behandelte, ihrem Sohne zuschob und für sich fast nur die Krumen zusammenscharrte. Dazwischen schärfte sie ihm ein, wie er seinen Meistern gehorchen, bescheiden und fleißig sein und keine Händel suchen sollte. Dann mußte er seinen Geldbeutel nochmals hervorziehen; vier oder fünf neue große Geldstücke wurden als bekannte Größen einstweilen beiseite gelegt, dagegen eine Handvoll kleineres Geld überzählt, betrachtet und ausgeschieden. Der Junge steckte seinen Schatz wieder ein, die Mutter aber entwickelte aus einem Zipfel ihres Schnupftuches etwas Kupfermünze und bezahlte die Zeche.
Inzwischen rollte das bewegliche Wanderhaus mit seinen ewig wechselnden Bewohnern wieder auf der Straße, eine Anhöhe hinan und der kühlen Nacht entgegen. Heinrich schaute fortwährend zurück nach Süden; rein, wie seine schuldlose Jugend, ruhte die Luft auf den Gebirgszügen seiner Heimat, aber diese waren ihm in ihrer jetzigen Gestalt fast ebenso fremd wie die Schwarzwaldhöhen im dämmernden Norden, denen er sich allmählich näherte und über welchen rötliche Wolkengebilde einen rätselhaften Vorhang vor das deutsche Land zogen.
Fern hinter dem Wagen sah er seinen jungen Nachbar den Hügel hinankeuchen, noch kaum erkennbar mit seinem schweren Felleisen. Über denselben hinweg gleiteten Heinrichs Augen noch einmal nach dem südlichen Horizonte; er suchte diejenige Stelle am Himmel, welche über seiner Stadt, ja über seinem Hause liegen mochte, und fand sie freilich nicht. Desto deutlicher hingegen sah er nun, als er, sich in den Wagen zurücklehnend, die Augen schloß, die mütterliche Wohnstube mit allen ihren Gegenständen, er sah seine Mutter einsam umhergehen, ihr Abendbrot bereitend, dann aber kummervoll am Tische vor dem Ungenossenen dasitzen. Er sah sie darauf einen Band eines großen Andachtswerkes, fast ihre ganze Bibliothek, nehmen und eine geraume Zeit hineinblicken, ohne zu lesen; endlich ergriff sie die stille Lampe und ging langsam nach dem Alkoven, hinter dessen schneeweißen Vorhängen Heinrichs Wiege gestanden hatte. Hier mußte er den Mantel ein wenig vor sein Gesicht drücken, es war ihm, als ob er schon jahrelang und tausend Stunden weit in der Ferne gelebt hätte, und es befiel ihn eine plötzliche Angst, daß er die Stube nie mehr betreten dürfe.
Er konnte sich nicht enthalten, jene Familien bitterlich zu beneiden, welche Vater, Mutter und eine hübsche runde Zahl Geschwister nebst übriger Verwandtschaft in sich vereinigen, wo, wenn je eines aus ihrem Schoße scheidet, ein andres dafür zurückkehrt und über jedes außerordentliche Ereignis ein behaglicher Familienrat abgehalten wird, und selbst bei einem Todesfalle verteilt sich der Schmerz in kleinere Lasten auf die zahlreichen Häupter, so daß oft wenige Wochen hinreichen, denselben in ein fast angenehm-wehmütiges Erinnern zu verwandeln. Wie verschieden dagegen war seine eigne Lage! Das ganze Gewicht ruhte auf zwei einzigen Seelen; wurden die auseinandergerissen, so kannte jede die Einsamkeit der anderen, und der Trennungsschmerz wurde so verdoppelt.
Haben wohl, dachte er, jene Propheten nicht unrecht, welche die jetzige Bedeutung der Familie vernichten wollen? Wie kühl, wie ruhig könnten nun meine Mutter und ich sein, wenn das Einzelleben mehr im Ganzen aufgehen, wenn nach jeder Trennung man sich gesichert in den Schoß der Gesamtheit zurückflüchten könnte, wohl wissend, daß der andere Teil auch darin seine Wurzeln hat, welche nie durchschnitten werden können, und wenn endlich demzufolge die verwandtschaftlichen Leiden beseitigt würden!
Im Mittelalter wurde der Tod als ein menschliches Skelett abgebildet, und es hat sich daraus eine ganze Knochenromantik entwickelt; sogar leblose Gegenstände, wie Meerschiffe, wurden skelettisiert und mußten auf dem Meere als Totenschiff spuken. Denkt man sich solcherweise das fliegende Gerippe einer Krähe, so war es der Schatten derselben, welchem der Gedanke glich, der soeben über Heinrichs Seele lief. Die warme Sonne schien reichlich durch das dürre Gitter der Knöchlein und Gebeine.
Nein, rief ihm sein innerstes Gefühl zu, der Zustand, den sich diese Menschen wünschen, gleicht zu sehr der stabilen gedankenlosen Seligkeit, welche das höchste Ziel der meisten Christen ist. Man muß wohl unterscheiden zwischen Leiden und Leiden; das eine ist zu dulden, ja zu ehren, während das andere unzulässig ist!
Nicht ohne Herzklopfen vernahm er nun, daß man sich dem Rheine nähere, und bald sah er den schönen Fluß im Mond lichte glänzend daherwallen. Die Post hielt in einem kleinen Grenzorte, und als das Nachtquartier besorgt war, ging Heinrich wieder hinaus; denn die freie Natur, der nächtliche Himmel waren nun seine einzigen Bekannten. Einen jungen Fischer, der singend in seinem Kahne saß, bewog er, ein wenig stromaufwärts zu fahren. Die Nacht war schön; das deutsche Ufer zeichnete sich dunkel mit seinen Wäldern auf den heitern Himmel. Noch eine Ruderlänge, und Heinrich konnte den Fuß auf dies Land setzen, dessen Namen ihn mit dunklen lockenden Erwartungen erfüllte. Das badische Ufer war gerade nicht sehr verschieden vom schweizerischen. Es war finster und still, eine einsame Zollstätte ruhte unter Bäumen, ein mattes Licht brannte darin. Aber schimmernd umfaßte die Rheinflut den steinigen Strand, und ihre Wellen zogen gleichmäßig kräftig dahin, hell glänzend und spiegelnd in der Nähe, in der Ferne in einem mildern Scheine verschwimmend. Und über diese Wellen war fast alles gekommen, was Heinrich in seinen Bergen Herz und Jugend bewegt hatte. Hinter jenen Wäldern wurde seine Sprache rein und so gesprochen, wie er sie aus seinen liebsten Büchern kannte, so glaubte er wenigstens, und er freute sich darauf, sie nun ohne Ziererei auch mitsprechen zu dürfen. Hinter diesen stillen schwarzen Uferhöhen lagen alle die deutschen Gauen mit ihren schönen Namen, wo die vielen Dichter geboren sind, von denen jeder seinen eigenen mächtigen Gesang hat, der sonst keinem gleicht, und die in ihrer Gesamtheit den Reichtum und die Tiefe einer Welt, nicht eines einzelnen Volkes, auszusprechen scheinen. Er liebte sein helvetisches Vaterland; aber über diesen Strom waren dessen heiligste Sagen, in unsterblichen Liedern verherrlicht, erst wieder zurückgewandert; fast an jedem Herde und bei jedem Feste, wo der rüstige Schatten mit Armbrust und Pfeil heraufbeschworen wurde, trug er das Gewand und sprach die Worte, welche ihm der deutsche Sänger gegeben hat. Er schwärmte nur für die deutsche Kunst, von welcher er allerlei Wundersames erzählen hörte, und verachtete alles andere, Frankreich liebte er, wie man ein schönes liebenswürdiges Mädchen mitliebt, dem alle Welt den Hof macht, und wenn etwas Gutes in Paris geschah, so freute er sich höchlich, kam etwas Widerwärtiges vor, so wußte er allerlei galante Entschuldigungen aufzubringen. Erblickte hingegen in Deutschland etwas Gutes das Licht, so machte er nicht viel Wesens daraus, als ob sich das von selbst verstände, und des Schlechten schämte er sich, und es machte ihn zornig. Alles aber, was er sich unter Deutschland dachte, war von einem romantischen Dufte umwoben. In seiner Vorstellung lebte das poetische und ideale Deutschland, wie sich letzteres selbst dafür hielt und träumte. Er hatte nur mit Vorliebe und empfänglichem Gemüte das Bild in sich aufgenommen, welches Deutschland durch seine Schriftsteller von sich verfertigen ließ und über die Grenzen sandte. Das nüchterne praktische Treiben seiner eigenen Landsleute hielt er für Erkaltung und Ausartung des Stammes und hoffte jenseits des Rheines die ursprüngliche Glut und Tiefe des germanischen Lebens noch zu finden. Dabei hatte er alle Richtungen und Färbungen desselben ineinandergeflochten, ohne Kenntnis und Beurteilung ihrer natürlichen Stellung unter- und gegeneinander. Dem Rationalismus hing die romantische Caprice am Arm, das Schillersche Pathos und der britische Humor, Jean Paulsche Religiosität und Heinesche Eulenspiegelei schillerten durcheinander wie eine Schlangenhaut; die Beschwörungsformeln aller Richtungen hatte er im Gedächtnis und sah darum begeistert das vor ihm liegende Land als einen großen alten Zaubergarten an, in welchem er als ein willkommener Wanderer mit jenen Stichworten köstliche Schätze heben und wieder in seine Berge zurücktragen dürfe.
Neugierig schaute Heinrich, näher hinzufahrend, in die dämmernde Waldnacht hinein, welche nur spärlich vom Mondlicht durchschienen ward, und als ein Reh aus dem Busche an das Ufer trat, ein in der Schweiz schon seltenes Tier, da begrüßte er es freudigen Mutes als einen freundlichen Vorboten. Es war übrigens gut, daß er keine solidere und gefährlichere Schmuggelware in seinem leichten Fahrzeuge führte als solche Hoffnungen; denn ein Wächter des deutschen Zollvereins war dem Schifflein schon geraume Zeit mit gespanntem Hahn nachgeschlichen, um zu spähen, wo es etwa landen möchte. Sein Rohr blinkte hin und wieder matt vom Scheine der mondbeglänzten Wellen.
Der Ostermontag sah den jungen Pilger schon früh den Rhein hinauf und Hussens Brandstätte vorbei über den weithin leuchtenden Bodensee fahren. Das schöne Gewässer, welches vom Mai bis zum Weinmonat der paradiesischen Landschaft zur Folie dient, machte jetzt noch seinen Reiz und seine Klarheit für sich selbst geltend, und das mehr und mehr im blauen Dufte verschwindende Ufer des Thurgaus schien nun bloß um der schönen Umgrenzung des Sees willen dazusein. Sanft und rasch trugen die Fluten das Schiff an das fremde Gebiet hinüber, und erst als eine Schar grämlich-höflicher Bewaffneter den plötzlich Gelandeten umringte und von allen Seiten musterte, tat es ihm fast weh, daß an der Schwelle seines Vaterlandes ihn gar niemand um sein Weggehen befragt und besichtigt hatte.