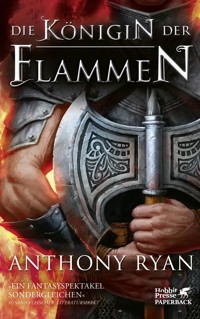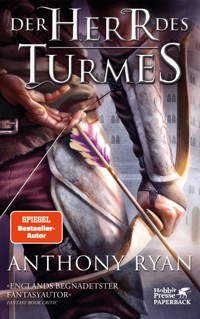
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rabenschatten
- Sprache: Deutsch
»Das Lied des Blutes« hat viele Leser in eine faszinierende Fantasywelt voller Geheimnisse, Gefahren und religiöser Konflikte geführt. Im zweiten Band der Rabenschatten-Trilogie muss Vaelin al Sorna erkennen, dass es vor dem Schicksal kein Entrinnen gibt. Vaelin al Sorna kehrt aus den Schlachten zurück und die schwere Bürde der Erinnerung lastet auf ihm. Nie wieder will er töten. Zu viele haben in König Janus' Krieg ihr Leben gelassen. Nicht nur, dass er für viele, die überlebt haben, das Ziel ihrer Rachegelüste ist. Zum Turmherrn der Nordlande ernannt, möchte er fern aller Intrigen Ruhe finden. Doch der neue König ist schwach und die Feinde des Reiches schmieden ein Bündnis, das mehr und mehr an Macht gewinnt. Wird Vaelin al Sorna, der das Töten hasst und in seiner Loyalität hin und her gerissen ist, doch wieder zum Schwert greifen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1282
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ANTHONY RYAN
RABENSCHATTEN 2
AUS DEM ENGLISCHEN ÜBERSETZTVON HANNES RIFFEL &BIRGIT MARIA PFAFFINGER
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Tower Lord. A Raven’s Shadow Novel« im Verlag ACE Books,
The Penguin Group (USA) Inc., New York 2014
© 2014 by Anthony Ryan
Für die deutsche Ausgabe
© 2015 / 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg;
Illustration: Federico Musetti
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94972-8
E-Book: ISBN 978-3-608-10837-8
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für meine Mutter Catherine,
die lange vor mir daran geglaubt hat
INHALT
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Vierter Teil
Fünfter Teil
Anhang IDramatis Personae
Anhang IIDie Regeln des Kriegersextetts
Danksagung
Karten
Erster Teil
◆◆◆
Der Rabe gleitet auf Feuerflügeln einherdieweil Flammen geboren werdenauf Sommerwinden.
— Seordahnisches Gedicht, anonym —
VERNIERS’ BERICHT
Meine Kindheit und Jugend habe ich in großem Wohlstand verbracht. Entschuldigen werde ich mich dafür nicht, denn schließlich hat man keinen Einfluss darauf, von wem man abstammt. Ich bedaure es auch nicht, im Überfluss gelebt zu haben, umgeben von Dienern und vortrefflichen Hauslehrern, die meine Neugier nährten und meine Begabungen förderten. Aus meiner Jugend weiß ich keine Geschichten von Mühsal und Entbehrung zu erzählen, keine Epen über das Ringen mit der Ungerechtigkeit des Lebens. Ich wurde in eine Familie von edler Abstammung und beträchtlichem Reichtum hineingeboren, habe eine außergewöhnliche Erziehung genossen und wurde schließlich, dank der Verbindungen meines Vaters, bei Hofe in Dienst genommen. Auch wenn treuen Lesern durchaus bekannt sein wird, dass mein Leben nicht völlig frei von Kummer und Leid war, habe ich in den sechsunddreißig Jahren, welche den Ereignissen vorausgingen, die hier geschildert werden, nie auch nur einen Tag körperlicher Strapazen gekannt. Hätte ich allerdings geahnt, dass meine Reise in die Königslande, wo ich meine Arbeit an einer vollständigen und vorurteilsfreien Geschichte dieses schrecklichen, wenngleich faszinierenden Reiches zu beginnen gedachte, mich mit mühevoller Arbeit, Erniedrigung und Folter bekannt machen würde, so wäre ich freudig über Bord gesprungen und hätte mich nach Kräften bemüht, die riesigen Gewässer, in denen es vor Haien nur so wimmelt, schwimmend zu überwinden, um nach Hause zurückzukehren. Mit Anbruch des Tages, an dem ich diese Geschichte zu erzählen beginne, hatte ich erfahren, was Schmerzen sind. Peitsche und Knüppel haben mich ihre Lektion gelehrt, und ich weiß, wie metallisch Blut schmeckt, wenn es einem aus dem Mund hervorschießt und Zähne und jeden Widerstandswillen mit sich fortreißt. Ich habe gelernt, was es heißt, ein Sklave zu sein. Als ein solcher wurde ich gerufen, denn ich war einer, und ungeachtet des ganzen Unfugs, den Ihr gehört oder gelesen haben mögt, war ich nie, zu keinem Zeitpunkt, ein Held.
Der volarianische General war jünger, als ich erwartet hatte, und seine Gattin– meine neue Besitzerin– desgleichen. »Wie ein Gelehrter sieht er nicht aus, mein Herz«, sagte er nachdenklich und musterte mich eingehend. »Dafür ist er ein wenig zu jung.« Er hatte sich, in rote und schwarze Seidengewänder gehüllt, auf einem Diwan niedergelassen, wie es sich für einen hochgeachteten Soldaten ziemte; seine Glieder waren wohlproportioniert, sein Körperbau athletisch. Auffallend war jedoch, dass die blasse Haut an seinen Armen und Beinen keinerlei Narben aufwies. Sogar sein Gesicht war glatt und makellos. Inzwischen bin ich zahllosen Kriegern unterschiedlicher Nationen begegnet, doch dieser war der erste, dem sein Beruf nicht anzusehen war.
»Scharfe Augen scheint er allerdings zu haben«, fuhr der General fort, als er meinen prüfenden Blick bemerkte. Sofort schlug ich die Augen nieder und machte mich auf den unvermeidlichen Schlag oder Peitschenhieb des Aufsehers gefasst. Am ersten Tag meiner Knechtschaft hatte ich miterlebt, wie ein gefangener Soldat des königlichen Heeres bestraft worden war, nur weil er einem untergeordneten Offizier der Freien Reiterei einen wütenden Blick zugeworfen hatte– erst war er bis aufs Blut ausgepeitscht worden, und dann hatte man ihm den Bauch aufgeschlitzt. Dies würde ich so schnell nicht vergessen.
»Hochverehrter Gatte«, sagte die Frau des Generals mit ihrer etwas schrillen, aber kultivierten Stimme. »Darf ich vorstellen? Verniers Alishe Someren, Erster der Gelehrten und kaiserlicher Geschichtsschreiber am Hofe seiner Hoheit Aluran Maxtor Selsus.«
»Ist er das wirklich, mein Herz?« Zum ersten Mal, seit ich diese vornehme Kajüte betreten hatte, schien das Interesse des Generals geweckt. Für eine Schiffskoje war das Gemach ungeheuer groß, ganz abgesehen von den teuren Teppichen und Wandbehängen, den mit Früchten und Wein überladenen Tischen. Wäre das sanfte Schaukeln des Kriegsschiffs nicht gewesen, hätte man sich in einem Palast wähnen können.
Der General erhob sich und kam auf mich zu, wobei er mein Gesicht genauer in Augenschein nahm. »Der Autor der Gesänge von Gold und Staub? Der Chronist des Großen Erlösungskrieges?« Er trat noch etwas näher und schnüffelte an mir. Seine Nasenflügel erbebten angewidert. »Ich finde, er riecht wie jeder andere alpiranische Hund. Und sein Blick ist bei weitem zu unverschämt.«
Er wich einige Schritte zurück und gab dem Aufseher ganz beiläufig ein Zeichen. Dieser versetzte mir den Hieb, den ich schon längst erwartet hatte, einen festen Schlag auf den Rücken, ausgeführt mit dem elfenbeinernen Peitschengriff, eine geübte, kaum wahrnehmbare Bewegung. Ich verbiss mir den Schmerzensschrei– ein Ausruf wurde als Rede gewertet, und wer ohne Aufforderung sprach, hatte den Tod zu gewärtigen.
»Mein Gatte, bitte!«, sagte die Frau des Generals in einer Anwandlung von Verärgerung. »Er war teuer.«
»Ach, das glaube ich wohl.« Der General streckte eine Hand aus, und in Windeseile kam ein Sklave herbei und füllte seinen Weinbecher. »Keine Sorge, verehrte Gattin. Ich werde darauf achten, dass sein Verstand und seine Hände unversehrt bleiben. Ohne sie taugt er nicht viel, oder? Nun denn, Schreiberling, wie kommt es, dass du dich in dieser von uns erst vor kurzem eroberten Provinz aufhältst?«
Ich antwortete schnell, während ich meine Schmerzenstränen fortblinzelte– wer zögerte, wurde umgehend bestraft. »Ich wollte Nachforschungen für ein neues Geschichtswerk anstellen, Herr.«
»Ausgezeichnet! Ich bin ein großer Bewunderer deiner Werke. Nicht wahr, mein Herz?«
»In der Tat, mein Gatte. Ihr seid selbst ein Gelehrter.« In ihrer Stimme schwang, als sie das Wort »Gelehrter« aussprach, ein merklicher Unterton mit. Hohn, wie mir bewusst wurde. Sie hat keinen Respekt vor diesem Mann. Und doch macht sie mich ihm zum Geschenk.
Es dauerte einen Moment, bevor der General weiterredete, und plötzlich klang er ein wenig gereizt. Ihm war die Beleidung nicht entgangen, doch er nahm sie hin. Wer hatte hier das Sagen?
»Und was war das Thema?«, wollte der General wissen. »Deines neuen Geschichtswerks?«
»Die Vereinigten Königslande, Herr.«
»Ah, dann haben wir dir ja einen Dienst erwiesen, nicht wahr?« Er kicherte, ganz entzückt über seinen eigenen Humor. »Schließlich haben wir dafür gesorgt, dass diese Geschichte ein Ende findet.«
Er lachte erneut, trank aus seinem Weinbecher und zog eine Augenbraue hoch. »Nicht übel. Schreib das auf, Sekretär.« Der glatzköpfige Sklave, der in einer Ecke gekauert hatte, trat vor, den Stift über dem Pergament erhoben. »Befehle an die Kundschafter: Die Weingüter sollen unangetastet bleiben und die Sklavenquoten in den Weinregionen halbiert werden. Schließlich wollen wir nicht, dass diese Fertigkeit in…« Er hielt inne und sah mich erwartungsvoll an.
»Cumbrael, Herr«, sagte ich.
»… in Cumbrael in Vergessenheit gerät. Nicht eben ein beeindruckender Name, wenn ich es mir recht überlege. Ich hätte gute Lust, dem Rat nach meiner Rückkehr vorzuschlagen, die Provinz umzubenennen.«
»Man muss dem Rat angehören, um ihm einen Vorschlag unterbreiten zu können, hochverehrter Gatte«, sagte seine Frau, dieses Mal ohne jede Geringschätzung. Mir entging jedoch nicht, wie der General seine wütenden Blicke hinter dem Weinbecher verbarg.
»Wo wäre ich, wenn Ihr mich nicht allzeit darauf hinweisen würdet, Fornella?«, murmelte er. »Nun denn, Geschichtsschreiber, wie geschah es, dass es uns vergönnt wurde, dich in unserer Familie willkommen zu heißen?«
»Ich war mit dem königlichen Heer unterwegs, Herr. König Malcius hatte mir die Erlaubnis erteilt, seine Soldaten bei ihrem Einsatz in Cumbrael zu begleiten.«
»Du warst also dort? Du hast meinen ruhmreichen Sieg miterlebt?«
Es kostete mich große Anstrengung, die Flut höllischer Geräusche und Bilder zu unterdrücken, die seit jenem Tag meine Träume heimsuchten. »Ja, Herr.«
»Mir scheint, Euer Geschenk ist weit wertvoller, als Euch bewusst war, Fornella.« Er schnippte mit dem Finger, und sein Sekretär hob den Kopf. »Gebt dem Geschichtsschreiber Stift, Pergament und eine Kajüte. Aber keine allzu bequeme, damit er mir nicht einnickt, anstatt seinen zweifellos wortgewaltigen und ergreifenden Bericht über meinen ersten großen Triumph während dieses Feldzugs zu verfassen.«
Er trat wieder dicht an mich heran und lächelte das Lächeln eines Kindes beim Anblick eines neuen Spielzeugs. »Ichmöchte ihn morgen früh lesen. Wenn nicht, kostet es dich ein Auge.«
♦ ♦ ♦
Meine Hände schmerzten und mein Rücken war verspannt, denn der Tisch, den sie mir zur Verfügung gestellt hatten, war viel zu niedrig. Die Ärmel meines Sklavengewands waren von Tintenspritzern übersät, und vor Erschöpfung verschwamm mir die Welt vor den Augen. Noch nie zuvor hatte ich in so kurzer Zeit so viele Worte niedergeschrieben. Pergamentbögen lagen überall in der Kabine verstreut, bedeckt von oft ungelenken Versuchen, die Lüge zu verfertigen, die der General von mir verlangt hatte. Ein ruhmreicher Sieg. Auf dem Schlachtfeld war nichts ruhmreich gewesen. Schmerzensschreie und unbändiges Gemetzel. Der Gestank von Scheiße und Tod. Ruhm? Nicht die Spur. Gewiss wusste der General das, schließlich war die Niederlage des königlichen Heeres sein Werk, aber mir war befohlen worden, eine Lüge hervorzubringen, und als pflichtbewusster Sklave bemühte ich mich nach Kräften, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Als die Nacht ihren Höhepunkt überschritten hatte, wurde ich hin und wieder von Schlaf überwältigt, der mich in Albtraumwelten riss– Welten, in denen die Erinnerungen an jenen Tag mit völliger Klarheit zurückkehrten… Das Gesicht des Kriegsherrn, als ihm bewusst wurde, dass nichts mehr die Niederlage abwenden konnte, die grimmige Entschlossenheit, als er sein Schwert zog und direkt auf die volarianischen Linien zuritt, wo er von den Kuritai niedergestreckt wurde, bevor er nur einen einzigen Streich führen konnte…
Ein lautes Klopfen holte mich in die Wirklichkeit zurück. Während die Kajütentür sich öffnete, rappelte ich mich auf. Ein Haussklave trat ein, in der Hand ein Tablett mit Brot und Trauben sowie einer kleinen Flasche süß duftendem Wein. Er stellte es auf dem Tisch ab und ging wortlos hinaus.
»Ich dachte mir, Ihr hättet vielleicht Hunger.«
Mein ängstlicher Blick richtete sich auf die Frau des Generals, die in der Tür stehen geblieben war. Sie trug ein Kleid aus roter Seide, das, mit Goldfäden durchwirkt, ihre Figur mehr als nur zur Geltung brachte. Sofort senkte ich den Blick.
»Vielen Dank, Herrin.«
Sie trat ein, schloss die Tür hinter sich und betrachtete die Blätter, die mit meiner fieberhaften Schrift bedeckt waren. »Und, seid Ihr fertig?«
»Ja, Herrin.«
Sie griff nach einem der Blätter. »Das ist Volarianisch.«
»Ich bin davon ausgegangen, dass dies dem Wunsch des Generals entspricht, Herrin.«
»Da habt Ihr wohl recht.« Während sie las, legte sie ihre Stirn in Falten. »Und elegant formuliert ist es auch. Mein Gatte wird neidisch sein. Er schreibt Gedichte, müsst Ihr wissen. Wenn Ihr einmal wirklich Pech habt, wird er sie Euch vortragen. Dann klingt er immer wie eine Ente mit einem äußerst unangenehmen Quaken. Aber das…« Sie hielt das Blatt hoch. »Es gibt hochangesehene volarianische Gelehrte, die Ihr damit beschämen würdet.«
»Ihr seid zu freundlich, Herrin.«
»Nein, ich spreche die Wahrheit. Sie ist meine Waffe.« Die Frau des Generals hielt inne und las dann laut vor. »Törichterweise unterschätzte der königliche Heerführer die Fähigkeiten seines Feindes und versuchte es mit einer ebenso offensichtlichen wie primitiven Strategie: Er wollte die Mitte derVolarianer direkt angreifen, während seine Kavallerie sich ihrer Flanke zuwandte. Dabei rechnete er allerdings nicht mit dem unvergleichlichen taktischen Scharfsinn von General Reklar Tokrev, der sämtliche dieser unbeholfenen Entscheidungen voraussah.« Sie blickte mich an. »Ganz offensichtlich seid Ihr ein Mann, der sein Publikum kennt.«
»Es freut mich, dass es Euch gefällt, Herrin.«
»Mir gefällt? Keineswegs. Aber meinem hochverehrten Gatten wird es gefallen, Dummkopf, der er ist. Diese Knittelverse werden spätestens morgen Abend an Bord des schnellsten Schiffes ins Kaiserreich unterwegs sein, zweifelsohne zusammen mit einem Befehl, tausend Abschriften davon anfertigen zu lassen.« Sie warf das Blatt beiseite. »Sagt mir– und ich befehle Euch, die Wahrheit zu sprechen–, wie kam es, dass das königliche Heer durch seine Hand eine solche Niederlage erlitten hat?«
Ich schluckte schwer. Sie mochte die Wahrheit von mir verlangen, aber was für einen Schutz konnte sie mir bieten, wenn sie diese Wahrheit mit zurück in ihr Ehebett nahm? »Herrin, ich habe mich womöglich einer etwas farbenfrohen Schilderung bedient…«
»Die Wahrheit, habe ich gesagt!« Wieder der schrille Tonfall, mehr als befehlsgewohnt. Die Stimme einer Frau, die lebenslang Sklaven besessen hatte.
»Das Heer des Königs ist der Überzahl und dem Verrat zum Opfer gefallen. Die Soldaten haben tapfer gekämpft, aber es waren zu wenig.«
»Ich verstehe. Habt Ihr an ihrer Seite gekämpft?«
Gekämpft? Als sich abzeichnete, dass die Königlichen die Schlacht verlieren würden, hatte ich mein Pferd blutig gepeitscht, um hinter die Linien zu gelangen und damit in Sicherheit. Doch es gab keine Sicherheit, die Volarianer waren überall, und sie töteten jeden. Ich entdeckte einen Leichenhaufen, unter dem ich mich verstecken konnte, und kroch später, als die Finsternis hereingebrochen war, darunter hervor, nur um sogleich von Sklavenjägern ergriffen zu werden. Diese Männer waren äußerst begierig gewesen, den Wert jedes Gefangenen einzuschätzen, und was ich wert war, wurde offensichtlich, als ich– nach der ersten Züchtigung– meinen wahren Namen preisgab. Die Frau des Generals hatte mich direkt aus dem Lager heraus gekauft, der in Ketten gelegten Meute entrissen. Allem Anschein nach hatte sie Befehl erteilt, sämtliche Gelehrte zu ihr zu bringen. Ich war offenbar ein ansehnlicher Fang, wovon auch der gut gefüllte Beutel zeugte, den sie dem Aufseher überreicht hatte.
»Ich bin kein Krieger, Herrin.«
»Das hoffe ich auch nicht, schließlich habe ich Euch nicht wegen Eures Heldenmuts gekauft.« Einen Moment betrachtete sie mich schweigend. »Ihr wisst es gut zu verbergen, aber ich sehe es trotzdem, Lord Verniers. Ihr hasst uns. Wir mögen Euch so lange geprügelt haben, bis Ihr uns gehorcht, aber der Hass ist noch immer da, wie trockener Zunder, der auf einen Funken wartet.«
Mein Blick blieb fest auf den Boden gerichtet und konzentrierte sich auf die verschlungenen Knoten in den Dielen, während sich auf meinen Handflächen frischer Schweiß bildete. Ihre Finger umfassten mein Gesicht und hoben mein Kinn. Ich schloss die Augen und unterdrückte einen angstvollen Laut, als sie mich küsste– ihre Lippen strichen ganz sanft über die meinen.
»Morgen früh«, sagte sie, »wird er wollen, dass Ihr dem abschließenden Angriff auf die Stadt beiwohnt, jetzt, nachdem die Breschen geschlagen sind. Sorgt unbedingt dafür, dass Euer Bericht angemessen aufgeplustert ist! Volarianer mögen es, wenn ihre blutigen Geschichten farbenprächtig erzählt werden.«
»Darauf könnt Ihr Euch verlassen, Herrin.«
»Also gut.« Sie trat zurück und öffnete die Tür. »Mit etwas Glück werden wir uns nicht allzu lange in diesem feuchten Land aufhalten müssen. Ich würde Euch in Volar gerne meine Bibliothek zeigen. Mehr als zehntausend Bände, manche so alt, dass niemand sie mehr übersetzen kann. Würde Euch das gefallen?«
»Sehr, Herrin.«
Sie seufzte mit einem Lächeln und verließ die Kajüte ohne ein weiteres Wort.
Ich starrte die geschlossene Tür lange an, ohne das Essen auf dem Tisch zu beachten, und das, obwohl mein Magen knurrte. Aus irgendeinem Grund hatten meine Hände aufgehört zu schwitzen. Trockener Zunder, der auf einen Funken wartet…
♦ ♦ ♦
Sie sollte recht behalten– der General ließ mich am Morgen auf das Vorderdeck bringen, von wo aus ich zuschauen musste, wie die Volarianer die Stadt Alltor einnahmen, die sie nun seit zwei Monaten belagerten. Es war ein beeindruckender Anblick: Die Zwillingstürme der Kathedrale des Weltvaters erhoben sich aus dem Meer der dicht beieinanderstehenden Häuser auf der großen, von einer Mauer gesäumten Insel, die mit dem Festland nur über eine einzige Dammstraße verbunden war. Dank meiner Nachforschungen wusste ich, dass diese Stadt noch nie eingenommen worden war, weder von Janus während der Vereinigungskriege noch von einem der früheren Anwärter auf die Königskrone. Dreihundert Jahre hatte sie allen Eroberern widerstanden! Doch damit war es jetzt vorbei, und das allein wegen zweier Breschen, die von den gewaltigen Wurfgeschützen in die Mauern geschlagen worden waren– Wurfgeschützen, die zweihundert Meter vom Ufer entfernt auf Schiffen emporragten und noch immer ihr Werk verrichteten und ihre riesigen Steine in die Breschen schleuderten, obzwar diese für mein unmilitärisches Auge schon ausreichend groß aussahen.
»Sind sie nicht prachtvoll, Geschichtsschreiber?«, fragte der General. Heute war er in voller Rüstung erschienen, die aus einer reich verzierten roten Emaillebrustplatte und schenkelhohen Kavalleriestiefeln bestand, mit einem Kurzschwert am Gürtel, jeder Zoll ein volarianischer Kommandant. Ich bemerkte einen weiteren Sklaven, der in der Nähe saß, einen spindeldürren alten Mann mit ungewöhnlich hellen Augen; ein Kohlestummel in seiner Hand bewegte sich über eine breite Leinwand, um das Bildnis des Generals festzuhalten. Der General deutete auf eines der Wurfgeschütze, warf sich in Pose und blickte über die Schulter zu dem alten Sklaven.
»Bisher wurden sie ausschließlich an Land eingesetzt, aber ich habe ihr Potential erkannt, uns hier den Sieg zu bringen. Eine erfolgreiche Verbindung von Land- und Seekriegsführung. Schreib das nieder.« Ich kritzelte seine Worte auf das Pergament, das mir zu diesem Zweck ausgehändigt worden war.
Der alte Mann hörte auf zu skizzieren und verneigte sich mit ernster Miene vor dem General. Dieser entspannte sich und trat an einen Kartentisch. »Ich habe deinen Bericht gelesen«, erklärte er mir. »Klug von dir, mit deinem Lob so zurückhaltend zu sein.«
Wieder spürte ich, wie sich mir vor Angst die Brust zusammenkrampfte, und ganz kurz überlegte ich, ob er mich vorher fragen würde, welches Auge er mir ausreißen sollte.
»Ein allzu schmeichelhafter Bericht hätte unter meinen Lesern zu Hause wohl Misstrauen hervorgerufen«, fuhr er fort. »Dann hätten sie bestimmt gedacht, ich hätte meine Errungenschaften ein wenig übertrieben. Das hast du klug vorausgesehen.«
»Danke, Herr.«
»Das war kein Kompliment, sondern lediglich eine Feststellung. Schau, hier.« Er bedeutete mir, näher zu kommen, und wies auf die Karte, die auf dem Tisch lag. Mir war durchaus geläufig, dass volarianische Kartographen für ihre Genauigkeit bekannt waren, doch dieser Stadtplan von Alltor war so außerordentlich detailliert, dass er die besten Bemühungen der Gilde der kaiserlichen Landvermesser weit hinter sich ließ. Sofort fragte ich mich, wie lange die Volarianer diesen Überfall bereits geplant hatten und wer ihnen alles dabei geholfen hatte.
»Die Breschen sind hier und hier.« Seine Finger deuteten auf zwei Kohlemarkierungen auf der Karte, plumpe Striche durch die mit feiner Hand gezeichneten Mauern. »Ich werde beide gleichzeitig angreifen. Gewiss werden die Cumbraeler auf ihrer Seite allerlei Unannehmlichkeiten vorbereitet haben, aber sie werden sich ausschließlich auf die Breschen konzentrieren und nicht erwarten, dass wir noch einmal die Mauern stürmen.« Er tippte auf einen Punkt auf der nach Westen gewandten Mauer, der mit einem Kreuz markiert war. »Ein ganzes Bataillon Kuritai wird die Mauer erklimmen und die nächstgelegene Bresche von hinten einnehmen. Damit werden wir uns einen Zugang zur Stadt sichern, und ich gehe davon aus, dass sie bis zum Einbruch der Dunkelheit in unserer Hand ist.«
Ich schrieb das alles nieder, wobei ich darauf achtete, nicht der Versuchung zu erliegen, ins Alpiranische zu verfallen. Falls ich mir Notizen in meiner Muttersprache machte, würde das sicherlich Misstrauen erregen. Der General trat vom Kartentisch zurück und sagte mit theatralischer Geste: »Ich muss zugeben, dass diese Gottesanbeter tapfere Feinde waren und, der Wahrheit die Ehre, die besten Bogenschützen, denen ich auf dem Schlachtfeld jemals begegnet bin. Diese Hexe scheint sie wirklich zu großen Anstrengungen zu beflügeln. Du hast zweifelsohne von ihr gehört, nicht wahr?«
In den Sklavenpferchen waren Neuigkeiten ein knappes Gut gewesen– nur wenn die Freien Schwerter einander Gerüchte zuflüsterten, schnappte man hier und dort etwas auf. Zumeist waren es Geschichten von neuen Massakern, welche die volarianischen Armeen auf ihrem Plünderungszug durch die Königslande begingen. Doch als diese sich nach Süden wandten und in Cumbrael einmarschierten, kam die Rede immer wieder auf die schreckliche Hexe von Alltor, den einzigen Hoffnungsfunken in einem dem Untergang geweihten Land. »Nur vage Gerüchte, Herr. Gut möglich, dass sie lediglich eine Mär ist.«
»O nein, es gibt sie wirklich. Die Wahrheit habe ich von einer Kompanieder Freien Schwerter erfahren, die nach dem letzten Angriff auf die Mauern geflohen ist. Sie sei dort gewesen, erzählten sie, ein Mädchen, nicht älter als zwanzig Jahre, mitten im Kampfgetümmel. Zahlreiche Männer soll sie getötet haben, behaupteten sie. Ich habe die nichtsnutzigen Feiglinge natürlich alle erdrosseln lassen.« Einen Moment hielt er gedankenversunken inne. »Schreib das auf: Feigheit ist der schlimmste Verrat an dem Geschenk der Freiheit. Denn ein Mann, der vor dem Kampf flieht, ist ein Sklave seiner Furcht.«
»Sehr tiefsinnig, hochverehrter Gatte.« Die Frau des Generals gesellte sich zu uns. An diesem Morgen war sie eher einfach gekleidet: Anstelle des edlen Seidenkleids trug sie ein schlichtes Musselingewand und einen roten Wollschal. Sie glitt an mir vorbei, dichter, als es im Grunde ziemlich war, schritt zur Reling und beobachtete die Männer, die eine der großen Winden betätigten, um die Zwillingsarme des Wurfgeschützes ein weiteres Mal zu spannen. »Vergesst nicht, dem bevorstehenden Blutbad in Eurem Bericht angemessen Platz einzuräumen, Verniers!«
»Jawohl, Herrin.« Mir entging nicht, dass die Hand des Generals am Heft seines Schwertes zuckte. Sie verspottet ihn bei jeder Gelegenheit. Und doch hält er seinen Zorn im Zaum, dieser Mann, der Tausende abgeschlachtet hat. Worin mag ihre wahre Rolle bestehen?, fragte ich mich.
Fornellas Blick richtete sich auf ein kleines Boot, das sich unserem Schiff näherte. Es war Ebbe, und die Riemen tauchten mit schöner Regelmäßigkeit in das ruhige Wasser. Im Bug stand ein Mann, der auf diese Entfernung nur schwer zu erkennen war, doch als sie ihn sah, erstarrte sie am ganzen Leib. »Unser Verbündeter schickt seinen Günstling, hochverehrter Gatte«, sagte sie.
Der General folgte ihrem Blick, und ganz kurz glitt ein düsterer Schatten über seine Gesichtszüge: Auf Zorn folgte Furcht. Plötzlich hatte ich das Bedürfnis, mich in Luft aufzulösen. Wer auch immer sich da dem Schiffe näherte– ich wusste, dass ich seine Bekanntschaft nicht machen wollte, wenn er diesen Menschen Angst einjagte. Aber natürlich gab es kein Entrinnen. Ich war ein Sklave, und niemand hatte mich fortgeschickt. Also blieb mir nichts anderes übrig, als stehen zu bleiben und auszuharren. Ein Tau wurde über Bord geworfen, und der volarianische Seemann fing es auf und band es mit einer Effizienz fest, die ihn Jahre ängstlicher Knechtschaft gelehrt hatten.
Der Mann, der sich auf das Deck hochzog, war in mittlerem Alter und untersetzt; er hatte einen Bart und sich lichtendes Haar. Sein Gesicht zeigte keinerlei Regung. »Willkommen«, sagte der General, um einen neutralen Tonfall bemüht. Kein Name zur Begrüßung, stellte ich fest. Wer ist dieser Mann?
»Ihr habt neue Informationen für uns, nehme ich an?«, fuhr der General fort.
Der Mann schenkte der Frage keine Beachtung. »Der Alpiraner«, grollte er mit einem Akzent, der, so hatte ich gelernt, aus dem Norden des gefallenen Reiches stammte. »Welcher ist er?«
»Was wollt Ihr von ihm?«, fragte Fornella mit schriller Stimme. Er wandte nicht einmal den Kopf, und meine Furcht erreichte neue Höhen, als er den Blick über das Deck schweifen ließ und schließlich auf mich richtete. Dann schritt er auf mich zu und blieb so dicht vor mir stehen, dass ich den üblen Geruch seines ungewaschenen Leibes riechen konnte. Er stank nach Tod und vollkommener Missachtung jeglicher menschlicher Sitte von Sauberkeit, sein Atem erinnerte an einen Gifthauch. Ängstlich wich ich vor ihm zurück.
»Wo«, verlangte er zu wissen, »ist Vaelin Al Sorna?«
ERSTES KAPITEL
Reva
Möge der Weltvater, der in Seiner Liebe alles sieht und alles weiß, meine Klinge lenken.
Sie beobachtete den hochgewachsenen Mann, der den Landungssteg herunterschritt und den Kai betrat. Gekleidet war er in gewöhnliche Seemannstracht aus einfachem graubraunem Stoff, feste, wenn auch nicht mehr ganz neue Stiefel und einen abgetragenen Wollmantel, den er sich um die Schultern gelegt hatte. Zu ihrer Überraschung konnte sie an seinem Gürtel kein Schwert entdecken. Allerdings hielt er einen mit einem Strick zugeknoteten Segeltuchbeutel umklammert, der groß genug für ein Schwert war.
Der hochgewachsene Mann drehte sich um, denn vom Schiff hatte jemand nach ihm gerufen– ein stämmiger, schwarzhäutiger Mann mit einem roten Schal um den Hals, der ihn als Kapitän des Seglers auswies, auf dem der erlauchte Passagier in diese kleine Hafenstadt gereist war. Der hochgewachsene Mann schüttelte den Kopf, ein höfliches, wenngleich angespanntes Lächeln auf den Lippen, winkte freundlich, aber unmissverständlich zum Abschied und wandte dem Schiff den Rücken zu. Er zog sich die Kapuze seines Mantels über den Kopf und ging mit raschen Schritten davon.
Am Kai warteten zahlreiche fliegende Händler, Sänger und Huren, die dem hochgewachsenen Mann nur wenig Beachtung schenkten, obwohl er aufgrund seiner Größe einige Blicke auf sich zog. Eine Schar Huren unternahm einen halbherzigen Versuch, ihn anzulocken, denn sie hielten ihn für einen der vielen Matrosen, die hier ihre Münzen unter das Volk bringen wollten, doch er lachte nur unbeschwert und breitete die Arme aus, um ihnen zu bedeuten, dass bei ihm nichts zu holen war.
Törichte Schlampen, dachte sie und duckte sich in die feuchtkalte Gasse, die seit drei Tagen ihr Zuhause war. Fischhändler wohnten in den Häusern rechts und links, und sie hatte sich noch immer nicht an den Gestank gewöhnt. Ihn gelüstet es nach Blut, nicht nach nackter Haut.
Der hochgewachsene Mann bog um die Ecke– zweifellos war das Nordtor sein Ziel. Sie erhob sich und trat aus ihrem Versteck, um ihm zu folgen.
»Die nächste Zahlung ist fällig, Schätzchen.« Schon wieder der fette Junge. Er drangsalierte sie bereits, seit sie das erste Mal in der Gasse Zuflucht gesucht hatte, und forderte ihr eine Münze nach der anderen ab, stets mit der Drohung, sie an die Wachleute zu verraten, denn die Hafenbehörde duldete keine Vagabunden. Allerdings wusste sie, dass er es eigentlich nicht auf ihr Geld abgesehen hatte. Er mochte etwa sechzehn sein und damit zwei Jahre jünger als sie, aber er war auch eine Handbreit größer und deutlich stämmiger. Ihm war anzusehen, dass er einen Großteil seiner Einnahmen für Wein ausgegeben hatte. »Schluss mit den Spielchen«, sagte er. »Noch einen Tag, und dann bist du verschwunden, hast du gesagt. Und jetzt treibst du dich immer noch hier rum. Die nächste Zahlung ist fällig.«
»Bitte!« Sie wich vor ihm zurück, ihre Stimme hoch und ängstlich. Wäre er nüchtern gewesen, hätte er sich vielleicht gefragt, warum sie sich in die finstere Gasse flüchtete, wo sie endgültig in der Falle saß. »Schau doch, ich hab noch mehr!« Sie streckte eine Hand aus, und die Kupfermünze funkelte im Halbdunkel.
»Kupfer!« Wie sie erwartet hatte, schlug er ihre Hand beiseite. »Cumbraelische Schlampe. Ich werde mir dein Kupfer nehmen und noch viel…«
Ihre Faust traf ihn, die Knöchel vorgestreckt, direkt unter der Nase, ein präziser Schlag, um den größtmöglichen Schmerz zu verursachen und die größtmögliche Verwirrung zu stiften. Sein Kopf flog nach hinten, und aus seiner Nase schoss ein Schwall Blut. Während er zurücktaumelte, zuckte ihr Messer aus der versteckten Scheide hinter ihrem Rücken hervor, aber es war nicht nötig, den tödlichen Streich zu führen. Dem fetten Jungen stand die Verständnislosigkeit ins Gesicht geschrieben. Er leckte sich über die aufgeplatzten Lippen und sackte dann langsam in sich zusammen. Sie packte ihn an den Fußknöcheln und zerrte ihn in eine dunkle Ecke. In seinen Taschen entdeckte sie ein paar Kupfermünzen, ein Fläschchen mit Rotblüte und einen angebissenen Apfel. Sie nahm die Münzen und den Apfel, ließ das Fläschchen stecken und ging geräuschvoll kauend davon. Wahrscheinlich würde es Stunden dauern, bis jemand den fetten Jungen fand, und selbst dann würden die Wachleute davon ausgehen, dass da zwei Betrunkene in eine Prügelei geraten waren. Wenig später hatte sie den hochgewachsenen Mann wieder entdeckt. Er schritt gerade durch das Tor, wobei er den Wachmännern freundlich zulächelte, allerdings ohne die Kapuze herunterzunehmen. Sie blieb zurück und aß ihren Apfel auf, während er die Straße nach Norden nahm. Erst als er eine halbe Meile Vorsprung hatte, heftete sie sich an seine Fersen.
Möge der Weltvater, der in Seiner Liebe alles sieht und alles weiß, meine Klinge lenken.
♦ ♦ ♦
Der hochgewachsene Mann hielt sich den ganzen Tag über auf der Straße nach Norden und blieb nur hin und wieder stehen, um den Blick über den Waldrand und den Horizont schweifen zu lassen– ganz offensichtlich war er ein vorsichtiger und erfahrener Krieger. Sie dagegen mied die Straße und versteckte sich stattdessen zwischen den Bäumen, die das Land nördlich von Warnsheim beherrschten, achtete aber darauf, ihn nicht aus dem Blick zu verlieren. Er marschierte in gleichmäßigem Tempo, wobei er schneller vorankam, als man eigentlich hätte meinen sollen. Auf der Straße waren nur wenige andere Reisende unterwegs, größtenteils Fuhrwerke, die Waren zum oder vom Hafen weg transportierten, und ein paar einsame Reiter, von denen keiner anhielt, um mit dem hochgewachsenen Mann zu sprechen. In den Wäldern lauerten allenthalben Banditen, und so war es äußerst unklug, mit einem Fremden zu reden. Ihm selbst schien das argwöhnische Desinteresse der Leute jedoch nichts auszumachen.
Während sich allmählich die Nacht über die Straße legte, bog er abund suchte sich im Wald eine Lagerstätte. Sie folgte ihm bis zu einer kleinen Lichtung, die sich unter die Äste einer gewaltigen Eibe schmiegte, versteckte sich in einem flachen Graben hinter einem Ginstergestrüpp und beobachtete zwischen einigen Farnwedeln hindurch, wie er sein Lager aufschlug. Sie war von seinen sparsamen Bewegungen beeindruckt, von dem fast unbewussten Tun eines Mannes, der sich in der Wildnis auskennt; er sammelte Holz, zündete ein Feuer an, räumte sich einen Liegeplatz frei und rollte seine Decke aus– und das alles in kürzester Zeit.
Der hochgewachsene Mann setzte sich, mit dem Rücken an die Eibe gelehnt, auf den Erdboden, aß sein Abendmahl, das aus getrocknetem Rindfleisch bestand, und spülte es mit einem Schluck aus seiner Feldflasche hinunter. Dann schaute er zu, wie das Feuer herunterbrannte, seine Gesichtszüge merkwürdig angespannt, fast als lausche er einer bedeutenden Unterhaltung. Nur für den Fall, dass er sie bemerkte, hatte sie das Messer bereits gezogen. Spürt er, dass er nicht allein ist?, fragte sie sich. Der Priester hatte sie gewarnt, dass er das Dunkle in sich trage– dass er wahrscheinlich der schrecklichste Gegner war, mit dem sie es je zu tun haben würde. Sie hatte gelacht und das Messer auf die Zielscheibe geworfen, die an der Wand der Scheune hing, in der der Priester sie so viele Jahre ausgebildet hatte. Das Messer war zitternd genau in der Mitte stecken geblieben, und die Zielscheibe war in zwei Teile zerbrochen und heruntergefallen. »Der Weltvater ist mit mir, habt Ihr das schon vergessen?«, hatte sie gesagt. Der Priester hatte sie ausgepeitscht, ihres Stolzes wegen und weil sie zu wissen behauptete, was der Weltvater dachte.
Sie beobachtete den hochgewachsenen Mann und seine merkwürdig angespannten Gesichtszüge noch eine weitere Stunde, bis er schließlich blinzelte, einen letzten Blick in die Umgebung warf und sich dann, in seinen Mantel eingewickelt, zum Schlafen niederlegte. Trotz ihrer Ungeduld zwang sie sich, noch eine Stunde zu warten, bis der Himmel völlig finster geworden und der Wald pechschwarz war. Nur die Rauchfahne, die von dem erloschenen Feuer aufstieg, verbreitete noch die Andeutung eines Lichtscheins.
Sie kroch aus dem Graben, ging in die Hocke und hielt das Messer umgedreht, sodass es mit der Klinge flach an ihrem Unterarm lag und sich nicht durch ein Funkeln verriet. Mit der ganzen Verstohlenheit, die der Priester in sie hineingeprügelt hatte, seit sie sechs Jahre alt gewesen war, näherte sie sich der schlafenden Gestalt, so lautlos wie nur irgendeines der Raubtiere, die in diesem Wald heimisch waren. Der hochgewachsene Mann lag auf dem Rücken, den Kopf zur Seite geneigt, den Hals entblößt. Es wäre so einfach gewesen, ihn jetzt zu töten, aber ihre Aufgabe war eindeutig. Das Schwert, hatte der Priester ihr erklärt, immer und immer wieder. Allein das Schwert ist von Bedeutung, alles andere ist zweitrangig.
Sie drehte das Messer herum, sodass sie es nun stoßbereit in der Hand hielt. Die meisten Menschen reden freimütig, wenn sie eine Klinge an der Kehle spüren, hatte der Priester gesagt. Möge der Weltvater, der in Seiner Liebe alles sieht und alles weiß, deine Klinge lenken.
Sie warf sich auf den hochgewachsenen Mann, und das Messer schnellte auf seine entblößte Kehle zu…
Die Luft wich ihr schmerzhaft aus der Lunge, als ihre Brust mit etwas Massivem zusammenprallte. Seine Stiefel, dachte sie fassungslos. Dann segelte sie drei Meter weit durch die Luft und landete auf dem Rücken. Sofort rappelte sie sich auf und stieß mit dem Messer dorthin, von wo sie den Angriff erwartete… und wäre fast vornübergefallen. Der hochgewachsene Mann stand neben der Eibe und betrachtete sie mit einer Miene, die den Zorn in ihrer Brust anschwellen ließ: Er schien belustigt zu sein.
Sie stieß ein Knurren aus und stürzte los, wobei sie jegliche Vorsicht fahren ließ, welche die Rute des Priesters ihr eingebleut hatte. Sie täuschte nach links und setzte dann zum Sprung an. Ihr Messer fuhr herab, um sich in die Schulter des hochgewachsenen Mannes zu bohren… und wieder verfehlte sie ihn. Dabei geriet sie ins Stolpern und hätte, von ihrem eigenen Schwung mitgerissen, fast das Gleichgewicht verloren. Kaum hatte sie sich gefangen, wirbelte sie herum und sah ihn nicht weit entfernt stehen, noch immer sichtlich belustigt.
Sie stürzte sich auf ihn, und ihr Messer vollführte eine komplizierte Abfolge von Stichen und Stößen, begleitet von einer schwindelerregend schnellen Salve von Tritten und Faustschlägen… und wieder ging alles ins Leere.
Sie zwang sich stillzustehen, schnappte verzweifelt nach Luft und rang den Hass nieder, der sie zu überwältigen drohte. Wenn ein Angriff scheitert, so ziehe dich zurück. Die Worte des Priesters hallten laut in ihrem Kopf nach. Harre im Schatten aus, bis sich eine weitere Gelegenheit bietet. Der Weltvater weiß Geduld stets zu belohnen.
Sie knurrte den hochgewachsenen Mann ein letztes Mal an und wandte sich ab, um in der Finsternis zu verschwinden…
»Du hast die Augen deines Vaters.«
LAUF!, schrie die Stimme des Priesters in ihren Gedanken. Doch sie blieb stehen und drehte sich langsam wieder um. Der Gesichtsausdruck des hochgewachsenen Mannes hatte sich verändert, und an die Stelle der Belustigung war so etwas wie Trauer getreten.
»Wo ist es?«, verlangte sie zu wissen. »Dunkelklinge, wo ist das Schwert meines Vaters?«
Er runzelte die Stirn. »Dunkelklinge. Diesen Namen habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört.« Er ging zum Lager zurück, warf frische Zweige auf das Feuer und schlug einen Zündstein an.
Ihr Blick glitt zwischen Wald und Lager hin und her. Scham und Enttäuschung rangen in ihr um die Oberhand. Memme, Feigling.
»Bleib, wenn du bleiben möchtest«, sagte die Dunkelklinge. »Oder lauf, wenn du laufen willst.«
Sie atmete tief durch, schob ihr Messer in die Scheide und setzte sich auf die andere Seite des Feuers. »Eure unheilige Magie ist eine Beleidigung für die Liebe des Weltvaters.«
Er stieß ein belustigtes Brummen aus und warf weiter Zweige ins Feuer. »An deinen Schuhen klebt Kot aus Warnsheim. Stadtkot hat einen ganz bestimmten Geruch. Du hättest dich windabwärts verstecken sollen.«
Sie betrachtete ihre Schuhe und fluchte innerlich, widerstand jedoch der Versuchung, den Kot abzukratzen. »Ich weiß, dass Ihr dank der dunklen Gabe über geheimes Wissen verfügt. Woher wüsstet Ihr sonst, wer mein Vater ist?«
»Wie ich gesagt habe, du hast seine Augen.« Die Dunkelklinge ließ sich auf der Erde nieder, griff nach einem Lederbeutel und warf ihn ihrüber das Feuer hinweg zu. »Hier– du siehst aus, als hättest du Hunger.«
Der Beutel enthielt getrocknetes Rindfleisch und einige Haferplätzchen. Sie ignorierte das Essen ebenso wie das lautstarke Knurren ihres Magens, der mit dieser Entscheidung offenbar überhaupt nicht einverstanden war. »Kein Wunder, dass Ihr das wisst«, sagte sie. »Schließlich habt Ihr ihn getötet.«
»Nein, das habe ich nicht. Und der Mann, der ihn auf dem Gewissen hat…« Er verstummte, und seine Miene verdüsterte sich. »Nun, auch er ist tot.«
»Es geschah auf Euren Befehl hin– Ihr habt ihn angegriffen, während er sich auf seiner heiligen Mission befand…«
»Hentes Mustor war ein wahnsinniger Fanatiker, der seinen eigenen Vater ermordet und sein Reich in einen sinnlosen Krieg gestürzt hat.«
»Die Wahrklinge hat einen Verräter der Gerechtigkeit des Weltvaters zugeführt und strebte danach, uns von Eurer ketzerischen Herrschaft zu befreien. Alles, was er vollbracht hat, geschah im Dienste des Weltvaters…«
»Wirklich? Hat er dir das erzählt?«
Sie verstummte, den Kopf gesenkt, um ihren Zorn zu verbergen. Ihr Vater hatte ihr rein gar nichts erzählt, denn sie hatte ihn nie kennengelernt, was dieser vom Dunklen heimgesuchte Ketzer offensichtlich wusste. »Sagt mir, wo es ist«, krächzte sie. »Das Schwert meines Vaters. Von Rechts wegen gehört es mir.«
»Das ist deine Mission? Eine heilige Queste, nur um eine Elle geschärften Stahls zu finden?« Er griff nach einem in Leinwand eingeschlagenen Bündel, das an der Eibe lehnte, und reichte es ihr. »Nimm das hier, wenn du möchtest. Wahrscheinlich ist es mit größerer Kunstfertigkeit geschmiedet worden als das deines Vaters.«
»Das Schwert der Wahrklinge ist eine heilige Reliquie, die als solche im Elften Buch beschrieben wird. Sie ist vom Weltvater gesegnet, um den Geliebten die Einheit zu bringen und der ketzerischen Herrschaft ein Ende zu bereiten.«
Das schien ihn noch mehr zu belustigen. »In Wahrheit war es eine schlichte Waffe renfaelischer Machart, eine Waffe, wie sie von Söldnern verwendet wird oder von einem Ritter, dem es an Mitteln mangelt. Auf dem Heft prangten weder Gold noch Edelsteine, die ihm einen Wert verliehen hätten.«
Trotz seines Spotts machten seine Worte sie neugierig. »Ihr wart dabei, als es nach dem Märtyrertod meines Vaters geraubt wurde. Sagt mir, wo es ist, oder ich schwöre beim Weltvater, Ihr werdet mich töten müssen, denn ich werde Euch Euer Leben lang verfolgen, Dunkelklinge.«
»Vaelin«, sagte er und legte das Schwert beiseite.
»Was?«
»So lautet mein Name. Wäre es dir möglich, ihn zu verwenden? Oder Lord Al Sorna, wenn dir an Förmlichkeit gelegen ist.«
»Ich dachte, man müsste Euch mit Bruder anreden.«
»Nicht mehr.«
Sie zuckte überrascht zurück. Er gehört nicht mehr dem Orden an? Das war absurd und gewiss ein Trick.
»Woher wusstest du, wo du meine Fährte aufnehmen kannst?«, fragte er.
»Das Schiff hat in Südturm angelegt, bevor es nach Warnsheim weitergesegelt ist. Unter den Geliebten spricht sich dergleichen schnell herum.«
»Also bist du nicht allein in deinem großen Unterfangen.«
Sie verbiss sich weitere von Zorn geschürte Worte. Warum verrätst du ihm nicht gleich alle deine Geheimnisse, du nutzlose Schlampe? Sie erhob sich und wandte ihm den Rücken zu. »Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen…«
»Ich weiß, wo du das Schwert finden kannst.«
Sie zögerte und blickte über die Schulter. Seine Miene war jetzt vollkommen ernst. »Dann sagt es mir.«
»Das werde ich, aber ich habe Bedingungen.«
Sie verschränkte die Arme, das Gesicht von Abscheu verzerrt. »Der große Vaelin Al Sorna feilscht also wie jeder andere Mann um nackte Haut.«
»Das nicht. Wie du gesagt hast– ich sollte mich nicht wundern, wenn ich erkannt werde. Ich benötige so etwas wie eine Tarnung.«
»Eine Tarnung?«
»Ja, und du wirst meine Tarnung sein. Wir werden gemeinsam reisen, und zwar als…« Er dachte einen Moment nach. »… als Bruder und Schwester.«
Gemeinsam reisen. Mit ihm. Allein die Vorstellung bereitete ihr Übelkeit. Aber das Schwert… Allein das Schwert ist von Bedeutung. Möge der Weltvater mir verzeihen. »Wie weit?«, fragte sie.
»Nach Varinsburg.«
»Das sind von hier aus drei Wochen.«
»Länger. Ich muss unterwegs eine Zwischenstation einlegen.«
»Und wenn wir Varinsburg erreichen, werdet Ihr mir sagen, wo ich das Schwert finden kann?«
»Mein Wort darauf.«
Sie setzte sich wieder, jedoch ohne ihn anzuschauen. Es war ihr zutiefst unangenehm, ihm so widerspruchslos zu folgen. »In Ordnung.«
»Dann solltest du möglichst etwas schlafen.« Er rückte ein Stück vom Feuer weg, wickelte sich in seinen Mantel und legte sich hin. »Ach«, sagte er. »Wie soll ich dich nennen?«
Wie soll ich dich nennen? Nicht etwa: Wie heißt du? Offenbar ging er davon aus, dass sie ihn anlügen würde. Sie beschloss, ihn zu enttäuschen. Wenn er starb, wollte sie, dass er den Namen der Frau kannte, die ihn getötet hatte. »Reva«, sagte sie. Nach meiner Mutter.
♦ ♦ ♦
Sie schreckte aus dem Schlaf, geweckt von den Geräuschen, als er die Überreste des Feuers auseinandertrat. »Du solltest, glaube ich, etwas essen.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf den Lederbeutel. »Wir haben heute noch ein ziemliches Stück Weges vor uns.«
Sie aß zwei Haferplätzchen und trank etwas Wasser aus der Feldflasche. Der Hunger war ein alter Freund, und sie konnte sich keines Tages entsinnen, an dem er ihrem Leben ferngeblieben wäre. Die wahrhaft Geliebten, hatte der Priester gesagt, als er sie das erste Mal die ganze Nacht draußen in der Kälte hatte ausharren lassen, bedürfen lediglich der Liebe des Weltvaters als Nahrung.
Sie befanden sich auf der Straße, noch bevor sich die Sonne über dieBäume erhoben hatte. Al Sorna schritt weit und gleichmäßig aus, und ihr fiel es nicht leicht, mit ihm mitzuhalten. »Warum habt Ihr in Warnsheim kein Pferd gekauft?«, fragte sie. »Reiten Adlige nicht überallhin?«
»Mein Geld reicht kaum für Essen, geschweige denn für ein Pferd«, erwiderte er. »Außerdem erregt ein Mann zu Fuß weniger Aufmerksamkeit.«
Warum ist er so darauf bedacht, sich vor seinen eigenen Landsleuten zu verstecken?, fragte sie sich. Er hätte in Warnsheim nur seinen Namen erwähnen müssen, und sie hätten ihn mit Gold überhäuft und ihm jedes Pferd überlassen, das er sich nur wünschen kann.
Doch jedes Mal, wenn ein Karren vorbeiklapperte, wandte er den Blick ab und zog sich die Kapuze tiefer ins Gesicht. Warum auch immer er zurückgekehrt ist, sinnierte sie, um des Ruhmes willen hat er es nicht getan.
»Du kannst recht gut mit deinem Messer umgehen«, bemerkte er, als sie neben einem Meilenstein eine Pause einlegten.
»Nicht gut genug«, murmelte sie.
»Solche Fertigkeiten bedürfen der Übung.«
Sie aß ein Haferplätzchen und schwieg.
»Als ich in deinem Alter war, hätte ich nicht versagt.« Er meinte es nicht spöttisch, sondern äußerte lediglich eine Tatsache.
»Weil Euer unheiliger Orden Euch von klein auf wie Hunde mit der Peitsche antreibt und Euch lehrt zu töten.«
Zu ihrer Überraschung lachte er. »Wohl wahr. Mit was für Waffen kannst du sonst noch umgehen?«
Sie schüttelte missmutig den Kopf, nicht länger willens, ihm mehr zu verraten als nötig.
»Mit dem Bogen bist du doch bestimmt vertraut«, beharrte er. »Alle Cumbraeler sind das.«
»Ich aber nicht!«, fauchte sie. Was nur ehrlich war. Der Priester hatte ihr erklärt, das Messer sei alles, was sie brauche, ein Bogen sei nichts für Frauen. Er selbst hatte natürlich einen Bogen– alle cumbraelischen Männer hatten einen, Priester oder nicht. Die Schmerzen während der Prügel, die er ihr verabreicht hatte, als sie versuchte, sich den Umgang mit dem Bogen heimlich selbst beizubringen, wurden nur von der Demütigung übertroffen, die sie empfand, als sie feststellte, dass es ihre Kraft überstieg, einen Langbogen zu spannen. Bis heute hatte sie das nicht überwunden.
Er ließ die Sache auf sich beruhen, und sie setzten ihren Weg fort, wobei sie vor Einbruch der Nacht weitere zwanzig Meilen zurücklegten. Er schlug das Lager ein wenig früher auf als am Abend zuvor, und nachdem er das Feuer angezündet und sie angewiesen hatte, es zu schüren, machte er Anstalten, im Wald zu verschwinden. »Wohin geht Ihr?«, fragte sie, weil sie argwöhnte, dass er einfach davonlaufen und sie zurücklassen würde.
»Ich möchte sehen, was für Geschenke der Wald für uns bereithält.«
Eine gute Stunde später, als es allmählich richtig finster wurde, kam er zurück, in der Hand einen langen Eschenast. Nach dem Essen setzte er sich ans Feuer, entfernte mit geübter Hand Zweige und Rinde, und begann mit einem kurzen Seemannsmesser daran herumzuschnitzen. Da er kein Wort der Erklärung äußerte, konnte sie schließlich dem Drang nicht widerstehen, ihn zu fragen. »Was macht Ihr da?«
»Einen Bogen.«
Sie stieß ein wütendes Knurren aus. »Ich werde von Euch keine Geschenke annehmen, Dunkelklinge.«
Er hob nicht einmal den Blick. »Der ist für mich. Über kurz oder lang werden wir jagen müssen.«
Während der nächsten beiden Abende arbeitete er an dem Bogen. Er spitzte die Enden an und schliff die Mitte rund, wobei sie auf einer Seite abgeflacht war. Als Bogensehne flenste er einen Schnürsenkel und band ihn an den Kerben fest, die er in die Enden geschnitzt hatte. »Ich war noch nie ein guter Bogenschütze«, sinnierte er und schlug die Sehne an, die daraufhin einen dunklen Ton von sich gab. »Mein Bruder Dentos dagegen– bei dem hatte man den Eindruck, er wäre mit einem Bogen in der Hand zur Welt gekommen.«
Sie kannte die Geschichte von Bruder Dentos, denn sie war ein fester Bestandteil seiner Legende. Der berühmte Bogenschütze aus dem Orden, der seine Mitbrüder gerettet hatte, indem er die alpiranischen Belagerungsmaschinen in Brand steckte, nur um am nächsten Tag in einen feigen Hinterhalt der Alpiraner zu geraten und zu sterben. Man erzählte sich, dass die Dunkelklinge so wütend gewesen war, dass er die Angreifer ausnahmslos niedergemetzelt hatte, obwohl sie um Gnade flehten. Reva hegte ernsthafte Zweifel an der Wahrheit dieser und all der anderen abstrusen Geschichten, die sich um das Leben vonVaelin Al Sorna rankten, aber die Leichtigkeit, mit der er an jenem ersten Abend ihren Angriff zurückgeschlagen hatte, gab ihr zu denken– vielleicht verbarg sich unter all dem doch ein Körnchen Wahrheit.
Aus einem weiteren Eschenast fertigte er Pfeile; allerdings musste er diese, da sie kein Metall für die Spitze zur Verfügung hatten, von Hand bearbeiten. »Für Vögel sollten sie genügen«, sagte er. »Ein Wildschwein kann man damit allerdings nicht erlegen, dafür braucht es Eisen.«
Er nahm den Bogen und verschwand im Wald. Sie wartete ganze zwei Minuten, stieß einen Fluch aus und folgte ihm. Schließlich entdeckte sie ihn, wie er hinter dem Stamm einer uralten Eiche kauerte, einen Pfeil schussbereit aufgelegt. Er wartete völlig regungslos, den Blick auf eine mit hohem Gras bewachsene Lichtung gerichtet. Reva trat vorsichtig an seine Seite, brachte es jedoch fertig, auf einen trockenen Zweig zu treten. Ein lautes Knacken hallte über die Lichtung. Drei Fasane erhoben sich mit rauschenden Flügeln aus dem Gras. Die Bogensehne sirrte, und ein Vogel taumelte auf die Wiese, wobei hinter ihm Federn aufstoben. Al Sorna warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, bevor er hinüberging, um seine Beute zu holen.
Von wegen kein guter Bogenschütze, dachte sie. Lügner.
♦ ♦ ♦
Als sie am nächsten Morgen erwachte, war sie allein. Die Dunkelklinge befand sich zweifellos wieder auf der Jagd; allerdings hatte er den Bogen zurückgelassen– er lehnte an einem umgestürzten Baumstamm. Sie hatte ein komisches Gefühl in der Magengrube, eine seltsame Schwere, und ihr wurde bewusst, dass sie das erste Mal in ihrem Leben mit vollem Bauch aufgewacht war. Al Sorna hatte den Fasan aufgespießt, seine Haut mit Zitronenthymian eingerieben und ihn dann über dem Feuer gegart. Das Fett war ihr übers Kinn gelaufen, während sie ihren Anteil hinuntergeschlungen hatte. Er hatte ihr mit einem Lächeln dabei zugeschaut, und sie hatte sich wütend abgewandt, aber aufgehört zu essen hatte sie nicht.
Ihr Blick ruhte einen Moment auf dem Bogen. Er war kürzer als der Langbogen, mit dem sie sich jahrelang abgemüht hatte, und sehr wahrscheinlich einfacher zu spannen. Sie sah sich um, hob ihn hoch und legte einen Pfeil aus dem behelfsmäßigen Köcher auf, den Al Sorna aus langen Grashalmen geflochten hatte. Der Bogen fühlte sich leicht an, wie für sie geschaffen. Sie visierte den schmalen Stamm einer Weißbirke an, der etwa zehn Meter entfernt war, das leichteste Ziel, das sie entdecken konnte. Der Bogen war schwerer zu spannen, als sie erwartet hatte, und sie musste daran denken, wie sie sich mit dem Langbogen abgeplagt hatte, aber schließlich gelang es ihr doch, die Sehne bis an ihre Lippen zurückzuziehen, bevor sie losließ. Der Pfeil streifte die Birke und verschwand in einem Farngesträuch.
»Nicht übel.« Al Sorna kam durch das Unterholz geschritten; in seinem Mantel trug er einen ganzen Haufen frisch gesammelter Pilze.
Reva warf ihm den Bogen zu, ging in die Hocke und zog ihr Messer. »Er ist nicht ganz gerade«, murmelte sie. »Sonst hätte ich getroffen.« Sie packte ihr Haar im Nacken und begann, wie jede Woche, es rituell abzuschneiden.
»Lass das bitte«, sagte Al Sorna. »Du sollst als meine Schwester gelten. Asraelische Frauen tragen ihr Haar lang.«
»Asraelische Frauen sind eitle Schlampen.« Demonstrativ sägte sie ein Haarbüschel ab und ließ es fallen.
Al Sorna seufzte. »Dann werden wir wohl erzählen müssen, dass du ein bisschen einfältig bist. Das Kind hat sich schon in jungen Jahren angewöhnt, sich die Haare abzuschneiden. Meine arme alte Mama konnte es ihm einfach nicht abgewöhnen.«
»Das wagt Ihr nicht!« Sie starrte ihn wütend an. Er schenkte ihr ein breites Lächeln. Sie biss die Zähne zusammen und schob das Messer in die Scheide zurück.
Er legte Bogen und Köcher neben sie auf die Erde. »Behalte ihn. Ich werde mir einen neuen machen.«
♦ ♦ ♦
Am nächsten Tag marschierten sie wieder die Straße entlang. Al Sorna ließ in seinem Tempo nicht nach, aber ihr fiel es immer leichter, mit ihm mitzuhalten, was zweifellos auch daran lag, dass sie endlich einmal genug zu essen bekam. Nach etwa einer Stunde blieb Al Sorna stehen, hob den Kopf und sog die Luft durch die Nase ein. Es dauerte einen Moment, bevor Reva den Geruch, der von dem leichten Westwind herbeigetragen wurde, ebenfalls bemerkte– ein beißender Gestank, der ihr durchaus vertraut war, und Al Sorna erging es offenbar ähnlich.
Er sagte nichts, sondern verließ die Straße und schritt zum Wald hinüber. Je weiter sie nach Norden kamen, desto mehr lichtete er sich, aber sie waren doch immer wieder auf dichte Waldungen gestoßen, in denen sie ihr Lager aufschlagen und jagen konnten. Sie bemerkte, dass er sich jetzt irgendwie anders bewegte; er hatte die Schultern ein wenig gebeugt, seine Arme hingen locker herab, und er spreizte die Finger, als wollte er nach etwas greifen. Der Priester hatte sich manchmal auf dieselbe Art und Weise bewegt, allerdings nicht mit einer solch beiläufigen Anmut. Ihr wurde urplötzlich bewusst, dass die Dunkelklinge dem Priester weit überlegen war, etwas, das sie für unmöglich gehalten hatte. Niemand konnte den Priester besiegen, schließlich verdankte er seine Fähigkeiten dem Segen des Weltvaters. Aber dieser Ketzer, dieser Feind der Geliebten, bewegte sich mit solch raubtierhafter Anmut, dass sie wusste: Jeder Kampf zwischen den beiden hätte nur einen Ausgang. Ich war eine Närrin, dachte sie. Ihn so überwältigen zu wollen. Das nächste Mal muss ich mich einer List bedienen… oder besser ausgebildet sein.
Sie folgte ihm in kurzem Abstand. In der Hand hielt sie noch immer den Bogen, und sie fragte sich, ob sie einen Pfeil auflegen sollte, entschied sich jedoch dagegen. Sie war einfach nicht gut genug, um eine Bedrohung für das darzustellen, was unter den Bäumen auf sie wartete. Stattdessen zog sie das Messer und suchte den Waldsaum ab, konnte außer Ästen, die sich im Wind wiegten, aber nichts entdecken.
Etwa zwanzig Meter tief im Wald stießen sie auf die Leichen, drei Leichen: ein Mann, eine Frau und ein Kind. Der Mann war an einen Baum gefesselt und mit einem Hanfseil geknebelt worden, und vom Hals bis zur Taille starrte seine Haut vor getrocknetem Blut. Die Frau war nackt, und ihr war anzusehen, dass sie lange Marter erduldet hatte– ihre Haut war von Striemen und Schnitten bedeckt. Einer ihrer Finger war abgehackt worden, und zwar während sie noch am Leben gewesen war, so viel Blut war geflossen. Der Junge mochte nicht älter als zehn gewesen sein, und auch er war misshandelt worden.
»Banditen«, sagte Reva. Sie musterte den Mann, der an den Baum gefesselt war, eingehender. Der Hanfknebel hatte sich tief in seine Wangen gegraben. »Sieht so aus, als hätten sie ihn gezwungen, alles mitanzuschauen.«
Al Sorna betrachtete den Schauplatz des Verbrechens mit einer Intensität, die sie bisher noch nicht an ihm bemerkt hatte. Er suchte den Boden ab, als würde er eine Spur verfolgen.
»Das alles ist vor mindestens anderthalb Tagen geschehen«, fuhr Reva fort. »Ihre Fährte hat sich wahrscheinlich längst verloren. Bestimmt haben sie die nächstgelegene Ortschaft aufgesucht und versaufen und verhuren das, was sie hier erbeutet haben.«
Er wandte sich um und betrachtete sie mit loderndem Blick. »Die Liebe deines Weltvaters scheint dir jegliches Mitgefühl geraubt zu haben.«
Angesichts seines Zorns packte sie ihr Messer fester. »In diesem Land wimmelt es nur so von Dieben und Mördern, Dunkelklinge. Dies ist nicht meine erste Begegnung mit dem Tod. Wir haben Glück gehabt, dass uns bisher keine Banditen aufgelauert haben.«
Die Flammen in seinen Augen erloschen, und er richtete sich auf. Plötzlich wirkte er nicht mehr wie ein sprungbereites Raubtier. »Bis nach Rhansmühle ist es nicht weit.«
»Das liegt aber nicht auf unserem Weg.«
»Ich weiß.« Er trat zu der Leiche des Mannes und durchschnitt mit seinem Seemannsmesser die Fesseln, mit denen er an dem Baum festgebunden war. »Sammle Holz«, sagte er. »Viel Holz.«
♦ ♦ ♦
Sie brauchten einen ganzen Tag, um nach Rhansmühle zu gelangen, eine wenig beeindruckende Ansammlung von Häusern, die sich am Ufer des Flusses Avern um eine Wassermühle scharten. Als sie am späten Abend eintrafen, wurde in dem Dorf lautstark gefeiert. Zahlreiche Fackeln waren entzündet worden, und die Menschen drängten sich um einen Halbkreis aus grellbunt bemalten Wagen.
»Schauspieler«, sagte Reva voller Abscheu, kaum dass sie die frivolen und mitunter lüsternen Darstellungen auf den Wagen sah. Langsam schoben sie sich durch die Menge, wobei sich Al Sorna die Kapuze tief ins Gesicht zog. Der Blick des Publikums war auf die hölzerne Bühne in der Mitte des Halbkreises gerichtet. Der Mann auf der Bühne hatte ein schmales Gesicht und trug ein hellrotes Seidenhemd und eng anliegende gelb-schwarze Hosen. Er sang und spielte auf einer Mandoline, während eine Frau in einem Chiffonkleid dazu tanzte. Das Spiel des Mannes war hinreißend, seine Stimme melodiös und klar, aber es war die tanzende Frau, die Revas Aufmerksamkeit erregte– die Anmut und Präzision ihrer Bewegungen schlugen sie in ihren Bann. Ihre bloßen Arme schienen im Fackelschein zu glänzen, und hinter dem Chiffonschleier leuchteten ihre Augen hell und blau…
Reva wandte den Blick ab, schloss die Augen und spürte, wie sich ihre Fingernägel in ihre Handballen gruben. Weltvater, wieder muss ich dich um Vergebung anflehen…
»Die Hand meiner Geliebten ist ach so weich«, sang der Mann in dem roten Hemd, die letzte Strophe von Jenseits des Tals. »Eine Träne glitzert auf ihrer Wange bleich, im Jenseits blüht ein grüner Garten, wo ich werd auf meine Geliebte…« Er hielt inne, die Augen weit aufgerissen, und starrte eine Gestalt in der Menge an. Reva folgte seinem Blick und stellte fest, dass er direkt auf Al Sorna gerichtet war. »…warten«, schloss der Mann, als bereite ihm das letzte Wort große Schwierigkeiten. Das Publikum klatschte, trotz dieses Aussetzers, einmütig Beifall.
»Vielen Dank, meine Freunde!« Der Mandolinenspieler verbeugte sich tief und wies mit einer ausladenden Handbewegung auf die Tänzerin. »Die bezaubernde Ellora und ich danken Euch in aller Demut. Bitte zeigt uns Eure Wertschätzung auf die gewohnte Weise.« Er deutete auf den Kübel, der am vorderen Rand der Bühne stand. »Und jetzt, meine Freunde«– der Musiker senkte die Stimme, und seine Miene wurde ernst–, »und jetzt kommen wir zur letzten Aufführung des heutigen Abends. Eine Geschichte voller Abenteuer und Verrat, in der Blut vergossen und Schätze geraubt werden. Macht Euch bereit für… Die Rache des Piraten!« Er warf die Arme in die Luft, nahm dann die Hand der jungen Frau und eilte hinter die Kulissen, wobei er merklich hinkte.
Umgehend schritten zwei Männer auf die Bühne, beide in äußerst phantasievolle meldeneische Seemannstracht gekleidet.
»Dort drüben ist ein Schiff, Käpt’n!«, sagte der kleinere Mann, als der Applaus nachgelassen hatte, und hob ein hölzernes Fernglas ans Auge, wie um den Horizont abzusuchen. »Ein Segler aus den Königslanden, wenn ich mich nicht täusche. Bei den Göttern, da wartet reiche Beute auf uns.«
»Da habt Ihr wohl recht!«, pflichtete der größere Mann ihm bei. Ein falscher Bart aus loser Wolle bedeckte sein Kinn und ein rotes Tuch seinen Kopf. »Wir werden genug Blut vergießen, um sogar den Durst unserer Götter zu stillen.« Die beiden Schauspieler lachten finster.
Al Sorna berührte Reva behutsam am Arm. Er neigte den Kopf nach links, und sie folgte ihm, während er sich durch die Menge auf eine Lücke in dem Wagenhalbkreis zuschob. Sie war nicht weiter überrascht, den Mandolinenspieler dort anzutreffen, der mit leuchtenden Augen im Halbdunkel stand und Al Sorna begierig musterte, als dieser die Kapuze herunternahm.
»Feldwebel Norin«, sagte er.
»Euer Lordschaft«, hauchte der Mann. »Ich hatte gehört… es gab Gerüchte, aber…«
Al Sorna trat vor und umarmte den Mann herzlich. Reva entging nicht, wie überrascht der Musiker war. »Es freut mich sehr, dich zu sehen, Janril«, sagte Al Sorna. »Wirklich.«
♦ ♦ ♦
»Tausend Geschichten erzählen von Eurem Tod«, erklärte der Sänger Al Sorna während des Abendessens. Er hatte sie in den Wagen hereingebeten, den er gemeinsam mit Ellora bewohnte. Anstelle des Chiffongewands trug sie jetzt ein schlichtes graues Kleid. Nach kurzer Vorbereitung servierte sie ihnen einen Eintopf mit Knödeln. Reva vermied es geflissentlich, in ihre Richtung zu blicken, und konzentrierte sich auf ihr Essen. Al Sorna hatte sie als »Reva, meine vorgebliche Schwester für die nächsten Wochen« vorgestellt. Janril Norin nickte nur und hieß sie willkommen, wobei er jegliche Neugier, die er hinsichtlich ihrer Beziehung empfinden mochte, sorgfältig verbarg. Soldaten stellen ihren Befehlshabern keine Fragen, dachte sie im Stillen.
»Und eintausend mehr über Eure Flucht«, fuhr Norin fort. »Es heißt, Ihr hättet mit Unterstützung der Ahnen aus Euren Ketten einen Streitkolben gefertigt und alle erschlagen, die Euch daran hindern wollten, aus dem Kerker auszubrechen. Ich habe ein Lied darüber geschrieben, das bei den Leuten immer gut ankommt.«
»Tja, ich fürchte, du wirst ein neues schreiben müssen«, sagte Al Sorna, »und zwar darüber, wie sie mich einfach haben gehen lassen.«
»Ich dachte, Ihr wärt als Erstes auf den meldeneischen Inseln gelandet«, sagte Reva, die ihre Zweifel nicht für sich behalten konnte. »Dort sollt Ihr den stärksten Kämpen der Piraten getötet und eine Prinzessin errettet haben.«
Er zuckte nur mit den Achseln. »Auf den Inseln habe ich lediglich Theater gespielt. Allerdings bin ich kein besonders guter Schauspieler.«
»Wie dem auch sei«, sagte Norin. »Ihr wisst, dass Ihr bei dieser Truppe jederzeit willkommen seid. So lange, wie Ihr es wünscht.«
»Wir sind nach Varinsburg unterwegs. Wenn das auch euer Ziel ist, begleiten wir euch gerne.«
»Wir wollen nach Süden«, sagte Ellora. »Im Sommer ist der Jahrmarkt in Mealinsbucht für uns stets besonders einträglich.« Ihr Tonfall wirkte eher zurückhaltend, und sie schien sich in Anwesenheit der Dunkelklinge einigermaßen unwohl zu fühlen. Klug genug, um zu wissen, dass er, wohin er auch geht, den Tod bringt, mutmaßte Reva.
»Wir gehen nach Norden«, erklärte ihr Norin mit ausdrucksloser Stimme und schenkte Al Sorna dann ein Lächeln. »Der Jahrmarkt in Varinsburg ist für uns bestimmt genauso gewinnbringend.«
»Wir werden unseren Lebensunterhalt selbst bestreiten«, sagte Vaelin zu Ellora.
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, widersprach Norin. »Euer Schwert auf unserer Seite zu wissen, ist Entlohnung genug. Hier ist man nirgendwo vor Banditen sicher.«
»Da wir gerade davon reden– wir sind ein paar Meilen südlich auf ihrWerk gestoßen. Eine Familie, ausgeraubt und gemeuchelt. Genaugenommen sind wir sogar hierhergekommen, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Sind dir irgendwelche fragwürdigen Gestalten aufgefallen?«
Norin dachte einen Moment nach. »In der Bierschenke haben sich heute Nachmittag einige rauflustige Halunken herumgetrieben. Ihre Kleider waren schäbig, aber sie hatten Geld für Bier. Aufgefallen sind sie mir, weil einer von ihnen einen Goldring an einer Kette um den Hals hängen hatte. Und der war zu klein für einen Männerring, soweit ich das beurteilen kann. Sie haben für einigen Rabatz gesorgt, als der Brauer sich weigerte, ihnen eine seiner Töchter zu verkaufen. Die Wachleute haben ihnen gesagt, sie sollen sich benehmen oder sich vom Acker machen. Etwa eine Meile flussabwärts befindet sich ein Landstreicherlager. Sofern sie noch nicht in den Wald zurückgekehrt sind, finden wir sie wahrscheinlich dort.«
Als sie das Wort »wir« hörte, blitzten Elloras Augen wütend auf.
»Wenn sie betrunken waren, schlafen sie jetzt ihren Rausch aus«, sagte Al Sorna. »Morgen früh sind sie bestimmt immer noch da. Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, werden wir wohl die Wachleute hinzuziehen müssen, das wollte ich eigentlich vermeiden.«