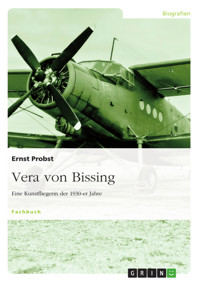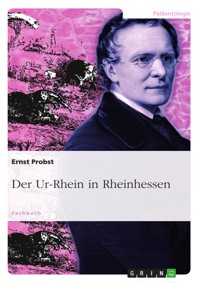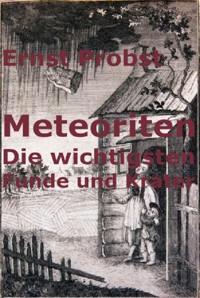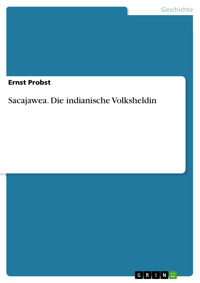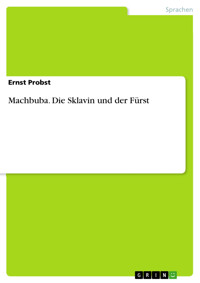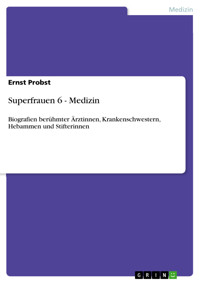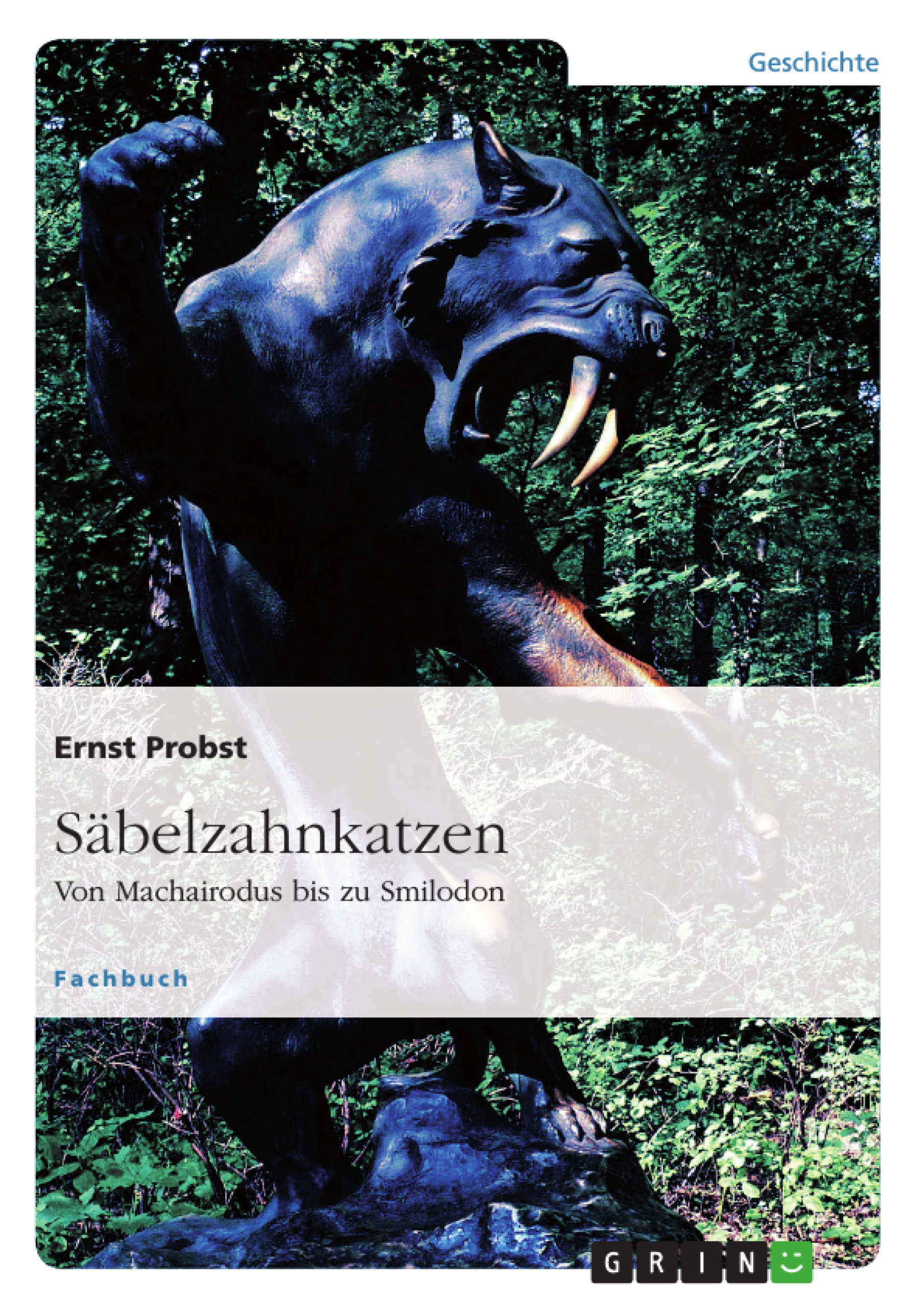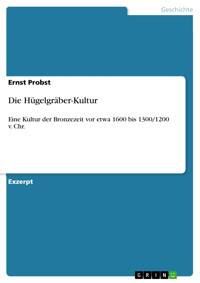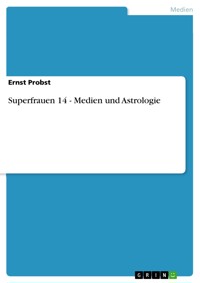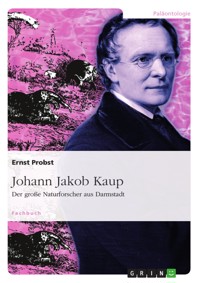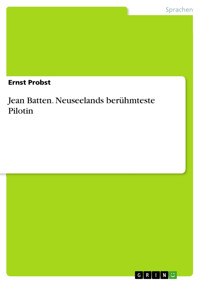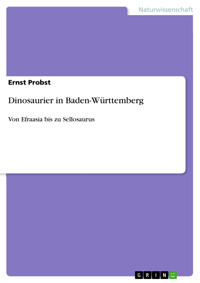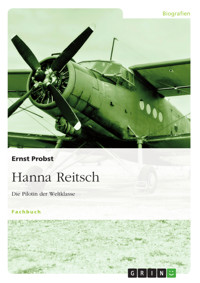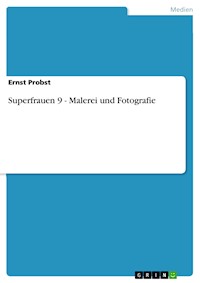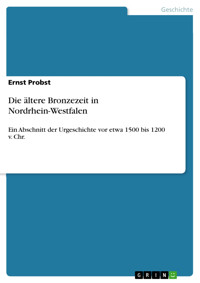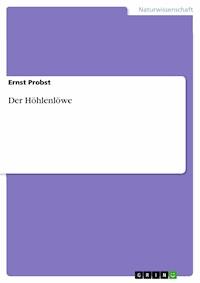
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Fachbuch aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Biologie - Zoologie, , Veranstaltung: -, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit Schwanz bis zu 3,20 Meter lang, maximal 1,50 Meter hoch und schätzungsweise mehr als 300 Kilogramm schwer war der Europäische Höhlenlöwe (Panthera leo spelaea). Dank dieser beeindruckenden Maße kann man diese Raubkatze aus dem Eiszeitalter vor etwa 300.000 bis 10.000 Jahren zweifellos als „König der Tiere“ bezeichnen.Der Europäische Höhlenlöwe gilt neben dem Mammut (Mammuthus primigenius) und dem Höhlenbär (Ursus spelaeus) als eines der bekanntesten Tiere des Eiszeitalters. Er steht im Mittelpunkt des 144-seitigen Taschenbuches „Der Höhlenlöwe“ des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Dabei handelt es sich um einen Auszug aus dem 332 Seiten umfassenden Werk „Höhlenlöwen“, in dem auch der Mosbacher Löwe (Panthera leo fossilis), aus dem der Europäische Höhlenlöwe hervorging, sowie der Amerikanische Höhlenlöwe (Panthera leo atrox) und der Ostsibirische Höhlenlöwe (Panthera leo vereshchagini) vorgestellt werden. Aus der Feder von Ernst Probst stammen unter anderem die Taschenbücher „Deutschland im Eiszeitalter“, „Der Mosbacher Löwe. Die riesige Raubkatze aus Wiesbaden“, „Der Höhlenbär“, „Säbelzahnkatzen. Von Machairodus bis zu Smilodon“ und „Säbelzahntiger am Ur-Rhein. Machairodus und Paramachairodus“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Dank
VORWORT
Der Europäische Höhlenlöwe Panthera leo spelaea
Höhlenlöwen in der Kunst der Eiszeit
Löwenfunde in Deutschland
Löwenfunde in Österreich
Löwenfunde in der Schweiz
Der Autor
Literatur
Bildquellen
Bücher von Ernst Probst
Dank
Für Auskünfte, kritische Durchsicht von Texten (Anmerkung: etwaige Fehler gehen zu Lasten des Verfassers), mancherlei Anregung, Diskussion und andere Arten der Hilfe danke ich:
Petra Berns, Bad Honnef
Michel Blant,
Institut suisse de speleologie et de karstologie (ISSKA), La Chaux-de-Fonds
Dr. Robert Darga,
Naturkunde- und Mammut-Museum Siegsdorf
Dr. Cajus G. Diedrich,
Paläontologe, PalaeoLogic, Halle/Westfalen
Thomas Engel,
geologischer Präparator, Naturhistorisches Museum Mainz / Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz
Fritz Geller-Grimm, Kurator, Museum Wiesbaden
Ulrich H. J. Heidtke, Niederkirchen (Pfalz)
Dr. Brigitte Hilpert,
Geozentrum Nordbayern, Fachgruppe PaläoUmwelt, Erlangen
Markus Höneisen,
Kanton Schaffhausen, Kantonsarchäologie
Professor Dr. Ralf-Dietrich Kahlke,
Leiter der Forschungsstation für Quartärpaläontologie der
Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Weimar
Dr. Thomas Keller,
Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische und Paläontologische Denkmalpflege, Wiesbaden
Dr. Peter Lanser, LWL-Museum für Naturkunde, Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium, Münster
Dick Mol, Mammut-Experte, Hoofddorp bei Amsterdam, Niederlande
o. Univ.Prof. Mag. Dr. Gernot Rabeder, Institut für Paläontologie,Universität Wien
Thomas Rathgeber,
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
Klaus Reis, Deidesheim
Dr. Wilfried Rosendahl, Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
Dr. Oliver Sandrock, Paläontologe Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Dr. Ulrich Schmölcke, Zoologisches Institut Haustierkunde, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Shuhei Tamura, Kanagawa, Japan
Silvan Thüring, Naturmuseum Solothurn
Martin Walders,
Museum für Ur- und Ortsgeschichte (Quadrat Bottrop)
Kurt Wehrberger, stellvertretender Direktor,
VORWORT
Der „König der Tiere" im Eiszeitalter
Mit Schwanz bis zu 3,20 Meter lang, maximal 1,50 Meter hoch und schätzungsweise mehr als 300 Kilogramm schwer war der Europäische Höhlenlöwe(Panthera leo spelaea).Dank dieser beeindruckenden Maße kann man diese Raubkatze aus dem Eiszeitalter vor etwa 300.000 bis 10.000 Jahren zweifellos als „König der Tiere" bezeichnen.Der Europäische Höhlenlöwe gilt neben dem Mammut(Mammuthus primigenius)und dem Höhlenbär(Ursus spelaeus)als eines der bekanntesten Tiere des Eiszeitalters. Er steht im Mittelpunkt des 144-seitigen Taschenbuches „Der Höhlenlöwe" des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst. Dabei handelt es sich um einen Auszug aus dem 332 Seiten umfassenden Werk „Höhlenlöwen", in dem auch der Mosbacher Löwe(Panthera leo fossilis),aus dem der Europäische Höhlenlöwe hervorging, sowie der Amerikanische Höhlenlöwe(Panthera leo atrox)und der Ostsibirische Höhlenlöwe(Panthera leo vereshchagini)vorgestellt werden. Aus der Feder von Ernst Probst stammen unter anderem die Taschenbücher „Deutschland im Eiszeitalter", „Der Mosbacher Löwe. Die riesige Raubkatze aus Wiesbaden", „Der Höhlenbär", „Säbelzahnkatzen. Von Machairodus bis zu Smilodon" und „Säbelzahntiger am Ur-Rhein. Machairodus und Paramachairodus".
Der Arzt und Naturforscher Georg August Goldfuß (1782—1848) beschrieb 1810 den Höhlenlöwen (Panthera leo spelaea) anhand eines Schädelfundes aus der Zoolithenhöhle von Burg-gaillenreuth bei Muggendorf in der Fränkischen Schweiz.
Der Europäische Höhlenlöwe Panthera leo spelaea
Die Löwen aus dem Eiszeitalter vor etwa 300.000 Jahren bis zu dessen Ende vor etwa 10.700 Jahren werden in Europa als Höhlenlöwen(Panthera leo spelaea)bezeichnet. Sie sind aus den riesigen Mosbacher Löwen(Panthera leo fossilis)hervorgegangen,die nach etwa 600.000 Jahre alten Funden aus dem ehemaligen Dorf Mosbach bei Wiesbaden benannt sind. Diese Mosbacher Löwen gelten mit einer Gesamtlänge bis zu 3,60 Metern als die größten Löwen Europas.. Der Arzt und Naturforscher Georg August Goldfuß (1782-1848) hat 1810, als er noch in Erlangen arbeitete, den Höhlenlöwen anhand eines Schädelfundes aus der Zoolithenhöhle im Wiesenttal von Burggaillenreuth bei Muggendorf in der Fränkischen Schweiz erstmals wissenschaftlich beschrieben. Goldfuß war ein besonders tüchtiger Gelehrter: Ihm ist die Entdeckung von etwa 200 Fossilien aus verschiedenen Fundstellen und Zeitaltern geglückt, die er wissenschaftlich untersuchte und publizierte.
Noch heute ist der so genannte Holotyp, nach dem der Europäische Höhlenlöwe(Panthera leo spelaea)erstmals beschrieben worden ist, im Museum für Naturkunde Berlin der Humboldt-Universität vorhanden. Nach Erkenntnissen des Paläontologen Cajus G. Diedrich aus Halle/Westfalen handelt es sich dabei um den recht großen Schädel eines erwachsenen männlichen Höhlenlöwen. Der 40,2 Zentimeter lange Schädel stammt aus der Würm-Eiszeit (etwa 115.000 bis 11.700 Jahre). Der Holotyp des Höhlenlöwen aus der Zoolithenhöhle wurde aus Teilen von mindestens zwei Tieren zusammengesetzt, fand Diedrich heraus. So ist der linke Oberkieferast rund drei Zenti-
Erforscher von Höhlen in der Fränkischen Schweiz: Pfarrer Johann Friedrich Esper (1732—1781) aus Uttenreuth bei Erlangen (oben), Paläontologin Brigitte Hilpert vom Geozentrum Nordbayern, Fachgruppe PaläoUmwelt, in Erlangen (unten)
meter kürzer und auch, was seine Proportionen anbetrifft, merklich schlanker als der rechte. Offenbar stammt der rechte Oberkieferast mit einem großen Eckzahn von einem Männchen, der linke dagegen von einem Weibchen. Die Zoolithenhöhle wurde durch Unmengen fossiler Tierknochen berühmt. Dort fand man Reste von schätzungsweise etwa 800 Höhlenbären(Ursus spelaeus),aber auch zahlreichen Höhlenhyänen(Crocuta crocuta spelaea)und ungewöhnlich vielen Höhlenlöwen. Dieser Fundreichtum bewog den evangelischen Pfarrer Johann Friedrich Esper (1732-1781) aus Uttenreuth bei Erlangen, der 1771 seine erste Erkundungsreise in die geheimnisvolle Unterwelt unternommen hatte, die Höhle als „Kirchhof unter der Erde" zu bezeichnen. Zur Zeit von Pfarrer Esper wurden in der Zoolithenhöhle erstaunlich viele Reste von Höhlenlöwen geborgen. Nach Angaben der Paläontologin Brigitte Hilpert vom Geozentrum Nordbayern, Fachgruppe PaläoUmwelt, in Erlangen hat man dort Fossilien von rund 25 Höhlenlöwen gefunden. Bei Grabungen ab 1971 kamen noch einige Schädel-, Kiefer- und Skelettreste dazu. Nirgendwo in der Welt sind mehr Höhlenlöwen entdeckt worden als in der Zoolithenhöhle!
Während bei den Mosbacher Löwen nie bezweifelt wurde, dass es sich um Überreste von Löwen handelt, hielt man anfangs die Höhlenlöwen aus dem Oberpleistozän (etwa 127.000 bis 11.700 Jahre) oft für Tiger und nannte sie „Höhlentiger". Dies lag daran, dass die Höhlenlöwen in dem einen oder anderen Merkmal dem Erscheinungsbild von Tigern ähnelten. Noch immer befinden sich in vielen Museen der Welt fehlbestimmte fossile „Tiger". Inzwischen kennen aber erfahrene Zoologen am Schädelknochen unter anderem einige sogar mit den Fingern ertastbare Nervenlöcher und Muskelansätze, die optisch nicht so sehr ins Gewicht fallen, an denen sich aber Löwe und Tiger sicher unterscheiden lassen.
2004 gelang es einem deutschen Forscherteam um den Geoarchäologen Wilfried Rosendahl (Mannheim), den Biologen
Der Paläontologe Cajus G. Diedrich aus Halle/Westfalen hat in vielen deutschen Museen fossile Reste von Höhlenhyänen (Crocuta crocuta spelaea) und Höhlenlöwen (Panthera leo spelaea) aus dem Eiszeitalter wissenschaftlich untersucht und beschrieben. Weil die Höhlenlöwen nachweislich keine Höhlen als Lebens- oder Geburtsort nutzten, bezeichnet er sie als „eiszeitliche Löwen" oder „spätpleistozäne Steppenlöwen".