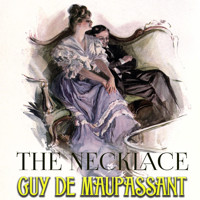1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Guy de Maupassants Der Horla und andere Erzählungen ist eine Sammlung von fesselnden und unheimlichen Kurzgeschichten, die den Leser mit einer düsteren Atmosphäre und psychologischen Abgründen fesseln. Maupassant, ein Meister des Realismus und des Naturalismus, präsentiert in diesem Buch Geschichten von übernatürlichen Phänomenen und dem Zerfall der menschlichen Psyche. Mit einem präzisen und detaillierten Schreibstil taucht der Autor tief in die menschlichen Abgründe ein und bietet dem Leser ein faszinierendes Panorama der dunklen Seiten der menschlichen Natur. Die Erzählungen sind zeitlos und zeigen Maupassants Talent, komplexe Charaktere und angespannte Situationen meisterhaft darzustellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Der Horla und andere Erzählungen
Books
Inhaltsverzeichnis
Fräulein Fifi
Pariser Abenteuer
Giebt es ein brennenderes Gefühl für eine Frau als die Neugier? Was gäbe sie darum, das, wovon sie geträumt, kennen zu lernen und zu erleben! Wenn die ungeduldige Neugierde einer Frau einmal geweckt ist, ist sie aller Dummheiten, jeder Verrücktheit fähig. Sie wird alles wagen, vor nichts mehr zurückschrecken. Ich rede von den Frauen, die wirklich Frau sind, von jenem dreifachen Geiste beseelt, der äußerlich kalt und vernünftig erscheint, in Wirklichkeit jedoch versteckt drei Eigenschaften birgt: den immer unstäten Weibessinn, List im Schäferkleide der Unschuld – jener spitzfindige gefährliche Kunstgriff der Scheinheiligen, – endlich reizende Gemeinheit, köstliche Niedertracht wundervolle Treulosigkeit, kurz alle jenen gottlosen Eigenschaften, die den einen Liebhaber, wenn er leichtgläubig und dumm ist, zum Selbstmord treiben, während sie den anderen bezaubern.
Die Frau, deren Geschichte ich erzählen will, war eine kleine, bis dahin in ihrer Naivetät anständige Provinzialin. Ihr Leben lief, äußerlich unbewegt in ihren vier Pfählen dahin, zwischen einem vielbeschäftigten Manne und zwei Kindern, die sie tadellos erzog. Aber ihr Herz bebte vor ungestillter, quälender Sehnsucht nach irgend etwas, das sie selbst nicht kannte. Immer dachte sie an Paris. Sie verschlang die Zeitungen und was darin stand von Festen, Toiletten, Vergnügungen, weckte in ihr stürmische Wünsche. Am wundersamsten erregten sie die kleinen Notizen voller Andeutungen, die geschickt halbverschleierten Sätze, die etwas ahnen ließen von sündhaft ausschweifenden Freuden.
Von weitem schien ihr Paris wie ein Traum von wunderbarer, verderbter Üppigkeit.
Und in den langen Nächten, wo ihr das regelmäßige Schnarchen ihres Gatten ein Wiegenlied sang, ihres Gatten, der mit der Schlafmütze auf dem Schädel an ihrer Seite auf dem Rücken lag, da dachte sie an jene berühmten Männer, deren Namen auf der ersten Seite der Zeitungen oft genannt wurden, gleich leuchtenden Sternen am dunklen Himmel. Sie stellte sich das geniale Leben dieser Leute vor, voller Schwelgereien, voll antiker Orgien von furchtbarer Sinnlichkeit, voll heimlicher Ausschweifungen der Sinne – nicht auszudenken.
Die Boulevards erschienen ihr wie der Abgrund menschlicher Leidenschaften, ihre Häuser bargen Rätsel seltsamer Liebe.
Sie aber fühlte, daß sie alt wurde, alt ohne anderes vom Leben gehabt zu haben als immer die langweilige gleichmäßige Tretmühle derselben häuslichen Pflichten, »Glück des Daheims« geheißen. Sie war noch hübsch – das stille Dasein hatte sie erhalten, wie eine Winterfrucht im verschlossenen Schranke – nur verzehrt war sie, zerquält, aus dem Gleichgewicht gebracht durch heimliche Wünsche. Und sie fragte sich, ob sie denn in die Grube fahren sollte, ohne diese verbotenen Früchte nur ein einziges Mal gekostet zu haben, ohne sich auch nur einmal in den Strudel der Lüste von Paris zu stürzen!
Da bereitete sie mit langer Ausdauer eine Reise nach Paris vor. Sie fand einen Vorwand, ließ sich durch Verwandte einladen und reiste, da sie ihr Mann nicht begleiten konnte, allein ab.
Als sie angekommen war, dachte sie sich einen Grund aus, gegebenen Falls zwei Tage, oder vielmehr zwei Nächte fortbleiben zu können: sie behauptete, Freunde wiedergetroffen zu haben, die draußen in einem der Vororte wohnten.
Dann ging sie auf Entdeckungen. Sie durchstreifte die Boulevards. Aber sie sah nichts als das gewerbsmäßige Laster der Straße. Sie beobachtete die großen Cafés, und studierte aufmerksam die »Kleine Korrespondenz« im Figaro, die ihr jeden Morgen wie ein lockendes Licht zur Liebe erschien.
Doch nichts brachte sie auf die Spur der wilden Feste von Künstler und Künstlerin, nichts verriet ihr den Tempel der Ausschweifungen, den sie verschlossen wähnte durch ein Zauberwort, wie in den Märchen von tausend und einer Nacht, wie die Katakomben Roms, wo der verfolgte Glaube heimlich seine Wunderfeiern hielt.
Durch ihre Verwandten – kleine Bürgersleute – konnte sie mit keiner jener Berühmtheiten bekannt werden, deren Namen in ihrem Kopfe schwirrten. Schon gab sie alle Hoffnung auf, als ihr der Zufall zu Hilfe kam.
Als sie eine Tages die rue de la Chaussée-d’Antin ging, blieb sie vor einem Laden stehen, wo jene japanischen, kleinen Sächelchen auslagen, die in ihrer Buntheit das Auge erfreuen. Während sie die spaßhaften, winzigen Elfenbeinarbeiten, die farbenleuchtend eingelegten Vasen, die seltsamen Bronzen betrachtete, hörte sie im Inneren des Ladens die Stimme des Besitzers. Er zeigte unter vielen Bücklingen einem kahlköpfigen, wohlgenährten, kleinen Herrn mit grauem Bart eine riesige, dickbäuchige Pagode. Es sei ein Unikum meinte er.
Und in jedem Satz posaunte er wie mit Trompetenstoß einmal den Namen des Kunstfreundes aus, einen berühmten Namen. Die übrigen Käufer, junge Frauen, elegante Herren, warfen verstohlen einen schnellen Blick ehrerbietiger Würdigung zu dem bekannten Schriftsteller, der seinerseits nur sehnsüchtig die Pagode beachtete. Sie gaben sich an Häßlichkeit nichts nach, wie Kinder eines Schoßes.
Der Kaufmann sagte:
– Herr Jean Varin, Ihnen würde ich das Ding für tausend Franken lassen. Das kostet es mich selbst: Von anderen verlange ich fünfzehnhundert Franken, aber mir liegt an der Kundschaft der Herren Künstler, darum mache ich ihnen Vorzugspreise. Sie beehren mich alle, Herr Jean Varin. Gestern noch kaufte Herr Busnach eine große, antike Schale. Neulich erst habe ich an Herrn Alexandre Dumas zwei solche Leuchter verkauft. Sie sind schön, was? Sehen Sie mal, wenn Herr Zola das Ding da sähe, das Sie in der Hand haben – wär’s schon weg, Herr Varin!
Der Schriftsteller schwankte unschlüssig. Der Gegenstand reizte ihn, doch er dachte an den Preis. Dabei kümmerte er sich so wenig um die neugierigen Blicke, als ob er in der Wüste allein gewesen wäre.
Sie war zitternd eingetreten, beinahe frech, das Auge auf ihn gerichtet. Nichts fragte sie darnach, ob er schön sei, elegant, jung. Es war ja Jean Varin in eigner Person! Jean Varin!
Nach langem Kampf und schmerzlichem Zögern stellte er die Figur auf den Tisch mit den Worten:
– Nein, das ist zu teuer!
Der Kaufmann verdoppelte seine Beredsamkeit:
– Aber Herr Jean Varin, zu teuer? Das ist seine zweitausend Franken unter Brüdern wert!
Der Schriftsteller gab traurig zurück, indem er die Pagode mit den Emailaugen betrachtete:
– Das glaube ich schon! Aber es ist mir zu teuer.
Da packte sie närrische Keckheit. Sie trat vor und sagte:
– Für wieviel geben Sie mir das Ding da?
Der Kaufmann entgegnete erstaunt.
– Fünfzehnhundert Franken, meine Dame.
– Ich nehme es.
Bis dahin hatte sie der Schriftsteller nicht einmal bemerkt. Nun drehte er sich hastig um und musterte sie beobachtend, blinzelnd von Kopf zu Fuß. Dann blickte er sie schärfer an mit Kenneraugen.
Sie sah reizend aus. Das Feuer, das bis dahin in ihr geschlummert, hatte sie heute belebt und lieh ihr seinen Glanz. Und dann konnte eine Frau, die für fünfzehnhundert Franken eine Nippessache kauft, nicht gerade die erste beste sein.
Da wandte Sie sich zu ihm in einer Regung reizenden Zartgefühles und sagte mit bebender Stimme:
– Entschuldigen Sie, ich bin wohl voreilig gewesen, vielleicht waren Sie noch nicht schlüssig?
Er verbeugte sich:
– Ich war schlüssig, gnädige Frau.
Ganz bewegt antwortete sie:
– Jedenfalls, wenn Sie Ihre Ansicht ändern … sollten, so werde ich Ihnen das Stück jederzeit überlassen. Ich habe es nur gekauft, weil es Ihnen gefiel.
Er lächelte, sichtlich geschmeichelt:
– Woher wissen Sie denn wer ich bin?
Da erzählte sie ihm von ihrer Bewunderung, sprach von seinen Werken und redete wie ein Wasserfall.
Bei der Unterhaltung hatte er sich auf ein Möbel gestützt und richtete auf sie seine durchdringenden Augen, im Bemühen sie zu erraten.
Ab und zu, wenn neue Käufer eingetreten waren, rief der Kaufmann, der glücklich war diese lebendige Reklame zu haben, vom anderen Ende des Ladens herüber:
– Bitte schön, Herr Jean Varin, sehen Sie mal das an; gefällt es Ihnen?
Dann wandten sich alle Köpfe herum, und es überlief sie kalt vor Wonne so im intimen Gespräch mit einem berühmten Manne gesehen zu werden.
Das machte sie förmlich trunken und sie wagte ein Äußerstes, wie ein Feldherr der den Sturm befiehlt:
– Herr Varin wollen Sie mir eine Freude machen, eine sehr große Freude. Erlauben Sie mir Ihnen diese Pagode als Andenken anzubieten an eine Frau die Sie leidenschaftlich bewundert, und die Sie nach diesen zehn Minuten nicht wiedersehen!
Er lehnte ab. Sie bestand darauf. Er widerstrebte höchlichst belustigt unter herzlichem Lachen.
Da sagte sie eigensinnig:
– Gut, dann bringe ich sie Ihnen sofort selbst! Wo wohnen Sie?
Er wollte seine Adresse nicht angeben, aber sie fragte den Händler darum, erfuhr sie, bezahlte ihren Kauf und lief zu einem Wagen. Der Schriftsteller hinterdrein, sie einzuholen, denn er wollte sich dem nicht aussetzen, ein Geschenk von jemandem zu erhalten, den er nicht kannte. Er erreichte sie, als sie gerade in den Wagen sprang, stürzte nach und fiel beim plötzlichen Anziehen des Pferdes beinahe auf sie drauf. Dann setzte er sich verdrießlich an ihre Seite.
Er hatte schön bitten, in sie dringen, sie blieb unbeugsam. Als sie an seine Thür kamen, stelle sie folgende Bedingungen:
– Ich erlasse es Ihnen, das da anzunehmen, wenn Sie versprechen, heute alles zu thun, was ich will.
Das schien ihm so komisch, daß er sich einverstanden erklärte. Nun fragte sie:
– Was machen Sie gewöhnlich um diese Zeit?
Er zögerte ein wenig, ehe er antwortete:
– Ich gehe spazieren!
Da befahl sie mit fester Stimme:
– Also in’s Bois de Boulogne!
Sie gingen.
Er mußte ihr alle bekannten Damen zeigen, vor allem die der Halbwelt, mit allen Einzelheiten über ihr Leben, ihre Gewohnheiten, ihr Haus, ihre Laster.
Es begann Abend zu werden.
– Was machen Sie sonst um diese Zeit? fragte sie. Er antwortete lachend:
– Ich trinke meinen Absinth.
Da entgegnete sie ernsthaft:
– Herr Varin, so trinken wir unseren Absinth.
Sie traten in ein großes Boulevardcafé, wo er Kollegen zu treffen pflegte. Er stellte ihr alle vor. Sie war verrückt vor Freude und immerfort summte ihr das Wort im Hirn: Endlich! Endlich!
Die Zeit verstrich. Sie fragte:
– Ist’s jetzt etwa Ihre gewohnte Essenszeit?
– Jawohl, gnädige Frau.
– Schön Herr Varin; dann wollen wir zu Tisch gehen!
Als sie das Café Bignon verließen meinte sie:
– Was machen Sie abends?
Er blickte sie starr an:
– Das kommt darauf an. Manchmal gehe ich ins Theater.
– Gut, Herr Varin, so gehen wir ins Theater.
Sie besuchten das Vaudeville, durch seine Vermittlung umsonst, und zu ihrem höchsten Stolze ward sie auf dem Balkonfauteuil vom ganzen Hause an seiner Seite gesehen.
Nach der Vorstellung küßte er ihr galant die Hand.
– Gnädige Frau, ich muß mich noch für diesen reizenden Tag bedanken ….
Sie unterbrach ihn:
– Was pflegen Sie sonst nachts um diese Zeit zu thun?
– Nun … nun … ich gehe nach Haus ….
Sie fing an zu lachen mit einem Zittern im Ton:
– Schön, Herr Varin … wir wollen also zu Ihnen gehen.
Sie redete nicht mehr. Ab und zu schauerte sie zusammen von Kopf zu Fuß, indem sie abwechselnd der Wunsch überkam zu fliehen oder zu bleiben. Im Grunde ihres Herzens war sie aber doch entschlossen, alles auszukosten.
Auf der Treppe klammerte sie sich ans Geländer vor innerer Erregung. Er stieg atemlos voran einen Fünfminutenbrenner in der Hand.
Sobald sie im Zimmer war, zog sie sich schnell aus und schlüpfte ins Bett, ohne ein Wort zu sprechen. Dort wartete sie an die Wand gedrückt.
Aber sie war unerfahren, eben wie die Ehefrau eines Provinznotares. Er aber anspruchsvoller denn ein Pascha. Sie verstanden sich nicht. Nicht im Geringsten.
Da schlief er ein. Die Nacht strich hin nur vom Tik-Tak der Wanduhr unterbrochen. Sie lag unbeweglich und dachte an die Nächte daheim, und beim gelben Licht einer chinesischen Laterne betrachtete sie, unsägliche Traurigkeit im Herzen, neben sich diesen kleinen rundlichen Mann, der auf dem Rücken lag und dessen kugelförmiger Leib die Bettdecke hob gleich einem gefüllten Luftballon. Er schnarchte, daß es klang wie Orgelgebraus, wie langdauerndes Schnauben, wie die komischsten Erstickungsanfälle. Seine paar Haare machten sich die Ruhe zu nutze und sträubten sich auf die abenteuerlichste Art, als hätten sie die ewig gleiche Lage auf diesem nackten Schädel satt bekommen, dessen Verheerungen im Haarwuchs sie verstecken sollten. Und aus dem Winkel seines halboffenen Mundes zogen Speichelfäden.
Da sich endlich das Frührot ins Zimmer stahl, stand sie auf, kleidete sich lautlos an, und hatte schon halb die Thür geöffnet als das Schloß kreischte und er erwachte.
Er rieb sich die Augen. Als er seine Schlaftrunkenheit überwunden und ihm die Erinnerung des ganzen Erlebnisses wiedergekommen, fragte er:
– Nun? Sie gehen?
Sie blieb stehen und stotterte verlegen:
– Es ist ja Morgen!
Er richtete sich auf:
– Hören Sie mal, nun muß ich Sie aber etwas fragen.
Sie antwortete nicht und er fuhr fort:
– Sie haben mich höllisch in Erstaunen gesetzt seit gestern. Seien Sie mal aufrichtig und gestehen Sie mir, wozu Sie das alles gemacht haben! Denn ich kapiere die ganze Geschichte nicht.
Sie trat leise näher und jungfräuliches Rot stieg ihr in die Wangen:
– Ich wollte das … das Laster … kennen lernen … nun … nun … schön ist es nicht.
Und sie entfloh, eilte die Treppe hinab und stürzte auf die Straße.
Ganze Reihen von Straßenkehrern kehrten. Sie kehrten die Bürgersteige und den Fahrdamm indem sie den Kehricht in die Gosse fegten. Immer mit dem gleichen regelmäßigen Schwung, wie Schnitter auf der Wiese, trieben sie den Schmutz im Halbkreis vor sich her. Von Straße zu Straße fand sie sie wieder, gleich ausgezogenen Hampelmännern automatisch schreitend.
Und ihr schien, als wäre auch aus ihr etwas hinausgekehrt worden, als wären ihre überhitzten Träume in den Rinnstein, in die Gosse gefegt.
Atemlos, erstarrt kam sie zu Hause an, nur die Erinnerung im Hirne jenes Besenschwunges, der Paris reinfegte am Morgen.
Und als sie in ihrem Zimmer war, weinte sie bitterlich.
Fräulein Fifi
Der preußische Befehlshaber Major Graf von Farlsberg durchflog die eingelaufenen Postsachen. Er war in einem großen gestickten Fauteuil versunken und hatte die Stiefel auf den eleganten Marmor des Kamins gelegt, in den seine Sporen seit den drei Monaten, die er nun im Schloß von Uville lag, zwei tiefe Löcher gebohrt. Von Tag zu Tag wurden sie tiefer.
Eine Tasse Kaffee dampfte auf einem kleinen eingelegten Tischchen, das durch Likör beschmutzt, von Cigarren verbrannt und mit dem Federmesser des als Sieger hausenden Offiziers zerschnitten war. Wenn er seinen Bleistift spitzte, hielt er oft in Gedanken inne und kritzelte Buchstaben oder Figuren auf dem zierlichen Möbel.
Als er seine Briefe zu Ende gelesen und die deutschen Zeitungen durchflogen, die ihm der Wachtmeister gebracht, stand er auf. Er warf drei oder vier mächtige Kloben frischen Holzes ins Feuer – denn die Herren fällten allmählich, um sich zu wärmen, den ganzen Park – und trat ans Fenster.
In Strömen ging der Regen nieder, ein echter Regen der Normandie, als ob er im Zorn heruntergeschüttet worden, schief, wie ein dichter Vorhang, eine schräge gestreifte Mauer. Ein Regen, der das Gesicht peitschte, mit Kot bespritzte, alles ersäufte, ein Regen, wie er nur um Rouen fallen kann, dem Nachtgeschirr Frankreichs.
Der Offizier sah lange auf die überschwemmten Rasenflächen hinaus und weiterhin auf die angeschwollene Andelle, die über die Ufer getreten. Er trommelte einen rheinischen Walzer an den Scheiben, als er Lärm hörte. Er drehte sich um: der zweitälteste Offizier war gekommen: Rittmeister Freiherr von Kelweingstein.
Der Major war ein breitschultriger Riese mit langem Vollbart, der sich fächerartig auf der Brust ausbreitete. Seine mächtige gravitätische Erscheinung machte den Eindruck eines militärischen Pfaues, aber eines Pfaues, dessen Schweif unter dem Kinn wuchs und dort ein Rad schlug. Er hatte kühle, mildblickende blaue Augen, eine Backe war ihm im österreichischen Feldzuge durch einen Säbelhieb gespalten. Er galt für einen braven Mann und guten Soldaten.
Der Rittmeister dagegen war klein, rotwangig mit dickem Bauch und gebremster Taille. Kurz geschoren trug er sein feuerrotes Haar, dessen Stoppeln ihm bei gewisser Beleuchtung einige Ähnlichkeit mit einer Streichholzkuppe gaben. In einer Bummelnacht hatte er einmal, weiß Gott wie, zwei Zähne eingebüßt, sodaß man ihn nun bei seiner Sprechweise schlecht verstand. Dazu trug er eine Glatze, gleich einer Mönchstonsur, um deren nackten Kreis ein Fell goldglänzender kleiner Härchen stand.
Der Befehlshaber gab ihm die Hand und schüttete auf einen Zug seinen Kaffee hinab (die sechste Tasse seit heute früh), indem er die Meldung seines Untergebenen über die Vorkommnisse im Dienst anhörte. Dann traten beide ans Fenster und meinten, es sei hier nicht gerade zum Totlachen. Der Major, eine ruhige Natur, der eine Frau daheim besaß, fügte sich in alles, aber der freiherrliche Rittmeister, ein großer Bummler und Mädchenjäger, war wütend, nun seit drei Monaten auf diesem verlorenen Posten zur Enthaltsamkeit gezwungen zu sein.
Da sie an der Thür Lärm vernahmen, rief der Major »herein« und ein Mensch – einer ihrer steifen Soldaten – erschien in der Öffnung, durch seine stumme Gegenwart das Frühstück meldend.
Im Eßsaal fanden sie drei andere Offiziere vor: Premierleutnant Otto von Großling, die Leutnants Fritz Schönauburg und Wilhelm Reichsgraf von Eyrik, ein winziges, blondes Kerlchen, das stolz und roh gegen seine Leute war, schroff gegen die Besiegten, und heftig wie ein Gewehr, das immerfort losgeht.
Seitdem sie sich in Frankreich befanden, nannten ihn seine Kameraden nur noch »Fräulein Fifi«. Ein Spitzname, den er seinem gezierten Wesen verdankte, seiner engen Taille, die den Eindruck machte, als trüge er ein Korsett und seinem bleichen Gesicht, auf dem man kaum den ersten Bartflaum sah. Vor allem aber, weil er es sich angewöhnt hatte, um seine allerhöchste Verachtung von Menschen und Dingen auszudrücken, fortwährend die französische Redensart zu gebrauchen » fi donc«, deren » fi« er leise pfeifend aussprach.
Der Eßsaal des Schlosses Uville war ein großer, fürstlich ausgestatteter Raum. Seine mit Kugellöchern besäten, alten Kristallspiegel, seine hohen, flandrischen Gobelins, die von Säbelhieben zerfetzt hier und da herunterhingen, zeugten von Fräulein Fifis Beschäftigung in seinen Mußestunden.
An der Wand hingen drei Familienbilder, ein gepanzerter Krieger, ein Kardinal und ein Staatsmann. Sie rauchten lange Porzellanpfeifen, während eine Edelfrau in enganschließendem Gewand aus ihrem durch die Jahre etwas goldverblichenen Rahmen anmaßend mit einem mächtigen Kohleschnurrbart herausschaute.
Die Offiziere nahmen beinahe schweigend das Frühstück ein in diesem verwüsteten, bei dem Regenwetter düsteren Gemach, das traurig dreinschaute angesichts der Sieger und dessen altes Eichengetäfel abgetreten war wie die Diele einer Kneipe.
Nach Tisch rauchten sie, tranken und sprachen wie alltäglich von ihrer Langeweile. Cognac und Schnaps ging reihum, sie lehnten sich in den Stühlen zurück, und bliesen in kleinen Wölkchen den Dampf aus ihren im Mundwinkel baumelnden, langen Pfeifen mit den Porzellanköpfen, auf denen Bilder geklext waren, um Hottentotten zu berücken.
Sobald die Gläser leer wurden, füllten sie sie müde von neuem. Aber Fräulein Fifi zerbrach alle Augenblicke das seine, und sofort reichte ihm ein Soldat ein anderes.
Schwarzer Tabakrauch hüllte sie ein wie in eine Wolke, und sie brüteten hier in trauriger, schläfriger Trunkenheit, jener stumpfsinnigen Sauferei von Leuten, die nichts zu thun haben.
Aber der Freiherr raffte sich plötzlich auf. Er ärgerte sich und fluchte:
– Gott verdamm’ mich, das kann nicht so weiter gehen! Wir müssen irgend was aushecken!
Premierleutnant von Großling und Leutnant Schönauburg, zwei echt deutsche, schwerfällige, ernste Menschen, antworteten zugleich:
– Was denn Herr Rittmeister?
Er sann einen Augenblick nach, bis er zurückgab:
– Was? Nun, wenn der Herr Major nichts dagegen hat müßten wir irgend ein Fest veranstalten.
Der Major nahm seine Pfeife aus dem Mund:
– Was für’n Fest meinen Sie, Kelweingstein?
Der Freiherr erklärte sich näher:
– Herr Major ich übernehme alles. Ich schicke den » Befehl« nach Rouen. Der wird uns Weiber holen. Ich weiß schon woher. Wir veranstalten ein kleines Souper. Wir haben alles dazu hier. Jedenfalls giebt’s einen ganz netten Abend!
Graf Farlsberg zuckte lächelnd die Achseln.
– Sie sind verdreht, lieber Freund!
Aber die Offiziere waren alle aufgesprungen, umringten den Major und baten:
– Herr Major müssen’s dem Herrn Rittmeister erlauben! Es ist zu ledern hier!
Endlich willigte der Major ein:
– Meinetwegen.
Da ließ der Freiherr den »Befehl« kommen, einen alten Unteroffizier, der nie eine Miene verzog, und für jeden Auftrag seiner Vorgesetzten nur ein »Befehl« hatte.
Unbeweglich nahm er des Rittmeisters Auseinandersetzung entgegen, ging, und fünf Minuten später jagte im strömenden Regen ein mit vier Pferden bespannter Trainwagen, über den man die Plane eines Müllerwagens gespannt, im Galopp davon.
Da schienen sie sofort aufzuwachen, sie richteten sich aus ihren müden Stellungen auf, ihre Mienen wurden lebhaft und man begann zu schwatzen.
Der Major behauptete, obgleich es noch immer weiter goß, es sei schon heller geworden. Premierleutnant von Großling kündigte mit Bestimmtheit an, der Himmel würde sich aufklären. Selbst Fräulein Fifi schien erregt, stand auf, setzte sich. Sein hartes, klares Auge suchte nach einem Zerstörungsobjekt. Der junge Blondkopf sah plötzlich die Dame mit dem Schnurrbart scharf an, zog seinen Revolver und sagte:
– Du sollst das nicht mit ansehen!
Ohne aufzustehen zielte er, und schoß mit zwei Kugeln scharf hintereinander dem Bilde die Augen aus. Dann rief er:
– Jetzt wollen wir ‘ne Mine legen!
Sofort schwieg das Gespräch als ob alle einen neuen, wichtigen Unterhaltungsstoff gefunden.
»Die Mine« war seine Erfindung, Seine Vernichtungsart, sein Hauptvergnügen.
Graf Ferdinand d’Amoys d’Uville, der rechtmäßige Besitzer, hatte, ehe er das Schloß verließ, keine Zeit gehabt, irgend etwas mitzunehmen oder zu verstecken. Nur das Silber war in der Mauer in einem Loch verborgen. Da er nun sehr reich war und prachtliebend, so schaute sein großer Salon neben dem Eßsaal vor der schleunigen Flucht seines Herrn, wie ein Museum aus.
An den Wänden hingen kostbare Ölgemälde, Handzeichnungen und Aquarelle. Auf den Möbeln, Etagèren, in eleganten Glasschränken, standen tausend Nippsachen, Vasen, Statuen, Figürchen aus Altmeißen, chinesische Pagoden, alte Elfenbeinschnitzereien und Venezianische Gläser wertvoll und wundervoll.
Viel war nicht mehr übrig. Nicht daß man sie hätte mitgehen heißen – das hätte Major Graf Farlsberg nie geduldet – aber Fräulein Fifi legte ab und zu eine »Mine«. Und an diesem Tage unterhielten sich alle Offiziere einmal wirklich fünf Minuten lang.
Der kleine Reichsgraf holte aus dem Salon was er brauchte. Er brachte eine reizende, kleine chinesische Theekanne mit, füllte sie mit Schießpulver, steckte vorsichtig ein langes Stück Feuerschwamm in die Schnauze, zündete es an und trug die Höllenmaschine schnell in das Nebengemach.
Dann kehrte er eiligst zurück und schloß die Thür. Die Deutschen blieben stehen und warteten mit lächelnder Miene neugierig wie die Kinder. Sobald die Explosion das Schloß hatte erzittern machen, liefen sie alle herbei.
Fräulein Fifi war zuerst eingetreten und schlug vor Freude die Hände zusammen angesichts einer Venus aus Terrakotta, deren Kopf endlich abgesprungen. Jeder hob Porzellanstücke auf, bestaunte die seltsamen Sprünge der Splitter, betrachtete die neuen Verwüstungen, stellte gewisse Verheerungen, als eben entstanden, fest, und der Major besah väterlichen Auges den großen Salon, der durch diesen Vandalismus um und um geworfen war und besät mit Überresten von Kunstwerken. Er entfernte sich zuerst, indem er gutmütig erklärte:
– Dies Mal hat die Geschichte gut geklappt!
Aber in den Eßsaal war eine solche Rauchwolke gedrungen und mischte sich nun mit dem Tabakdunst, daß man kaum atmen konnte. Der Major riß ein Fenster auf, und die Offiziere, die herübergekommen waren, um noch einen letzten Schluck Cognac zu trinken, stellten sich dazu.
Die feuchte Luft strömte ins Zimmer, indem sie die Bärte mit Wasserdunst beschlug. Ein Überschwemmungsgeruch verbreitete sich. Vor ihnen lagen die großen Bäume, die sich förmlich bogen unter den Regengüssen, das weite, durch die triefenden, tiefhängenden, dunkeln Wolken nebelerfüllte Thal, und in der Ferne den aus dem peitschenden Regen wie eine graue Nadel ragenden Kirchturm.
Seitdem sie im Lande waren, hatte sein Geläut geschwiegen, der einzige Widerstand, den die Eindringlinge weit und breit gefunden. Der Pfarrer hatte sich nicht geweigert, preußische Soldaten bei sich aufzunehmen und zu verpflegen. Er hatte sogar ein paar Mal mit dem feindlichen Befehlshaber, der sich seiner oft als wohlwollende Mittelsperson bediente, eine Flasche Bier oder Rotwein getrunken. Aber nicht einen Ton seiner Glocke durfte man von ihm verlangen. Lieber hätte er sich totschießen lassen. So protestierte er gegen den feindlichen Einbruch auf seine eigne Art, friedlich, still, die einzige Form, die, wie er sagte, dem Priester zustand, als Mann des Friedens und nicht des Krieges. Und Jedermann zehn Meilen in der Runde rühmte die Festigkeit und den Mut des Abbé Chantavoine, der durch das beharrliche Schweigen seiner Kirche die öffentliche Trauer einzugestehen und zu verkünden wagte.
Das ganze Dorf fühlte sich gehoben durch diesen Widerstand. Sie waren bereit durch Dick und Dünn mit ihrem Pfarrer zu gehen und betrachteten diesen stillschweigenden Protest als Rettung der Nationalehre. Die Bauern glaubten sich so mehr ums Vaterland verdient zu machen als Belfort und Straßburg, meinten, sie hätten ein gleich hohes Beispiel gegeben, so daß der Name ihres Dorfes nun unsterblich geworden. Sonst fügten sie sich den siegreichen Preußen.
Der Major und seine Offiziere lachten über diesen harmlosen Mut. Da sich sonst die ganze Gegend gefällig und nachgiebig gegen sie zeigte, so duldeten sie diesen stummen Patriotismus.
Nur der kleine Reichsgraf hätte die Glocke gern zum Läuten gebracht. Er ärgerte sich über die Nachgiebigkeit seines Vorgesetzten gegen den Pfarrer. Täglich bat er den Major, ihn doch ein einziges Mal »Bim-bam« machen zu lassen, einmal nur, ein einziges Mal, damit es was zu lachen gäbe. Katzenfreundlich, weibisch schmeichelnd bat er darum, mit weicher Stimme, wie eine, die von ihrem Liebhaber die Erfüllung irgend eines sehnlichen Wunsches begehrt. Aber der Major gab nicht nach und Fräulein Fifi legte im Schlosse von Uville weiter »Minen« als Trost.
Die fünf Männer atmeten am Fenster einige Minuten hindurch die feuchte Luft ein. Endlich sagte Leutnant Schönauburg mit halbem Lächeln:
– Na, schönes Wetter haben die Damen zu ihrem Ausfluge gerade nicht!
Darauf trennte man sich. Jeder mußte zu seinem Dienst und der Rittmeister hatte für das Diner zu sorgen.
Als sie sich bei Einbruch der Dämmerung wieder zusammenfanden und einander ansahen alle pomadisiert, parfümiert, frisch hergerichtet strahlend wie zur Parade, herrschte allgemeine Heiterkeit. Des Majors Haare schauten weniger grau aus, als am Morgen, und der Rittmeister hatte sich rasiert. Nur der Schnurrbart war stehen geblieben, wie eine Flamme unter der Nase.
Trotz des Regens blieb das Fenster offen und einer der Herren horchte bisweilen. Um sechs Uhr zehn Minuten verkündigte der Rittmeister, er höre ein fernes Rollen. Alle liefen herbei und bald darauf erschien im Galopp der große Wagen, dessen rauchende, schnaubende Pferde bis zum Rücken hinauf bespritzt waren.
Fünf Frauenzimmer stiegen aus, schöne Mädchen, die ein Kamerad des Rittmeisters, dem der »Befehl« eine diesbezügliche Karte seines Schwadronschefs gebracht, sorgfältig ausgewählt.
Sie hatten sich nicht weiter nötigen lassen, denn sie wußten, daß sie gut bezahlt werden würden. Im übrigen kannten sie die Preußen nun seit drei Monaten, die sie mit ihnen in Berührung waren und nahmen Männer und Dinge wie sie nun einmal lagen. – Das Geschäft bringt es so mit sich! sagten sie sich unterwegs um letzte Gewissensregungen zu betäuben.
Gleich ging’s in den Eßsaal, der erleuchtet in seinem kläglichen Zustande noch trauriger aussah.
Der mit Speisen, reichem Geschirr und dem Silber gedeckte Tisch, das in dem Loch aufgestöbert worden, wo es der Besitzer versteckt, gab dem Raum das Aussehen einer Schenke, in der Räuber nach einer Plünderung tafeln. Der Rittmeister strahlte. Er nahm von den Mädchen Besitz, wie von etwas altvertrautem, beguckte, umarmte, beschnupperte sie, und tarierte sie dabei auf ihren Wert als Dirne. Die drei jungen Leute wollten nun jeder eine in Besitz nehmen. Aber da widersprach er energisch, indem er sich die Teilung vorbehielt, nach Recht und Gerechtigkeit genau nach der Anciennetät, damit nicht gegen die militärische Ordnung verstoßen würde.
Um nun Streit und Widerrede, auch um den Schimmer von Parteilichkeit zu vermeiden, ordnete er sie nach der Größe und fragte den rechten Flügelmann im Befehlstone:
– Wie heißt Du?
Sie antwortete mit rauher Stimme.
– Pamela.
Da bestimmte er:
– Nummero Eins, namens Pamela, zur Dienstleistung beim Herrn Major.
Nachdem er dann Blondine, die zweite, durch einen Kuß in Besitz genommen, teilte er Premierleutnant von Großling die dicke Amanda und Leutnant Schönauburg die Tomaten-Eva zu. Rahel, die kleinste, braun, blutjung, mit kohlschwarzen Augen, eine Jüdin, deren Regennase die Regel bestätigte, wonach ihre Rasse krumme Schnäbel trägt, erhielt der jüngste Offizier, der gebrechliche Reichsgraf Wilhelm von Eyrik.
Übrigens waren sie alle hübsch und rundlich, ohne besonderen Ausdruck, an Teint und Äußerem etwa gleich geworden durch tägliche Ausübung ihres Berufes und durch das gemeinsame Leben im öffentlichen Hause.
Die drei jungen Leute wollten, unter dem Vorwand, ihnen Seife und Bürsten zum Reinigen anzubieten, ihre Mädchen sofort mit sich nehmen, doch der Rittmeister war schlauerweise dagegen. Er meinte, sie wären reinlich genug, um sich zu Tisch zu setzen und die, die hinaus gegangen, würden, nachdem sie wieder gekommen, tauschen wollen und so die anderen stören. Seine Erfahrenheit drang durch. Man küßte sich nur viel, küßte sich und wartete.
Plötzlich bekam Rahel einen Erstickungsanfall, und ließ hustend den Zigarrenrauch durch die Nase entweichen. Der Reichsgraf hatte gethan, als wollte er sie umarmen und ihr dabei eine Tabakswolke in den Mund geblasen. Sie ward nicht böse, sprach kein Wort, aber sie blickte ihren Inhaber starr an und in der Tiefe ihres Schwarzen Auges stieg leiser Zorn empor.
Man nahm Platz. Selbst der Major schien sich zu unterhalten. Er ließ Pamela rechts, Blondine links von sich sitzen und meinte, indem er seine Serviette auseinandersetze:
– Das ist ‘ne famose Idee von Ihnen, Kelweingstein!
Die Leutnants von Großling und Schönauburg waren höflich wie gegen Damen der Gesellschaft, und setzten dadurch ihre Nachbarinnen ein wenig in Verlegenheit. Aber der Rittmeister ließ sich gehen. Er strahlte über’s ganze Gesicht, warf mit zweifelhaften Redensarten um sich und sah mit seiner roten Haarkrone aus, als ob er in Flammen stünde. In rheinisch gefärbtem Französisch schnitt er die Cour und bestürmte die Mädchen unter einem regelrechten Speichelfeuer durch die Lücke seiner beiden zerbrochenen Zähne mit seinen Kneipenkomplimenten.
Aber sie begriffen nichts davon und ihr Verständnis schien erst zu erwachen, als er anfing, unanständige Worte vorzubringen, Zoten, die er durch seine Aussprache verstümmelte. Da fingen sie alle an, wie die Blödsinnigen zu lachen, lehnten sich an ihre Nachbarn an und wiederholten die Ausdrücke, die der Rittmeister dann im Scherze noch mehr verdrehte, damit sie Schweinereien reden sollten. Sie waren angeheitert von der ersten Flasche ab und nun zeigten sie ihre wahre Natur, ließen sich gehen, küßten nach rechts nach links, kniffen in den Arm, schrieen wie besessen, tranken aus allen Gläsern, sangen französische Couplets und abgerissene Stücke deutscher Lieder, die sie durch den täglichen Verkehr mit dem Feinde gelernt hatten.
Bald wurden auch die Männer verrückt durch diese Weiberkörper vor ihren Augen und in ihren Armen. Sie schrieen und zerschlugen Teller und Gläser, während die Soldaten hinter ihnen, sie ohne eine Miene zu verziehen, bedienten.
Nur der Major beherrschte sich.
Fräulein Fifi hatte Rahel auf den Schoß genommen und regte sich unnütz auf, indem er einmal wie verrückt die rabenschwarzen Härchen am Halse küßte, wobei er durch den Spalt zwischen Kleid und Haut die süße Wärme und den Odem ihres Leibes einsog, indem er sie dann wieder von geiler Wut und seinem Radautriebe gepackt, durch den Stoff hindurch wütend kniff, bis sie schrie. Dann wieder hielt er sie umfaßt, sie an sich pressend als sollte sie eins mit ihm sein, drückte lange seinen Mund auf der Jüdin frische Lippen, und küßte sie, daß sie nicht mehr atmen konnte. Plötzlich aber biß er sie so stark, daß ihr ein Blutstrom über das Kinn lief und auf die Taille tropfte.
Wieder sah sie ihn scharf an und zischte:
– Das zahl’ ich Dir heim!
Er lachte hart:
– Ich werde zahlen.
Der Nachtisch wurde aufgetragen, und Sekt eingeschenkt. Der Major erhob sich und sagte im selben Tone, als wenn er im Casino ein Hoch ausgebracht hätte:
– Auf das Wohl unserer Damen.
Eine ganze Reihe von Toasten begann, Toaste im Ton besoffener Soldateska, voll gemeiner Witze, die bei der Unkenntnis des Französischen noch roher klangen. Einer erhob sich nach dem anderen, indem er geistreich und komisch zu sein suchte. Die Weiber waren so betrunken, daß sie sich kaum aufrecht halten konnten. – Mit verglasten Augen und schleimigen Lippen klatschten sie jedes Mal wie rasend Beifall.
Der Rittmeister hob, um der Orgie einen galanten Anstrich zu geben, noch einmal sein Glas und rief:
– Auf unsere Siege über die Weiberherzen!
Da richtete sich Premierleutnant von Großling, eine Art Schwarzwaldbär, auf und der Wein stieg ihm so zu Kopf, daß er plötzlich in trunkenem Patriotismus rief:
– Auf unsere Siege über Frankreich!
Die Weiber schwiegen in ihrer Trunkenheit, nur Rahel drehte sich zusammenzuckend um:
– Du hör’ mal, ich kenne Franzosen vor denen Du so was nicht sagen würdest.
Der kleine Reichsgras, der sie noch immer auf den Knieen hielt, fing an zu lachen. Der Wein machte ihn fröhlich:
– Oho! Oho! Ich habe noch keinen gesehen! Sobald wir kommen – reißen sie aus!
Das Mädchen warf ihm verzweifelt in’s Gesicht:
– Du lügst, Du Lump!
Während einer Sekunde ließ er auf ihr sein kühles Auge ruhen, wie auf den Gemälden, nach denen er mit dem Revolver schoß, dann fing er an zu lachen:
– Na davon wollen wir mal lieber schweigen, Verehrteste! Säßen wir etwa hier, wenn sie tapfer wären?
Und er ward lebhafter.
– Wir sind die Herren. Frankreich gehört uns!
Sie ließ sich mit einem Ruck von seinem Schoß herunter auf den Stuhl. Er stand auf, hob sein Glas über den Tisch und wiederholte:
– Uns gehört Frankreich und die Franzosen, die französischen Wälder, Felder, Häuser, alles!
Die anderen ergriff plötzlich in ihrer Trunkenheit unsinnige militärische Begeisterung. Sie hoben ihre Gläser, mit dem Ruf:
– Es lebe Preußen!
Und leerten sie auf einen Zug. Die Mädchen widersprachen nicht, gezwungen zu schweigen und von Angst gepackt. Selbst Rahel war nicht im Stande zu antworten.
Da setzte der kleine Reichsgraf der Jüdin sein frisch gefülltes Sektglas auf den Kopf und schrie:
– Uns sollen auch alle französischen Frauen gehören !
Sie sprang so schnell auf, daß die Krystallschale kippte, indem sich wie zur Taufe der goldperlende Wein über ihr Haar ergoß, fiel und am Boden zerschellte. Mit bebenden Lippen hielt sie des Offiziers noch immer lächelndem Blicke stand und stammelte mit vor Wut erstickter Stimme:
– Das … das … das ist nicht wahr! Hörst Du! Die französischen Frauen kriegt ihr nicht!
Er setzte sich und wollte sich ausschütten vor Lachen:
– Das ist gut, wirklich gut, was suchst Du denn dann hier, Kleine?
Das brachte sie außer Fassung. Sie war so verdutzt, daß sie zuerst gar nicht recht begriff und schwieg. Als sie dann aber verstanden hatte was er gesagt, schrie sie ihm empört in’s Gesicht:
– Ich … ich … ich bin keine Frau, ich bin eine Hure! Nur so eine paßt für die Preußen!
Kaum hatte sie ausgesprochen, als er ihr mit aller Kraft eine Ohrfeige gab. Aber als er, sinnlos vor Wut die Hand zum zweiten Male hob, ergriff sie vom Tisch ein Dessertmesser mit silberner Klinge und rannte es ihm so schnell, daß man kaum gewahr wurde was vor sich ging, in den Hals, genau in die Höhlung wo die Brust ansetzt.
Das Wort blieb ihm in der Kehle stecken und fürchterlichen Blickes stand sein Mund offen.
Alle schrieen, und sprangen mit Getöse auf. Rahel aber warf ihren Stuhl Premierleutnant von Großling zwischen die Beine, sodaß er der Länge nach hinschlug, lief an’s Fenster, riß es auf ehe man ihr folgen konnte und schwang sich in die Nacht hinaus, in den noch immer strömenden Regen.
Nach zwei Minuten war Fräulein Fifi tot. Da griffen Schönauburg und Großling nach den Waffen, um die Weiber, die ihnen zu Füßen lagen niederzumachen. Der Major hatte Mühe Blutvergießen zu hindern. Er ließ die vier bestürzten Mädchen unter Bewachung von zwei Mann in ein Zimmer sperren. Dann befahl er seinen Leuten die Verfolgung der Flüchtigen, indem er sie verteilte wie zum Gefecht. Und er war gewiß sie zu fangen.
Fünfzig Mann wurden mit strengsten Befehlen in den Park entsandt, zweihundert mußten den Wald und alle Häuser im Thal durchsuchen.
Der schnell abgeräumte Tisch, diente nun als Totenbett. Die vier Offiziere blieben starr, entnüchtert, mit ernstem Dienstgesicht an den Fenstern stehen und spähten in die Nacht hinaus.
Immer weiter strömte der Regen. Es plätscherte im Nebel, wie unbestimmtes Murmeln von Wasser das niederströmt, Wasser das fließt, Wasser das abtropft, Wasser das zurückspritzt.
Plötzlich fiel ein Schuß, dann weit entfernt ein zweiter und so vernahm man vier Stunden lang ab und zu weiter oder näher Entladungen, Rufe zum Sammeln, und seltsame Kehllaute als Anruf.
Früh rückte alles wieder ein. Im Eifer des Gefechts und der Aufregung der nächtlichen Verfolgung waren zwei Soldaten getötet und drei andere durch ihre Kameraden verwundet worden.
Rahel hatte man nicht wiedergefunden.
Da wurden die Einwohner bedroht, die Wohnungen um und umgeworfen, die ganze Gegend durchspäht, abgetrieben, umgewälzt. Die Jüdin schien keine Spur auf ihrem Wege hinterlassen zu haben.
Der General, dem Meldung erstattet worden, befahl die Sache niederzuschlagen um der Armee kein schlechtes Beispiel zu geben. Der Major erhielt eine Disziplinarstrafe und der wiederum bestrafte seine Untergebenen. Der General hatte gesagt : »Zum Scherz und um Weibergeschichten führen wir nicht Krieg.« Graf Farlsberg war erbittert und beschloß sich an der Gegend zu rächen.
Da er einen Vorwand brauchte um in seiner Maßregelung nicht behindert zu sein, ließ er den Pfarrer kommen und befahl ihm, beim Begräbnis des Reichsgrafen von Eyrik, die Glocke läuten zu lassen.
Ganz wider Erwarten fügte sich der Pfarrer, war unterwürfig und zu allem bereit. Und als die Leiche des Fräulein Fifi, von Soldaten mit geladenem Gewehr getragen, geführt, umgeben, gefolgt, das Schloß von Uville verließ um zum Kirchhof gebracht zu werden, stimmte die Glocke zum ersten Mal ihr Totengeläute an. Und sie klang beinahe munter, als ob eine freundliche Hand sie gestreichelt.
Abends klang sie wieder und am andern Morgen und alle Tage. So oft es verlangt ward bimmelte sie. Sogar manchmal Nachts setzte sie sich von selbst in Bewegung, und von seltsamer Fröhlichkeit gepackt, wach geworden, man wußte nicht warum, ließ sie zwei oder drei Töne in die Nacht hinausschallen. Da meinten alle Ortseinwohner sie sei verhext und außer dem Pfarrer und dem Meßner wagte sich niemand mehr an den Turm heran.
Ein armes Mädchen nämlich lebte in Angst und Einsamkeit dort oben und wurde heimlich von den beiden Männern mit Essen versorgt.
Bis zum Abmarsch der deutschen Truppen blieb sie dort. Dann brachte sie der Pfarrer selbst mit dem vom Bäcker geborgten Wagen, eines Abends an die Thore von Rouen. Dort umarmte sie der Geistliche. Sie stieg aus und kehrte zu Fuß zu dem öffentlichen Hause zurück, deren Inhaberin sie schon tot geglaubt.
Einige Zeit später nahm sie ein vorurteilsloser Vaterlandsfreund heraus, der sie zuerst wegen ihrer schönen That, dann um ihrer selbst willen, liebgewonnen. Er heiratete sie und sie ward eine Frau, nicht schlechter denn manche andere.
Die beiden Freunde
Paris war belagert, ausgehungert und lag in den letzten Zügen. Die Spatzen auf den Dächern wurden selten, die Gossen entvölkerten sich. Man aß alles.
Herr Morissot, der von Beruf Uhrmacher war, doch gelegentlich auch Pantoffeln verkaufte, schlenderte, die Hände in die Taschen seiner Uniformhose versenkt, an einem hellen Januarmorgen traurig und hungrig den äußeren Boulevard entlang. Da stand plötzlich ein Kamerad vor ihm, ein alter Freund, Herr Sauvage, den er vom Wasser her kannte.
Ehe der Krieg ausbrach, fuhr Morissot jeden Sonntag bei Tagesanbruch, den Bambusstock in der Hand, einen Blechkasten aus dem Rücken, mit dem Zug in der Richtung nach Argenteuil. In Colombes stieg er aus und ging zur Insel Marante. Sobald er am Ziel seiner Wünsche war, fing er an zu angeln, und angelte bis zu sinkender Nacht.
Und jeden Sonntag traf er dort ein dickes, joviales Männchen, Herrn Sauvage, den Krämer aus der Straße Notre-Dame-de-Lorette , der gleichfalls begeisterter Angler war. Oft saßen sie einen halben Tag lang Seite an Seite, die Angelrute in der Hand, und ließen die Füße über dem Wasser baumeln. So hatten sie sich angefreundet.
An manchen Tagen redeten sie keinen Ton. Zuweilen unterhielten Sie sich. Aber sie verstanden sich ausgezeichnet auch ohne Worte, denn sie teilten den gleichen Geschmack und hatten gleiche Interessen.
Im Frühling, wenn morgens gegen zehn die junge Sonne aus dem leise dahinströmenden Fluß Dunst aufsteigen ließ, der mit dem Wasser wanderte, wenn sie den beiden eifrigen Anglern behaglich auf den Rücken schien, dann sagte wohl Morissot zu seinem Nachbar :
– Ach ist das mollig!
Und Herr Sauvage gab zurück:
– So was giebt’s nicht wieder!
Das genügte, daß sie sich verstanden und gern hatten.
Im Herbst, wenn gegen Abend die untergehende Sonne den blutroten Himmel und scharlachfarbene Wolkenbilder im Wasser spiegelte, den ganzen Fluß mit Purpur übergoß, den Horizont in Flammen setzte, die beiden Freunde wie mit Feuer umspielte und die vom Winterhauch schon zitternd braun gefärbten Bäume goldig überzog, sah Herr Sauvage wohl lächelnd Morissot an und sprach:
– Wie das aussieht!
Und Morissot antwortete staunend, ohne einen Blick von seinem Schwimmer zu lassen:
– Ist das nicht schöner als der Boulevard, was?
Sobald sich die beiden erkannt hatten. schüttelten sie einander kräftig die Hand – bewegt sich unter solch’ veränderten Verhältnissen wiederzusehen. Herr Sauvage meinte seufzend:
– Was alles passiert ist!
Morissot stöhnte niedergeschlagen :
– Und das Wetter! Heute ist der erste schöne Tag im Jahre.
Der Himmel lachte in der That in reinster Bläue nieder.
Sie gingen nachdenklich und traurig nebeneinander her. Morissot begann:
– Und das Angeln was? Das war doch schön!
Herr Sauvage fragte:
– Wann fangen wir wieder an?
Sie traten in ein kleines Café und tranken zusammen einen Absinth. Dann setzten sie ihren Spaziergang auf der Straße fort.
Morissot blieb plötzlich stehen:
– Noch ein Gläschen, was meinen Sie?
Herr Sauvage stimmte bei :
– Wie Sie wollen!
Und sie sprachen noch bei einem anderen Weinhändler vor.
Als sie gingen, waren sie tüchtig angezecht, wie Leute die auf nüchternen Magen getrunken haben. Es war milde, eine weiche Brise spielte ihnen um die Wangen.
Die laue Luft hatte Herrn Sauvage vollends angeheitert und er blieb stehen:
– Wenn wir hingingen?
– Wohin?
– Na, zum Angeln!
– Aber wo?
– Auf unsere Insel natürlich. Die französischen Vorposten stehen bei Colombes. Ich kenne den Oberst Dumoulin. Man wird uns schon durchlassen.
Morissot zitterte vor Begierde:
– Abgemacht. Ich bin dabei!
Und Sie trennten sich um ihre Angelgerätschaften zu holen.
Eine Stunde lang schritten sie Seite an Seite die Chaussee hinab, zur Villa, wo der Oberst lag. Er lächelte über die Bitte und hatte gegen ihre Grille nichts einzuwenden. Mit einem Passierschein versehen, setzten sie den Weg fort.
Bald kamen sie durch die Vorposten, durchschritten das verlassene Colombes und erreichten die kleinen Weinberge, die zur Seine hinabziehen. Es war gegen elf Uhr.
Das Dorf Argenteuil gerade gegenüber schien wie ausgestorben. Die Höhenzüge von Orgemont und Sannois überragten die ganze Gegend. Die große Ebene, die bis Nanterre reicht, lag verlassen da, ganz verlassen, mit ihren kahlen Kirschbäumen und ihrem grauen Boden.
Herr Sauvage deutete mit dem Finger nach den Hügeln hinüber.
– Dort oben sind die Preußen!
Und ein unheimliches Gefühl befiel die beiden Freunde vor diesem öden Land.
»Die Preußen!« Sie hatten noch nie welche gesehen, aber seit Monaten fühlten sie ihre Anwesenheit um Paris, die Frankreich vernichteten, plündernd, mordend, aushungernd – unsichtbar und allmächtig. Und eine Art abergläubischen Schreckens trat zum Haß, den sie gegen dieses unbekannte, siegreiche Volk hegten.
Morissot stammelte :
– Herr Gott wenn wir nun welche treffen?
Herr Sauvage antwortete mit jenem Pariser Humor, der durchbrach trotz alledem:
– Wir bieten ihnen ein Gericht Fische an!
Aber sie zögerten doch sich hinaus zu wagen: das allgemeine Schweigen rundum machte sie ängstlich.
Endlich faßte Herr Sauvage einen Entschluß:
– Wir wollen nur immer gehen, aber Vorsicht!
Und sie stiegen einen Weinberg hinunter, geduckt, kriechend, indem sie hinter den Büschen Deckung suchten, ängstlich um sich blickten und lauschten.
Ein Stück freies Feld mußte noch überschritten werden bis zum Flußufer. Sie fingen an zu laufen, und kauerten sich, sobald sie die Böschung erreicht, im trocknen Schilfe nieder.
Morissot legte das Ohr an die Erde, zu horchen ob er Tritte vernähme. Er hörte nichts. Sie waren allein, ganz allein.
Nun beruhigten sie sich und fingen an zu angeln.
Die einsame Insel Marante gegenüber deckte sie gegen das andere Ufer. Das kleine Restaurant drüben war verschlossen und schien seit Jahren verlassen.
Herr Sauvage fing den ersten Gründling, Morissot den zweiten, und nun zogen sie alle Augenblicke die Angel heraus an der ein kleines silberglänzendes Tier zappelte; ein wahrer Wunderfang.
Sie ließen leise die Fische in ein engmaschiges Netz gleiten, das zu ihren Füßen im Wasser hing. Und eine köstliche Wonne überkam sie, die Wonne, die einen packt, wenn man sein Lieblingsvergnügen wiederaufnimmt, das man lange hat entbehren müssen.
Die liebe Sonne schien ihnen warm auf den Rücken. Sie hörten nichts mehr. Sie dachten an nichts mehr, vergaßen die übrige Welt : sie angelten.
Aber plötzlich machte ein dumpfer Lärm, der vom Innern der Erde zu kommen schien, den Boden erzittern. Das Geschütz fing wieder an zu donnern.
Morissot wandte den Kopf und gewahrte über der Böschung, weit drüben links die gewaltigen Umrisse des Mont-Valérien, der auf der Stirn eine weiße Haube trug, eine Pulverwolke, die er eben ausgespien.
Und in dem Augenblick schoß ein zweiter Dampfstrahl vom Gipfel der Festung, wenige Sekunden darauf grollte eine neue Entladung.
Dann folgten andere und von Moment zu Moment hauchte der Berg seinen Todesatem hinaus, blies milchige Dämpfe von sich, die langsam in die blaue Luft stiegen, als Wolke über ihm.
Herr Sauvage zuckte die Achseln und sprach :
– Da fangen sie schon wieder an.
Morissot, der ängstlich zusah wie die Spule seines Schwimmers auf-und untertauchte, ward plötzlich von Wut gepackt, als friedlich gesinnter Mann gegen jene Verrückten, die sich da schlugen, und brummte in den Bart:
– ‘s ist doch zu dumm, sich so totzuschießen!
Herr Sauvage antwortete:
– Dümmer wie’s Vieh!
Und Morissot, der eben einen Weißfisch gefangen hatte, erklärte:
– Und wenn man sich überlegt, daß es immer so sein wird, so lange wir Regierungen haben!
Herr Sauvage unterbrach ihn:
– Die Republik hätte den Krieg nicht erklärt ! …
Morissot fuhr dazwischen:
– Beim Königtum hat man den Krieg draußen bei der Republik hat man den Krieg im Innern!
Und sie begannen ruhig zu diskutieren, indem sie die großen, politischen Fragen mit dem gesunden Menschenverstand braver, etwas beschränkter Geister lösten. Über eins waren sie einig: daß man niemals frei wäre. Und der Mont-Valérien donnerte ohne Unterlaß. Mit seinen Geschossen legte er französische Häuser in Trümmer, Leben vernichtend, menschliche Wesen zerschmetternd! Mit seinen Geschossen bereitete er ein jähes Ende manchem Traum, vielen Freuden, viel erhofftem Glück, und schlug Frauen-, Mädchen-, Mutterherzen, dort drüben im anderen Land, Wunden, nie zu schließen.
– So ist das Leben! erklärte Herr Sauvage.
– Sagen Sie lieber – der Tod! gab Morissot lachend zurück.
Aber sie zuckten erschrocken zusammen, sie fühlten, daß hinter ihnen jemand gegangen, und als sie den Kopf wandten, gewahrten sie in ihrem Rücken vier Männer, vier große, bewaffnete, bärtige Männer, wie Livréediener gekleidet mit platten Mützen auf dem Kopf, die Gewehre im Anschlag.
Die beiden Angelruten entsanken ihren Händen und trieben den Fluß hinab.
Binnen weniger Sekunden waren sie gepackt, gefesselt, fortgeschleppt, in einen Kahn gebracht und nach der Insel übergesetzt.
Nun gewahrten sie hinter dem Hause , das sie verlassen gewähnt, einige zwanzig deutsche Soldaten.
Eine Art behaarter Riese, der rittlings aus einem Stuhl sitzend eine lange Pfeife mit Porzellankopf schmauchte, fragte sie in ausgezeichnetem Französisch:
– Nun, meine Herren, haben Sie einen guten Fang gethan?
Da legte ein Soldat das Netz voller Fische, das er sorgsam mitgeschleppt zu den Füßen des Offiziers nieder. Der Preuße lächelte:
– Oho, Sie haben ja Glück gehabt! Aber es handelt sich um etwas Anderes. Hören Sie mich an und regen Sie sich weiter nicht aus. In meinen Augen sind Sie einfach zwei Spione, die uns auskundschaften sollen. Um das besser zu bemänteln, haben Sie so gethan, als angelten Sie. Sie sind mir in die Hände gefallen – schlimm für Sie – wir sind nun mal im Kriege! Aber da Sie durch die Vorposten gekommen sind, müssen Sie das Losungswort kennen, um wieder hineinzukommen. Sagen Sie mir das Losungswort und ich lasse Gnade vor Recht ergehen.
Die beiden Freunde standen aschfahl nebeneinander, ihre Hände zitterten nervös ein wenig, sie schwiegen.
Der Offizier fing wieder an:
– Kein Mensch erfährt’s. Sie gehen ruhig wieder hinein. Mit Ihnen ist das Geheimnis weggelöscht. Weigern Sie sich aber, so kostet’s Ihnen den Kopf, und zwar augenblicklich. Also wählen Sie.
Sie blieben unbeweglich stehen, ohne den Mund aufzuthun.
Der Preuße behielt seine Ruhe. Er deutete mit der Hand auf den Fluß:
– Denken Sie dran, daß Sie in fünf Minuten dort im Wasser auf dem Grunde liegen. In fünf Minuten! Sie müssen doch Angehörige haben!
Der Mont-Valérien donnerte immer weiter.
Die beiden Angler blieben wortlos stehen. Der Deutsche gab in seiner Sprache einige Befehle, dann rückte er seinen Stuhl ein Stück ab, um den Gefangenen nicht zu nahe zu sein. Und zwölf Mann stellten sich in zwanzig Schritt Entfernung auf, Gewehr bei Fuß.
Der Offizier fuhr fort:
– Ich gebe Ihnen noch eine Minute Bedenkzeit. Nicht zwei Sekunden mehr.
Dann stand er hastig aus, ging auf die beiden Franzosen zu, nahm Morissot beim Arm, zog ihn ein Stück fort und sagte leise zu ihm:
– Schnell das Losungswort? Ihr Kamerad erfährt nichts davon. Ich werde so thun, als ob ich mich erweichen ließe.
Morissot antwortete nicht.
Da zog der Preuße Herrn Sauvage bei Seite und stellte ihm die gleiche Frage.
Herr Sauvage antwortete nicht.
Sie standen wieder nebeneinander.
Und der Offizier gab ein Kommando. Die Soldaten legten an.
Da fiel Morissots Blick zufällig auf das Netz voll Gründlinge, das ein paar Schritte von ihm im Grase liegen geblieben war.
Ein Sonnenstrahl glitzerte auf den noch zappelnden Fischen. Und eine Schwäche wandelte ihn an. Wider Willen füllten sich seine Augen mit Thränen.
Er stammelte:
– Adieu Herr Sauvage.
Herr Sauvage antwortete:
– Adieu Herr Morissot.
Sie drückten sich die Hand und, wie sie auch dagegen kämpften, ein Zittern lief ihnen über den ganzen Körper.
Der Offizier kommandierte: »Feuer!«
Zwölf Schüsse klangen wie einer.
Herr Sauvage fiel wie ein Klotz auf’s Gesicht. Der große Morissot schwankte, drehte sich und sank schräg über seinen Kameraden, während aus seiner an der Brust aufgesprungenen Uniform ein Blutstrom drang.
Der Deutsche gab neue Befehle.
Seine Leute gingen und kamen mit Stricken und Steinen wieder, die sie den beiden Toten an die Füße banden. Dann trugen sie die Leichen an’s Ufer.
Der Mont-Valérien grollte immerfort, nun ganz in Wolken gehüllt.
Zwei Soldaten packten Morissot bei Kopf und Füßen. Zwei andere Herrn Sauvage in gleicher Weise. Die Körper wurden einen Augenblick kräftig hin und her geschaukelt, dann in der Luft losgelassen. Sie beschrieben einen Bogen und tauchten stehend in den Fluß, indem die Steine zuerst die Füße hinabzogen.
Das Wasser spritzte, kochte, zitterte und kam zur Ruhe, während sich kleine Wellenkreise bis zum Ufer fortpflanzten.
Ein bißchen Blut schwamm auf der Flut davon.
Der Offizier sagte, immer noch mit heiterem Ausdruck, halblaut:
– Nun sind die Fische an die Reihe gekommen.
Dann ging er zum Hause zurück.
Und plötzlich sah er das Netz mit den Gründlingen im Grase liegen. Er hob es auf, betrachtete es, lächelte und rief:
– Wilhelm!
Ein Soldat mit weißer Schürze eilte herbei. Der Preuße warf ihm die Jagdbeute der beiden Erschossenen hin und befahl:
– Laß mir mal gleich die Tierchen da backen, während sie noch lebendig sind. Das wird famos schmecken !
Dann rauchte er seine Pfeife weiter.
Der Weihnachtsabend
– Der Weihnachtsabend! Ach geht mir mit dem Weihnachtsabend. Ich feiere ihn nicht! – sagte der dicke Henri Templier in wütendem Ton, als ob man ihm eine Ehrlosigkeit zugemutet hätte.
Die übrigen riefen lachend:
– Warum wirst du denn so böse?
Er antwortete:
– Weil mir der Weihnachtsabend den widerlichsten Possen gespielt hat und ich einen unüberwindlichen Abscheu vor diesem blödsinnigen Abend bekommen habe mit seiner albernen Fröhlichkeit.
– Wieso denn?
– Wieso? Ihr wollte wissen? Na da hört mal an:
Ihr wißt noch wie’s vor zwei Jahren um die Zeit kalt war, so ‘ne Kälte, um arme Leute auf der Straße gleich tot hinzuschmeißen. Die Seine fror zu. Auf den Trottoirs kriegte man Eisbeine gleich durch die Sohlen durch. Die Welt schien nicht weit vom Krepieren zu sein.
Ich hatte damals gerade ‘ne große Arbeit vor und lehnte alle Einladungen zum Weihnachtsabend ab, weil ich lieber die Nacht am Schreibtisch sitzen wollte. Ich aß allein. Dann fing ich an. Aber so gegen zehn hatt’ ich keine Ruhe mehr. Ich dachte an all die Fröhlichkeit überall in Paris, dann tönte der Straßenlärm trotz alledem immer zu mir heraus und durch die Wand hörte ich die Vorbereitungen meiner Nachbarn zum Abendessen. Ich wußte nicht mehr, was ich eigentlich arbeitete. Ich schrieb Blech! Und ich sah ein, daß ich’s nur ruhig aufstecken konnte, diese Nacht was Vernünftiges fertig zu kriegen.
Ich ging ein wenig im Zimmer spazieren, setzte mich, stand auf. Ich unterlag eben auch dem ansteckenden Einfluß der allgemeinen Fröhlichkeit und ergab mich darein, klingelte meinem Mädchen und sagte:
– Angele, holen Se mir ‘n Abendessen zu zwei Personen: Austern, ‘n kalten Rebhahn, Krebse, Schinken, Kuchen. Dann bringen Sie mir zwei Flaschen Sekt raus, decken Sie und gehen Sie schlafen.
Sie gehorchte, wenn auch etwas erstaunt. Als alles bereit war, zog ich den Überzieher an und ging aus.
Es galt eine wichtige Frage zu entscheiden: mit wem sollte ich soupieren? Meine Freundinnen waren schon eingeladen. Hätt’ ich eine haben wollen, hätt’ ich mich früher umthun müssen. Da dachte ich, du wirst zugleich eine gute That vollbringen, Paris wimmelt von armen, hübschen Mädeln, die nichts zu beißen haben und die nur einen »noblen Kavalier« suchen. Ich werde bei einer dieser Enterbten den Weihnachtsmann spielen. Ich werde rumbummeln, die Vergnügungsorte abgrasen, fragen, auf die Jagd gehen und suchen was mir paßt.
Ich zog also los.
Ich traf ja ‘n ganzen Haufen armer Mädel, die ‘n Abenteuer suchten, aber entweder waren sie häßlich, daß ‘s einem gleich schlecht werden konnte, oder so dürr, daß sie sofort ‘n Eiszappen geworden wären, wären sie stehen geblieben.
Ihr wißt, ich habe so ‘ne kleine Schwäche für die Dicken. Je fetter desto besser. Eine »Riesendame« macht mich rein verrückt.
Da entdeckte ich plötzlich gerade gegenüber vom Theater des Variétés ein Profil, das mir gefiel. Ein Kopf, dann vorn zwei Erhöhungen, die Brust – sehr schön, die drunter – erstaunlich: ein Leib wie ‘ne fette Gans. Mich überlief’s und ich sagte mir: Gottes Donnerwetter ist das ‘n hübsches Mädel! Eins mußte noch aufgeklärt werden: das Gesicht.
Das Gesicht ist das Dessert. Das übrige ist … ist der Braten.
Ich ging schneller, holte das herumbummelnde Frauenzimmer ein und drehte mich unter einer Gaslaterne schnell um.
Sie war entzückend, ganz jung, bräunlich mit großen, schwarzen Augen.
Ich lud sie ein, sie nahm ohne Zögern an.
Eine Viertelstunde darauf waren wir in meiner Wohnung.
Beim Eintreten sagte sie:
– Ah, hier ist man gut aufgehoben!
Und sie blickte um sich mit sichtlicher Befriedigung, bei dieser eisigen Nacht Tisch und Bett gefunden zu haben. Sie war herrlich, zum Staunen hübsch und dick, daß mir das Herz im Leibe lachte.
Sie legte Hut und Mantel ab, setzte sich und fing an zu essen. Aber sie schien nicht aufgelegt zu sein und manchmal zuckte es über ihr ein wenig bleiches Gesicht, als ob sie einen geheimen Kummer hätte.
Ich fragte sie:
– Du hast wohl irgend ‘ne Unannehmlichkeit!
Sie antwortete:
– Bah, ich mag nicht dran denken!
Und sie begann zu trinken. Auf einen Zug leerte sie ihr Glas Sekt, füllte es und leerte es wieder ohne Unterlaß.
Bald färbten sich ein wenig ihre Wangen und sie begann zu lachen.
Ich war schon ganz verliebt und schmatzte sie ab, indem ich die Entdeckung machte, daß sie weder dumm, noch gemein, noch ungebildet war, wie die Mädchen von der Straße. Ich wollte Einzelheiten über ihr Leben wissen. Sie antwortete:
– Kleiner, das geht dich nichts an!
Ach! Eine Stunde später ….
Endlich nahte der Augenblick des Schlafengehens. Während ich den Tisch fortrückte, der vor dem Feuer stand, zog sie sich schnell aus und schlüpfte unter die Decke.
Meine Nachbarn vollführten einen gräßlichen Spektakel, lachten und sangen wie die Irrsinnigen. Und ich sagte mir: »Ich habe doch riesig recht gehabt mir das schöne Mädel zu holen, von Arbeiten wäre doch keine Rede gewesen!«
Ein tiefes Stöhnen klang, so daß ich mich umdrehte und fragte:
– Was fehlt dir denn mein Kätzchen?
Sie antwortete nicht, aber stieß weiter schmerzliche Seufzer aus, als ob sie fürchterlich zu leiden hätte.
Ich fragte:
– Fühlst du dich nicht wohl?
Da schrie sie plötzlich, schrie herzzerreißend. Ich eilte mit einem Licht herbei.
Ihr Gesicht war von Schmerzen entstellt, sie rang keuchend die Hände, während aus ihrer Brust ein dumpfes Wimmern klang, wie Röcheln, daß einem das Herz bebte.
Ich fragte erschrocken:
– Aber was hast du denn? So sage mir doch was du hast!
Sie antwortete nicht und fing an zu heulen.
Plötzlich schwiegen die Nachbarn, um zu horchen, was bei uns los sei.
Ich wiederholte:
– Wo hast du denn Schmerzen? So sage mir doch wo!
Sie stammelte:
– Ach mein Leib, mein Leib …
Mit einem Ruck hob ich die Decke auf, und entdeckte …
Sie kam nieder, liebe Freunde!
Da verlor ich den Kopf. Ich lief zur Wand, und trommelte daran mit den Fäusten, was ich nur konnte, indem ich rief:
– Hilfe! Hilfe!
Die Thür ging auf, eine Menge Menschen kamen herein, Herren im Frack, dekolletierte Damen, Pierrots, Türken, Musketiere. Dieser Einbruch verstörte mich derartig, daß ich nicht einmal imstande war zu erklären, was los sei.
Sie hatten irgend ein Unglück vermutet, vielleicht ein Verbrechen, und begriffen nun nichts.
Ich sagte endlich:
– Hier … Hier … diese Frau … komm. nieder ….
Da ward sie von allen betrachtet und alle gaben ihr Urteil ab. Ein Kapuziner vor allem behauptete, Sachverständiger zu sein, und wollte der Natur zuvorkommen.
Sie waren betrunken wie die Stiere. Ich dachte sie würden sie tot machen und stürzte ohne Hut die Treppe hinunter, um einen alten Arzt zu holen, der in einer Nachbarstraße wohnte.
Als ich mit dem Doktor wiederkam, war das ganze Haus auf den Beinen. Auf der Treppe hatte man das Gas wieder angesteckt, die Bewohner aller Stockwerke füllten meine Wohnung. Vier Quaiarbeiter machten meinem Sekt und meinen Krebsen ein Ende.
Als man mich zu Gesicht bekam, kreischte alles laut aus und eine Milchfrau hielt mir in einem Handtuch ein fürchterliches, runzliges, faltiges, wimmerndes Stück Fleisch, das Töne von sich gab wie eine Katze, mit den Worten entgegen:
– Es ist ein Mädchen.
Der Arzt untersuchte die Wöchnerin, erklärte ihren Zustand für bedenklich, weil das Unglück gleich nach einem Souper stattgefunden, und ging, indem er mir mitteilte, er werde sofort eine Krankenwärterin und eine Amme schicken.
Eine Stunde darauf kamen die beiden Frauen mit einem Packet Arzenei.
Ich brachte die Nacht in einem Lehnstuhle zu, viel zu erschrocken, als daß ich an die Folgen gedacht hätte.
Zeitig am andern Morgen kam der Arzt. Er fand den Zustand der Kranken ziemlich schlecht, und sagte mir:
– Ihre Frau, Herr ….
Ich antwortete ihm:
– Sie ist nicht meine Frau.
Er fuhr fort:
– Also Ihr Verhältnis, das ist mir gleich.
Und er zählte auf, was sie an Pflege, Arzenei und Diät brauche.
Was sollte ich thun? Das unselige Ding in’s Krankenhaus schicken? Man hätte mich im ganzen Hause, im ganzen Viertel für einen Unmensch gehalten.
Ich behielt sie bei mir. Sie blieb sechs Wochen in meinem Bett liegen.
Das Kind gab ich in Pflege zu Bauern nach Poissy. Es kostet mich heute noch fünfzig Franks monatlich. Da ich nun mal zu Anfang bezahlt hatte, so bin ich jetzt genötigt bis an mein seliges Ende weiter zu blechen.
Und später wird es mich für seinen Vater halten.
Aber um das Pech voll zu machen, denkt euch, als das Mädchen wieder hergestellt ist, liebt es mich … liebt mich rasend, das Unglückswurm!
– Na und?