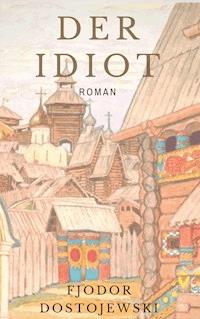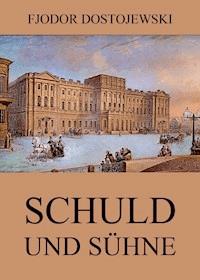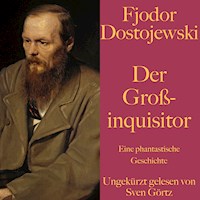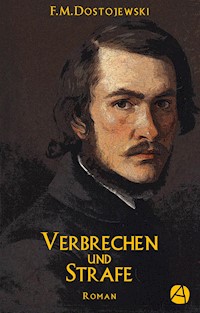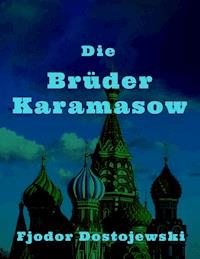10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verliebt in zwei Frauen.
Fürst Myschkin, von Epilepsie geplagt und für seine Naivität bekannt, wird von allen »der Idiot« genannt. Als er nach einem langen Sanatoriumsaufenthalt nach St. Petersburg zurückkehrt, wird der großmütige junge Fürst in eine Dreiecksgeschichte hineingezogen, aus der er nicht mehr herausfindet: Von nun an bestimmen ihn die Liebe zu Aglaja und das tiefe Mitleid mit Nastassja, in der er als Einziger nicht die Frau von zweifelhaftem Ruf, sondern den leidenden Menschen sieht. Myschkin ist Narr und Heiliger zugleich, ein Don Quijote der Liebe.
»Ist Dostojewski nicht immer aktuell, ja superlativistisch aktueller denn je?« Die Zeit.
»Ist Tolstoi der Michelangelo des Ostens, so darf man Dostojewski den Dante dieser Sphäre nennen.« Thomas Mann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1278
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Verliebt in zwei Frauen.
Fürst Myschkin, von Epilepsie geplagt und für seine Naivität bekannt, wird von allen »der Idiot« genannt. Als er nach einem langen Sanatoriumsaufenthalt nach Moskau zurückkehrt, wird der großmütige junge Fürst in eine Dreiecksgeschichte hineingezogen, aus der er nicht mehr herausfindet: Von nun an bestimmen ihn die Liebe zu Aglaja und das tiefe Mitleid mit Nastassja, in der er als Einziger nicht die Frau von zweifelhaftem Ruf, sondern den leidenden Menschen sieht. Myschkin ist Narr und Heiliger zugleich, ein Don Quijote der Liebe.
»Ist Dostojewski nicht immer aktuell, ja superlativistisch aktueller denn je?« Die Zeit.
»Ist Tolstoi der Michelangelo des Ostens, so darf man Dostojewski den Dante dieser Sphäre nennen.« Thomas Mann
Über Fjodor Dostojewski
Fjodor Dostojewski (1821–1881) wurde in Moskau als Sohn eines Militärarztes und einer Kaufmannstochter geboren. Er studierte an der Petersburger Ingenieurschule und widmete sich seit 1845 ganz dem Schreiben. 1849 wurde er als Mitglied eines frühsozialistischen Zirkels verhaftet und zum Tode verurteilt. Unmittelbar vor der Erschießung wandelte man das Urteil in vier Jahre Zwangsarbeit mit anschließendem Militärdienst als Gemeiner in Sibirien um. 1859 kehrte Dostojewski nach Petersburg zurück, wo er sich als Schriftsteller und verstärkt auch als Publizist neu positionierte.
Wichtigste Werke: »Arme Leute« (1845), »Der Doppelgänger« (1846), »Erniedrigte und Beleidigte« (1861), »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1862), »Schuld und Sühne« (1866), »Der Spieler« (1866), »Der Idiot« (1868), »Die Dämonen« (1872), »Der Jüngling« (1875), »Die Brüder Karamasow« (1880).
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Fjodor Dostojewski
Der Idiot
Roman in vier Teilen
Aus dem Russischen von Hartmut Herboth
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Vierter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12: Schluß
Anhang
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Vierter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12: Schluß
Anhang
Zu diesem Band
Anmerkungen
Impressum
Erster Teil
1
Ende November, bei spätherbstlichem Schneematschwetter, näherte sich gegen neun Uhr früh der Zug der Petersburg-Warschauer Eisenbahnlinie unter vollem Dampf seinem Zielbahnhof Petersburg. Es war so feucht und neblig, daß es gar nicht recht hell werden wollte; schon zehn Schritt rechts und links vom Bahndamm konnte man aus den Abteilfenstern kaum noch etwas unterscheiden. Einige der Reisenden kehrten aus dem Ausland zurück; doch dichter besetzt waren die Abteile der dritten Klasse, durchweg mit Kleinbürgern und allerlei Arbeitsvolk aus der Umgebung. Alle wirkten natürlicherweise verschlafen, die Nacht lastete noch auf den Lidern; alle fröstelten, auf den Gesichtern lag das fahle Blaßgelb des Nebels.
In einem Waggon dritter Klasse saßen sich seit dem Morgengrauen zwei Männer am Fenster gegenüber – beide jung, beide fast ohne Gepäck, beide wenig elegant gekleidet, doch von recht ansehnlichem Äußeren, und beide schließlich nicht abgeneigt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Hätten sie in diesem Augenblick um die ihnen eigenen Besonderheiten gewußt, wären sie gewiß erstaunt gewesen, daß der Zufall sie auf so seltsame Weise in einem Abteil dritter Klasse der Petersburg-Warschauer Eisenbahn vis-à-vis plaziert hatte. Der eine war von untersetzter Gestalt, etwa siebenundzwanzig Jahre alt, hatte lockiges, fast schwarzes Haar und kleine graue, aber feurige Augen. Seine Nase wirkte breit und platt zwischen kräftig ausgebildeten Backenknochen, um seine schmalen Lippen spielte ständig ein dreistes, spöttisches, ja boshaftes Lächeln, doch seine hohe, wohlgeformte Stirn milderte das Grobschlächtige der unteren Gesichtshälfte. Besonders fiel die Totenblässe auf; sie ließ das Antlitz des jungen Mannes, ungeachtet seiner sonst recht kräftigen Statur, wie ausgemergelt erscheinen und verlieh ihm zugleich den Ausdruck von geradezu quälender Leidenschaftlichkeit, die mit dem anmaßenden groben Lächeln und dem durchdringenden, selbstzufriedenen Blick durchaus nicht harmonierte. Der Mann trug warme Kleidung – einen weiten schwarzen Tuchmantel, mit gewöhnlichem Lammfell gefüttert –, ihm war in der Nacht gewiß nicht kalt gewesen wie seinem Gegenüber, der, auf solche Witterung offensichtlich nicht vorbereitet, mit frierendem Rücken sämtliche Annehmlichkeiten einer feuchten russischen Novembernacht ausgekostet hatte. Ihn schützte lediglich ein ziemlich weiter, grobgewebter Umhang mit mächtiger Kapuze, wie ihn Winterreisende im Ausland zu benutzen pflegen; in der Schweiz etwa oder in Norditalien, wo sie natürlich nicht mit solchen Strecken wie der von Eydtkuhnen nach Petersburg zu rechnen hatten. Was jedoch für Italien paßt und dort völlig ausreicht, erweist sich für Rußland als unzulänglich. Der Besitzer des Umhanges mit der Kapuze war ein junger Mann, ebenfalls sechs- oder siebenundzwanzig Jahre alt, wenig mehr als mittelgroß, mit dichtem, sehr blondem Haar, eingefallenen Wangen und geradezu weißem Spitzbart. Seine großen blauen Augen blickten aufmerksam; in ihnen lag etwas Stilles, doch auch Schweres; sie hatten jenen eigentümlichen Ausdruck, an dem manche sogleich den Fallsüchtigen erkennen. Im übrigen wirkte das Antlitz des jungen Mannes angenehm, es war schmal und hager, doch krankhaft blaß, ja in diesem Augenblick sogar fast blau vor Kälte. In den Händen hielt er ein aus einem alten verblichenen Seidentuch geknüpftes dürftiges Bündel, das offenbar sein gesamtes Reisegepäck darstellte. Seine Füße steckten in dickbesohlten Schuhen mit geknöpften Gamaschen darüber, beides nicht nach russischer Art. Der gegenübersitzende schwarzhaarige Mitreisende in dem Bauernpelz betrachtete dies alles, zum Teil wohl aus Langerweile, und fragte endlich mit jenem wenig zartfühlenden Lächeln, das mitunter rücksichtslos und unverhüllt die Befriedigung mancher Menschen über die Mißerfolge ihres Nächsten zeigt: »Ist Ihnen kalt?«
Dabei zog er selbst die Schultern zusammen.
»Sehr«, erwiderte der Reisegefährte äußerst bereitwillig. »Und wir haben doch Tauwetter, wie man sieht. Wie wäre das erst, wenn Frost herrschte? Mir war gar nicht in Erinnerung, daß es bei uns so kalt ist. Ich bin’s nicht mehr gewöhnt.«
»Sie kommen aus dem Ausland?«
»Ja, aus der Schweiz.«
»Sieh an! Was Sie nicht sagen.«
Der Schwarzhaarige stieß einen leisen Pfiff aus und lachte kurz auf.
Sie kamen ins Gespräch. Der weißblonde junge Mann im Schweizer Umhang gab seinem schwarzhaarigen Gegenüber mit erstaunlicher Bereitschaft Auskunft, ohne daß ihm auch nur im entferntesten die Geringschätzung auffiel, mit der dieser seine höchst unangebrachten und belanglosen Fragen stellte. So erzählte er unter anderem, er sei in der Tat lange nicht in Rußland gewesen, über vier Jahre nicht, da man ihn einer eigentümlichen Nervenkrankheit wegen, einer Art Epilepsie oder Veitstanz mit Zuckungen und Krämpfen, ins Ausland geschickt habe. Während des Berichts lächelte der Dunkle mehrmals, vor allem aber, als er auf die Frage: »Und sind Sie nun völlig geheilt?« die Antwort erhielt: »Nein, völlig nicht.«
»Nanu, dann haben Sie Ihr Geld also umsonst ausgegeben? Und wir setzen hier so großes Vertrauen in die ausländischen Ärzte«, bemerkte daraufhin der Schwarzhaarige höhnisch.
»Ja, das stimmt«, mischte sich ein neben ihm sitzender schlecht gekleideter Herr in das Gespräch, dem Aussehen nach ein im Dienst verknöcherter Beamter, etwa vierzig Jahre alt, stämmig, mit roter Nase und Pickeln im Gesicht. »Wahrhaftig, mein Herr, die wollen uns Russen bloß schröpfen.«
»Oh, da irren Sie sich in meinem Fall aber sehr«, widersprach der aus der Schweiz kommende Patient mit sanfter, friedfertiger Stimme. »Ich kann natürlich nicht streiten, da ich nicht so genau Bescheid weiß, doch der Arzt, bei dem ich in Behandlung war, hat mir von seinem letzten Geld noch die Fahrkarte hierher gekauft, nachdem ich dort fast zwei Jahre lang auf seine Kosten gelebt habe.«
»Wie denn, es mußte niemand für Sie bezahlen?« fragte der Schwarzhaarige.
»Nein. Herr Pawlistschew, der anfangs für meinen Unterhalt aufkam, ist vor zwei Jahren gestorben; ich habe daraufhin hierher an Frau Generalin Jepantschina geschrieben, eine entfernte Verwandte von mir, aber keine Antwort erhalten. So bin ich losgefahren.«
»Und wo wollen Sie hin?«
»Sie meinen, wo ich wohnen werde? Ja – das weiß ich eigentlich selbst noch nicht.«
»Das wissen Sie nicht?«
Beide Zuhörer lachten abermals.
»Enthält dieses Bündelchen etwa Ihre ganze Habe?« fragte der Schwarzhaarige.
»Darauf möchte ich wetten«, fiel mit höchst zufriedener Miene der rotnasige Beamte ein. »Und auch darauf, daß er nichts im Gepäckwagen hat. Obwohl Armut ja keine Schande ist, wie man dabei betonen muß.«
Seine Annahme erwies sich als richtig: Der weißblonde junge Mann bestätigte sie sogleich mit ungewöhnlicher Eilfertigkeit.
»Immerhin hat Ihr Bündel doch einiges Gewicht«, fuhr der Beamte fort, nachdem beide Mitreisende ausgiebig gelacht hatten. (Bemerkenswerterweise war der Besitzer des Bündels angesichts ihrer Heiterkeit am Ende in ihr Lachen eingefallen, was die anderen noch mehr amüsiert hatte.) »Zwar würde ich wetten, daß Sie keine Rollen ausländischer Goldstücke darin transportieren, etwa Napoleondore und Friedrichsdore oder holländische Dukaten, wie allein schon die Gamaschen über Ihren ausländischen Schuhen erkennen lassen, aber … wenn man sich bei seinem Anblick vor Augen hält, daß, wie Sie behaupten, eine Frau wie die Generalin Jepantschina mit Ihnen verwandt ist, dann wiegt es sogleich beträchtlich schwerer, vorausgesetzt natürlich, Ihre Angabe stimmt tatsächlich, und Sie bringen da nicht vielleicht aus Zerstreutheit etwas durcheinander, was ja Leuten mit, nun, sagen wir, mit zu reger Phantasie durchaus nicht selten widerfährt.«
»Oh, Sie haben es abermals getroffen«, bestätigte der weißblonde junge Mann sogleich. »Es war wohl in der Tat ein Irrtum von mir, das heißt, Frau Jepantschina und ich sind nur entfernt verwandt, so entfernt, daß ich eigentlich schon damals gar nicht erstaunt war, keine Antwort vor ihr zu bekommen. Ich hatte nichts anderes erwartet.«
»Das Geld für das Briefporto war zum Fenster hinausgeworfen. Hm, Sie sind zumindest ein treuherziger und aufrichtiger Mensch, und das ist löblich! Ja. Den General Jepantschin kenne ich, das heißt, den kennt jeder; ich kannte aber auch den verstorbenen Herrn Pawlistschew, der Ihren Aufenthalt in der Schweiz bezahlt hat, falls es sich um Nikolai Andrejewitsch Pawlistschew handelt, denn es gibt zwei Vettern dieses Familiennamens. Der andere lebt noch auf der Krim. Nikolai Andrejewitsch, der Verstorbene, war ein ehrbarer Mann mit guten Verbindungen, er nannte seinerzeit viertausend Seelen sein eigen.«
»Ganz recht, er hieß Nikolai Andrejewitsch Pawlistschew«, erwiderte der junge Mann, den Blick unverwandt und fragend auf den Herrn Alleswisser gerichtet.
Solche Herren findet man gelegentlich, ja sogar recht häufig, in einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht. Sie wissen alles; der unstete Forscherdrang ihres Hirns und all ihre Fähigkeiten zielen unabwendbar in eine Richtung, natürlich auf Kosten wichtigerer Lebensinteressen und -qualitäten, wie moderne Denker sich ausdrücken würden. Wenn wir sagen, sie wissen alles, so ist darunter im übrigen ein sehr beschränktes Gebiet zu verstehen, nämlich die Kenntnis, welchen Posten jemand bekleidet, mit wem er bekannt ist, auf welche Höhe sich sein Vermögen beläuft, wo er Gouverneur war, aus was für einer Familie seine Frau stammt und wieviel sie mit in die Ehe gebracht hat, wer seine Vettern und sonstigen ferneren Verwandten sind und so weiter und so fort in dieser Art. Die meisten dieser Alleswisser laufen mit abgewetzten Ellbogen herum und beziehen ein Gehalt von siebzehn Rubel im Monat. Von den Leuten, deren Leben sie in allen Einzelheiten ergründen, vermag sich natürlich niemand vorzustellen, was sie zu solchem Tun treibt, aber vielen von ihnen vermitteln diese einer Wissenschaft gleichkommenden Kenntnisse effektiv Trost, Selbstachtung und sogar tiefsten Seelenfrieden. Und es handelt sich hier in der Tat um eine Wissenschaft, noch dazu um eine sehr verlockende. Ich kenne Gelehrte, Literaten, Dichter und Politiker, denen diese Wissenschaft innigste Befriedigung und das erstrebenswerteste Ziel bot oder noch bietet, ja die einzig durch sie Karriere gemacht haben. Der schwarzhaarige junge Mann gähnte mehrfach während dieses Gesprächs, er schaute ziellos aus dem Fenster und wartete offensichtlich voller Ungeduld auf das Ende der Fahrt. Er wirkte reichlich zerstreut, ja erregt und sogar sonderbar: Manchmal hörte er nur scheinbar zu, oder er betrachtete die anderen, ohne sie zu sehen; dann wieder lachte er und wußte im nächsten Augenblick nicht mehr, warum.
»Erlauben Sie, mit wem habe ich eigentlich die Ehre?« fragte der picklige Herr unvermittelt den blonden jungen Mann mit dem Bündel.
»Ich bin Fürst Lew Nikolajewitsch Myschkin«, erwiderte dieser entgegenkommend und ohne im geringsten zu zögern.
»Fürst Myschkin? Lew Nikolajewitsch? Den Namen kenne ich nicht, werter Herr. Er ist mir noch nie zu Ohren gekommen«, versetzte der Beamte nachdenklich. »Das heißt, ich meine nicht den Familiennamen, der ist ja historisch und steht zu Recht in Karamsins ›Geschichte‹, aber eine solche Person … Zudem gibt es doch gar keine Fürsten Myschkin mehr, man hört nicht mal von ihnen.«
»Ja, ganz recht«, antwortete der Fürst sogleich. »Es gibt keinen Fürsten Myschkin mehr außer mir, ich bin wohl der letzte. Meine Vorväter waren immer nur Einhofbauern, mein Vater allerdings hatte eine Junkerschule besucht und diente als Leutnant in der Armee. Eigentlich weiß ich gar nicht, wieso auch die Generalin Jepantschina von den Fürsten Myschkin abstammen soll, sie müßte ja dann ebenfalls so ziemlich das letzte Licht sein.«
»Hehehe! Das letzte Licht! Hehe! Wie Sie das formuliert haben!« sagte der Beamte kichernd.
Auch der Schwarzhaarige lachte. Der Blonde wunderte sich selbst ein wenig, daß er ein solches, allerdings recht gehässiges, Bonmot zustande gebracht hatte.
»Ob Sie’s glauben oder nicht, ich habe das völlig ohne Hintergedanken gesagt«, erklärte er schließlich verblüfft.
»Oh, das glaube ich, das glaube ich«, versicherte ihm der Beamte amüsiert.
»Haben Sie sich dort bei Ihrem Professor auch mit den Wissenschaften befassen können?« fragte der Schwarze unvermittelt.
»Ja, doch, das konnte ich.«
»Ich für mein Teil habe mich nie mit den Wissenschaften befaßt.«
»Na ja, ich habe es auch nur hin und wieder getan«, fügte der Fürst wie zu seiner Entschuldigung hinzu. »Man meinte, ich tauge meiner Krankheit wegen nicht für ein systematisches Studium.«
»Kennen Sie die Rogoshins?« fragte der Schwarze plötzlich.
»Nein, gar nicht. Ich kenne in Rußland nur sehr wenig Leute. Heißen Sie Rogoshin?«
»Ja. Parfen Rogoshin.«
»Parfen? Doch nicht einer der Rogoshins …«, begann der Beamte betont wichtig.
»Ja, genau«, unterbrach ihn der Schwarze schroff und ungehalten. Er hatte im übrigen noch kein einziges Wort an den pickligen Beamten gerichtet, sondern bisher immer nur mit dem Fürsten geredet.
»Ist das denn die Möglichkeit!« Der Beamte erstarrte förmlich zur Salzsäule vor Staunen, seine Augen traten fast aus den Höhlen, und sein Gesicht nahm plötzlich einen ehrfurchtsvollen und unterwürfigen, ja erschrockenen Ausdruck an. »Demnach sind Sie ein Sohn des vor einem Monat verstorbenen, mit dem erblichen Ehrenbürgertitel ausgezeichneten Semjon Parfenowitsch Rogoshin, der zweieinhalb Millionen hinterlassen hat?«
»Woher weißt du denn, daß es zweieinhalb Millionen sind?« fiel ihm der Schwarze abermals ins Wort, wiederum ohne ihn anzusehen. »Also dieser Kerl …« (Er deutete, dem Fürsten zugewandt, mit den Augen auf den Beamten.) »Was haben diese Leute bloß davon, wenn sie einem sofort wie ein Schatten nachrennen? Es stimmt, mein Vater ist gestorben, und ich kehre jetzt, nach einem Monat, sozusagen fast ohne Stiefel von Pskow nach Hause zurück. Weder mein Bruder, der Schuft, noch meine Mutter haben mir Geld oder auch nur eine Nachricht geschickt – nichts, als wäre ich ein Hund. Ich habe in Pskow einen ganzen Monat mit Fieber im Bett gelegen.«
»Dafür können Sie jetzt über eine Million auf einmal in Empfang nehmen. Mindestens! O Gott!« rief der Beamte und klatschte in die Hände.
»Was geht denn ihn das an, sagen Sie mir bitte mal?« Rogoshin deutete abermals gereizt und böse mit dem Kopf auf den Beamten. »Dir gebe ich sowieso keine Kopeke davon ab, da kannst du dich hier vor mir auf den Kopf stellen.«
»Das mache ich, das mache ich!«
»Dacht ich mir’s. Aber du kriegst nichts, absolut nichts, und wenn du mir eine Woche lang was vortanzt.«
»Nun ja doch, ich will auch nichts, es steht mir ja gar nichts zu! Aber ich tanze trotzdem. Ich verlasse Frau und Kinder, um vor dir zu tanzen. Man muß immer mal jemanden anhimmeln, ja, das muß man.«
»Pfui über dich!« Der Schwarze spuckte aus und wandte sich an den Fürsten. »Vor fünf Wochen bin ich mit ebenso einem Bündelchen wie dem Ihren vor meinem Vater zu meiner Tante nach Pskow geflohen; dort packte mich das Fieber, ich mußte mich hinlegen, und so ist er ohne mich gestorben. Am Schlagfluß. Ehre seinem Andenken, obwohl er mich fast zu Tode geprügelt hat. Glauben Sie es mir, Fürst, um Gottes willen! Wäre ich nicht geflohen, er hätte mich glatt umgebracht.«
»Hatten Sie ihn denn so verärgert?« erkundigte sich der Fürst, während er den Millionär im Bauernpelz mit besonderer Neugier musterte. Der Mann war ja allein schon als künftiger Besitzer einer Million wie überhaupt als Erbschaftsempfänger eine Sehenswürdigkeit, und doch verwunderte und beschäftigte den Fürsten noch etwas anderes; zudem verlangte es offensichtlich auch Rogoshin nach einer Unterhaltung mit dem Fürsten, wobei es ihm allerdings wohl mehr um eine Plauderei mechanischer als moralisierender Art ging, um ein Gespräch eher aus einer Geistesabwesenheit heraus als aus schlichtem Mitteilungsbedürfnis, Sorge oder Unruhe, das heißt, es ging ihm einfach um einen Partner, den er ansehen konnte, während seine Zunge Worte formte. Er schien noch immer im Fieberwahn oder zumindest in einer fiebrigen Zerstreutheit befangen. Der Beamte aber hing förmlich an ihm; fast ohne zu atmen, erlauschte und wog er jedes Wort, als prüfe er einen Brillanten.
»Nun ja, verärgert war er, und vielleicht zu Recht«, erwiderte Rogoshin. »Doch am übelsten hat mir mein Bruder mitgespielt. Über meine Mutter kann ich nichts sagen, sie ist eine alte Frau, liest ihre Heiligenleben, hockt mit ihren greisen Weibern zusammen, und was das liebe Brüderchen Semjon anordnet, das wird gemacht. Aber er, warum hat er mich nicht rechtzeitig benachrichtigt? Keine Frage! Sicher, ich war zu der Zeit nicht bei Besinnung. Sie sagen auch, es sei ein Telegramm an mich abgegangen. Meine Tante hat in der Zeit tatsächlich eins bekommen. Aber sie ist seit dreißig Jahren Witwe und von früh bis spät immer nur mit lauter schwachsinnigen Betschwestern zusammen wie eine Nonne oder noch schlimmer. Vor Telegrammen hat sie solche Angst, daß sie auch dieses sofort ungeöffnet zur Polizei brachte, und da liegt es bis heute. Erst Konew, Wassili Wassiljitsch, hat mich erlöst und mir alles geschrieben. Mein Bruder hat in der Nacht von der Brokatdecke über dem Sarg meines Vaters die goldenen Quasten abgeschnitten, denn die kosten ja eine Menge Geld. Allein dafür würde er nach Sibirien kommen, wenn ich wollte, denn so was ist Leichenschändung. – He, du närrisches Schreckgespenst«, er wandte sich an den Beamten, »ist das Leichenschändung nach dem Gesetz?«
»Unbedingt, unbedingt!« bekräftigte der Beamte sofort.
»Kommt man dafür nach Sibirien?«
»Aber ja, auf der Stelle!«
»Meine Leute vermuten mich noch im Bett«, erzählte Rogoshin dem Fürsten weiter, »aber ich habe mich, ohne ihnen ein Wort zu schreiben, kurzerhand auf die Bahn gesetzt, noch halb krank; nun fahre ich hin, und mein Brüderchen Semjon Semjonytsch wird mir die Tür öffnen. Er hat mich bei unserem seligen Vater angeschwärzt, das weiß ich. Aber daß ich meinen alten Herrn tatsächlich erzürnt habe, und zwar durch die Sache mit Nastassja Filippowna, das ist nun mal wahr. Daran trage ich allein die Schuld. Der Teufel hat mich geritten.«
»Nastassja Filippowna?« murmelte der Beamte unterwürfig und zögernd, als überlege er.
»Die kennst du aber nun wirklich nicht!« schrie Rogoshin ungehalten.
»Oh, und ob!« erwiderte der Beamte triumphierend.
»Was nicht gar! Es gibt viele Nastassja Filippownas! Du bist ein ganz unverschämtes Subjekt, sage ich dir! – Ich hab’s doch gewußt, daß sich gleich einer von dieser Sorte an mich hängen würde.« Er hatte sich wieder dem Fürsten zugewandt.
»Und ich kenne sie doch!« beharrte der Beamte. »Lebedew weiß Bescheid! Euer Hochwohlgeboren geruhen an mir zu zweifeln, aber wie, wenn ich den Beweis antrete? Es handelt sich ja wohl um eben die Nastassja Filippowna, deretwegen Ihr Herr Vater Sie mit Hilfe einer Haselrute Mores lehren wollte, das heißt um Nastassja Filippowna Baraschkowa, sozusagen eine vornehme Dame und auf ihre Art ebenfalls eine Fürstin, die mit einem gewissen Tozki, Afanassi Iwanowitsch, liiert ist, und zwar nur mit ihm, einem Gutsbesitzer und Finanzmagnaten, Mitglied mehrerer Kompanien und Gesellschaften, weswegen ihn eine enge Freundschaft mit dem General Jepantschin verbindet.«
»Also hör sich das einer an!« rief Rogoshin, jetzt ehrlich erstaunt. »Beim Satan, er weiß wirklich Bescheid.«
»Aber ja. Lebedew ist über alles informiert. Ich habe seinerzeit auch Alexaschka Lichatschow zwei Monate lang begleitet, Euer Hochwohlgeboren, ebenfalls nach dem Ableben seines Vaters, und kenne buchstäblich alle Winkel und Gassen, ja es kam so weit, daß er ohne Lebedew keinen Schritt mehr tun konnte. Jetzt sitzt er im Schuldgefängnis, doch durch ihn habe ich damals sowohl die Damen Armance und Corallie als auch die Fürstin Pazkaja und Nastassja Filippowna kennengelernt und überhaupt vieles erfahren.«
»Nastassja Filippowna? Hat die denn mit Lichatschow …« Rogoshin funkelte ihn böse an, seine Lippen wurden bleich und zitterten.
»O nein, nein, ganz bestimmt nicht«, erwiderte der Beamte hastig, sich rasch besinnend. »Bei der kam Lichatschow trotz seinem vielen Geld nicht an. Nein, sie ist nicht so eine wie Armance. Für sie gibt es nur Tozki. Des Abends sitzt sie im Bolschoi oder im Französischen Theater allein in ihrer Loge. Die Offiziere hecheln ja unter sich so ziemlich alle durch, aber ihr können sie nichts beweisen. ›Sieh mal die dort, das ist Nastassja Filippowna!‹ heißt es, und dabei bleibt’s, mehr gibt es nicht zu tuscheln, weil einfach nichts vorliegt.«
»Ja, genauso ist es«, bestätigte Rogoshin düster mit gerunzelter Stirn. »Dasselbe hat mir auch Saljoshew gesagt. Ich lief in einem schrecklich altmodischen Überrock meines Vaters über den Newski-Prospekt, da trat sie aus einem Geschäft und stieg in ihre Kutsche. In mir brannte es sogleich lichterloh. Wenig später traf ich Saljoshew, der war von einer anderen Sorte als ich, geschniegelt wie ein Friseurgehilfe, ein Monokel im Auge, während wir unter dem strengen Regime meines Vaters in geschmierten Stiefeln gingen und Kohlsuppe aßen. ›Die ist nichts für dich‹, sagte er, ›das ist eine Fürstin, sie heißt Nastassja Filippowna, mit Familiennamen Baraschkowa, und lebt mit Tozki. Der will sie allerdings jetzt loswerden, er weiß nur nicht, wie, denn er hat inzwischen sozusagen ein solides Alter erreicht, fünfundfünfzig, und möchte sich mit der schönsten Frau von ganz Petersburg verheiraten.‹ Immerhin gab er mir den Wink, daß ich Nastassja Filippowna am Abend im Bolschoi-Theater bei einer Ballettaufführung sehen könne, wo sie in ihrer vorgewölbten Parterreloge sitzen werde. Ein Ballettbesuch war unter unseren häuslichen Verhältnissen undenkbar – mein Vater hätte mich glatt erschlagen. Trotzdem schlich ich mich für eine Stunde heimlich weg und sah Nastassja Filippowna tatsächlich wieder; danach konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Am Morgen gab mir der Selige zwei fünfprozentige Kreditscheine zu je fünftausend, die ich einlösen sollte. ›Mit dem Geld gehst du zu Andrejew ins Kontor und zahlst an ihn siebentausendfünfhundert‹, befahl er, ›den Rest bringst du mir umgehend hierher, ich warte auf dich.‹ Ich ließ mir die Summe auszahlen, ging aber nicht zu Andrejew, sondern geradenwegs in das englische Juweliergeschäft und kaufte dort für die gesamte Barschaft zwei Ohrgehänge, jedes mit einem fast walnußgroßen Brillanten. Vierhundert Rubel mußte ich sogar noch schuldig bleiben; ich nannte meinen Namen, und man glaubte mir. Dann lief ich damit zu Saljoshew: So und so ist die Lage, sagte ich, geh mit mir zu Nastassja Filippowna, Bruder. Wir machten uns auf den Weg. Wohin meine Füße traten, was um mich herum geschah – ich weiß es nicht, es ist mir nicht in Erinnerung. Auf einmal standen wir in ihrem Salon, und sie kam herein. Ich gab nicht zu erkennen, daß ich es war, der zu ihr wollte, sondern Saljoshew sagte: ›Das ist von Parfen Rogoshin, zur Erinnerung an seine gestrige Begegnung mit Ihnen.‹ Sie öffnete das Etui, warf einen Blick hinein und erwiderte lächelnd: ›Danken Sie Ihrem Freund, Herrn Rogoshin, für seine liebenswürdige Aufmerksamkeit.‹ Darauf verabschiedete sie sich und ging hinaus. Ich wäre am liebsten auf der Stelle gestorben vor Scham. Wenn ich dennoch wegging, so nur, weil ich dachte: Es ist schon alles gleich, hier komme ich ja doch im Leben nie wieder her! Am meisten ärgerte ich mich darüber, daß Saljoshew, dieser Schurke, sich so wichtig getan hatte. Ich bin nicht sehr groß, war zudem gekleidet wie ein Laufbursche und hatte ihr aus lauter Verlegenheit nur schweigend in die Augen gestarrt, er dagegen, ausstaffiert nach der letzten Mode, das ondulierte Haar mit Pomade gestriegelt, mit roten Wangen, ein kariertes Krawattentuch um den Hals, er war fast zerflossen vor Liebedienerei, so daß sie wahrscheinlich sofort ihn für die Hauptperson gehalten hatte. ›Hör zu‹, sagte ich, als wir rausgingen, ›laß dir ja nicht noch mal einfallen, für mich auch nur zu denken, verstanden?‹ Er entgegnete lachend: ›Und wie willst du dich vor Semjon Parfenytsch rechtfertigen?‹ Ich war in der Tat drauf und dran, ins Wasser zu gehen anstatt zurück zu meinem Vater, aber ich dachte: Nun ist schon alles egal! und schlich wie ein armer Sünder nach Hause.«
»Oje, oje!« rief der Beamte mit dem Ausdruck des Entsetzens, ja am ganzen Leibe zitternd. »Der Selige war imstande, jemanden schon wegen zehn Rubel die Hölle heiß zu machen, geschweige denn wegen zehntausend!« erklärte er dem Fürsten, ihm zunickend. Der Fürst betrachtete Rogoshin gespannt, der ihm in diesem Augenblick noch blasser vorkam.
»So, meinst du?« sagte Rogoshin. »Du mußt es ja wissen.« Und zum Fürsten gewandt, berichtete er weiter: »Mein Vater erfuhr alles zur selben Stunde, Saljoshew erzählte es ja brühwarm jedem, den er traf. Er nahm mich mit nach oben, schloß uns in ein Zimmer ein und gab’s mir eine ganze Stunde lang. ›Das ist nur zur Vorbereitung‹, verkündete er, ›ich komme nachher noch, dir gute Nacht zu sagen.‹ Und was glauben Sie? Er fuhr trotz seiner grauen Haare zu Nastassja Filippowna, verbeugte sich vor ihr bis zur Erde, flehte und greinte, bis sie am Ende das Etui holte und es ihm vor die Füße warf. ›Hier hast du deine Ohrgehänge, du alter Knasterbart‹, sagte sie. ›Für mich sind sie jetzt zehnmal so viel wert, seit ich weiß, unter welcher Schreckensherrschaft Parfen sie beschafft hat. Bestelle Parfen Semjonytsch meinen Gruß und meinen Dank.‹ Indessen hatte ich mir mit dem Segen meiner Mutter bei Serjoshka Protuschin zwanzig Rubel geliehen und mich per Bahn nach Pskow davongemacht, wo ich wie im Fieber ankam. Dort setzten mir die alten Weiber mit ihren Heiligen zu, ich saß da, völlig benommen, und schließlich zog ich mit meinem letzten Geld durch die Kneipen; danach lag ich die ganze Nacht besinnungslos auf der Straße, so daß ich am Morgen erst richtig das Fieber kriegte, zudem hatten mich auch noch die Hunde angefressen. Mit knapper Not kam ich wieder zu mir.«
»Na, dafür wird uns Nastassja Filippowna von nun an mit Kußhand empfangen!« Der Beamte kicherte und rieb sich die Hände. »Was bedeuten jetzt diese Ohrgehänge, Herr! Jetzt können wir ihr ganz andere bieten.«
»Und dir sage ich eins: Wenn du noch ein einziges Wort über Nastassja Filippowna äußerst, dann verprügele ich dich, bei Gott, auch wenn du Lichatschows rechte Hand warst«, schrie Rogoshin und packte ihn heftig am Arm.
»Oh, schlagen Sie mich nur, denn das bedeutet, daß Sie mich nicht von sich stoßen! Schlagen Sie mich und besiegeln Sie damit … Aber ich sehe, wir sind da.«
In der Tat fuhr der Zug eben in den Bahnhof ein. Rogoshin hatte zwar gesagt, es wisse niemand von seinem Kommen, aber er wurde von mehreren Leuten erwartet. Sie riefen etwas und winkten ihm mit ihren Hüten zu.
»Sieh an, Saljoshew ist auch da«, murmelte Rogoshin, während er die Gruppe mit einem triumphierenden, wenn nicht gar boshaften Lächeln betrachtete. Plötzlich drehte er sich zu dem Fürsten um. »Ich weiß nicht, wieso, Fürst, doch du gefällst mir. Vielleicht weil ich dir in einem solchen Augenblick begegnet bin – aber das gilt ja für den da auch«, er deutete auf Lebedew, »und der gefällt mir nicht. Besuch mich doch mal, Fürst. Wir ziehen dir diese komischen Gamaschen aus, ich kaufe dir einen erstklassigen Marderpelz, lasse dir einen hocheleganten Frack nähen und eine weiße Weste oder was immer für eine du willst, stopfe dir die Taschen voll Geld, und dann … dann fahren wir zusammen zu Nastassja Filippowna! Kommst du?«
»Tun Sie es, Fürst Lew Nikolajewitsch!« fiel Lebedew beschwörend und feierlich ein. »Um Himmels willen, lassen Sie sich das nicht entgehen!«
Fürst Myschkin erhob sich, streckte Rogoshin höflich die Hand entgegen und erwiderte liebenswürdig: »Ich nehme Ihre Einladung mit dem größten Vergnügen an, und ich danke Ihnen sehr, daß Sie Gefallen an mir gefunden haben. Vielleicht komme ich schon heute, wenn ich es schaffe. Denn auch ich, das sage ich ganz aufrichtig, auch ich bin sehr von Ihnen angetan; besonders seit Sie mir Ihre Geschichte mit den Brillantohrgehängen erzählt haben. Doch ich war es auch schon vorher, trotz Ihrer düsteren Miene. Ich danke Ihnen auch für Ihr Anerbieten, mich einzukleiden, denn ich werde einen Anzug und einen Pelz in der Tat bald nötig haben, und im Augenblick besitze ich kaum eine Kopeke.«
»Ich kriege ja Geld, heute abend habe ich was, komm nur.«
»Geld wird genügend da sein«, fiel der Beamte ein. »Schon heute abend, noch ehe es dunkel wird.«
»Wie halten Sie es eigentlich mit den Frauen, Fürst? Sind Sie da sehr zugänglich? Dann sagen Sie es mir vorher.«
»Ich? Ach nein, nein. Ich bin doch … Sie wissen vielleicht nicht, daß mir meiner angeborenen Krankheit wegen Frauen überhaupt versagt sind.«
»Nun, wenn es so ist«, rief Rogoshin, »dann bist du ja wahrhaftig der rechte Narr in Christo, und solche liebt Gott.«
»Ja, solche liebt Gott«, echote der Beamte.
»Und du komm mit mir, du Schreiberseele«, sagte Rogoshin zu Lebedew, worauf alle drei das Abteil verließen.
So hatte Lebedew am Ende doch sein Ziel erreicht. Die lärmende Schar entfernte sich bald in Richtung Wosnessenski-Prospekt. Der Fürst mußte zur Litejnaja. Die Luft war kalt und feucht. Passanten erklärten ihm auf seine Frage, daß er etwa drei Werst Weges vor sich habe, worauf er beschloß, eine Droschke zu nehmen.
2
General Jepantschin wohnte im eigenen Haus, etwas abseits von der Litejnaja nahe der Preobrashenski-Kathedrale. Außer diesem (sehr schönen) Gebäude, von dem er fünf Sechstel vermietete, besaß der General noch ein sehr großes an der Sadowaja, das ihm ebenfalls beträchtliche Einkünfte brachte. Zudem nannte er ein gewinnträchtiges stattliches Landgut unmittelbar vor den Toren Petersburgs sowie eine Fabrik in der weiteren Umgebung sein eigen. Vor Zeiten war er, wie jedermann wußte, ein Steuerpächter gewesen, heute hatte er Sitz und maßgebliche Stimme in mehreren soliden Aktiengesellschaften. Er galt als ein Mann mit großem Vermögen, vielerlei Tätigkeiten und weitreichenden Verbindungen. Mancherorts hatte er sich völlig unentbehrlich zu machen verstanden, unter anderem auch in seiner eigentlichen Dienststelle. Dabei war bekannt, daß Iwan Fjodorowitsch Jepantschin keine höhere Bildung genossen hatte und von einem Soldaten abstammte; letzteres konnte ihm freilich nur zur Ehre gereichen, aber er hatte, wenngleich ein kluger Mann, doch auch seine kleinen, durchaus verzeihlichen Schwächen und schätzte gewisse Anspielungen nicht. Intelligent und gewandt war er jedoch ohne Zweifel. So verstand er es zum Beispiel auf eine eigene Art, sich nicht in den Vordergrund zu spielen, sondern dort, wo es nötig schien, Zurückhaltung zu üben, und manch einer schätzte an ihm eben diese Bescheidenheit, das heißt die Tatsache, daß er stets seinen Platz kannte. Indes hätten diese Richter erst mal wissen sollen, was mitunter in Iwan Fjodorowitsch vorging, der so gut seine Grenzen wahrte! Er besaß zwar in der Tat praktische Kenntnisse, Lebenserfahrung wie auch einige bemerkenswerte Fähigkeiten, führte aber lieber anderer Leute Ideen aus, als daß er eigene Klugheit zeigte, das heißt, er fühlte sich gern als »aufrechter Getreuer« und – was doch die Zeit alles bewirkt – als Russe von echtem Schrot und Korn. In letzterer Hinsicht stießen ihm sogar mancherlei lustige Geschichten zu, aber deshalb verzagte er nie, selbst in den komischsten Situationen nicht; zudem war ihm das Glück durchaus hold, selbst beim Kartenspiel, eine Neigung, die er mit ziemlich hohen Einsätzen betrieb und auch keineswegs als ein kleines Laster zu verbergen trachtete, sondern eher herausstellte, da sie ihm in vielen Fällen beträchtlichen Vorteil brachte. Die Gesellschaft, in der er sich bewegte, war gemischt, doch gehörten ihr natürlich stets nur »Asse« an. Im übrigen lag ja noch alles vor ihm – die Zeit ist geduldig, und für jedes Ereignis kommt einmal der rechte Augenblick. Auch stand General Jepantschin, wie man so sagt, in den besten Mannesjahren: Er war sechsundfünfzig, kein bißchen darüber, und das ist jedenfalls ein blühendes Alter, in dem, nach heutiger Auffassung, das wahre Leben erst anfängt. Seine gute Gesundheit, seine Gesichtsfarbe, sein kräftiges, wenn auch schwarzes Gebiß, sein stämmiger, kompakter Körper und seine des Morgens im Dienst geschäftige, des Abends beim Kartenspiel oder bei Seiner Durchlaucht unbeschwerte Miene, dies alles schien ein Unterpfand für derzeitige und künftige Erfolge sowie dafür zu sein, daß der Lebensweg Seiner Exzellenz mit Rosen bestreut blieb.
Seine Familie gedieh aufs beste. Gewiß blühten für ihn in dieser Hinsicht nicht ausschließlich Rosen, aber er sah doch vieles sich so gestalten, wie er es seit langem ernsthaft, von ganzem Herzen erhofft und erstrebt hatte. Was könnte auch gewichtiger und heiliger im Leben sein als die Ziele eines fürsorglichen Vaters? Woran soll man sich halten, wenn nicht an seine Familie? Die des Generals bestand aus seiner Gattin und drei erwachsenen Töchtern. Jepantschin hatte sehr früh, noch als Leutnant, eine fast Gleichaltrige geheiratet, die weder Schönheit noch Bildung besaß und ihm alles in allem nur fünfzig Seelen mit in die Ehe brachte – immerhin aber bildete diese Mitgift den Grundstock für sein ferneres Glück. Er murrte in der Folgezeit niemals über seine frühe Heirat und betrachtete sie auch nie als ein Produkt unbedachten jugendlichen Überschwangs, vielmehr empfand er vor seiner Frau so viel Hochachtung und manchmal auch Furcht, daß er sie am Ende sogar liebte. Die Generalin stammte aus dem nicht gerade glänzenden, aber sehr alten Fürstengeschlecht der Myschkins, eine Herkunft, auf die sie sich nicht wenig zugute tat. Seinerzeit hatte sich eine damals einflußreiche Persönlichkeit, ein Gönner von der nur ohne Geldausgaben zu einem Patronat bereiten Art, erboten, die Ehe der ledigen Fürstentochter zu betreiben. Er hatte dem jungen Offizier die Pforte geöffnet und ihn hineingeschoben, wenngleich dieser gar nicht eines solchen Anstoßes, sondern vielleicht nur eines Blickes bedurft hätte, um seine Chance zu nutzen. Seither lebten die Ehegatten jeweils bis zum nächsten Jubiläum mit geringen Ausnahmen in Eintracht zusammen. Die Generalin hatte es schon in sehr jungen Jahren verstanden – vielleicht als geborene Fürstin und letzte ihres Geschlechts, vielleicht auch persönlicher Qualitäten wegen –, sich einige sehr hohe Gönnerinnen zu schaffen. Später war sie dann zufolge des Reichtums und der Dienststellung ihres Gemahls in diesem hohen Kreise sogar selbst einigermaßen heimisch geworden.
In diesen letzten Jahren waren alle drei Töchter des Generals – Alexandra, Adelaida und Aglaja – herangewachsen und gereift. Sie trugen zwar nur den schlichten Namen Jepantschin, stammten aber doch mütterlicherseits aus fürstlicher Familie, durften mit einer ansehnlichen Mitgift rechnen, hatten einen Vater, der eines Tages vielleicht noch auf einen sehr hohen Posten aufrücken würde, und waren schließlich, was ebenfalls nicht wenig ins Gewicht fiel, alle drei bemerkenswert hübsch, selbst Alexandra, die älteste, die immerhin schon fünfundzwanzig Jahre zählte. Die mittlere war dreiundzwanzig, die jüngste, Aglaja, gerade erst zwanzig. Diese jüngste Tochter wuchs sogar mehr und mehr zu einer ausgesprochenen Schönheit heran, als die sie auch in der Öffentlichkeit bereits großes Aufsehen erregte. Doch damit waren die Vorzüge der Jepantschinmädchen nicht erschöpft: Alle drei zeichneten sich überdies durch Bildung, Klugheit und Talent aus. Man wußte, daß sie einander herzlich liebten und eine die andere unterstützte. Es hieß sogar, daß sich die beiden älteren zugunsten der jüngsten, des gemeinsamen Idols der Familie, geradezu aufopferten. In Gesellschaft taten sich alle drei nicht gern hervor, ja sie gaben sich fast übertrieben zurückhaltend. Niemand konnte ihnen Hochmut und Anmaßung nachsagen, obwohl sie Selbstbewußtsein zeigten und offensichtlich ihren Wert kannten. Die Älteste musizierte, die Mittlere leistete Beachtliches als Malerin, doch davon wußte viele Jahre lang kaum jemand, es war erst in der allerletzten Zeit ans Licht gekommen, und auch nur durch einen Zufall. Mit einem Wort, man hörte über sie sehr viel Lobendes. Aber es ließen sich auch Mißgünstige vernehmen. Manche redeten besorgt davon, daß die Jepantschintöchter zu viele Bücher gelesen hätten. Mit dem Heiraten hatten alle drei es nicht eilig; es war ihnen zwar wohl um eine Stellung in der Gesellschaft zu tun, aber sie lechzten auch nicht gerade danach. Das fiel um so mehr auf, als jedermann die Denkart, den Charakter, die Ziele und die Wünsche ihres Vaters kannte.
Es war schon etwa elf Uhr, als der Fürst an der Tür des Generals läutete. Der General bewohnte die erste Etage, deren Räume er tunlichst bescheiden, wenn auch seinem Rang entsprechend eingerichtet hatte. Ein livrierter Diener öffnete. Er musterte den Fürsten und dessen Bündel sofort argwöhnisch, so daß dieser lange auf ihn einreden mußte. Erst nach der mehrfachen kategorischen Erklärung, daß er in der Tat Fürst Myschkin sei und in einer wichtigen Angelegenheit unbedingt den General sprechen müsse, führte ihn der befremdete Lakai, ohne von seiner Seite zu weichen, in eine kleine Diele vor dem Empfangszimmer beim Arbeitsraum des Generals, wo er ihn einem anderen Diener überließ, welcher des Morgens in ebendieser Diele auf Besucher zu warten und sie zu melden hatte. Dieser zweite, ein über vierzig Jahre alter Mann im Frack mit geschäftiger Miene, war der spezielle Kabinettsdiener und Besucheranmelder Seiner Exzellenz und sich in dieser Eigenschaft seiner Wichtigkeit wohl bewußt.
»Warten Sie nebenan im Empfangszimmer, aber dieses Bündel lassen Sie hier«, sprach er, während er sich gemächlich und hoheitsvoll in seinem Sessel zurechtsetzte und mit erstauntem strengem Blick den Fürsten maß, der sich ohne Umstände neben ihn auf einen Stuhl niedergelassen hatte, sein Bündel in den Händen.
»Wenn Sie erlauben«, erwiderte der Fürst, »warte ich lieber hier bei Ihnen. Was soll ich da drüben allein?«
»Hier im Vorzimmer können Sie nicht bleiben, weil Sie ein Besucher sind, also ein Gast. Wollen Sie zum General persönlich?«
Der Mann war offenbar im Zweifel, ob er den merkwürdigen Fremden einlassen durfte, und wollte ihn daher noch einmal befragen.
»Ja, ich habe ein Anliegen«, begann der Fürst.
»Das geht mich nichts an, meine Sache ist es lediglich, Sie zu melden. Und das, fürchte ich, kann ich ohne Zustimmung des Sekretärs nicht tun.«
Das Mißtrauen des Dieners schien mehr und mehr zu wachsen: Zu wenig paßte der Fürst in das Bild der sonst üblichen Besucher, obwohl der General oft genug, ja eigentlich fast täglich, zur festgesetzten Empfangsstunde von manchmal sehr unterschiedlichen Leuten heimgesucht wurde, vor allem solchen mit einem Anliegen, trotz des gewohnten Anblicks aber und der ziemlich weitgefaßten Instruktionen hegte der Diener in diesem Falle große Zweifel, so daß er die Vermittlung durch den Sekretär für unumgänglich hielt.
»Sind Sie wirklich … Waren Sie wirklich bis jetzt im Ausland?« begann er nach einer Weile offenbar unbedacht, denn er stockte und korrigierte sich sogleich – sicherlich hatte er fragen wollen: Sind Sie wirklich Fürst Myschkin?
»Ja, ich komme geradewegs vom Bahnhof. Aber ich glaube, Sie wollten fragen, ob ich tatsächlich Fürst Myschkin bin, und haben es nur aus Höflichkeit nicht getan.«
»Hm«, brummte der Lakai verwundert.
»Ich versichere Ihnen, daß ich Sie nicht angelogen habe, es wird Sie niemand zur Verantwortung ziehen. Wenn ich in einem solchen Aufzug und mit einem Bündel in der Hand hier erscheine, so ist daran nichts Sonderbares: Meine Verhältnisse sind einfach zur Zeit nicht besser.«
»Hm. Ich fürchte nicht, daß ich mich verantworten muß, wissen Sie. Aber ich bin verpflichtet, alles zu melden, und dann wird der Sekretär zu Ihnen kommen, es sei denn … Ja, darum geht’s mir eben, um dieses ›es sei denn‹. Es führt Sie doch wohl nicht Ihre Armut zum General, falls es mir zukommt, das zu erfahren?«
»O nein, dessen können Sie völlig sicher sein. Es handelt sich um etwas anderes.«
»Verzeihen Sie, die Frage drängte sich mir auf, als ich Sie so ansah. Warten Sie auf den Sekretär; der General selbst ist eben mit einem Obersten beschäftigt, aber bald kommt der Sekretär … der von der Aktiengesellschaft.«
»Wenn es also noch eine Weile dauern wird, würden Sie mir dann sagen, ob man hier rauchen darf? Ich habe Pfeife und Tabak bei mir.«
»Rau-chen?« Der Diener warf dem Fürsten einen halb verächtlichen, halb verständnislosen Blick zu, als traue er seinen Ohren nicht. »Rauchen? Nein, das können Sie hier nicht, es sollte Ihnen peinlich sein, daran auch nur zu denken. Hm, das ist sonderbar, Herr.«
»Oh, ich dachte ja nicht an dieses Zimmer, hier geht es nicht, das weiß ich, aber vielleicht irgendwo draußen, wenn Sie mir da eine Stelle zeigen, denn ich bin es nun mal gewöhnt, und ich habe seit drei Stunden nicht geraucht. Im übrigen richte ich mich aber ganz nach Ihnen; Sie kennen ja das Sprichwort: Beharre in einem fremden Kloster nicht auf deinen eigenen Sitten.«
»Wie soll ich bloß einen Menschen wie Sie melden?« murmelte der Kammerdiener fast widerwillig. »Es gehört sich schon mal nicht, daß Sie sich hier aufhalten, Sie sollten im Empfangszimmer sitzen, weil Sie ja als Besucher kommen, also Gast sind – man wird mir Vorhaltungen machen. Haben Sie eigentlich die Absicht, bei uns zu wohnen?« fügte er mit einem weiteren schrägen Blick auf das Bündel des Fürsten hinzu, das ihm offensichtlich keine Ruhe ließ.
»Nein, daran denke ich nicht. Selbst wenn man mich dazu auffordern sollte, würde ich nicht bleiben. Ich will mich nur bekannt machen, weiter nichts.«
»Wie? Nur bekannt machen?« fragte der Kammerdiener erstaunt und mit verdreifachtem Argwohn. »Warum haben Sie denn vorhin gesagt, Sie hätten ein Anliegen?«
»Na ja, ein Anliegen direkt nicht. Das heißt, wenn Sie so wollen, dann habe ich schon eins – ich will um einen Rat bitten, aber vor allem möchte ich mich vorstellen, denn ich bin doch ein Fürst Myschkin, und die Generalin Jepantschina ist der letzte weibliche Sproß unseres Geschlechts, außer ihr und mir gibt es keine Myschkins mehr.«
»Dann sind Sie ja gar ein Verwandter?« erwiderte der Lakai, nun noch mehr erschrocken.
»Vielleicht, aber eher wohl nicht. Das heißt, genau betrachtet sind wir natürlich verwandt, aber so entfernt, daß man es eigentlich gar nicht mehr so nennen kann. Ich habe mich einmal aus dem Ausland brieflich an die Generalin gewandt, aber keine Antwort bekommen. Trotzdem hielt ich es für nötig, bei meiner Rückkehr die Beziehungen neu zu knüpfen. Ich erkläre Ihnen dies alles, um Ihre Zweifel zu zerstreuen, denn ich sehe, daß Sie sich noch immer Sorgen machen. Melden Sie getrost den Fürsten Myschkin, daraus wird der Grund meines Besuches schon ersichtlich. Empfängt mich der General, ist es gut, empfängt er mich nicht, ist es auch gut, vielleicht sogar noch besser. Aber ich denke, er kann mich gar nicht abweisen: Die Generalin wird natürlich den ältesten und einzigen Vertreter ihrer Sippe sehen wollen, zumal sie auf ihre Abstammung großen Wert legt, wie man mir genauestens berichtet hat.«
Dem Anschein nach befleißigte sich der Fürst einer höchst einfachen Redeweise, doch je schlichter er sprach, desto absonderlicher wirkte das in diesem Falle, und es war kein Wunder, daß der erfahrene Diener einen Ton herauszuhören glaubte, wie er für eine Unterhaltung zwischen zwei Lakaien, aber ganz und gar nicht zwischen einem Gast und einem Diener paßte. Da Dienstboten weit schlauer sind, als ihre Herrschaft gewöhnlich annimmt, kamen ihm sogleich zwei Möglichkeiten in den Sinn: Dieser Fürst war entweder ein Strolch, der sich was ergaunern wollte, oder einfach ein Narr ohne jedes Geltungsbedürfnis, denn ein klardenkender Fürst mit den geringsten Ambitionen hätte sich nicht ins Vorzimmer zu einem Lakaien gesetzt und mit ihm über seine Angelegenheiten gesprochen. Daraus folgte aber, daß man ihn, den Diener, im einen wie im anderen Falle zur Verantwortung ziehen würde.
»Immerhin sollten Sie sich in das Empfangszimmer begeben«, forderte er mit gebührendem Nachdruck.
»Wäre ich da reingegangen, hätte ich Ihnen das alles ja nicht erklären können«, erwiderte der Fürst fröhlich lachend. »Und Sie würden noch immer in Unruhe meinen Umhang und mein Bündel betrachten. So aber brauchen Sie jetzt vielleicht gar nicht mehr auf den Sekretär zu warten, sondern können selbst hineingehen und mich ankündigen.«
»Einen Besucher wie Sie kann ich ohne den Sekretär nicht melden, außerdem hat der General vorhin ausdrücklich befohlen, ihn auf keinen Fall zu stören, solange der Oberst bei ihm ist. Nur Gawrila Ardalionytsch darf rein.«
»Ist das ein Beamter?«
»Gawrila Ardalionytsch? Nein. Er arbeitet von sich aus für die Aktiengesellschaft. – Legen Sie doch wenigstens Ihr Bündel aus der Hand.«
»Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wenn Sie erlauben … Und wissen Sie, vielleicht sollte ich auch meinen Umhang abnehmen.«
»Natürlich, mit dem können Sie doch nicht zum General hinein.«
Der Fürst stand auf und zog eilig den Umhang von den Schultern. Es zeigte sich, daß er ein recht ordentlich und sorgfältig geschneidertes, wenn auch schon etwas abgetragenes Jackett trug; über seine Weste lief eine kurze Stahlkette mit einer silbernen Genfer Uhr daran.
Obwohl der Fürst nicht ganz richtig im Kopf war – zumindest nach der inzwischen gewonnenen Überzeugung des Dieners im Vorzimmer –, hielt dieser es schließlich doch für unschicklich, von sich aus das Gespräch mit ihm noch länger fortzuführen, wenngleich der eigentümliche Gast ihm seltsamerweise gefiel, auf seine Art natürlich. Andererseits allerdings weckte eben diese Art in ihm entschieden mißbilligende Entrüstung.
»Wann empfängt eigentlich die Generalin?« fragte der Fürst, während er sich wieder auf seinen vorherigen Platz setzte.
»Damit habe ich nichts zu tun. Zu unterschiedlichen Zeiten, je nach der Person. Ihre Modistin läßt sie schon um elf Uhr vor. Auch Gawrila Ardalionytsch darf eher als die anderen kommen, sogar zum Frühstück.«
»Hier bei Ihnen sind die Wohnungen im Winter wärmer als im Ausland«, bemerkte der Fürst. »Dafür ist es dort auf der Straße wärmer; in den Häusern hält es ein Russe, wenn er nicht daran gewöhnt ist, kaum aus.«
»Wird denn nicht geheizt?«
»Doch, aber die Häuser sind anders konstruiert, das heißt, sie haben andere Öfen und andere Fenster.«
»Hm. Waren Sie lange auf Reisen?«
»Vier Jahre. Aber ich habe immer an demselben Ort gelebt, auf einem Dorf.«
»Da sind Sie wohl unseren Verhältnissen ganz entwöhnt?«
»Ja, das ist wahr. Glauben Sie mir, ich wundere mich, daß ich unsere russische Sprache nicht vergessen habe. Während ich jetzt mit Ihnen rede, denke ich immerzu: Das kann ich ja gut! Vielleicht schwatze ich deshalb so viel. Wirklich, seit gestern möchte ich dauernd russisch sprechen.«
»Hm. Haha! Haben Sie vorher in Petersburg gewohnt?« (Der Lakai brachte es nicht über sich, ein so höfliches und gesittetes Gespräch abzubrechen, so sehr er sich auch bemühte.)
»In Petersburg? Nein, hier war ich sehr selten, nur mal auf der Durchreise. Ich kannte die Stadt auch früher nicht, aber es soll ja jetzt, wie ich höre, so viel Neues in ihr geben, daß selbst alte Kenner sich erst wieder zurechtfinden müssen. Man redet hier zur Zeit viel über die Justiz.«
»Hm, die Justiz. Ja, ja, das stimmt, über unsere Gerichte läßt sich allerhand sagen. Wie ist das denn dort im Ausland, geht’s da gerechter zu?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe über unsere Rechtsprechung eigentlich viel Gutes gehört. Zum Beispiel hat man bei uns doch die Todesstrafe wieder abgeschafft.«
»Gibt’s die dort noch?«
»Ja. Ich habe in Frankreich eine Hinrichtung mit angesehen, in Lyon. Schneider hatte mich mitgenommen.«
»Werden die Verurteilten gehenkt?«
»Nein, geköpft, in Frankreich jedenfalls.«
»Schreien sie dabei?«
»Woher denn. Das dauert nur einen Augenblick. Der Delinquent muß sich hinlegen, dann fällt in einer Maschine, Guillotine genannt, ein breites schweres Messer, so breit etwa. Das trennt den Kopf ab, ehe einer auch nur blinzeln kann. Schlimmer sind die Vorbereitungen. Das Urteil wird verlesen, man macht sich um den armen Sünder zu schaffen, fesselt ihn, führt ihn aufs Schafott – das ist das Entsetzliche. Eine Menge Volk läuft zusammen, auch Frauen, obwohl man es nicht gern hat, daß Frauen zusehen.«
»So was ist ja auch nichts für sie.«
»Natürlich nicht, natürlich nicht! Eine solche Tortur! Der Verbrecher war ein intelligenter Mensch, ohne Furcht, kräftig, nicht mehr jung, Legros hieß er. Aber ich sage Ihnen, ob Sie’s glauben oder nicht, als er aufs Schafott stieg, da weinte er und war weiß wie Papier. Darf es denn so etwas geben? Ist das nicht furchtbar? Vor Angst weint man eigentlich nicht. Ich hätte nie geglaubt, daß ein Mann, nicht etwa ein Kind, sondern ein Mann von fünfundvierzig Jahren, der vielleicht noch niemals geweint hat, aus Angst Tränen vergießen könnte. Was mag in einem solchen Augenblick im Herzen eines Menschen vorgehen, zu welch entsetzlichen Qualen treiben ihn seine Peiniger? Hier wird mit der Seele Schindluder getrieben, weiter nichts! Es steht geschrieben: Du sollst nicht töten! – heißt das denn, man darf jemanden töten, weil er getötet hat? Nein, das darf man nicht. Es ist nun schon über einen Monat her, daß ich das mit angesehen habe, aber das Bild steht mir bis heute vor Augen. Fünfmal habe ich schon davon geträumt.«
Der Fürst hatte sich förmlich in Hitze geredet; eine leichte Röte überzog sein blasses Antlitz, obwohl er genauso leise sprach wie vordem. Der Diener lauschte ihm mit lebhafter Anteilnahme, offensichtlich nicht mehr entschlossen, das Gespräch abzubrechen; vielleicht besaß auch er eine rege Vorstellungskraft und einen Hang zur Nachdenklichkeit.
»Gut ist dabei noch, daß einer nicht lange leiden muß, wenn ihm der Kopf abgehackt wird«, warf er ein.
»Wissen Sie«, entgegnete der Fürst sofort mit Inbrunst, »was Sie da sagen, das ist genau die allgemeine Ansicht, und unter ebendiesem Aspekt hat man eine solche Vorrichtung wie die Guillotine konstruiert. Doch mir kam schon dort beim Zusehen der Gedanke: Womöglich macht das die Sache sogar noch schlimmer? Es scheint Ihnen vielleicht unsinnig und barbarisch, aber bei einiger Phantasie ist so etwas durchaus denkbar. Überlegen Sie: Während der Folter zum Beispiel werden einem Menschen körperliche Schmerzen und Wunden zugefügt, seine Pein ist physischer Art und lenkt ihn von der seelischen ab, bis der Tod eintritt. Vielleicht empfindet man als schlimmste Qual nicht die körperliche Marter, sondern vielmehr die Gewißheit, daß man in einer Stunde, dann in zehn Minuten, in einer halben Minute, im nächsten Augenblick und schließlich jetzt sofort das Leben verlieren und kein Mensch mehr sein wird, das sichere Wissen darum, ja vor allem das, diese Gewißheit. Die Viertelsekunde, in der man, den Kopf unter dem Messer, die Klinge heruntersausen hört, die ist schrecklicher als alles andere. Wissen Sie, das ist nicht meiner Phantasie entsprungen, das haben schon viele geäußert. Aber ich glaube fest daran und sage Ihnen daher schlicht meine Meinung. Das Töten für eine Tötung steht als Strafe in keinem Verhältnis zu dem Verbrechen. Ein Mord auf Grund eines Gerichtsurteils ist etwas weitaus Entsetzlicheres als der von einem Banditen verübte. Das von Räubern des Nachts im Walde erstochene oder sonstwie umgebrachte Opfer hofft unbedingt bis zum letzten Augenblick auf Rettung. Es gab Fälle, in denen Betroffene noch mit durchschnittener Kehle zu fliehen versuchten oder um Schonung baten, das heißt noch Hoffnung hegten. Einem zum Tode Verurteilten aber ist dieser letzte Lichtschimmer, der das Sterben zehnmal leichter macht, mit Gewißheit genommen; das Urteil liegt vor, die Gewißheit aber, daß es kein Entrinnen gibt, birgt eine so furchtbare Qual, wie es sie schlimmer auf der Welt nicht gibt. Man könnte einen Soldaten in der Schlacht vor eine Kanonenmündung stellen und auf ihn schießen, er würde noch immer hoffen; verliest man diesem selben Soldaten jedoch vorher sein Todesurteil, verliert er den Verstand oder bricht in Tränen aus. Niemand wird behaupten, der Mensch sei in der Lage, dergleichen mit unzerrüttetem Verstand zu ertragen. Wozu solche widersinnige, unnötige und nutzlose Niedertracht? Vielleicht gibt es sogar jemanden, dem sein Todesurteil schon mal verlesen, dem also eine solche Qual bereitet worden ist und dem man dann gesagt hat: Mach, daß du wegkommst, du bist begnadigt. Der könnte wohl einiges erzählen. Auch Christus spricht von dieser Pein und dieser Angst. Nein, so darf man mit den Menschen nicht umspringen.«
Der Diener hätte dies alles zwar nicht so ausdrücken können wie der Fürst, aber er verstand es, zumindest das meiste, wie allein schon seine ergriffene Miene verriet.
»Wenn Sie so sehr gern rauchen möchten«, sagte er leise, »dann gäb’s vielleicht doch eine Möglichkeit. Aber Sie müßten sich beeilen. Sonst will der General Sie schließlich empfangen, und Sie sind nicht da. Unter der Treppe dort sehen Sie eine Tür. Durch die gelangen Sie rechts in eine kleine Kammer, da können Sie rauchen. Öffnen Sie die Lüftungsklappe im Fenster, denn es soll eigentlich nicht sein.«
Allein der Fürst kam nicht mehr dazu, von dem Angebot Gebrauch zu machen: Ein junger Mann mit einem Aktendeckel in der Hand trat ins Vorzimmer. Der Diener nahm ihm den Pelz ab. Währenddessen betrachtete der Ankömmling den Fürsten von der Seite.
»Gawrila Ardalionytsch«, begann der Diener in konfidentiellem, ja fast familiärem Ton, »der Herr sagt, er sei Fürst Myschkin und ein Verwandter der gnädigen Frau. Er kommt soeben per Bahn aus dem Ausland, mit dem kleinen Bündel da, mehr hat er nicht.«
Das Weitere verstand der Fürst nicht, weil der Lakai die Stimme senkte. Gawrila Ardalionowitsch hörte ihn aufmerksam an und musterte dabei den Fürsten höchst interessiert; schließlich wandte er sich ungeduldig ab und trat auf ihn zu.
»Sie sind ein Fürst Myschkin?« fragte er äußerst liebenswürdig und höflich. Er war ein sehr gutaussehender junger Mann, ebenfalls um die achtundzwanzig, stattlich, blond, mittelgroß, mit einem kleinen Napoleonbart und klugem, ausgesprochen schönem Gesicht. Sein Lächeln allerdings war trotz aller Freundlichkeit eine Idee zu glatt, seine dabei bloßgelegten Zähne wirkten ein bißchen zu perlengleich ebenmäßig, und sein Blick hatte bei aller Heiterkeit und scheinbaren Aufrichtigkeit etwas Gespanntes, Forschendes.
Wenn er allein ist, lacht er wahrscheinlich nie, und so einen fröhlichen Blick hat er dann gewiß auch nicht! empfand der Fürst unwillkürlich.
Er setzte dem jungen Mann in Eile noch einmal fast dasselbe auseinander, was er zuvor schon dem Diener und vor diesem Rogoshin erklärt hatte. Gawrila Ardalionowitsch schien sich indessen an etwas zu erinnern.
»Haben Sie nicht vor einem Jahr oder gar erst vor einigen Monaten einen Brief an Jelisaweta Prokofjewna geschickt, aus der Schweiz, glaube ich?« fragte er.
»Ja, ganz recht.«
»Dann kennt man Sie doch hier, oder man weiß zumindest von Ihnen. Wollen Sie zu Seiner Exzellenz? Ich werde Sie sofort melden. Er ist sicher gleich frei. Nur sollten Sie vielleicht … Möchten Sie nicht solange im Empfangszimmer Platz nehmen? Wieso sitzt der Herr eigentlich hier?« Die letzte Frage war in strengem Ton an den Diener gerichtet.
»Ich hab’s dem Herrn gesagt, aber er wollte nicht hineingehen.«
In diesem Augenblick wurde unversehens die Tür des Arbeitszimmers von innen geöffnet, und eine Militärperson mit einer Aktentasche in der Hand kam heraus, lauthals sich verabschiedend.
»Ach, du bist hier, Ganja?« rief jemand aus dem Kabinett. »Komm doch rein!«
Gawrila Ardalionowitsch nickte dem Fürsten zu und folgte eilends der Aufforderung.
Zwei Minuten später öffnete sich die Tür abermals, und Gawrila Ardalionowitsch sagte mit seiner wohltönenden, freundlichen Stimme: »Bitte sehr, Fürst.«
3
Der General, Iwan Fjodorowitsch Jepantschin, stand mitten in seinem Arbeitszimmer und musterte den hereinkommenden Fürsten aufs höchste gespannt, ja er ging ihm sogar zwei Schritte entgegen. Der Fürst trat näher und stellte sich vor.
»Nun also«, erwiderte der General, »was kann ich für Sie tun?«
»Es führt mich keine spezielle, unaufschiebbare Angelegenheit hierher, meine Absicht war lediglich, mich mit Ihnen bekannt zu machen. Auch möchte ich keinesfalls Ihren Tagesablauf und Ihre Dispositionen stören. Ich bin nur eben erst hier eingetroffen, aus der Schweiz, und komme geradenwegs von der Bahn.«
Der General hätte beinahe spöttisch gelächelt, doch er überlegte es sich anders und blieb ernst; weiter in Gedanken, betrachtete er seinen Gast mit zusammengekniffenen Augen noch einmal von Kopf bis Fuß. Dann wies er ihm rasch einen Stuhl, setzte sich selbst ein wenig schräg auf einen anderen und sah den Fürsten mit ungeduldiger Erwartung an. Ganja stand in einer Ecke des Zimmers am Schreibtisch und ordnete Papiere.
»Für Bekanntschaften habe ich im allgemeinen wenig Zeit«, sagte der General. »Aber Sie führt gewiß ein Anliegen zu mir, also …«
»Ich habe schon geahnt«, unterbrach ihn der Fürst, »daß Sie meinem Besuch unbedingt ein besonderes Anliegen unterstellen. Aber ich verfolge bei Gott außer dem Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, keinerlei persönliche Ziele.«
»Dieses Vergnügen ist natürlich auch für mich ein ganz außerordentliches, doch ich bin hier nicht zum Zeitvertreib, man hat gelegentlich auch noch zu tun, wissen Sie. Zudem sehe ich bisher zwischen uns keinerlei Gemeinsamkeiten, respektive keinen Grund …«
»Ein Grund liegt zweifellos nicht vor, und Gemeinsames haben wir natürlich nur wenig. Denn der Umstand, daß ich ein Fürst Myschkin bin und Ihre Frau Gemahlin unserem Geschlecht entstammt, ist selbstverständlich kein hinreichendes Argument. Das leuchtet mir ein. Aber ich weiß kein anderes. Ich war über vier Jahre lang nicht in Rußland, und als ich wegfuhr, hatte ich kaum ein eigenes Urteilsvermögen. Schon damals kannte ich das Leben hier nicht, und jetzt steht es damit noch schlimmer. Ich brauche gute Menschen; zum Beispiel habe ich da jetzt eine Sache zu erledigen und weiß nicht, wie ich es anfangen soll. Schon in Berlin dachte ich: Mit den Jepantschins bin ich ja fast verwandt, ich werde zuerst mal zu ihnen gehen, vielleicht können wir einander nützlich sein, sie mir und ich ihnen, wenn sie gute Menschen sind. Ich habe nämlich gehört, daß Sie gute Menschen seien.«
»Verbindlichsten Dank«, sagte der General einigermaßen verwundert. »Darf man wohl erfahren, wo Sie Quartier genommen haben?«
»Bis jetzt noch nirgends.«
»Das heißt, Sie kommen vom Bahnhof direkt zu mir? Und … mit Ihrem Gepäck?«
»Ich besitze weiter nichts als ein kleines Bündel mit Wäsche, das trage ich ohnehin in der Hand bei mir. Ein Hotelzimmer kann ich mir auch noch heute abend mieten.«
»Diese Absicht haben Sie immerhin?«
»Aber ja, natürlich.«
»Ihren Worten nach könnte ich mir denken, daß Sie gern hier bei mir logieren würden.«
»Das ginge schon, allerdings nur, wenn Sie mich dazu aufforderten. Das heißt, offen gestanden, ich würde Ihr Anerbieten wohl ausschlagen, nicht aus einem besonderen Grunde, sondern einfach … es ist nicht meine Art.«
»Nun, dann trifft es sich ja ganz gut, daß ich Sie nicht eingeladen habe und es auch nicht tun werde. Und wenn Sie erlauben, Fürst, wollen wir gleich in jeder Hinsicht Klarheit schaffen: Da wir uns nun einig sind, daß von einer Verwandtschaft zwischen uns keine Rede sein kann – wenngleich sie für mich natürlich äußerst schmeichelhaft wäre –, sollten wir wohl …«
»… sollte ich wohl jetzt aufstehen und gehen«, unterbrach ihn der Fürst, sich erhebend, mit einem ausgesprochen heiteren Lächeln, ungeachtet seiner offensichtlich peinlichen Lage. »Bei Gott, General – wenn ich auch praktisch von den hiesigen Gepflogenheiten und überhaupt dem Leben hier so gut wie nichts weiß, habe ich doch an keinen anderen Ausgang meines Besuches bei Ihnen geglaubt als eben diesen. Nun ja, vielleicht muß das so sein. Sie haben mir ja seinerzeit auch auf meinen Brief nicht geantwortet. So leben Sie denn wohl und entschuldigen Sie, daß ich Sie belästigt habe.«
Sein Blick war dabei so einfühlsam freundlich und sein Lächeln so aufrichtig, ohne auch nur den Anflug verborgener Feindseligkeit, daß dem General plötzlich Zweifel kamen und er seinen Gast auf andere Weise betrachtete. Sein Sinneswandel vollzog sich in nicht mehr als einem Augenblick.