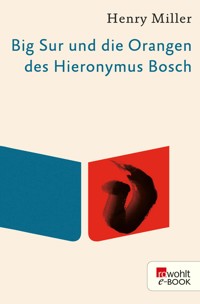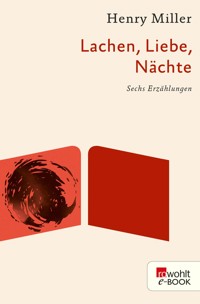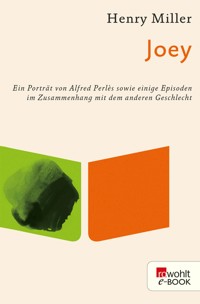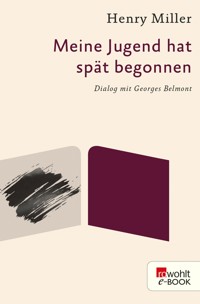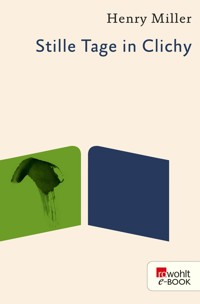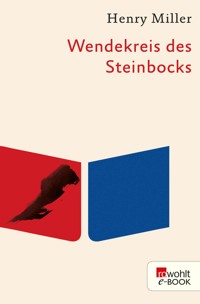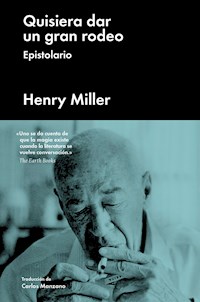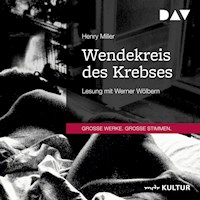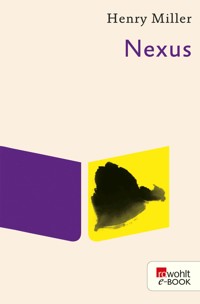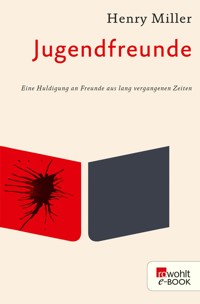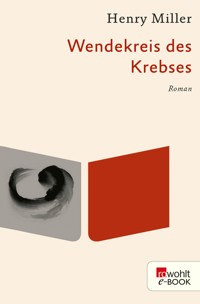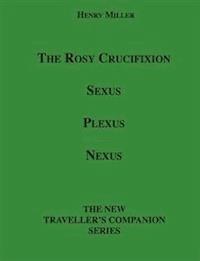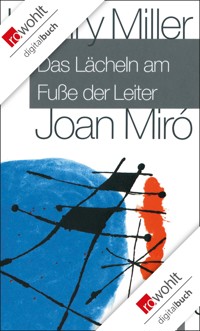5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre lang hatte Henry Miller das Leben im kulturträchtigen Europa genossen, als ihn der drohende Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zur Rückkehr in die neue Welt zwang. Um sich mit dem Land auszusöhnen, durchreiste er kreuz und quer die USA. Was ihm dabei entgegenschlägt, schildern die neunzehn Episoden dieses Buches: das häßlichste Angesicht der amerikanischen Wirklichkeit, wo im Schatten der Paläste allmächtiger Konzernbosse die Hütten der Armen verfallen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Henry Miller
Der klimatisierte Alptraum
Reportagen
Über dieses Buch
Zehn Jahre lang hatte Henry Miller das Leben im kulturträchtigen Europa genossen, als ihn der drohende Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zur Rückkehr in die Neue Welt zwang. Um sich mit dem Land auszusöhnen, durchreiste er kreuz und quer die USA. Was ihm dabei entgegenschlägt, schildern die neunzehn Episoden dieses Buches: das häßlichste Angesicht der amerikanischen Wirklichkeit, wo im Schatten der Paläste allmächtiger Konzernbosse die Hütten der Armen verfallen.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1945 unter dem Titel «The Air-Conditioned Nightmare» bei New Directions, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2020
Copyright © 1977 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Air-Conditioned Nightmare» Copyright © 1945 by New Directions, New York
Redaktion Angela Praesent
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung iStock/Gettyimages/subjob
ISBN 978-3-644-00646-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
nein
«Die größten Männer ...
Vorwort
Frohe Botschaft! Gott ist die Liebe!
Vive la France!
Die Seele der Empfindungslosigkeit
«The Shadows»
Dr. Souchon: Chirurg und Maler
Arkansas und die große Pyramide
Brief an Lafayette
Mit Edgar Varèse in der Wüste Gobi
Mein Traum von Mobile
Ein Tag im Park
Auto-Passacaglia
Eine «Wüstenratte»
Vom Grand Canyon nach Burbank
Soiree in Hollywood
Eine Nacht mit Jupiter
Stieglitz und Marin
Hiler und seine Wandmalereien
Im tiefen Süden
Anhang
Für Margaret und Gilbert Neiman, einst Bunker Hill (Los Angeles), jetzt irgendwo weiter oben, hinter dem Garten der Götter.
In meiner Erinnerung und Zuneigung rangieren sie sogar noch ein bißchen höher, über den Göttern, weil sie so überaus und ganz und gar menschlich sind.
«Die größten Männer dieser Welt sind unbekannt aus ihr geschieden. Gestalten wie Buddha und Christus, die wir kennen, sind nur zweitrangige Helden im Vergleich zu den größten Männern, von denen die Welt nichts weiß. Hunderte von diesen unbekannten Helden haben in jedem Land gelebt und still gewirkt. Still leben sie und still verscheiden sie, und zur gegebenen Zeit finden ihre Gedanken ihren Ausdruck in einem Buddha oder einem Christus, und nur diese werden uns dann bekannt. Die hervorragendsten Männer trachten nicht danach, sich aus ihrem Wissen einen Namen zu machen oder Ruhm zu ernten. Sie hinterlassen ihre Ideen der Welt. Sie beanspruchen nichts für sich selbst und gründen keine Schulen oder Systeme in ihrem Namen. Ihre ganze Natur schreckt vor so etwas zurück. Sie sind die reinen Sattvikas, die nie imstande sind, Aufsehen zu erregen, sondern nur in Liebe aufgehen ...
Im Leben des Gautama Buddha fällt uns auf, daß er immer wieder sagt, er sei der fünfundzwanzigste Buddha. Die vierundzwanzig vor ihm sind in der Geschichte unbekannt geblieben, obschon der geschichtlich bekannte Buddha auf dem von ihnen errichteten Fundament aufgebaut haben muß. Die hervorragendsten Männer sind still, sie schweigen und sind unbekannt. Sie sind die Männer, die wirklich die Macht des Gedankens kennen. Sie sind gewiß, daß selbst, wenn sie sich in eine Höhle zurückziehen, die Türe schließen und einfach fünf wahre Gedanken denken und dann sterben, diese ihre fünf Gedanken in alle Ewigkeit fortleben werden. Tatsächlich werden ihre Gedanken die Gebirge überwinden, die Ozeane überqueren und durch die Welt wandern. Sie werden tief in die Herzen und Gehirne der Menschen eindringen und Männer und Frauen aufrütteln, die ihnen einen praktischen Ausdruck in den Handlungen des menschlichen Lebens geben ... Gestalten wie Buddha und Christus werden von Ort zu Ort ziehen und diese Wahrheiten predigen ... Diese Sattvika-Männer sind Gott zu nahe, um tätig zu sein und zu kämpfen, zu streiten, zu predigen und, wie man sagt, der Menschheit hier auf Erden Gutes zu tun.»
Swami Vivekananda
Vorwort
Der Gedanke, ein Buch über Amerika zu schreiben, kam mir vor einigen Jahren in Paris. Damals schien die Möglichkeit, meinen Traum zu verwirklichen, in ziemlich weiter Ferne, denn um das Buch zu schreiben, würde es erforderlich sein, daß ich Amerika besuchte, in Muße reisen konnte, Geld in der Tasche hatte und so weiter. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wann ein solcher Tag anbrechen würde.
Da ich nicht über die Mittel verfügte, die Reise zu unternehmen, war das Nächstliegende, sie in der Phantasie zu durchleben, wozu ich mich hin und wieder entschloß. Diese vorbereitende Reise begann, wie ich mich erinnere, damit, daß ich ein dickes Notizbuch erbte, das einmal Walter Löwenfels gehört hatte, der mich am Vorabend seiner Abreise aus Frankreich dazu einlud, bei der Verbrennung eines riesigen Stoßes von Manuskripten mitzuwirken, der Produktion von Jahren.
Wenn ich um Mitternacht in mein Atelier zurückgekehrt war, stand ich oft am Tisch und trug in diese himmlische Art von Hauptbuch die zahllosen kleinen Dinge ein, aus denen die Buchführung eines Schriftstellers besteht: Träume, Angriffs- und Verteidigungspläne, Erinnerungen, Titel von Büchern, die ich zu schreiben vorhatte, Namen und Adressen potentieller Gläubiger, eindringliche Wendungen, Redakteure, die man ausnehmen konnte, Schlachtfelder, Monumente, klösterliche Zufluchtsstätten usw. Noch deutlich erinnere ich mich an die Erregung, die ich empfand, als ich solche Worte wie Mobile, Suwaneefluß, Navajos, Painted Desert, die Lynchversammlung, der elektrische Stuhl niederschrieb.
Jetzt finde ich es schade, daß ich über diese imaginäre Reise, die in Paris ihren Anfang nahm, keinen Bericht geschrieben habe. Was für ein ganz anderes Buch wäre das geworden!
Es gab jedoch einen Grund, die Reise auch körperlich zu unternehmen, wenn sie sich auch als fruchtlos erweisen sollte. Ich fühlte das Bedürfnis, mich mit meinem Heimatland auszusöhnen. Es war ein dringendes Bedürfnis, weil ich – anders als die meisten verlorenen Söhne – nicht in der Absicht zurückgekehrt war, im Schoß der Familie zu bleiben, sondern wieder weiter wandern wollte, vielleicht nie mehr zurückzukehren. Ich wollte noch einen letzten Blick auf mein Land werfen und es ohne einen schlechten Nachgeschmack verlassen. Ich wollte nicht davonlaufen, wie ich es ursprünglich getan hatte. Ich wollte es in die Arme schließen, fühlen, daß die alten Wunden wirklich geheilt waren, und dann ins Unbekannte aufbrechen, mit einem Segen auf den Lippen.
Ich verließ Griechenland in heiterer Stimmung. Wenn jemand auf Erden frei von Haß, Vorurteil und Bitterkeit war, so glaubte ich das zu sein. Ich war zuversichtlich, daß ich zum erstenmal in meinem Leben New York und was dahinter lag ohne eine Spur von Abscheu oder Haß betrachten würde.
Es stellte sich heraus, daß das Schiff zuerst in Boston anlegte. Das war vielleicht bedauerlich, aber als Probe ausgezeichnet. Ich war nie in Boston gewesen und recht erfreut über diesen Streich, den mir das Schicksal gespielt hatte. Ich war bereit, Boston zu mögen.
Als ich an Deck kam, um einen ersten Blick auf die Küstenlinie zu werfen, war ich sofort enttäuscht. Nicht nur enttäuscht, so möchte ich sagen, sondern geradezu betrübt. Die amerikanische Küste sah für mich traurig und abstoßend aus. Ich mochte den Anblick amerikanischer Häuser nicht. Die Architektur des amerikanischen Eigenheims hat etwas Kaltes, Nüchternes, etwas Steriles und Abweisendes. Ein Heim eben, mit all den häßlichen, bösen und finsteren Nebenbedeutungen, die das Wort für eine rastlose Seele in sich birgt. Es bot einen frigiden, moralischen Anblick, der mich zu Eis erstarren ließ.
Es war ein Wintertag und ein Sturm blies. Ich ging mit einem der Passagiere an Land. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, wer er war oder wie er aussah, was bezeichnend ist für die Gemütsverfassung, in der ich mich befand. Aus irgendeinem Grund schlenderten wir durch die Bahnhofshalle, einen finsteren Ort, der mir Angst einflößte und mir sofort ähnliche Bahnhöfe in ähnlichen Städten ins Gedächtnis zurückrief – alles quälende, schmerzliche Erinnerungen. Am deutlichsten aber sehe ich in diesem Bahnhof von Boston noch die riesigen Stapel von Büchern und Zeitschriften vor mir, genauso billig, gewöhnlich und kitschig wie eh und je. Und die Mutterschoßwärme, die dort herrschte – so amerikanisch, so unvergeßlich amerikanisch.
Es war Sonntag und der Pöbel trieb sich auf den Straßen umher, verstärkt durch Gruppen rowdyhafter Studenten. Das Spektakel widerte mich an. Ich wollte so rasch wie möglich zum Schiff zurück. In etwa einer Stunde hatte ich alles gesehen, was ich von Boston sehen wollte. Es kam mir scheußlich vor.
Auf dem Rückweg zum Schiff kamen wir an Brücken, Eisenbahnschienen, Lagerhallen, Fabriken, Ladeplätzen und was weiß ich noch alles vorbei. Es war, als folge man den Spuren eines wahnsinnigen Riesen, der seine verrückten Träume in die Erde gesät hatte. Hätte ich nur ein Pferd oder eine Kuh sehen können, oder wenigstens eine angriffslustige Ziege, die an Konservenbüchsen knabberte, dann wäre das eine ungeheure Erleichterung gewesen. Aber nichts aus dem Tier-, Pflanzen- oder Menschenreich war in Sicht. Es war eine endlose, wirre Wüste, von frühzeitlichen oder untermenschlichen Monstren im Delirium der Habgier geschaffen. Es war etwas Negatives, ein wie auch immer geartetes Nichts. Es war ein schlechter Traum, und schließlich begann ich zu laufen, teils aus Abscheu und Ekel, teils wegen des heulenden eisigen Windes, der alles in Sichtweite in eine gefrorene Pastetenkruste verwandelte. Als ich zum Schiff zurückkam, betete ich, der Kapitän möge wunderbarerweise beschließen, seinen Kurs zu ändern und nach Piräus zurückfahren.
Das war kein guter Anfang. Der Anblick von New York – des Hafens, der Brücken, der Wolkenkratzer – trug nichts dazu bei, meine ersten Eindrücke auszulöschen. Zu dem Eindruck öder, erbarmungsloser Häßlichkeit, den Boston vermittelt hatte, gesellte sich nun noch ein vertrautes Gefühl des Schreckens. Als wir bei Anbruch der Nacht ganz nah am Ufer entlang um die Battery herum von der einen Flußmündung in die andere glitten, waren die Straßen mit Insekten besät, und ich empfand, was ich für New York schon immer empfunden habe: daß es der schauderhafteste Ort auf Gottes Erde ist. Wie oft ich auch zu entfliehen suche, man bringt mich wie einen entlaufenen Sklaven zurück in diese Stadt, und jedesmal verabscheue und hasse ich sie mehr.
Zurück in der Rattenfalle. Ich versuche, mich vor meinen alten Freunden zu verbergen. Ich möchte nicht mit ihnen die Vergangenheit wieder zum Leben erwecken, weil die Vergangenheit voll schlimmer, unerquicklicher Erinnerungen ist. Ich denke einzig daran, aus New York fortzukommen, etwas wahrhaft Amerikanisches zu erleben. Ich möchte ein paar Stellen, die ich einmal gekannt habe, wieder aufsuchen. Ich möchte hinaus ins offene Land.
Egal was man vorhat, zunächst braucht man Geld. Ich war ohne einen Cent angekommen, genau so, wie ich vor Jahren das Land verlassen hatte. Beim Gotham Book Mart fand ich einen kleinen Geldbetrag vor, den Miss Steloff bei ihren Kunden für mich gesammelt hatte. Das war eine angenehme Überraschung. Ich war gerührt. Und doch reichte es nicht, um eine gewisse Zeit davon zu leben. Ich mußte noch mehr Geld auftreiben. Vielleicht würde ich mir eine Gelegenheitsarbeit suchen müssen – ein äußerst deprimierender Gedanke.
Inzwischen lag mein Vater im Sterben. Er lag schon seit drei Jahren im Sterben. Ich brachte es nicht übers Herz, ihn mit leeren Händen zu besuchen. Ich wurde verzweifelt. Etwas mußte geschehen – irgendein Wunder. Und es geschah. Zufällig lief mir ein Mann über den Weg, den ich für meinen Feind hielt. Beinahe die ersten Worte, die aus seinem Munde kamen, waren: «Was sind Ihre Pläne? Kann ich Ihnen helfen?» Wieder war ich gerührt, diesmal beinahe zu Tränen.
Einige Monate später war ich im tiefen Süden im Haus eines alten Freundes. Ich verbrachte einen Großteil des Sommers dort, dann kehrte ich nach New York zurück. Mein Vater war noch am Leben. Ich besuchte ihn regelmäßig zu Hause in Brooklyn, unterhielt mich mit ihm über die alten Zeiten in New York (die achtziger und neunziger Jahre), lernte seine Nachbarn kennen, hörte Radio (immer dieses verdammte «Die Nachrichten, bitte!»), erörterte die Beschaffenheit der Prostata, die Eigenheiten der Blase, den New Deal, der für mich noch neu war und ziemlich naiv und sinnlos klang. «Dieser Roosevelt!» höre ich noch die Nachbarn sagen, so als sagten sie: «Dieser Hitler!» Ein großer Wandel war in Amerika vor sich gegangen, darüber bestand kein Zweifel. Noch größere Veränderungen standen bevor, dessen war ich sicher. Wir waren nur die Zeugen des Vorspiels zu etwas Unvorstellbarem. Alles war aus den Fugen und geriet immer mehr durcheinander. Vielleicht würden wir auf allen vieren enden und kreischen wie Paviane. Etwas Verheerendes war im Anzug – jedermann fühlte das. Ja, Amerika hatte sich gewandelt. Der Mangel an Spannkraft, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Skepsis und der Defaitismus – ich traute zuerst kaum meinen Ohren. Und über allem der gleiche falsche Glanz eines einfältigen Optimismus – nur jetzt entschieden angeschlagen.
Ich wurde ruhelos. Mein Vater schien noch nicht bereit zu sterben. Gott weiß, wie lange ich in New York festsitzen würde. Ich beschloß meine Pläne in die Tat umzusetzen. Die Reise war sowieso eines Tages fällig – warum also warten? Natürlich, wieder das Geld. Man braucht Geld, um etwa ein Jahr lang im Land umherzureisen. Wirklich Geld, meine ich. Ich hatte keine Ahnung, wieviel dazu nötig war. Ich wußte nur, daß ich bald aufbrechen mußte oder mich für immer festfahren würde.
Seit meiner Rückkehr aus dem Süden hatte ich, wann immer ich konnte, Abe Rattners Studio besucht und versucht, mein Können als Aquarellmaler zu verbessern. Eines Tages brachte ich das Gespräch auf meine bevorstehende Reise. Zu meiner Überraschung äußerte Rattner den Wunsch, mich zu begleiten. Es dauerte nicht lange, und wir besprachen, was für eine Art von Buch wir machen wollten – eine ganz große Sache mit farbigen Bildtafeln und so weiter. Etwas Luxuriöses wie die wundervollen französischen Ausgaben, die uns vertraut waren. Wer es für uns verlegen würde, wußten wir nicht. Die Hauptsache war, es erst einmal zu machen – und dann einen Verleger zu finden. Und wenn nichts daraus würde, hatten wir immerhin unsere Reise gehabt.
Langsam näherten wir uns dem Gedanken, einen Wagen zu kaufen. Die einzige Weise, wie man Amerika sehen kann, ist im Auto – jedenfalls behauptet das jeder. Das stimmt natürlich nicht, aber es klingt großartig. Ich hatte noch nie einen Wagen besessen, konnte nicht einmal fahren. Jetzt wünschte ich, wir hätten statt dessen ein Kanu genommen.
Wir entschieden uns für den ersten Wagen, den wir besichtigten. Keiner von uns verstand irgend etwas von Autos. Wir glaubten dem Mann einfach, daß es ein gutes, zuverlässiges Fahrzeug sei. Das war es auch, alles in allem, trotz seiner schwachen Seiten.
Einige Tage bevor wir fertig waren zum Abdampfen, traf ich einen Mann namens John Woodburn vom Verlag Doubleday, Doran & Co. Er schien an unserem Vorhaben ungewöhnlich interessiert zu sein. Zu meinem Erstaunen unterzeichnete ich einige Tage später in seinem Büro einen Vertrag für das Buch. Theodore Roosevelt war einer der Unterzeichner, wie man das so nennt. Er hatte nie zuvor von mir gehört und war anscheinend ein wenig unschlüssig, seinen Namen darunter zu setzen. Aber er unterschrieb den Vertrag trotzdem.
Ich hatte eine Vorauszahlung von fünftausend Dollar erwartet und erhielt fünfhundert. Das Geld war fort, bevor ich auch nur den Holland-Tunnel verlassen hatte. Rattners Beitrag zu dem Buch wurde gestrichen. Es wäre zu kostspielig gewesen, ein Buch so zu drucken, wie wir es geplant hatten. Ich war peinlich berührt und verärgert, um so mehr, als Rattner es mit so guter Miene hinnahm. Zweifellos hatte er so etwas erwartet. Ich andererseits erwartete immer, daß die Engel jeden Scheißdreck von mir mit einer Gloriole bedachten. «Die Hauptsache ist», meinte Rattner, «daß wir Amerika sehen.» Ich pflichtete ihm bei. Insgeheim hegte ich die Hoffnung, daß ich mit meinen zukünftigen Tantiemen in der Lage sein würde, Rattners eigene Version von Amerika in Stift und Farbe herauszubringen. Es war ein Kompromiß, und ich hasse Kompromisse, aber so ist Amerika nun mal. «Das nächste Mal kannst du tun, was du für richtig hältst» – das ist das Lied dazu. Es ist eine faustdicke Lüge, aber um sie zu beschönigen, erhältst du Schweigegeld.
So begann die Reise. Trotzdem waren wir gut in Form, als wir New York verließen. Ein wenig nervös, muß ich gestehen, weil wir nur etwa ein halbes Dutzend Stunden in der Fahrschule gehabt hatten. Ich wußte, wie man steuerte, wie man schaltete, wie man bremste – was war weiter notwendig? Wie gesagt, als wir in Richtung Holland-Tunnel losfuhren, waren wir bester Laune. Es war ein Samstagmittag, als wir aufbrachen. Ich war nie zuvor in dem verdammten Loch gewesen, außer einmal in einem Taxi. Es war ein Alptraum. Der Beginn eines endlosen Alptraums, so möchte ich sagen.
Als wir merkten, daß wir ziellos in Newark herumkurvten, überließ ich Rattner das Steuer. Nach einer Stunde Fahren hatte ich genug. Nach Newark zu kommen ist leicht, aber an einem Samstagnachmittag bei Regen wieder herauszukommen, auf die verrückte Hochstraße zurückzufinden, ist etwas anderes. Eine weitere Stunde später befanden wir uns jedoch auf dem offenen Land, der Verkehr war so gut wie nicht vorhanden, die Luft würzig, die Landschaft vielversprechend. Wir waren unterwegs! In New Hope wollten wir zum erstenmal Halt machen.
New Hope! Es ist ziemlich komisch, daß wir uns eine Stadt mit diesem Namen als erste Station ausgesucht hatten. Es war übrigens ein wundervoller Fleck, der mich ein wenig an ein verschlafenes europäisches Dorf erinnerte. Und Bill Ney, den wir besuchten, war förmlich das Symbol neuer Hoffnung, der Begeisterung für neue Ideen, neuer Verteilung des Vorhandenen. Es war ein ausgezeichneter Ausgangspunkt: die Luft war voller Verheißung.
New Hope ist eine von Amerikas Künstlerkolonien. Ich habe eine lebhafte Erinnerung an meine Gemütsverfassung beim Verlassen des Ortes. Sie lief auf einen Satz hinaus : Keine Hoffnung für den Künstler! Die einzigen, die kein Hundeleben führten, waren diejenigen, die Gebrauchskunst machten; sie hatten wundervolle Häuser, wundervolle Pinsel, wundervolle Modelle. Die anderen lebten wie ehemalige Strafgefangene. Dieser Eindruck bestätigte und vertiefte sich noch im Verlauf der Reise. Amerika ist kein Land für einen Künstler: Künstler zu sein bedeutet hier ein moralisch Aussätziger, ein wirtschaftlicher Versager, ein sozialer Passivposten zu sein. Ein mit Mais gemästetes Schwein genießt ein besseres Leben als ein Schriftsteller, Maler oder Musiker. Sogar ein Kaninchen hat es noch besser.
Kurz nachdem ich aus Europa zurückgekehrt war, wurde ich oft, manchmal in unangenehmer Weise, an die Tatsache erinnert, daß ich freiwillig im Exil gelebt hatte. Der im Ausland lebende Schriftsteller wurde häufig als jemand angesehen, der vor der Wirklichkeit zu fliehen sucht. Bis zum Kriegsausbruch war es der Traum jedes amerikanischen Künstlers, nach Europa zu gehen und dort so lange wie möglich zu bleiben. Damals dachte niemand daran, so jemandem Eskapismus vorzuwerfen. Es war das Natürliche, das Richtige, das Gegebene, nach Europa zu gehen, will ich sagen. Mit dem Ausbruch des Krieges setzte eine Art kindischer, mutwilliger Chauvinismus ein. «Bist du nicht froh, in den guten alten USA zurück zu sein?» war die übliche Begrüßung. «Es geht doch nichts über Amerika, was?» Darauf wurde erwartet, daß man sagte: «Na und ob!» Hinter diesen Bemerkungen steckte natürlich ein uneingestandenes Gefühl der Enttäuschung. Der amerikanische Künstler, der jetzt wieder Zuflucht in seiner alten Heimat suchen mußte, war über seine europäischen Freunde verärgert, weil sie ihn des Privilegs beraubt hatten, das Leben zu führen, nach dem er sich am meisten sehnte. Er verübelte ihnen, daß sie eine so häßliche und unnötige Sache wie den Ausbruch des Krieges zugelassen hatten. Amerika besteht, wie wir alle wissen, aus Leuten, die vor solchen häßlichen Situationen davongelaufen sind. Amerika ist das Land des gewählten Exils und des Eskapismus par excellence – das Land der Renegaten, um ein starkes Wort zu gebrauchen. Eine wundervolle Welt hätten wir aus diesem neuen Kontinent machen können, wenn wir unseren Mitmenschen in Europa, Asien und Afrika wirklich davongelaufen wären. Eine tapfere neue Welt hätte es werden können, hätten wir den Mut gehabt, der alten den Rücken zu kehren, neu aufzubauen, die Giftstoffe abzusondern, die sich im Lauf der Jahrhunderte voll bitterer Rivalität, Eifersüchteleien und Hader angesammelt hatten.
Eine neue Welt entsteht nicht, indem man versucht, einfach die alte zu vergessen. Eine neue Welt entsteht aus einem neuen Geist, aus neuen Werten. Unsere Welt mag vielleicht so angefangen haben, doch heute ist sie nur ein Zerrbild davon. Unsere Welt ist eine Welt der Dinge. Sie besteht aus Bequemlichkeiten und Luxusgütern – oder jedenfalls dem Wunsch nach ihnen. Was wir angesichts des drohenden Debakels am meisten fürchten ist, unsere Spielsachen, unsere Apparate, alle die kleinen Annehmlichkeiten, die uns so viel Unannehmlichkeiten gebracht haben, aufgeben zu müssen. Nichts an unserer Haltung ist tapfer, großzügig, heroisch oder hochherzig. Wir sind keine friedlichen Seelen. Wir sind überheblich, furchtsam, mäkelig und verunsichert.
Ich spreche vom Krieg, weil ich nach meiner Rückkehr aus Europa ständig mit Fragen zur europäischen Lage bestürmt wurde. Als ob die bloße Tatsache, daß ich einige Jahre dort gelebt hatte, meinen Worten Gewicht geben könnte! Wer vermag das Rätsel, das einem so ausgedehnten Konflikt zugrunde liegt, zu lösen? Journalisten und Historiker werden so tun, als könnten sie es, aber ihre nachträglichen Einsichten stehen in einem solchen Mißverhältnis zu ihrer Voraussicht, daß Skepsis ihren Analysen gegenüber berechtigt ist. Auf was ich hinaus will ist dies: Obwohl ich ein gebürtiger Amerikaner bin, obwohl ich das wurde, was man «im Exil lebend» nennt, betrachte ich die Welt nicht als Parteigänger dieses oder jenes Landes, sondern als ein Bewohner des Erdballs. Daß ich zufällig hier geboren bin, ist kein Grund dafür, daß die amerikanische Lebensform die beste sein sollte. Daß ich es vorgezogen habe, in Paris zu leben, ist kein Anlaß, für die Irrtümer der französischen Politiker mit dem Leben zu zahlen. Ein Opfer seiner eigenen Fehler zu sein, ist schlimm genug, aber auch noch das Opfer der Fehler des Nebenmanns zu werden, das scheint mir zu viel. Außerdem sehe ich keine Notwendigkeit, warum ich die Fassung verlieren sollte, weil ein Verrückter namens Hitler zu toben anfängt. Hitler wird verschwinden, wie das Napoleon, Tamerlan, Alexander und die anderen getan haben. Eine große Geißel der Menschheit taucht niemals ohne Grund auf. Es gab tausend triftige Gründe für den Aufstieg europäischer und asiatischer Diktatoren. Wir haben unseren eigenen Diktator, nur daß er hydraköpfig ist. Wer glaubt, der einzige Weg, diese Verkörperungen des Bösen auszuschalten, bestehe darin, sie zu zerstören, der soll sie zerstören. Zerstört alles in Sichtweite, wenn ihr glaubt, daß dies der Weg ist, eure Probleme loszuwerden. Ich glaube nicht an diese Art von Zerstörung. Ich glaube nur an jene Zerstörung, die natürlich ist und zum Wesen der Schöpfung gehört. Wie John Marin in einem Brief an den berühmten Fotografen Stieglitz einmal sagte: «Manche stimmen einen Gesang an, wenn sie sich selbst zerfleischen, andere, wenn sie andere zerfleischen.»
Jetzt, da die Reise vorüber ist, muß ich gestehen, daß das Erlebnis, das am stärksten in mir haften geblieben ist, die Lektüre von Romain Rollands zwei Bänden über Ramakrischna und Vivekananda ist. Ich möchte rasch noch einige andere Einzelheiten hinzufügen ...
Die schönste Frau, der ich begegnet bin, eine Königin in jedem Sinne des Wortes, war die Frau eines Negerdichters. Die stärkste Persönlichkeit, der einzige Mensch, in dem ich wirklich «eine große Seele» kennenlernte, war ein stiller Hindu-Yogi in Hollywood. Der Mann mit der größten Einsicht in die Zukunft war ein jüdischer Philosophie-Professor, dessen Name den Amerikanern praktisch unbekannt ist, obschon er seit nahezu zehn Jahren in unserer Mitte lebt. Das meistversprechende work in progress war das eines Malers, der nie zuvor eine Zeile geschrieben hatte. Das einzige Wandgemälde, das ich sah, und das wirklich diesen Namen verdiente, war in San Francisco und stammte von einem Amerikaner, der ausgewandert war. Die aufregendste und mit einem Höchstmaß an Intelligenz zusammengetragene Sammlung moderner Malerei befand sich im Privatbesitz von Walter Arensberg in Hollywood. Den einzigen Menschen, den ich mit seinem Los zufrieden und seiner Umgebung angepaßt fand, der glücklich mit seiner Arbeit und repräsentativ für alles war, was zum Besten in der amerikanischen Tradition gehört, war ein schlichter, bescheidener Bibliothekar an der University of California in Los Angeles namens Lawrence Clark Powell. Hier muß ich auch John Steinbecks Freund Ed Ricketts von den Pazifischen Biologischen Laboratorien erwähnen, einen in Charakter und Temperament ganz außergewöhnlichen Menschen – einen Mann, der innere Ruhe, Heiterkeit und Weisheit ausstrahlte. Der jüngste und vitalste Mensch, auf den ich gestoßen bin, war die siebzigjährige Dr. Marion Souchon aus New Orleans. Von der Arbeiterklasse schienen mir die erstaunlichsten Typen die Leute von den Tankstellen ganz im Westen zu sein, vor allem jene an den Standard-Tankstellen. Sie sind ein völlig verschiedener Menschenschlag von denen im Osten. Die Person, die das schönste Englisch sprach, war ein Führer in den Massanutten-Höhlen in Virginia. Unter allen öffentlichen Rednern war der Mann mit dem anregendsten Geist, an den ich mich erinnern kann, ein Theosoph namens Fritz Kunz. Die einzige Stadt, die mich wirklich angenehm überraschte, war Biloxi, Mississippi. Obwohl es Hunderte von Buchhandlungen in Amerika gibt, können sich nur etwa ein Dutzend mit denen in Europa vergleichen – darunter vor allem der Argus Book Shop, New York, der Gotham Book Mart, New York, Terence Holliday's Book Shop, New York, und der Satyr Book Shop in Hollywood. Das interessanteste College, das ich besuchte, war das Black Mountain College in North Carolina – hier waren es die Studenten, die interessant waren, nicht die Professoren. Die langweiligste Gruppe an allen Orten waren die Universitätsprofessoren – und ihre Frauen. Besonders die Frauen. Jamestown, Virginia, beeindruckte mich als der tragischste Ort in ganz Amerika. Die geheimnisvollste Gegend des Landes schien mir die riesige rechteckige Fläche innerhalb der vier Staaten Utah, Arizona, Colorado und Neu-Mexiko zu sein.
An die zehntausend Meilen mußte ich reisen, ehe ich auch nur zum Schreiben einer einzigen Zeile inspiriert wurde. Alles, was sich über den amerikanischen Lebensstil zu sagen lohnt, konnte ich auf dreißig Seiten zusammenfassen. Topographisch ist das Land großartig – und erschreckend. Warum erschreckend? Weil nirgendwo anders in der Welt die Trennung zwischen Mensch und Natur so vollständig ist. Nirgends bin ich einer so stumpfen, monotonen Lebensstruktur begegnet wie hier in Amerika. Hier ist die Langeweile auf die Spitze getrieben.
Wir sind gewohnt, uns als befreites Volk zu verstehen. Wir sagen, wir seien demokratisch, freiheitsliebend, ohne Vorurteile und Haß. Dies ist der Schmelztiegel, der Schauplatz eines großen menschlichen Experiments. Wunderschöne Worte, voll edlen, idealistischen Gefühls. In Wirklichkeit sind wir ein ordinärer, drängelnder Haufen, der in seinen Leidenschaften von Demagogen, Presseleuten, religiösen Scharlatanen, Agitatoren und dergleichen leicht zu mobilisieren ist. Dies eine Gesellschaft freier Völker zu nennen ist Blasphemie. Was haben wir der Welt zu bieten, außer der überreichen Ausbeute, die wir unbekümmert der Erde entreißen in der wahnsinnigen Selbsttäuschung, daß diese verrückte Aktivität für Fortschritt und Aufklärung stehe? Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist zu einem Land des unsinnigen Schweißvergießens und des Existenzkampfs geworden. Das Ziel aller unserer Anstrengungen ist längst in Vergessenheit geraten. Wir wollen die Unterdrückten und Heimatlosen nicht mehr unterstützen; es gibt keinen Platz in diesem großen, leeren Land für jene, die – wie vor uns unsere Vorfahren – jetzt eine Zufluchtsstätte suchen. Millionen von Männern und Frauen sind – oder waren noch vor kurzem – auf eine Fürsorgeunterstützung angewiesen, verdammt wie Meerschweinchen zu einem Leben erzwungener Untätigkeit. Die Welt blickt inzwischen auf uns mit einer Verzweiflung, wie sie eine solche nie zuvor gekannt hat. Wo ist der demokratische Geist? Wo sind die Führergestalten?
Für ein großes menschliches Experiment müssen wir vor allen Dingen Menschen haben. Hinter dem Begriff «Mensch» muß Größe stehen. Keine politische Partei ist in der Lage, das Reich des Menschen einzuleiten. Die Arbeiter der Welt werden vielleicht eines Tages, wenn sie nicht länger auf ihre mit Scheuklappen versehenen Führer hören, eine brüderliche Menschheit organisieren. Aber die Menschen können keine Brüder sein, ohne zuerst Ebenbürtige zu werden, und das heißt Gleichrangige in einem königlichen Sinn. Was die Menschen daran hindert, sich als Brüder zu vereinigen, ist ihre eigene verächtliche Unzulänglichkeit. Sklaven können sich nicht vereinigen; Feiglinge können sich nicht vereinigen; die Unwissenden können sich nicht vereinigen. Nur indem wir unseren vornehmsten Impulsen gehorchen, können wir uns vereinigen. Das Verlangen, sich selbst zu übertreffen, muß instinktiv, nicht nur theoretisch oder glaubhaft sein. Wenn wir uns nicht bemühen, die Wahrheiten, die in uns sind, klar zu erkennen, werden wir immer wieder scheitern. Als Demokraten, Republikaner, Faschisten, Kommunisten stehen wir alle auf gleicher Höhe. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so prächtig bekriegen können. Mit unserem Leben verteidigen wir die kleinlichen Prinzipien, die uns trennen. Für die Verteidigung des gemeinsamen Prinzips, nämlich die Errichtung eines Menschenreiches auf Erden, rühren wir keinen Finger. Wir fürchten jeden Antrieb, der uns aus dem Dreck ziehen würde. Wir kämpfen nur für den Status quo, unseren speziellen Status quo. Wir schlagen uns mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen. Tatsächlich gibt es niemals einen Status quo, außer in den Gehirnen politischer Dummköpfe. Alles ist im Fluß. Diejenigen, die sich in der Defensive befinden, bekämpfen Phantome.
Was ist der größte Verrat? Das in Zweifel zu ziehen, wofür man kämpft. Hier reichen sich Irrsinn und Verrat die Hände. Krieg ist eine Form des Irrsinns – die edelste oder die gemeinste, je nach dem Standpunkt, den man einnimmt. Da es ein Massenirrsinn ist, sind die Einsichtigen machtlos, sich dagegen aufzulehnen. Vor jedem anderen Einzelfaktor, den man als Erklärung für den Krieg anführen mag, steht die Ratlosigkeit. Wenn alle anderen Waffen versagen, wendet man Gewalt an. Aber vielleicht ist an den Waffen, die wir so leicht und bereitwillig ablegen, alles in bester Ordnung. Vielleicht müssen sie geschärft werden, oder wir müssen im Umgang mit ihnen geübter werden, oder beides. Indem man kämpft, gesteht man ein, daß man ratlos ist; es ist ein Akt der Verzweiflung, nicht der Stärke. Eine Ratte vermag großartig zu kämpfen, wenn sie in die Enge getrieben wird. Sollen wir es der Ratte gleichtun?
Um zu wissen, was Frieden ist, muß der Mensch den Konflikt erlebt haben. Er muß durch das heroische Stadium gegangen sein, bevor er wie ein Weiser handeln kann. Er muß ein Opfer seiner Leidenschaften geworden sein, bevor er sich über sie zu erheben vermag. Um die leidenschaftlichen Regungen des Menschen zu wecken, um ihn dem Teufel zu überantworten und ihn auf die höchste Probe zu stellen, muß ein Konflikt bestehen, bei dem es um mehr geht als um Vaterland, politische Prinzipien, Ideologien usw. Der Mensch in Auflehnung gegen seine eigene ekelerregende Natur – das ist ein echter Krieg. Und ein unblutiger, der unter der friedlichen Bezeichnung Evolution immer weitergeht. In diesem Krieg stellt sich der Mensch ein für allemal auf die Seite der Engel. Mag er als einzelner auch besiegt werden, über den Ausgang kann er sicher sein – weil das ganze Universum auf seiner Seite ist.
Es gibt Experimente, die mit Schlauheit und Präzision gemacht werden, weil man das Ergebnis vorausahnt. Der Wissenschaftler zum Beispiel stellt sich immer lösbare Probleme. Doch das menschliche Experiment ist nicht von dieser Art. Die Antwort auf dieses grandiose Experiment liegt im Herzen. Die Suche muß von innen her geführt werden. Wir scheuen uns, dem Herzen zu trauen. Wir bewohnen eine geistige Welt, ein Labyrinth, in dessen dunklen Schlupfwinkeln ein Ungeheuer lauert, um uns zu verschlingen. Bis jetzt haben wir uns in einer mythologischen Traumfolge bewegt und keine Lösungen gefunden, weil wir die falschen Fragen stellen. Wir finden nur, wonach wir suchen, und wir suchen am falschen Ort. Wir müssen aus der Dunkelheit herauskommen, dieses Forschen aufgeben, das nur eine Flucht aus Angst ist. Wir müssen aufhören, auf allen vieren herumzutappen. Wir müssen hinaus ins Freie treten, aufrecht und völlig ungeschützt.
Diese Kriege lehren uns nichts, nicht einmal die Überwindung unserer Ängste. Wir sind noch immer Höhlenmenschen. Demokratische Höhlenmenschen vielleicht, doch das ist ein geringer Trost. Unser Kampf besteht darin, aus der Höhle herauszukommen. Wären wir bereit, uns nur ein wenig in dieser Richtung anzustrengen, dann würden wir damit die ganze Welt ermutigen.
Wenn wir die Rolle des Vulcanus übernehmen, laßt uns schimmernde neue Waffen schmieden, die uns von den Ketten befreien, die uns fesseln. Laßt uns die Erde nicht auf perverse Weise lieben. Laßt uns aufhören, die Rolle des Rückfälligen zu spielen. Laßt uns aufhören, einander umzubringen. Die Erde ist keine Lagerstelle, noch ist sie ein Gefängnis. Die Erde ist ein Paradies, das einzige, das wir jemals kennenlernen werden. Wir werden uns dessen bewußt in dem Augenblick, in dem wir die Augen öffnen. Wir brauchen die Erde nicht zu einem Paradies zu machen – sie ist eines. Wir müssen uns nur würdig erweisen, es zu bewohnen. Der Mann mit dem Gewehr, der Mann, der auf Mord sinnt, ist unfähig, das Paradies zu erkennen, selbst wenn man es ihm zeigt.
Neulich abends, in der Wohnung eines ungarischen Freundes, unterhielt ich mich mit ihm über die im Exil Lebenden und die Emigranten. Ich hatte ihm gerade im einzelnen meine Eindrücke von Amerika erzählt und mit der Feststellung geendet, die Reise habe mir einzig und allein meine intuitiven Vermutungen bestätigt. Er erwiderte, vermutlich hätte ich Amerika zu sehr geliebt. Einen Augenblick später führte er mich an seinen Schreibtisch am Fenster und forderte mich auf, mich auf seinen Stuhl zu setzen. «Schauen Sie sich diesen Blick an!» sagte er. «Ist er nicht herrlich?» Ich blickte hinaus auf den Hudson und sah eine große Brücke im Glanz fahrender Lichter. Ich wußte, was er empfand, wenn er auf diese Szenerie blickte. Ich wußte, daß sie für ihn die Zukunft darstellte – die Welt, deren Erbe seine Kinder antreten würden. Für ihn war es die Welt der Verheißung. Für mich war es eine Welt, die ich nur zu gut kannte – eine Welt, die mich unendlich traurig stimmte.
«Es ist seltsam», sagte ich, «daß Sie mich an dieses Fenster führen. Wissen Sie, woran ich dachte, als ich hier saß? Ich dachte an ein anderes Fenster, in Budapest, an dem ich eines Abends stand und einen ersten Blick auf die Stadt warf. Sie hassen Budapest. Sie mußten daraus fliehen. Und mir erschien es als magischer Ort. Vom ersten Augenblick an liebte ich es. Ich fühlte mich dort sofort heimisch. Tatsächlich fühle ich mich überall heimisch, außer in meinem Heimatland. Hier fühle ich mich als Fremder, besonders in New York, meiner Geburtsstadt.»
Sein ganzes Leben lang, erwiderte er, habe er davon geträumt, nach Amerika und besonders nach New York zu kommen.
«Und wie haben Sie es gefunden», fragte ich, «als Sie es zum erstenmal sahen? Hat es irgendwie dem entsprochen, was Sie sich in Ihren Träumen vorgestellt haben?»
Er sagte, es sei genau so gewesen, wie er es sich erträumt habe, bis hinunter zu seinen häßlichen Seiten. Die Mängel hatten ihn nicht weiter gestört: Sie gehörten zu dem Bild, mit dem er im voraus einverstanden war.
Ich dachte an eine andere europäische Stadt – an Paris. Dort hatte ich genau das gleiche Gefühl gehabt. Ich möchte sogar behaupten, daß ich seine anrüchigen Seiten und seine Häßlichkeit liebte. Ich war verliebt in Paris. Ich kenne keinen Teil von Paris, der mich abstößt, ausgenommen das düstere, langweilige, bürgerliche Stadtviertel Passy. Was ich an New York am liebsten habe, ist das Ghetto. Es vermittelt mir ein Gefühl von Leben. Die Menschen im Ghetto sind Ausländer. Wenn ich in ihrer Mitte weile, bin ich nicht mehr in New York, sondern mitten unter den Völkern Europas. Das ist für mich erregend. Alles Fortschrittliche und Amerikanische an New York ist mir verhaßt.
Ob ich enttäuscht, ernüchtert bin ... Die Antwort lautet vermutlich ja. Ich hatte das Unglück, mit den Träumen und Visionen von großen Amerikanern aufzuwachsen – von Dichtern und Sehern. Aber ein anderer Menschenschlag hat den Sieg davongetragen. Diese Welt, die im Entstehen begriffen ist, erfüllt mich mit Angst. Ich habe sie aufkeimen sehen – wie eine Blaupause kann ich sie vor mir sehen. Es ist keine Welt, in der ich leben möchte. Es ist eine Welt, geeignet für Monomanen, die von der Idee des Fortschritts besessen sind – aber eines falschen Fortschritts, eines Fortschritts, der stinkt. Es ist eine Welt, angefüllt mit zwecklosen Gegenständen, die als nützlich anzusehen man Männern und Frauen beibringt, damit man sie ausbeuten und erniedrigen kann. Für den Träumer, dessen Träume nicht auf Nützlichkeit ausgerichtet sind, gibt es keinen Platz in dieser Welt. Was immer sich nicht dafür eignet, gekauft und verkauft zu werden, sei es im Bereich der Dinge, Ideen, Prinzipien, Träume oder Hoffnungen, wird ausgeschlossen. In dieser Welt ist der Dichter Anathema, der Denker ein Narr, der Künstler ein Flüchtling vor der Wirklichkeit, der Visionär ein Verbrecher.
Seitdem ich das Vorangegangene geschrieben habe, ist der Krieg erklärt worden. Manche Leute glauben, eine Kriegserklärung ändert alles. Wenn das nur wahr wäre! Wenn wir nur einem radikalen, umfassenden Wandel auf allen Ebenen entgegensehen könnten! Die Veränderungen, die ein Krieg herbeiführt, sind jedoch nichts im Vergleich zu den Entdeckungen und Erfindungen eines Edison. Trotzdem kann Krieg – im Guten wie im Schlimmen – eine Wandlung im Geist eines Volkes bewirken. Und daran bin ich zutiefst interessiert – an einer Wandlung des Herzens, einer Bekehrung.
Wir haben jetzt einen Zustand, der als «ein nationaler Notstand» bezeichnet wird. Obwohl die Gesetzgeber und Politiker nach Belieben toben, obschon die Pressesippschaft deliriert und Hysterie verbreitet, obwohl die Militärclique großmäulig droht und gegen alles einschreitet, was ihr nicht behagt, soll der Privatmann, für den und von dem der Krieg geführt wird, den Mund halten. Da ich nicht die geringste Achtung vor dieser Einstellung habe, da sie der Sache der Freiheit nicht förderlich ist, habe ich diese Aussagen, die selbst in Friedenszeiten dazu angetan sind, Anstoß und Verärgerung zu erregen, unverändert gelassen. Mit John Stuart Mill glaube ich, daß «ein Staat, der seine Menschen verkümmern läßt, damit sie zu gehorsameren Werkzeugen in seinen Händen werden, und sei es für nützliche Zwecke, erfahren wird, daß mit kleinen Leuten eine große Sache nicht wirklich ausgeführt werden kann.» Mir wäre es lieber, meine Ansichten und Würdigungen würden sich als falsch erweisen – durch das Sichtbarwerden eines neuen, vitalen Geistes. Wenn es eines Unglücks wie eines Krieges bedarf, um uns aufzurütteln und zu verwandeln, schön und gut, dann soll es so sein. Laßt uns jetzt sehen, ob die Arbeitslosen wieder Arbeit finden und die Armen ordentlich gekleidet, menschenwürdig untergebracht und ernährt werden. Laßt uns sehen, ob den Reichen ihre Beute abgenommen wird und ob sie wie der gewöhnliche Bürger leiden und auf vieles verzichten müssen; laßt uns sehen, ob alle Arbeiter Amerikas – unabhängig von Klasse, Fähigkeit oder Nützlichkeit – dazu gebracht werden können, sich mit dem gleichen Lohn zufrieden zu geben; laßt uns sehen, ob die Menschen ihre Wünsche in direkter Weise vorbringen können, ohne die Einmischung, die Entstellung und Stümperei der Politiker; laßt uns sehen, ob wir nicht eine wirkliche Demokratie schaffen können anstelle der verfälschten, die zu verteidigen wir aufgerufen wurden; laßt uns sehen, ob wir nicht ehrlich und gerecht zueinander sein können, ganz zu schweigen von dem Feind, den wir zweifellos besiegen werden.
Frohe Botschaft! Gott ist die Liebe!
In einem Hotel in Pittsburgh war's, daß ich das Buch über Ramakrischna von Romain Rolland zu Ende las. Pittsburgh und Ramakrischna – ist ein stärkerer Gegensatz vorstellbar? Das eine das Symbol brutaler Gewalt und des Reichtums ; der andere die wahre Verkörperung von Liebe und Weisheit.
Wir beginnen nun hier, inmitten des Alptraums, in dem Schmelztiegel, in dem alle Werte zu Schlacke reduziert werden.
Ich bin in einem kleinen, dem Anspruch nach komfortablen Zimmer eines modernen Hotels, das mit den allerneuesten Errungenschaften ausgestattet ist. Das Bett ist sauber und weich, die Dusche funktioniert bestens, der Toilettensitz ist seit dem letzten Gast sterilisiert worden, wenn ich glauben darf, was auf dem herumgeschlungenen Papierstreifen gedruckt steht; Seife, Handtücher, Streichhölzer, Briefpapier – alles ist in Hülle und Fülle vorhanden.
Ich fühle mich deprimiert, unsagbar deprimiert. Müßte ich dieses Zimmer für längere Zeit bewohnen, dann würde ich verrückt werden – oder Selbstmord begehen. Der Geist des Ortes, der Geist der Menschen, die diese Stadt so schrecklich gemacht haben wie sie ist, sickert durch die Wände. Mord liegt in der Luft. Er droht mich zu ersticken.
Vor einigen Augenblicken bin ich ausgegangen, um Luft zu schöpfen. Ich glaubte mich zurückversetzt in das zaristische Rußland. Ich sah Iwan den Schrecklichen, gefolgt von einer Kavalkade bestialischer Kerle. Da waren sie, bewaffnet mit Knüppeln und Revolvern. Sie sahen aus wie Männer, die jedem Befehl eifrig gehorchen, die bei der geringsten Herausforderung gezielt schießen.
Nie zuvor ist der Status quo mir häßlicher erschienen. Dies ist keineswegs der schlimmste Ort, ich weiß. Aber ich bin hier, und was ich sehe, trifft mich schwer.
Vielleicht war es ein Glück, daß ich meine Rundreise durch Amerika nicht in Pittsburgh, Youngstown oder Detroit begonnen habe. Ein Glück, daß ich nicht zuerst Bayonne, Bethlehem, Scranton und dergleichen Orte aufgesucht habe. Ich wäre dann vielleicht niemals bis Chicago gekommen. Ich hätte mich vielleicht in eine menschliche Bombe verwandelt und wäre explodiert. Durch einen klugen Selbsterhaltungstrieb wandte ich mich zuerst nach dem Süden, um die sogenannten «rückständigen» Staaten der Union zu erkunden. Wenn ich auch größtenteils gelangweilt war, fand ich doch wenigstens Ruhe und Frieden. Sah ich nicht auch im Süden Leid und Not? Natürlich. Es gibt Leid und Not überall in diesem riesigen Land. Aber es gibt alle möglichen Arten und Grade von Leid; die schlimmste ist meiner Ansicht nach die Art, der man gerade im Herzen des Fortschritts begegnet.
In diesem Augenblick sprechen wir über die Verteidigung unseres Landes, unserer Einrichtungen, unseres Lebensstils. Man betrachtet es als Selbstverständlichkeit, daß diese verteidigt werden müssen, ob wir nun eine Invasion erleben oder nicht. Aber es gibt Dinge, die nicht verteidigt werden sollten, die man untergehen lassen sollte; es gibt Dinge, die wir aus freien Stücken zerstören sollten, mit unseren eigenen Händen.
Laßt uns im Geist rekapitulieren. Laßt uns versuchen, uns in die Tage zurückzuversetzen, als unsere Vorfahren an diese Küsten kamen. Zunächst einmal waren sie vor etwas geflohen – wie die Emigranten, die anzuschwärzen und zu schmähen wir uns angewöhnt haben, hatten auch sie ihre Heimat verlassen auf der Suche nach etwas, was der Sehnsucht ihres Herzens näher war.
Eines der seltsamen Dinge an diesen unseren Vorfahren ist, daß sie zwar erklärtermaßen Frieden und Glück, politische und religiöse Freiheit suchten, aber erst einmal die Rasse, der dieser riesige Kontinent gehörte, beraubten, vergifteten, ermordeten, ja nahezu ausrotteten. Später, als der Goldrausch begann, machten sie dasselbe, was sie den Indianern angetan hatten, mit den Mexikanern. Und als die Mormonen in Erscheinung traten, waren ihre weißen Brüder denselben Grausamkeiten, derselben Unduldsamkeit und Verfolgung ausgesetzt.
Ich denke an diese häßlichen Tatsachen, weil mir, während ich von Pittsburgh nach Youngstown durch ein Inferno fuhr – das alles übertrifft, was sich Dante vorstellte –, plötzlich die Idee kam, ein nordamerikanischer Indianer sollte mich auf dieser Reise begleiten und mir schweigend oder sonstwie seine Gefühle und Betrachtungen mitteilen. Besonders gerne hätte ich einen Nachkommen eines der anerkannt «zivilisierten» Indianerstämme bei mir gehabt, beispielsweise einen Seminole, der sein Leben in den unzugänglichen Sümpfen Floridas verbracht hatte.
Man stelle sich uns beide dann vor, wie wir nachdenklich vor der häßlichen Großartigkeit eines dieser Stahlwerke stehen, welche die Eisenbahnlinie säumen. Ich höre beinahe, was er denkt – «Also deswegen habt ihr uns unserer Geburtsrechte beraubt, uns als Sklaven verschleppt, unsere Hütten niedergebrannt, unsere Frauen und Kinder hingeschlachtet, unsere Seelen vergiftet, jeden Vertrag, den ihr mit uns abgeschlossen habt, gebrochen und uns in den sumpfigen Dschungeln der Everglades sterben lassen!»
Glaubt ihr, man könne ihn leicht dazu veranlassen, mit einem unserer emsigen Arbeiter den Platz zu tauschen? Was für Überredungskünste würde man anwenden? Was vermöchte man ihm heute zu versprechen, das wirklich verführerisch wäre? Einen gebrauchten Wagen, mit dem er zur Arbeit fahren kann? Eine halb verfallene Hütte, die er, wäre er nur unwissend genug, eine Behausung nennen könnte? Für seine Kinder eine Ausbildung, die sie über das Laster, die Unwissenheit und den Aberglauben erheben, sie aber in Sklaverei belassen würde? Ein sauberes, gesundes Leben inmitten von Armut, Verbrechen, Schmutz, Krankheit und Angst? Löhne, die einen kaum über Wasser halten und oft nicht einmal das? Radio, Telefon, Kino, Zeitung, Schundhefte, Füllfederhalter, Armbanduhr, Staubsauger und andere Kinkerlitzchen ad infinitum? Sind es diese Spielereien, die das Leben lebenswert machen? Sind sie es, die uns glücklich, sorglos, großmütig, mitfühlend, gütig, friedlich und rechtschaffen machen? Sind wir jetzt erfolgreich und in Sicherheit, wie es sich so viele törichterweise erträumen? Ist irgendwer unter uns, selbst unter den Reichsten und Mächtigsten, sicher, daß nicht ein widriger Wind unsere Besitztümer, unser Ansehen, die Furcht und den Respekt, den man uns zollt, wegfegt?
Diese überhitzte Betriebsamkeit, die uns alle, reich und arm, schwach und stark, unter der Fuchtel hält – wohin führt sie uns? Es gibt im Leben zwei Dinge, die alle Menschen, wie mir scheint, erstreben und nur sehr wenige jemals erlangen (weil beide von ihnen in den geistigen Bereich fallen) – und das sind Gesundheit und Freiheit. Der Apotheker, der Arzt, der Chirurg – sie alle haben nicht die Macht, Gesundheit zu schenken; Geld, Macht, Sicherheit, Ansehen geben keine Freiheit. Eine Ausbildung kann niemals Weisheit verschaffen, ebensowenig wie die Kirchen Religion oder Reichtum Glück, oder Sicherheit Frieden zu vermitteln vermögen. Welchen Sinn hat unsere Betriebsamkeit dann? Welches Ziel?
Wir sind nicht nur ebenso unwissend, so abergläubisch und unmoralisch in unserem Verhalten wie die «unwissenden, blutrünstigen Wilden», die wir nach unserem Auftauchen hier enteignet und vernichtet haben – wir sind weit schlimmer als sie. Wir sind degeneriert; wir haben die Lebensweise, die wir auf diesem Kontinent einzuführen suchten, jeder Würde entkleidet. Die produktivste Nation der Erde, und doch nicht in der Lage, mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung ausreichend zu ernähren, zu kleiden und ihm menschenwürdige Behausungen zu verschaffen. Aus Vernachlässigung, Gleichgültigkeit, Habgier und Vandalismus verwandeln sich riesige Flächen wertvollen Bodens in Wüste. Vor mehr als achtzig Jahren durch den blutigsten Bürgerkrieg der Menschheitsgeschichte auseinandergerissen, und doch bis zum heutigen Tag unfähig, den besiegten Teil unseres Landes von der Rechtmäßigkeit unserer Sache zu überzeugen; die Befreier der Sklaven, aber nicht in der Lage, diesen wirkliche Freiheit und Gleichberechtigung zu geben; statt dessen versklaven und erniedrigen wir unsere eigenen weißen Brüder. Ja, der industrialisierte Norden besiegte den aristokratischen Süden – die Früchte dieses Sieges treten jetzt zutage. Wo immer es Industrie gibt, findet man Häßlichkeit, Not, Unterdrückung, Düsternis und Verzweiflung. Die Banken, die reich wurden, indem sie uns mit frommer Biederkeit zu sparen lehrten, um uns mit unserem eigenen Geld zu betrügen, bitten uns jetzt, unsere Ersparnisse nicht zu ihnen zu bringen, und drohen, selbst diesen lächerlichen Zinssatz, den sie nun anbieten, zu streichen, sollten wir ihren Rat nicht befolgen. Dreiviertel der Goldreserven der Welt liegen in Kentucky verborgen. Erfindungen, die weitere Millionen arbeitslos machen würden – da durch eine seltsame Ironie unseres Systems jede potentielle Wohltat für die Menschheit zum Übel wird –, liegen ungenützt in den Regalen des Patentamts oder werden von den Mächten, die unser Schicksal bestimmen, aufgekauft und vernichtet. Das Land, das dünn besiedelt ist und in verschwenderischer, ungesteuerter Weise einen riesigen Überfluß jeder Art produziert, wird von seinen Besitzern beherrscht, einer bloßen Handvoll von Männern, die weder die hungernden Millionen von Europäern, noch die hungernden Horden unseres eigenen Landes versorgen können. Ein Land, das sich lächerlich macht, indem es Missionare in die entlegensten Teile des Erdballs sendet und von Armen Almosen bettelt, damit es das christliche Werk irregeführter Teufel aufrechterhalten kann, die so wenig Christus vertreten wie ich den Papst, und das doch unfähig ist, durch seine Kirchen und Missionen in der Heimat den Schwachen und Hoffnungslosen, den Elenden und Entrechteten zu Hilfe zu kommen. Die Krankenhäuser, die Irrenanstalten, die Gefängnisse sind zum Bersten voll. Verwaltungsbezirke, manche von ihnen so groß wie ein europäisches Land, praktisch unbewohnt, gehören einer nicht greifbaren Gesellschaft, deren Fühler überallhin reichen und deren Verantwortungsbereich niemand definieren oder klar feststellen kann. Ein Mann, der bequem in einem Sessel in New York, Chicago oder San Francisco sitzt, von jedem Luxus umgeben und doch vor Angst und Besorgnis fast gelähmt, verfügt über das Leben und Schicksal Tausender von Männern und Frauen, die er nie gesehen hat, die er nie zu sehen wünscht und deren Geschick ihm völlig gleichgültig ist.
Das ist's, was im Jahr 1941 in diesen Vereinigten Staaten von Amerika Fortschritt genannt wird. Da ich nicht von Indianern, Negern oder Mexikanern abstamme, bereitet es mir keine Schadenfreude, dieses Bild von der Zivilisation des weißen Mannes zu zeichnen. Ich bin der Nachkomme zweier Männer, die aus ihrer Heimat geflohen sind, weil sie nicht Soldaten werden wollten. Meine Nachkommen werden sich ironischerweise dieser Pflicht nicht mehr entziehen können: Die ganze Welt der Weißen ist mittlerweile in ein Militär-Lager verwandelt worden.
Nun, wie ich sagte, bei der Abreise von Pittsburgh war ich ganz von Ramakrischna erfüllt. Ramakrischna, der nie kritisierte, nie predigte, der alle Religionen gelten ließ, der Gott überall und in allem sah: der ekstatischste Mensch, glaube ich, der jemals lebte. Dann kamen Coraopolis, Aliquippa, Wampun. Danach Niles, der Geburtsort von Präsident McKinley, und Warren, der Geburtsort von Kenneth Patchen. Dann Youngstown – und zwei Mädchen gehen den Abhang neben den Eisenbahnschienen in der phantastischsten Szenerie hinunter, die ich, seitdem ich von Kreta abgereist bin, zu Gesicht bekommen habe. Sofort bin ich wieder auf dieser alten griechischen Insel, stehe am Rand einer Gruppe von Menschen in den Außenbezirken von Heraklion, nur einige Meilen von Knossos entfernt. Es gibt keine Eisenbahn auf der Insel, die sanitären Verhältnisse sind schlecht, der Staub ist dick, überall sind Fliegen, das Essen ist lausig – aber es ist wundervoll, eine der wundervollsten Stellen auf der ganzen Welt. Wie in Youngstown am Bahnhof gibt es hier einen Steilhang, und eine griechische Bäuerin steigt langsam hinunter, einen Korb auf dem Kopf, mit nackten Füßen, Balance im Körper. Hier hört die Ähnlichkeit auf ...
Wie jedermann weiß, hat Ohio dem Land mehr Präsidenten beschert als jeder andere Staat der Union. Präsidenten wie McKinley, Hayes, Garfield, Grant, Harding – schwache, charakterlose Männer. Es hat uns auch Schriftsteller wie Sherwood Anderson und Kenneth Patchen geschenkt – der eine überall auf der Suche nach Poesie und der andere fast zum Wahnsinn getrieben angesichts der Schlechtigkeit und Häßlichkeit überall. Der eine wandert einsam bei Nacht durch die Straßen und erzählt uns von dem imaginären Leben, das hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Der andere wird durch das, was er sieht, so von Leid und Kummer gepeinigt, daß er den Kosmos unter dem Aspekt von Blut und Tränen neu erschafft, ihn auf den Kopf stellt und sich vor Abscheu und Ekel von ihm abwendet. Ich bin froh, daß ich die Gelegenheit hatte, diese Städte Ohios zu sehen, diesen Mahoning River, der aussieht, als sei die giftige Galle der ganzen Menschheit in ihn geschüttet worden, obwohl er in Wahrheit vielleicht nichts Schlimmeres als die Chemikalien und Abfallprodukte der Walzwerke und Fabriken enthält. Ich bin froh, daß ich Gelegenheit hatte, die Farbe der Erde hier im Winter zu sehen – eine Farbe nicht von Alter und Vergänglichkeit, sondern von Krankheit und Sorge. Froh bin ich, daß ich die Rhinozeros-häutigen Felsbänke sehen konnte, die sich über dem Flußufer erheben und im blassen Licht des Winternachmittags den Wahnsinn eines der Rivalität und dem Haß verfallenen Planeten widerspiegeln. Froh, daß ich einen Blick auf jene Schlackenhügel werfen konnte, die aussehen wie die gehäuften Exkremente kränklicher vorsintflutlicher Ungeheuer, die in der Nacht hier vorüberkamen. Es hilft mir, die düstere, monströse Dichtung zu verstehen, die der Jüngere von beiden aussondert, um den Verstand zu behalten. Es hilft mir zu verstehen, warum der ältere Schriftsteller Wahnsinn vortäuschen mußte, um dem Gefängnis zu entgehen, in dem er sich befand, als er in der Farbenfabrik arbeitete. Es hilft mir zu verstehen, warum Wohlstand, der auf diesem Lebensniveau aufgebaut ist, Ohio zum Ursprungsland von Präsidenten und zu einem Ort der Verfolgung genialer Männer machen konnte.
Die Autos, die vor den Walzwerken und Fabriken parken, bieten den traurigsten Anblick von allen. Das Auto ragt für mich heraus als das eigentliche Symbol von Lüge und Illusion. Da sind sie, Tausende und Abertausende von ihnen, in solchem Überfluß, daß es scheinen möchte, als sei niemand zu arm, eines zu besitzen. In Europa, Asien, Afrika blicken die schuftenden Menschenmassen mit feuchten Augen auf dieses Paradies, in dem der Arbeiter im eigenen Wagen zur Arbeit fährt. Was für eine herrliche Welt der unbegrenzten Möglichkeiten muß das sein, so denken sie bei sich. (Wenigstens möchten wir gerne glauben, daß sie das tun!) Nie fragen sie, was man für diese große Annehmlichkeit tun muß. Sie können sich nicht vorstellen, daß der amerikanische Arbeiter, wenn er aus dieser schimmernden Blechkutsche steigt, sich mit Leib und Seele der verdummendsten Schwerarbeit ausliefert, die ein Mensch verrichten kann. Sie haben keine Ahnung, daß es möglich ist, selbst wenn man unter den bestmöglichen Bedingungen arbeitet, alle Rechte als Mensch einzubüßen. Sie wissen nicht, daß die bestmöglichen Bedingungen (im amerikanischen Jargon) die größten Gewinne für den Boss bedeuten, die äußerste Versklavung für den Arbeiter, die größte Verwirrung und Desillusionierung für die Öffentlichkeit im allgemeinen. Sie sehen nur einen wundervollen, lackglänzenden Wagen, der wie eine Katze schnurrt. Sie sehen endlose Asphaltstraßen, so glatt und makellos, daß der Fahrer Mühe hat, sich wach zu halten. Sie sehen Kinos, die wie Paläste wirken, sie sehen Kaufhäuser mit Schaufensterpuppen, die wie Prinzessinnen gekleidet sind. Sie sehen den Glanz und die Tünche, die Nippsachen, die Haushaltgeräte, die Luxusgegenstände; die Bitterkeit im Herzen, die Skepsis, den Zynismus, die Leere, die Sterilität, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die am amerikanischen Arbeiter nagen, sehen sie nicht. Sie wollen das nicht sehen – sie stecken selbst im Elend. Sie wollen einen Ausweg: Sie wollen den tödlichen Komfort, die Annehmlichkeiten, den Luxus. Und sie folgen unseren Fußstapfen – blind, kopflos, rücksichtslos.