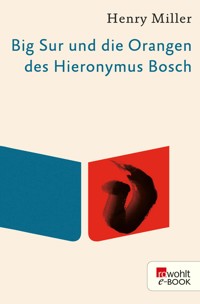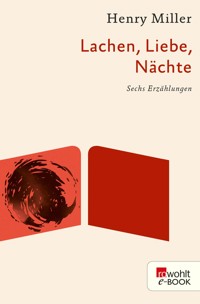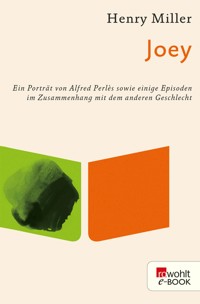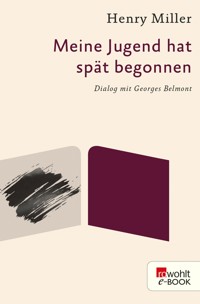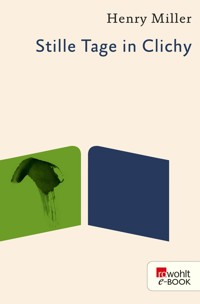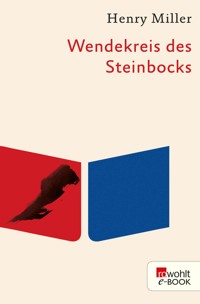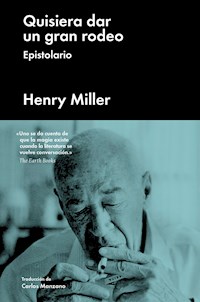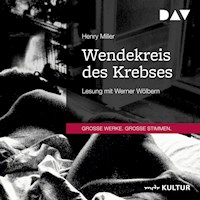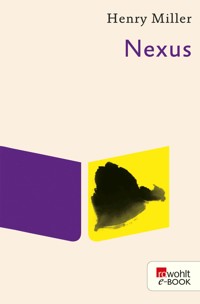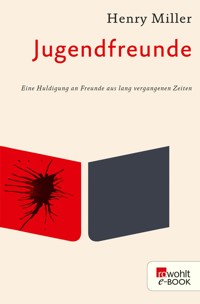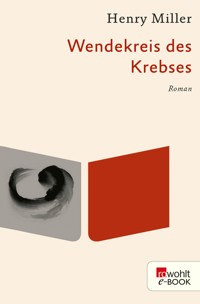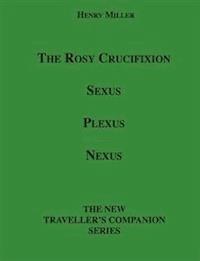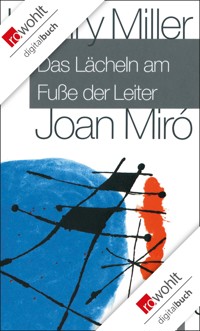9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch, teils leidenschaftliches Plädoyer, teils biographia literaria, gibt, wie Lawrence Durrell in seinem Vorwort schreibt, «dem Leser den Schlüssel zum Universum Millers». Es entstand zwischen den beiden großen autobiographischen Zyklen, den «Wendekreisen» und der Trilogie «Sexus», «Plexus» und «Nexus», in einem Jahr der Rückschau und Neuorientierung – in den gleichen Monaten, in denen Miller nach der Rückkehr aus Frankreich 1940 den Roman «Stille Tage in Clichy» schrieb. Ein Buchhändler in Chicago, Ben Abrahamson vom Argus Book Shop, brachte «Die Welt des Sexus» als Privatdruck heraus, in einer Auflage von 250 Exemplaren. «Als diese Ausgabe», erinnert sich Henry Miller, «vergriffen und der Verleger gestorben war, entschloss ich mich, sie meinem Pariser Verleger zu geben, damit er sie seiner Bibliothek verbotener Bücher einverleibte – der ‹Wendekreis›-Serie. Beim Wiederlesen fing ich an, Korrekturen zu machen; es wurde ein Spiel, das mich verführte, es bis zu Ende zu spielen. Jede Seite der Originalfassung ging ich mit Feder und Tinte durch, schraffierend und kreuz und quer darin herumstreichend, bis es aussah wie ein chinesisches Vexierbild. In der neuen Ausgabe (auch in der deutschen) sind einige dieser korrigierten Seiten abgebildet; der Leser mag selbst urteilen, auf was für eine Aufgabe ich mich da eingelassen hatte.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Henry Miller
Die Welt des Sexus
Über dieses Buch
Dieses Buch, teils leidenschaftliches Plädoyer, teils biographia literaria, gibt, wie Lawrence Durrell in seinem Vorwort schreibt, «dem Leser den Schlüssel zum Universum Millers». Es entstand zwischen den beiden großen autobiographischen Zyklen, den «Wendekreisen» und der Trilogie «Sexus», «Plexus» und «Nexus», in einem Jahr der Rückschau und Neuorientierung – in den gleichen Monaten, in denen Miller nach der Rückkehr aus Frankreich 1940 den Roman «Stille Tage in Clichy» schrieb.
Ein Buchhändler in Chicago, Ben Abrahamson vom Argus Book Shop, brachte «Die Welt des Sexus» als Privatdruck heraus, in einer Auflage von 250 Exemplaren. «Als diese Ausgabe», erinnert sich Henry Miller, «vergriffen und der Verleger gestorben war, entschloss ich mich, sie meinem Pariser Verleger zu geben, damit er sie seiner Bibliothek verbotener Bücher einverleibte – der ‹Wendekreis›-Serie. Beim Wiederlesen fing ich an, Korrekturen zu machen; es wurde ein Spiel, das mich verführte, es bis zu Ende zu spielen. Jede Seite der Originalfassung ging ich mit Feder und Tinte durch, schraffierend und kreuz und quer darin herumstreichend, bis es aussah wie ein chinesisches Vexierbild. In der neuen Ausgabe (auch in der deutschen) sind einige dieser korrigierten Seiten abgebildet; der Leser mag selbst urteilen, auf was für eine Aufgabe ich mich da eingelassen hatte.»
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die Dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Impressum
Die Originalausgabe von «The World of Sex» veröffentlichte Ben Abramson, The Argus Bookshop, Chicago, im Jahre 1940. Die revidierte Fassung kam 1959 im Verlag Olympia Press, Paris, heraus.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2020
Copyright © 1960, 1977 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The World of Sex» Copyright © 1940, 1959 by Henry Miller
Covergestaltung Cover-Konzept anyway, Hamburg, Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung iStock/Gettyimages/subjob
ISBN 978-3-644-00663-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Lawrence Durrell Zu diesem Buch
Dieses Buch hat im Kanon Henry Millers einen Stellenwert, der ungefähr dem der Apokalypse im Werk des D.H. Lawrence entspricht: es gibt dem Leser den Schlüssel zum Universum Millers. Es ist nicht eben ein Essay und auch keine Kurzgeschichte, doch hat es etwas von beidem – ich möchte es ein Aquarell in Prosa nennen. Im 18. Jahrhundert hätte es wahrscheinlich den Titel Eine Vision von der Natur des Menschen bekommen. In diesem Buch macht der Autor Miller dem Visionär Miller Platz, wiewohl natürlich unser unvergleichlicher Amerikaner selbst bei all seinen Visionen noch seinen charakteristischen Sinn für Humor behält – diese Gabe, die ihn von Lawrence unterscheidet und in die Nähe Rabelais' rückt.
Ich denke, es ist angebracht, die «Botschaft» in Millers Werk zu erörtern, um herauszustellen, wie sehr sie jener Botschaft gleicht, die der gute Doktor Rabelais in seiner Vision von der Abtei Thélème uns hinterließ - jener idealen Welt, in der der Mensch sein ungeschmälertes Erbe antreten kann. Für Miller ist das Wort «Sexus» dasselbe wie für Rabelais «la Dive Bouteille». Er setzt es für alles, was unsere Kultur, unsere Methode des Selbst-Erkennens speist. Die moderne Zivilisation löst den Menschen aus seinem Boden, trennt ihn von seinen Wurzeln und läuft so Gefahr, die Gans zu töten, die das goldene Ei der Selbst-Bewußtheit, des Selbst-Begreifens legt. Millers ganzer langer Kampf inmitten der sogenannten Obszönitäten war ein Versuch, die Berührung mit dem Boden wiederherzustellen, das zu finden, war er den «prä-adamitischen» Menschen nennt – die verlorene Unschuld wiederzufinden, die dem Menschen vermutlich entglitt, als sich die Pforten von Eden hinter ihm schlossen. Um dies zu erreichen, hielt er es für notwendig, das Tabu ans Licht zu heben, das die menschliche Psyche deformiert und entstellt hat – ein Tabu, das die sexuellen Beziehungen bestimmte. Die Heftigkeit und das zornige Ungestüm seiner Attacke mußten schon ihrem Wesen nach viele Leute beleidigen, die nicht die Absicht erfaßten, welche dahinterstand; das liegt in der Natur der Dinge. Doch jene, die ihn mit ganz offenen Augen lasen, konnten mühelos erkennen, daß eine befruchtende und befreiende Gewalt von seinem Werk ausging. Es war keine Zertrümmerung um der Zertrümmerung willen. Es war ein Versuch, der Psyche des Menschen die ihr eigenen Kräfte zurückzugeben - die Kräfte der Selbst-Erkenntnis. Für Miller steht am Anfang und Ende der psychischen Erkenntnis die sexuelle. Er möchte die Schrecken bannen, die den Menschen daran hindern, zu seiner vollen Größe emporzuwachsen. Als Künstler vermochte er das am besten dadurch zuwege zu bringen, daß er seine eigenen Wurzeln aufspürte, daß er auf den Grund seiner eigenen psychischen Dissonanz tauchte. Seine Autobiographie stellt daher eine lange Suche nach dem prä-adamitischen Menschen in ihm selbst dar. Wenn er uns oft vor den Kopf stößt, uns oft verletzt, so nur deshalb, weil er uns zum Selbst-Verstehen aufrufen will, weil er uns zu unserer Reife drängen möchte.
In der Welt unserer Zeit, in der der Mensch in zunehmendem Maß eine soziologische Gleichung geworden ist, mehr eine Recheneinheit ist denn eine Seele, ist es wichtig, daß der Künstler auf der poetischen Schau der Dinge besteht, darauf besteht, daß wir das Unsterbliche an uns pflegen. In einer Welt steriler Gehirnkonstruktionen und eines so schweren Mißbrauchs der analytischen Fähigkeiten bedürfen wir mehr denn je des Gegengewichts der mystischen Schau. Die psychische Gesundheit des Menschen steht auf dem Spiel.
Dies also lese ich aus Millers Buch; doch ich werde hoffentlich nicht so verstanden, als ob es sich hier um eine wissenschaftliche Arbeit handele, um eine gelehrte Abhandlung – es ist nichts davon. Es ist wie ein Tanz, ein Gedicht in Prosa, in dem sich all seine großen Eigenschaften vereinen: dahinströmende Sprache, Offenheit und sprühendes Gelächter. Dieser große, unanfechtbare Schriftsteller ist sogar noch in seinen Sechzigern ein Schelm, ein Kind. Alle, die seine Eigenschaften lieben, werden sich der Bedeutung dieses Buches nicht verschließen.
Vorwort von Henry Miller
Die ursprüngliche Fassung dieses Buches wurde von einem Mann, der jetzt tot ist, als Privatdruck herausgegeben. Wie viele Exemplare gedruckt und verkauft wurden, konnte ich nie feststellen. Das Buch wurde unter dem Ladentisch gehandelt, und über die Anzahl der verkauften Exemplare wurden keine Aufzeichnungen gemacht. Wenigstens habe ich nie eine Aufstellung darüber erhalten.
Seit dem Tode des Verlegers war das Buch vergriffen. Da es nur eine beschränkte Verbreitung gefunden hatte und da wahrscheinlich kein englischer oder amerikanischer Verleger es wieder drucken würde, entschloß ich mich, eine neue Ausgabe in Frankreich herauszubringen, wo alle verbotenen Bücher, die meinen Namen tragen, erschienen sind und noch erscheinen.
Bevor ich es jedoch der Post anvertraute, hielt ich es für ratsam, noch einmal durchzulesen, was ich vor so langer Zeit (1940) geschrieben hatte. Während der Lektüre begann ich (ganz unwillkürlich) Änderungen und Verbesserungen anzubringen, ohne daß ich mir träumen ließ, auf was ich mich da eingelassen hatte. Wenn der Leser die beigegebenen Korrekturseiten aufschlagen will, wird er selbst sehen, mit welcher fast diabolischen Begeisterung ich mich über diese Umarbeitung hergemacht habe.
Als ich mit ihr fast fertig war, kam mir der Gedanke, es möchte vielleicht, besonders für solche Leser, die von der mühseligen Arbeit eines Schriftstellers mehr kennen wollen als den fertigen Text, interessant sein, die beiden Fassungen vergleichen zu können.
Da die neuen und die korrigierten Seiten beträchtlich voneinander abweichen, muß ich auch erwähnen, daß ich noch eine weitere vollständige Revision vornahm, die hier nicht gezeigt wird, von der jedoch die vorgelegte Fassung herstammt. Die bei der zweiten Revision aufgewandte Mühe war noch größer und noch aufregender als die mit dem ersten Versuch verbundene.
Ich möchte auch betonen, daß ich bei der Revision des ursprünglichen Textes nicht die Absicht hatte, den Gedanken zu ändern, sondern ihn klarer hervorzuheben. Ich hoffe, daß ist mir nicht mißlungen.
Die Welt des Sexus
Die Mehrzahl meiner Leser zerfällt, wie ich oft festgestellt habe, in zwei deutlich unterschiedene Gruppen. Zu der einen gehören jene, die behaupten, durch die reichliche Dosierung sexueller Schilderungen abgestoßen oder angeekelt zu werden, zu der anderen jene, die darüber höchst erfreut sind, daß dieses Element einen so großen Anteil hat. Zu der ersten Gruppe zählen viele, die meine Studien und Essays nicht nur lobenswert, sondern ihrem Geschmack besonders angemessen finden und die sich deshalb nur schwer erklären können, wie ein und derselbe Verfasser so stark voneinander abweichende Werke hervorbringen kann. In der zweiten Gruppe sind manche, die mit meiner sogenannten ernsten Seite höchst unzufrieden sind und denen es daher Spaß macht, alles, was darin zum Vorschein kommt, als dummes Zeug, Quatsch und Mystizismus zu bezeichnen. Nur ein paar einsichtige Seelen können anscheinend die angeblich widerspruchsvollen Seiten eines Menschen in Einklang bringen, der sich bemüht hat, keinen Teil seines Wesens zu unterdrücken.
Andererseits habe ich häufig genug erfahren, daß ein Leser, mit wie heftiger Ablehnung er auch auf mein Werk reagieren mag, mich schließlich von ganzem Herzen akzeptiert, sobald wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Aus den vielen Begegnungen, die ich mit meinen Lesern gehabt habe, geht hervor, daß Antipathien gegen einen Schriftsteller schnell verschwinden, wenn man ihn persönlich kennenlernt. Wiederholte Erlebnisse dieser Art ließen mich schließlich glauben, daß jeder Widerspruch zwischen dem Menschen und dem Schriftsteller, zwischen dem, was ich bin und dem, was ich tue oder sage, sich auflöst, wenn ich durch das geschriebene Wort die Wahrheit und Aufrichtigkeit meiner Gedanken in vollem Umfang vermitteln kann. Dies ist meiner bescheidenen Meinung nach das höchste Ziel, das sich ein Schriftsteller setzen kann. Dasselbe Ziel – das einigende Band zu finden – liegt allem religiösen Streben zugrunde. Da ich das weiß, bin ich immer ein religiöser Mensch gewesen. Auf die Frage, ob das Sexuelle und das Religiöse im Gegensatz stehen, möchte ich folgende Antwort geben: jedes Element oder jede Seite des Lebens, wie naturnotwendig oder wie fragwürdig sie auch (für uns) sei, ist einer Umwandlung zugänglich und muß unserer Entwicklung und unserem wachsenden Verständnis gemäß durch Verwandlung auf andere Ebenen erhoben werden. Die Bemühung, die «abstoßenden» Seiten des Daseins auszuschalten, was die fixe Idee der Moralisten ist, halte ich nicht nur für töricht, sondern auch für vergeblich. Es mag einem gelingen, häßliche «sündige» Gedanken und Wünsche, Regungen und Triebe zurückzudrängen, aber das Ergebnis ist sichtlich katastrophal. (Es bleibt fast nur die Wahl zwischen dem Heiligen und dem Verbrecher.) Seine Wünsche auszuleben und dadurch unmerklich ihre Natur zu ändern, ist das Ziel eines jeden Menschen, der nach Weiterentwicklung strebt. Aber das Verlangen selbst ist unüberwindlich und unausrottbar, selbst wenn es, wie die Buddhisten es ausdrücken, in sein Gegenteil umschlägt. Es muß einen danach verlangen, sich vom Verlangen zu befreien.
Dieses Thema hat mich immer stark interessiert. In meiner Jugend und noch lange nachher war ich heftigen Trieben ausgesetzt, die gänzlich unbezähmbar waren. In der letzten Zeit bin ich nach intensiver schöpferischer Tätigkeit mehr als je über den Gedankensumpf verblüfft, in dem die unaufhörliche Behandlung des Themas festgefahren ist.
Es war im Jahre 1935, als ich durch einen Freund, einen Okkultisten, das Buch Seraphita in die Hände bekam. Seraphita