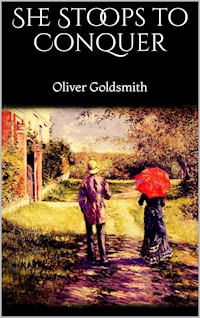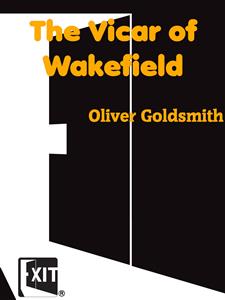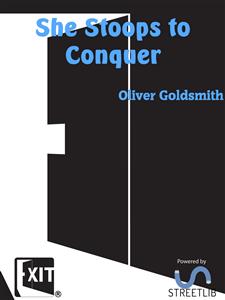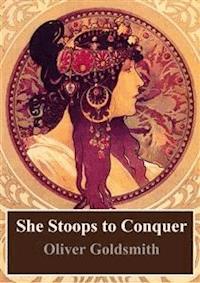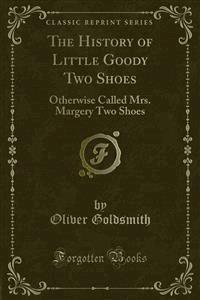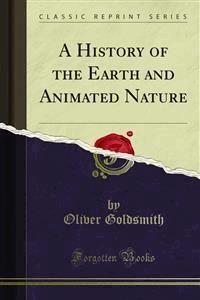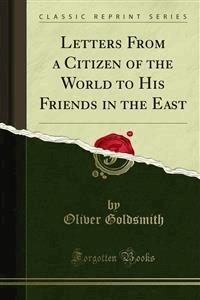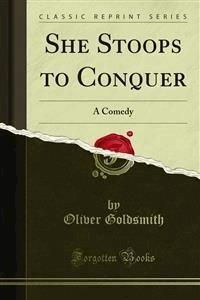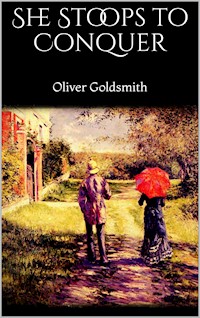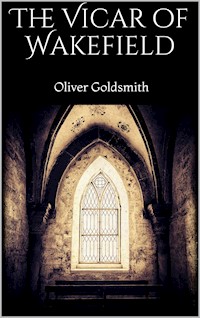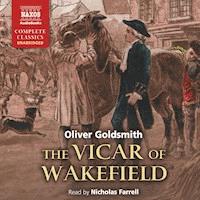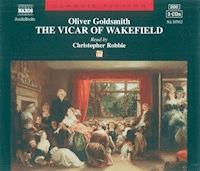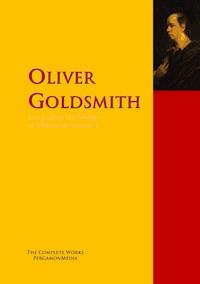Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Oliver Goldsmiths Empfindsamkeitsroman "Der Landprediger von Wakefield" schildert die Hauptfigur Reverend Dr. Charles Primrose den sozio-ökonomischen Fall und Aufstieg seiner Familie. Der im 18. und 19. Jahrhundert überaus erfolgreiche Roman wurde 1766 veröffentlicht und hat die literarische Tradition nachhaltig geprägt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Landprediger von Wakefield
Oliver Goldsmith
Inhalt:
Oliver Goldsmith – Biografie und Bibliografie
Der Landprediger von Wakefield
Vorwort.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Achtundzwanzigstes Kapitel.
Neunundzwanzigstes Kapitel.
Dreißigstes Kapitel.
Einunddreißigstes Kapitel.
Zweiunddreißigstes Kapitel.
Der Landprediger von Wakefield, Oliver Goldsmith
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849610814
www.jazzybee-verlag.de
Oliver Goldsmith – Biografie und Bibliografie
Engl. Dichter und Romanschriftsteller, geb. 10. Nov. 1728 im Dorfe Pallas in der irischen Grafschaft Longford, gest. 4. April 1774 in London, war der Sohn eines Geistlichen, der zwei Jahre später nach dem freundlichen Lissoy übersiedelte; hier empfing der Knabe jenen Sinn für landschaftliche Schönheit, der seinen Gedichten zu besonderem Vorteil gereicht. Von Verwandten unterstützt, erhielt er eine ziemlich unregelmäßige Vorbildung und bezog 1745 als Sizar (Armenstudent) das Trinity College zu Dublin, wo er 1749 Magister artium wurde. Als er sich aber einige Jahre darauf um ein geistliches Amt bewarb, wurde er abgewiesen: eine Demütigung, die ihn bestimmte, seine Familie heimlich zu verlassen und nach Amerika auszuwandern. Das Schiff, auf dem er einen Platz gemietet, stach aber ohne ihn in See, und von allen Mitteln entblößt, kehrte er heim. Seine Verwandten statteten ihn zum zweiten mal für die Universität aus, und G. begab sich 1752 nach Edinburgh, um Medizin zu studieren. Von da wandte er sich nach Leiden, wo er sein Studium vollendete, und durchwanderte sodann Frankreich, die Schweiz und Italien; er befand sich in dürftigster Lage und erwarb sein Brot z. T. durch Flötenspiel, in Italien durch Beteiligung an gelehrten Disputationen. In Padua soll er die Doktorwürde erlangt haben. 1756 nach London zurückgekehrt, versuchte er sich in verschiedenen Lebensstellungen, als Apotheker, Arzt, Lehrer, endlich als Schriftsteller. Zunächst führte er Lohnarbeiten für Buchhändler aus. Allmählich besserte sich seine Lage; mancherlei Verbindungen und Erfolge hoben ihn; indessen kam er bei seiner kindlichen Gutmütigkeit und seinem Hang zum Vergnügen nicht aus den Schulden heraus. Sein dichterischer Ruhm erwuchs durch drei Originalwerke. das Gedicht »The traveller« (1764), worin der Dichter von der Höhe der Alpen Italien, Schweiz, Frankreich und Holland überblickt und ihren Glückszustand mit dem Englands vergleicht; die Elegie »The deserted village« (1770; beide deutsch von A. v. Bohlen, Berl. 1869), welche die Austreibung der Bewohner aus einem blühenden Dorfe durch einen städtischen Luxusmenschen schildert; und den idyllischen Familienroman »The vicar of Wakefield« (1766; oft übersetzt, z. B. von Susemihl, Leipz. 1841 u. ö.; Eitner, Hildburghausen 1867), worin die Erlebnisse eines humanen Dorfgeistlichen in Glück und Prüfung, endlich sein heldenhaftes Missionstum im Gefängnis, mit einer schlicht ergreifenden, in natürlichen Humor hinüberspielenden Wärme dargestellt wird. All diese Werke wurden auch auf die deutsche Literatur, besonders auf Goethe, von Einfluss. Als dramatischer Dichter bewährte sich G., indem er statt der ausschließlich herrschenden Possen wieder Lustspiele schrieb: »The good natured man« (1767 geschrieben) und »She stoops to conquer« (1772; wiederholt nachgeahmt, z. B. von Schröder: »Irrtum auf allen Ecken«). In seinen »Essays« (gesammelt zuerst 1715; deutsch, Basel 1780) zeigte G. die Fähigkeit, in leichter, anregender Weise über die verschiedensten Gegenstände zu schreiben; da sind Erzählungen wie »Asem« und »History of a strolling player«; ferner Kritiken (besonders »Enquiry into the present state of polite learning in Europe«, 1759), worin G. vielfach der Romantik vorarbeitete; endlich die Londoner Schilderungen eines fingierten Chinesen, genannt »Citizen of the world« (1762; deutsch, Leipz. 1781), in denen G. in der Weise von Montesquieus Perser einen Chinesen über England und die Engländer eine scheinbar naive Persiflage üben lässt. Seine historischen Arbeiten. »History of England, in a series of letters from a nobleman to his son« (1762), »Roman history« (1769, 2 Bde.; deutsch von Kosegarten, Leipz. 1792–1802, 4 Bde.), »History of England« (1771, 4 Bde.; deutsch von Schröckh, Leipz. 1774–76), »History of Greece« (1773, 2 Bde.; deutsch, Leipz. 1807) sind stilgewandte Kompilationen und nicht zuverlässig. Eine ähnliche Darstellung der Naturgeschichte. »History of the earth and animated nature« (1774; neue Aufl. von Turton, 1816), hinterließ er unvollendet. Auch eine Enzyklopädie der Künste und Wissenschaften, die G. mit Garrick, Johnson und dem Maler Reynolds herausgeben wollte, blieb unausgeführt. Eine Sammlung seiner poetischen Werke und Dramen erschien zuerst in Dublin 1777 in 2 Bänden, dann 1780 in London und öfter; seine »Miscellaneous works« erschienen zuerst in Perth 1792 (7 Bde.) und öfter, sorgfältiger von Prior (1837, 4 Bde., mit Biographie), von P. Cunningham (Lond. 1855, 4 Bde.) und am besten von J. W. Gibbs (das. 1884–86, 5 Bde.). Die beste deutsche Übersetzung der poetischen Werke Goldsmiths lieferte Adolf Böttger (Leipz. 1843). Vgl. Forster, Life and adventures of Oliver G. (6. Aufl., Lond. 1877); Karsten, Oliver G. (Straßb. 1873); Laun, Oliver G. (Berl. 1876); Black, Oliver G. (Lond. 1879 u. ö.); A. Dobson, G. (das. 1888); Neuendorf, Entstehungsgeschichte von Goldsmiths »Vicar of Wakefield« (Berl. 1904).
Der Landprediger von Wakefield
Vorwort.
Gewiß sind hundert Fehler in diesem Buche, und hundert Dinge ließen sich sagen, zu beweisen, daß es Schönheiten sind. Doch das ist nutzlos. Auch bei vielen Mängeln kann ein Buch unterhaltend sein, und dagegen sehr langweilig, ohne eine einzige Abgeschmacktheit. Der Held dieser Erzählung vereinigt die drei größten Charaktere auf Erden in sich: er ist Geistlicher, Landwirth und Familienvater. Er ist geschildert: eben so bereit zu lehren, als zu gehorchen, eben so demüthig im Glück, als groß im Mißgeschick. Wem kann aber in diesem Zeitalter des Ueberflusses und der Verfeinerung ein solcher Charakter gefallen? Wer ein vornehmes Leben liebt, wird sich mit Verachtung von seinem einfachen ländlichen Herde hinwegwenden. Wer Zoten für Humor hält, wird keinen Witz in seinem harmlosen Gespräche finden; und wer gelernt über Religion zu spotten, wird den Mann verlachen, der seine vorzüglichsten Trostgründe aus dem künftigen Leben schöpft.
Oliver Goldsmith.
Erstes Kapitel.
Schilderung der Familie von Wakefield, in der eine Familienähnlichkeit in Betreff der Gemüther und Personen herrscht.
Ich war stets der Ansicht, daß der rechtschaffene Mann, wenn er sich verheirathet und eine zahlreiche Familie auferzieht, mehr Nutzen stiftet, als wenn er unverheiratet bleibt und nur von Bevölkerung redet. Kaum war ich ein Jahr im Amte, als ich auch schon, von diesem Beweggrunde bestimmt, ernstlich an meine Verheirathung zu denken begann und meine Frau wählte, gerade wie sie ihr Brautkleid, nicht nach einem glänzenden Aeußern, sondern nach dauernden Eigenschaften. Um ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muß ich sagen, daß sie eine gutmüthige, betriebsame Frau war; und hinsichtlich der Bildung gab es wenig Landmädchen, die ihr darin gleichkamen. Sie konnte jedes englische Buch lesen, ohne viel zu buchstabiren. Aber im Einpökeln, Einmachen und in der Kochkunst wurde sie von Keiner übertroffen. Sie rühmte sich auch einer trefflichen Erfindungsgabe im Haushalt, obgleich ich nicht bemerkte, daß wir bei all ihren Erfindungen reicher wurden.
Doch liebten wir einander innig, und unsere Zärtlichkeit nahm mit den Jahren zu. Nichts konnte uns mit der Welt oder einander entzweien. Wir hatten ein hübsches Haus, in einer anmuthigen Gegend gelegen, und gute Nachbarn. Das Jahr verging bei geistigen und ländlichen Freuden, indem wir unsere reichen Nachbarn besuchten und die armen unterstützten. Wir hatten keine Glückswechsel zu fürchten, keine Beschwerden zu erdulden. All unsere Abenteuer geschahen an unserm Kamin und all unsere Auswanderungen gingen nur von dem blauen Bette zu dem braunen.
Da wir nahe an der Landstraße wohnten, hatten wir oft Besuche von Reisenden, die unsern Stachelbeerwein kosten wollten, dessen Trefflichkeit allgemein bekannt war, und ich versichere mit der Wahrhaftigkeit eines Geschichtschreibers, daß ihn, so viel ich weiß, Niemand jemals tadelte. Alle unsere Vettern, selbst bis zum vierzigsten Grade, erinnerten sich ihrer Verwandtschaft, ohne den Stammbaum zu Hülfe zu nehmen, und besuchten uns häufig. Einige von ihnen erwiesen uns freilich keine große Ehre durch ihren Anspruch auf Verwandtschaft. Blinde, Lahme und Bucklige befanden sich unter ihnen. Dessenungeachtet bestand meine Frau darauf, daß sie als unser eigenes Fleisch und Blut mit uns an demselben Tische sitzen sollten. So hatten wir zwar keine reiche, aber gewöhnlich sehr glückliche Freunde um uns; denn diese Bemerkung bestätigt sich im Leben: je ärmer der Gast, desto besser ist er stets mit seiner Aufnahme zufrieden, – und wie manche Menschen die Farben einer Tulpe oder einen Schmetterlingsflügel mit Bewunderung betrachten, so war ich von Natur ein Bewunderer fröhlicher Menschengesichter. Doch wenn sich unter unsern Verwandten eine Person von schlechtem Charakter, oder ein zänkischer Gast fand, den wir gern los sein wollten, unterließ ich es nie, ihm beim Abschied einen Oberrock oder ein Paar Stiefeln, zuweilen auch wohl ein Pferd von geringem Werthe zu leihen, und beständig hatte ich das Vergnügen, daß er nie wiederkam und das Geliehene zurückbrachte.
Auf diese Weise wurde das Haus von denen befreit, die uns nicht gefielen; doch konnte man nicht sagen, daß die Familie von Wakefield je einem Reisenden oder Hülfsbedürftigen die Thür gewiesen. So lebten wir mehrere Jahre in sehr glücklichem Zustande. Freilich fehlte es nicht an jenen kleinen Widerwärtigkeiten, welche die Vorsehung sendete, um den Werth ihrer Gaben zu erhöhen. Mein Obstgarten ward oft geplündert von Schulknaben und die Eierkäse meiner Frau wurden von Katzen benascht oder von den Kindern. Der Gutsherr schlief zuweilen bei den erhabensten Stellen meiner Predigt ein, oder seine Gemahlin erwiederte die tiefe Verbeugung meiner Frau mit gnädigem Kopfnicken. Doch verschmerzten wir bald den Kummer über dergleichen Vorfälle, und nach drei oder vier Tagen wunderten wir uns meistens, wie dergleichen uns nur habe beunruhigen können.
Meine Kinder, die Sprößlinge der Mäßigung, wurden nicht weichlich erzogen, und waren daher wohlgebildet und gesund: meine Söhne rüstig und lebhaft, meine Töchter schön und blühend. Wenn ich so da stand in der Mitte des kleinen Kreises, der mir in meinem Alter eine Stütze zu werden verhieß, fiel mir beständig die bekannte Geschichte des Grafen von Abensberg ein, der bei Heinrichs des Zweiten Reise durch Deutschland, als andere Höflinge mit ihren Schätzen ankamen, seine zwei und dreißig Söhne brachte und sie seinem Monarchen darbot, als das kostbarste Geschenk, welches er ihm gewähren könne. Obgleich ich nur sechs hatte, so betrachtete ich sie doch als die werthvollste Gabe, die ich meinem Vaterlande dargebracht, und hielt dasselbe demnach für meinen Schuldner. Unser ältester Sohn hieß Georg, nach seinem Onkel, der uns zehntausend Pfund hinterließ. Unser zweites Kind, ein Mädchen, beabsichtigte ich nach ihrer Tante Gretchen zu nennen; doch meine Frau, die während ihrer Schwangerschaft Romane gelesen hatte, bestand darauf, daß sie Olivia solle genannt werden. In weniger als einem Jahre hatten wir eine zweite Tochter, und nun war ich fest entschlossen, daß sie Gretchen genannt werden solle; doch eine reiche Verwandte bekam den Einfall, Pathenstelle zu vertreten, und so ward das Mädchen nach ihrem Wunsche Sophie genannt. So hatten wir denn zwei romanhafte Namen in der Familie. Doch betheuere ich feierlichst, daß ich nicht dabei im Spiele war. Moses war unser nächster Sohn, und zwölf Jahre später hatten wir noch zwei Söhne.
Es würde vergebens sein, meinen Stolz zu leugnen, wenn ich mich von meinen Kindern umgeben sah; doch die Eitelkeit und Freude meiner Frau übertraf noch die meinige. Wenn unsere Gäste sagten: "Das muß wahr sein, Mistreß Primrose, Sie haben die schönsten Kinder im ganzen Lande," so pflegte sie zu antworten: "Ja, Nachbar, sie sind, wie der Himmel sie geschaffen hat – hübsch genug, wenn sie nur gut genug sind; denn schön ist, wer schön handelt." – Und dann gebot sie den Mädchen, die Köpfe hübsch aufrecht zu tragen. Um aber nichts zu verschweigen, muß ich gestehen, daß sie wirklich sehr schön waren. Das Aeußere ist für mich ein so unbedeutender Gegenstand, daß ich es kaum würde erwähnt haben, wäre nicht in der Gegend allgemein davon die Rede gewesen. Olivia, jetzt etwa achtzehn Jahre alt, besaß jene glänzende Schönheit, in welcher die Maler gewöhnlich Hebe darzustellen pflegen, heiter, lebhaft und gebietend. Sophiens Schönheit fiel nicht sogleich in's Auge; doch war ihre Wirkung oft um so sicherer, denn sie war sanft, bescheiden und anziehend. Die Eine siegte beim ersten Anblick, die Andere durch wiederholte Eindrücke. Der weibliche Charakter spricht sich meistens in den Gesichtszügen aus; wenigstens war dies bei meinen Töchtern der Fall. Olivia wünschte sich viele Liebhaber, Sophie wollte nur einen Einzigen fesseln. Olivia zeigte sich oft aus zu großer Gefallsucht affectirt. Sophie verbarg selbst ihre Vorzüge, aus Furcht, Andere dadurch zu kränken. Die Eine ergötzte mich durch ihre Munterkeit, wenn ich heiter, die Andere durch ihr tiefes Gefühl, wenn ich ernst gestimmt war. Diese Eigenheiten wurden aber von Beiden nicht übertrieben, und ich habe oft gesehen, wie sie einen ganzen Tag ihre Charakter gegen einander vertauschten. Ein Trauerkleid vermochte meine Kokette in eine Spröde umzuwandeln und ein neuer Bandbesatz ihrer jüngern Schwester mehr als gewöhnliche Lebhaftigkeit zu verleihen. Mein ältester Sohn Georg war zu Oxford gebildet, da ich ihn für ein gelehrtes Fach bestimmte. Mein zweiter Knabe Moses, der Geschäftsmann werden sollte, erhielt zu Hause eine Art von gemischter Erziehung. Doch würde es zwecklos sein, eine Schilderung der besondern Charaktere junger Leute zu entwerfen, die noch sehr wenig von der Welt gesehen hatten. Kurz eine Familienähnlichkeit herrschte in allen; oder eigentlicher gesagt, sie hatten alle nur einen Charakter, nämlich den, daß sie gleich edel, leichtgläubig, unerfahren und harmlos waren.
Zweites Kapitel.
Familienunglück. – Der Verlust des Vermögens dient nur dazu, den Stolz der Rechtschaffenen zu vermehren.
Die irdische Sorge für unsere Familie war hauptsächlich der Leitung meiner Frau übertragen; die geistigen Angelegenheiten hatte ich gänzlich unter meiner Aufsicht. Die Einkünfte meiner Stelle, die jährlich etwa fünfunddreißig Pfund Sterling betrugen, hatte ich den Waisen und Wittwen der Geistlichkeit unseres Kirchsprengels überwiesen; denn da ich ein hinlängliches Vermögen besaß, so kümmerte ich mich wenig um das Zeitliche und fand ein geheimes Vergnügen daran, ohne Belohnung meine Pflicht zu thun. Ich faßte auch den Entschluß, keinen Gehülfen zu halten, mit allen Gemeinde-Mitgliedern bekannt zu werden, die verheirateten Männer zur Mäßigung und die Junggesellen zum Ehestande zu ermuntern. So wurde es in wenig Jahren zum allgemeinen Sprichwort: es wären drei seltsame Mängel in Wakefield – dem Prediger fehle es an Hochmuth, den Junggesellen an Frauen und den Bierhäusern an Gästen.
Der Ehestand war stets mein Lieblingsthema gewesen, und ich schrieb mehrere Abhandlungen, um den Nutzen und das Glück desselben zu beweisen. Doch gab es einen besonderen Satz, den ich zu vertheidigen suchte. Ich behauptete mit Whiston, es sei einem Priester der englischen Kirche nicht erlaubt, nach dem Tode seiner ersten Frau eine zweite zu nehmen; oder um es in einem Worte auszudrücken, ich war stolz darauf, ein strenger Monogamist zu sein.
Schon früh ließ ich mich auf diesen wichtigen Streit ein, über den schon so viele mühsam ausgearbeitete Werke geschrieben worden. Ich ließ einige Abhandlungen über diesen Gegenstand drucken, und da sie nie in den Buchhandel kamen, tröstete ich mich damit, daß sie nur von wenigen Glücklichen gelesen worden. Einige von meinen Freunden nannten dies meine schwache Seite; doch leider hatten sie die Sache nicht wie ich zum Gegenstande langen Nachdenkens gemacht. Je mehr ich darüber nachsann, desto wichtiger erschien sie mir. Ich ging in der Entwicklung meiner Grundsätze sogar noch einen Schritt weiter als Whiston, der in der Grabschrift seiner Frau bemerkte, daß sie Wilhelm Whistons einzige Gattin gewesen. Ich schrieb eine ähnliche Grabschrift für meine noch lebende Frau, und rühmte darin ihre Klugheit, Sparsamkeit und ihren Gehorsam bis zum Tode. Diese Grabschrift wurde zierlich abgeschrieben und in einem schönen Rahmen über dem Kamingesims angebracht, wo sie manche nützliche Zwecke beförderte. Sie erinnerte meine Frau an ihre Pflicht gegen mich und mich an meine Treue gegen sie. Sie begeisterte sie zum Streben nach Ruhm und stellte ihr stets ihr Lebensende vor Augen.
Vielleicht kam es von dem häufigen Anhören der Lobreden auf den Ehestand, daß mein ältester Sohn kurz nach seinem Abgange von der Universität seine Neigung auf die Tochter eines benachbarten Geistlichen richtete, der eine hohe Würde in der Kirche bekleidete und im Stande war, ihr eine bedeutende Mitgift zu geben. Vermögen war jedoch ihr geringster Vorzug. Fräulein Arabella Wilmot wurde von Allen, meine beiden Töchter ausgenommen, für eine vollendete Schönheit gehalten. Ihre Jugend, Gesundheit und Unschuld wurden noch durch einen so zarten Teint und einen so seelenvollen Blick erhöht, daß selbst ältere Personen sie nicht mit Gleichgültigkeit ansehen konnten. Da Herr Wilmot wußte, daß ich meinen Sohn anständig ausstatten könne, so war er der Verbindung nicht entgegen, und beide Familien lebten in all der Eintracht, die meistens einer erwarteten Verbindung voranzugehen pflegt. Da ich aus eigener Erfahrung wußte, daß die Tage des Brautstandes die glücklichsten unseres Lebens sind, so war ich sehr geneigt, diese Periode zu verlängern, und die mannichfachen Freuden, die das junge Paar täglich mit einander genoß, schienen ihre Liebe nur noch zu vermehren. Morgens wurden wir gewöhnlich durch Musik erweckt, und an heitern Tagen ritten wir auf die Jagd. Die Stunden zwischen dem Frühstück und der Hauptmahlzeit widmeten die Damen dem Ankleiden und der Lectüre. Sie lasen gewöhnlich eine Seite und betrachteten sich dann im Spiegel, dessen Fläche, was selbst Philosophen zugeben müssen, oft höhere Schönheit zeigte, als die, welche im Buche enthalten ist. Beim Mittagsmahl übernahm meine Frau die Leitung, und da sie stets darauf bestand, Alles selber vorlegen zu wollen, so theilte sie uns bei solchen Gelegenheiten zugleich die Geschichte jedes Gerichtes mit. Wenn das Mittagsessen geendet war, ließ ich gewöhnlich den Tisch wegnehmen, damit uns die Damen nicht verlassen möchten, und zuweilen gaben uns die Mädchen mit Hülfe des Musiklehrers ein angenehmes Concert. Spazierengehen, Theetrinken, ländliche Tänze und Pfänderspiele verkürzten den übrigen Theil des Tages, ohne Hülfe der Karten, denn ich haßte jedes Glücksspiel, Trictrac ausgenommen, in welchem mein alter Freund und ich zuweilen eine Zweipfennigpartie wagten. Einen Umstand übler Vorbedeutung darf ich hier nicht übergehen, der sich ereignete, als wir das letzte Mal mit einander spielten. Mir fehlte nämlich nur noch ein Wurf von Vieren, und doch warf ich fünfmal nach einander zwei Asse.
Einige Monate waren auf diese Weise vergangen, als wir es endlich für passend hielten, den Hochzeitstag des jungen Paares zu bestimmen, das ihn mit Sehnsucht zu erwarten schien. Weder die wichtige Geschäftigkeit meiner Frau, während der Vorbereitungen zur Hochzeit, noch die schlauen Blicke meiner Töchter will ich zu schildern wagen. Meine Aufmerksamkeit war auf einen ganz andern Gegenstand gerichtet, nämlich auf die Vollendung einer Abhandlung über mein Lieblingsthema, die ich baldigst herauszugeben gedachte. Da ich dieselbe hinsichtlich des Inhalts und Styles als ein Meisterstück betrachtete, konnte ich mich in dem Stolze meines Herzens nicht enthalten, sie meinem alten Freunde Herrn Wilmot zu zeigen, da ich nicht zweifelte, daß er mir seine Billigung würde zu Theil werden lassen. Doch erst als es schon zu spät war, entdeckte ich, daß er ein leidenschaftlicher Anhänger der entgegengesetzten Meinung sei, und zwar aus gutem Grunde, weil er eben um die vierte Frau warb. Wie sich erwarten läßt, entstand ein Streit daraus, der mit einiger Heftigkeit geführt wurde und unsere beabsichtigte Familienverbindung zu unterbrechen drohte. Doch kamen wir überein, über jenen Gegenstand am Tage vor der Hochzeit ausführlicher zu verhandeln.
Der Kampf begann mit gehörigem Muthe von beiden Seiten. Er behauptete, ich sei heterodox; ich gab ihm die Beschuldigung zurück. Er entgegnete und ich erwiederte. Als der Streit am heftigsten war, ward ich von einem meiner Verwandten aus dem Zimmer gerufen, der mir mit besorgter Miene rieth, den Streit wenigstens so lange einzustellen, bis die Trauung meines Sohnes geschehen sei. "Wie?" rief ich, "ich sollte die Sache der Wahrheit verlassen und zugeben, daß er ein Ehemann werde, nachdem ich ihn bereits so in die Enge getrieben, daß er nicht zurück kann? Eben so gut könnten Sie mir sagen, ich solle mein Vermögen aufgeben als diesen Streit." – "Ihr Vermögen," entgegnete mein Freund, "es thut mir leid, es sagen zu müssen, – ist so gut wie verloren. Der Kaufmann in der Stadt, dessen Händen Sie Ihr Geld übergaben, hat sich davon gemacht, um dem Bankerottgesetze zu entgehen, und man glaubt, daß kaum ein Schilling vom Pfunde übrig bleiben wird. Diese unangenehme Nachricht wollte ich Ihnen und der Familie erst nach der Hochzeit mittheilen. Jetzt aber möge sie dazu dienen, Ihre Hitze in dem Streite zu mäßigen; denn gewiß wird Ihre eigene Klugheit Ihnen die Nothwendigkeit der Verstellung wenigstens so lange empfehlen, bis Ihr Sohn das Vermögen der jungen Dame in Händen hat." – "Gut," erwiederte ich, "wenn es wahr ist, was Sie sagen und ich ein Bettler bin, so soll mich das doch nicht zu einem Schurken machen, oder mich nöthigen, meine Grundsätze zu verleugnen. Ich gehe sogleich, die ganze Gesellschaft mit meiner Lage bekannt zu machen. Was aber den Streitpunkt betrifft, so nehme ich jetzt sogar zurück, was ich früher dem alten Herrn zugestanden habe, und er soll jetzt durchaus kein Ehemann sein in irgend einem Sinne des Worts."
Es würde endlos sein, wollte ich die verschiedenen Empfindungen beider Familien bei dieser unglücklichen Nachricht schildern. Doch was die Andern fühlten, war unbedeutend gegen das, was die Liebenden zu erdulden schienen. Herr Wilmot, der schon früher geneigt geschienen, die Verbindung abzubrechen, faßte bei diesem Schlage bald seinen Entschluß. Eine Tugend besaß er im vollkommensten Grade, nämlich die Klugheit – leider oft die einzige, die uns im zwei und siebzigsten Jahre noch übrig ist.
Drittes Kapitel.
Eine Auswanderung. – Im Allgemeinen findet man, daß unser Lebensglück zuletzt von uns selber abhängt.
Die einzige Hoffnung unserer Familie bestand darin, daß das Gerücht von unserm Unglück der Bosheit oder dem Mißverständnisse zuzuschreiben sei. Doch erhielt ich bald einen Brief von meinem Agenten in London, der jeden einzelnen Umstand bestätigte. Für mich selber war der Verlust meines Vermögens von geringer Bedeutung. Die einzige Besorgniß, die ich empfand, galt meiner Familie, deren Erziehung nicht geeignet war, sie gegen Verachtung unempfindlich zu machen.
Fast vierzehn Tage waren vergangen, ehe ich versuchte, ihren Gram zu mildern; denn voreiliger Trost erinnert nur an den Kummer. Während dieser Zeit hatte ich auf Mittel gesonnen, uns unsern künftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und endlich wurde mir eine kleine Pfarre mit fünfzehn Pfund jährlicher Einkünfte in einer entfernten Gegend angeboten, wo ich wenigstens meinen Grundsätzen ungestört leben konnte. Diesen Vorschlag nahm ich freudig an und war entschlossen, mein Einkommen durch die Bewirthschaftung eines kleinen Pachtgutes zu vermehren.
Nach diesem Entschlusse war es meine nächste Sorge, die Trümmer meines Vermögens zu sammeln, und als ich alle Schulden zusammengerechnet und bezahlt hatte, blieben mir von vierzehntausend Pfund nur noch vierhundert übrig. Mein vorzüglichstes Bestreben bestand darin, den Stolz meiner Familie zu ihrer Lage herabzustimmen; denn ich wußte sehr wohl, daß Bettelstolz ein großes Elend ist. "Ihr wißt sehr wohl, meine Kinder," rief ich, "daß unser jüngst erlebtes Mißgeschick sich nicht durch unsere Klugheit vermeiden ließ; doch kann die Klugheit viel thun, die Wirkungen desselben zu mildern. Wir sind jetzt arm, meine Lieben, und die Weisheit gebietet, uns nach unserer demüthigen Lage zu richten. Laßt uns daher ohne Bedauern jenen Glanz aufgeben, bei welchem Viele elend sind, und unter demüthigern Umständen jenen Frieden suchen, durch den Alle glücklich sein können. Die Armen leben glücklich ohne unsere Hülfe; warum sollten wir nicht lernen, ohne ihre Hülfe zu leben? Nein, meine Kinder, laßt uns von diesem Augenblick an alle Ansprüche auf vornehmes Leben aufgeben. Zum Glück besitzen wir noch genug, wenn wir weise sind, und darum wollen wir uns beim Mangel des Vermögens der Zufriedenheit zuwenden."
Da mein ältester Sohn zum Gelehrten gebildet war, beschloß ich, ihn nach London zu schicken, wo seine Fähigkeiten ihm und uns nützlich sein konnten. Die Trennung von Freunden und Familien ist vielleicht einer von den widerwärtigsten Umständen, wovon die Armuth begleitet ist. Bald kam der Tag, wo wir uns trennen sollten. Nachdem mein Sohn von seiner Mutter und den Uebrigen unter Thränen und Küssen Abschied genommen hatte, bat er mich um meinen Segen. Ich ertheilte ihm denselben von ganzem Herzen, und dieser, nebst fünf Guineen, war das ganze Erbtheil, welches ich ihm mitgeben konnte. "Du gehst zu Fuß nach London, mein Sohn," rief ich, "auf dieselbe Weise wie Hooker, Dein großer Vorfahr, einst dorthin wanderte. Empfange von mir dasselbe Pferd, welches ihm einst der gute Bischof Jewel gab – diesen Stab, und dazu dies Buch. Es wird Dich trösten auf Deinem Wege. Diese zwei Zeilen allein sind eine Million werth: "Ich bin jung gewesen und alt geworden; doch habe ich nie den Gerechten verlassen oder seine Kinder nach Brod gehen sehen." – Dies möge Dein Trost sein auf dem Wege. Geh, mein Sohn! welches auch Dein Loos sein möge, laß Dich jedes Jahr einmal bei mir sehen; behalte ein gutes Herz und lebe wohl." Da er Redlichkeit und Ehrgefühl besaß, so war ich nicht besorgt, ihn nackend auf das Amphitheater des Lebens hinauszustoßen, denn ich wußte, daß er siegend oder besiegt eine gute Rolle spielen werde.
Seine Abreise war nur die Vorbereitung zu der unsrigen, welche einige Tage später erfolgte. Der Abschied von einer Gegend, wo wir so manche Stunden der Ruhe genossen hatten, war nicht ohne Thränen, die auch die größte Standhaftigkeit nicht hätte unterdrücken können. Eine Reise von siebzig Meilen erfüllte überdies eine Familie mit banger Besorgniß, die nie über zehn von der Heimath entfernt gewesen war, und das Wehklagen der Armen, die uns mehrere Meilen begleiteten, trug nur dazu bei, dieselbe zu erhöhen. Die erste Tagereise brachte uns glücklich unserm künftigen Aufenthaltsorte um dreißig Meilen näher, und wir brachten die Nacht in einer schlechten Schenke eines Dorfes an der Landstraße zu. Als man uns ein Zimmer angewiesen hatte, bat ich den Wirth, meiner Gewohnheit nach, uns Gesellschaft zu leisten, was er gern that, da das, was er trank, am nächsten Morgen mit auf meine Rechnung kam. Er kannte die ganze Gegend, wohin ich reiste, besonders den Gutsbesitzer Thornhill, meinen künftigen Gutsherrn, der einige Meilen von dem Orte wohnte. Diesen Herrn schilderte er als einen Mann, der wenig mehr von der Welt wissen wollte, als ihre Freuden, und der besonders wegen seiner Verehrung des schönen Geschlechts berüchtigt sei. Er bemerkte, noch habe keine Tugend seinen Künsten und seiner Beharrlichkeit widerstehen können, und schwerlich sei im Umkreise von zehn Meilen eine Pachterstochter zu finden, bei der er nicht glücklich und zugleich treulos gewesen. Dieser Bericht, der mich einigermaßen beunruhigte, brachte eine durchaus verschiedene Wirkung auf meine Töchter hervor, deren Gesichter sich bei der Erwartung eines nahen Triumphes zu erheitern schienen. Auch meine Frau war nicht weniger erfreut über diese zu erwartende Gelegenheit und vertraute fest den Reizen und der Tugend ihrer Töchter. Während unsere Gedanken auf diese Weise beschäftigt waren, trat die Wirthin ins Zimmer, um ihrem Manne zu sagen, daß der fremde Herr, welcher zwei Tage im Hause gewohnt, kein Geld habe, um die Rechnung zu bezahlen. "Kein Geld!" versetze der Wirth, "das kann nicht möglich sein, denn noch gestern bezahlte er dem Büttel drei Guineen, um den alten Soldaten zu schonen, der wegen Hundediebstahls durch das Dorf sollte gepeitscht werden." Doch die Wirthin blieb bei ihrer Behauptung, und er wollte das Zimmer verlassen, indem er schwur, er wolle auf die eine oder die andere Weise zu seinem Gelde kommen, als ich den Wirth bat, mich mit einem Fremden bekannt zu machen, der so viel Großmuth gezeigt habe. Er willigte ein und führte einen Herrn ins Zimmer, der etwa dreißig Jahre alt zu sein schien und dessen Rock ehemals mit Tressen besetzt gewesen war. Er war wohlgebaut und seine Züge gaben zu erkennen, daß er viel nachgedacht habe. Er war etwas kurz und trocken in seiner Anrede, und die gewöhnlichen Höflichkeitsformeln schien er entweder nicht zu kennen oder zu verachten. Als der Wirth das Zimmer verlassen hatte, konnte ich nicht umhin, dem Fremden mein Bedauern auszusprechen, einen Mann von Stande in solcher Lage zu sehen, und bot ihm meine Börse an, um die augenblickliche Forderung zu befriedigen. "Ich nehme sie von ganzem Herzen an," erwiederte er, "und freue mich, daß die Unbesonnenheit, womit ich kürzlich alles Geld weggab, welches ich bei mir hatte, mich jetzt überzeugt, daß es noch wohlwollende Menschen in der Welt giebt. Ich muß indeß vorher bitten, mir den Namen und Wohnort meines Wohlthäters zu nennen, um ihm so bald als möglich das Geld zurückzahlen zu können." Ich ertheilte ihm vollständige Auskunft darüber, nannte ihm nicht nur meinen Namen und erzählte ihm mein jüngst erlebtes Mißgeschick, sondern deutete ihm auch den Ort an, wohin ich mich begeben wollte. "Das trifft sich ja glücklicher, als ich hätte hoffen können," rief er. "Auch ich gehe jenen Weg, nachdem ich hier zwei Tage durch den Austritt des Flusses aufgehalten worden bin. Morgen wird er hoffentlich zu passiren sein." Ich versicherte ihm, daß es mir großes Vergnügen machen werde, in seiner Gesellschaft zu reisen, und auf das vereinte Bitten meiner Frau und Töchter ließ er sich bewegen, an unserm Abendessen Theil zu nehmen. Die Unterhaltung des Fremden war so angenehm und belehrend, daß ich wünschte, sie länger zu genießen. Doch es war hohe Zeit, sich zur Ruhe zu begeben und sich zu den Beschwerlichkeiten des folgenden Tages zu stärken.
Am nächsten Morgen machten wir uns alle zusammen auf den Weg. Meine Familie war zu Pferde, während Herr Burchell, unser neuer Reisegefährte, auf dem Fußsteige neben der Landstraße einherging. Er bemerkte lächelnd, da wir so schlecht beritten wären, so würde es nicht großmüthig von ihm sein, wollte er uns hinter sich lassen. Da das Wasser sich noch nicht ganz verlaufen hatte, waren wir genöthigt, einen Wegweiser zu nehmen, welcher vorauftrabte, während Herr Burchell und ich den Nachtrab bildeten. Wir verkürzten uns die Zeit unterwegs durch philosophische Disputationen, worin er sehr erfahren zu sein schien. Was mich aber am meisten in Erstaunen setzte, war, daß er, obgleich ein Geldborger, seine Ansichten mit solcher Hartnäckigkeit vertheidigte, als wäre er mein Patron gewesen. Hin und wieder theilte er mir auch mit, wem die verschiedenen Landsitze gehörten, an denen uns der Weg vorüberführte. "Jenes," rief er, indem er auf ein prächtiges Haus zeigte, welches in einiger Entfernung lag, "gehört einem Herrn Thornhill, der ein großes Vermögen besitzt, doch gänzlich von dem Willen seines Onkels, des Sir William Thornhill, abhängig ist, der sich mit Wenigem begnügt, seinem Neffen das Uebrige läßt und meistens in London wohnt." – "Was!" rief ich, "ist mein junger Gutsherr der Neffe eines Mannes, dessen Tugenden, Edelmuth und Sonderbarkeiten so allgemein bekannt sind? Ich habe diesen Sir William Thornhill oft als einen der edelsten, aber zu gleicher Zeit sonderbarsten Männer im ganzen Königreiche schildern hören, – als einen Mann von unbegrenzter Wohlthätigkeit." – "Vielleicht übertreibt er sie zu sehr," versetzte Herr Burchell, "wenigstens that er es in seiner Jugend; denn seine Leidenschaften waren damals mächtig, und da alle sich zur Tugend hinneigten, so führten sie ihn oft zu romantischen Extremen. Schon früh strebte er nach den Verdiensten des Kriegers und des Gelehrten, zeichnete sich bald in der Armee aus und erwarb sich einigen Ruf unter den Gebildeten. Schmeichelei folgt stets den Ehrgeizigen, denn die allein finden das höchste Vergnügen an der Schmeichelei. Er war von einer Menge umgeben, die ihm blos eine Seite ihres Charakters zeigte, so daß das Privatinteresse sich in eine unbegrenzte Theilnahme für Andere verlor. Er liebte das ganze Menschengeschlecht; denn der Reichthum hinderte ihn, die Erfahrung zu machen, daß es auch Schurken giebt. Aerzte erzählen uns von einer Krankheit, die den ganzen Körper so äußerst reizbar macht, daß er bei der leisesten Berührung Schmerz empfindet. Was einige körperlich erlitten, fühlte dieser Mann in seiner Seele. Das geringste Ungemach, entweder wirklich oder erdichtet, berührte ihn schmerzlich, und seine Seele wurde beim Anblick fremder Leiden tief ergriffen. Da er so sehr geneigt war, zu helfen, so ist nicht zu verwundern, daß Viele seine Hülfe suchten. Seine Verschwendung begann seinen Reichthum zu vermindern, aber nicht seine Gutmütigkeit, welche im Gegentheil zunahm, so wie der andere dahin schwand. Er wurde sorgloser, je ärmer er wurde, und obgleich er wie ein verständiger Mann redete, handelte er doch wie ein Thor. Noch immer von Zudringlichen umgeben und nicht mehr im Stande, jeden an ihn gerichteten Wunsch zu befriedigen, gab er Versprechungen statt baaren Geldes; denn dies war Alles, was er noch zu geben hatte, und ihm fehlte der Muth, Jemanden durch eine abschlägliche Antwort zu kränken. So zog er sich eine Menge von Hülfsbedürftigen auf den Hals; zwar wußte er, daß er täuschte, aber doch wünschte er ihnen zu helfen. Eine Zeit lang hingen sie ihm an und verließen ihn dann mit verdienten Vorwürfen und Verachtung. Aber auch sich selbst wurde er eben so verächtlich, wie er den Andern geworden war. Sein Gemüth bedurfte ihrer Schmeicheleien, und als diese Stütze hinweggenommen war, konnte er an dem Beifall seines Herzens kein Vergnügen finden welches er nicht zu achten gelernt hatte. Die Welt erschien ihm jetzt in einem ganz andern Lichte. Die Schmeicheleien seiner Freunde begannen zu einfachem Beifalle zusammenzuschrumpfen. Der Beifall nahm bald die freundschaftlichere Gestalt des Rathes an, und wenn der Rath verworfen wurde, so gab es Vorwürfe. Jetzt sah er ein, daß Freunde, die nur seine Freigebigkeit um ihn versammelt, geringen Werth hätten; er überzeugte sich, daß der Mensch sein Herz hingeben muß, um das eines Andern zu gewinnen. Ich fand jetzt, daß – ich vergesse, was ich sagen wollte: kurz, mein Herr, er beschloß, sich selbst zu achten, und entwarf einen Plan, sein gesunkenes Vermögen wiederherzustellen. Zu diesem Zweck durchwanderte er nach seiner Weise als Sonderling ganz Europa zu Fuß, und jetzt, ehe er noch sein dreißigstes Jahr erreicht, sind seine Vermögensumstände besser als je. Gegenwärtig vertheilt er seine Wohlthaten verständiger und gemäßigter als früher; doch ist er in Bezug auf seinen Charakter noch immer ein Sonderling, der an überspannter Tugend das höchste Vergnügen findet."
Meine Aufmerksamkeit war durch Herrn Burchells Erzählung so gefesselt worden, daß ich kaum auf den Weg vor mich hinblickte, bis wir plötzlich durch einen Hülferuf meiner Familie aufgeschreckt wurden. Als ich mich umsah, erblickte ich meine jüngste Tochter mitten in dem reißenden Strome. Sie war vom Pferde geschleudert worden und rang mit den Wellen. Schon zweimal war sie untergesunken, und ich konnte mich nicht schnell genug besinnen, um ihr zu Hülfe zu eilen. Meine Bestürzung war zu groß, um auf Mittel zu ihrer Rettung denken zu können. Gewiß wäre sie umgekommen, hätte sich nicht mein Reisegefährte beim Anblick ihrer Gefahr in die Fluth gestürzt und sie mit einiger Schwierigkeit glücklich an das entgegengesetzte Ufer getragen. Der übrige Theil der Familie, der den Fluß etwas weiter hinaufgeritten war, kam wohlbehalten hinüber, wo wir jetzt unsern Dank mit dem der Geretteten vereinigten. Ihre Erkenntlichkeit läßt sich mehr fühlen als beschreiben. Sie dankte ihrem Retter mehr durch Blicke als Worte und hielt sich noch immer an seinen Arm, als habe sie noch fernern Beistand von ihm zu erwarten. Auch meine Frau hoffte einst das Vergnügen zu haben, eine solche Güte in ihrem Hause zu vergelten.
Nachdem wir im nächsten Wirthshaus ausgeruht und ein Mittagsessen eingenommen hatten, nahm Herr Burchell von uns Abschied, da sein Weg ihn nach einer andern Richtung führte. Unterwegs äußerte meine Frau, der Fremde habe ihr außerordentlich gefallen, und versicherte, wenn Geburt und Vermögen ihn berechtigten, sich mit einer Familie wie die unsere zu verbinden, so wüßte sie Niemanden, der ihr geeigneter dazu erschiene. Ich konnte nicht umhin, zu lächeln, als sie in so vornehmem Tone sprach; doch mißfielen mir niemals dergleichen harmlose Täuschungen, die nur dazu beitrugen, uns für den Augenblick glücklicher zu machen.
Viertes Kapitel.
Ein Beweis, daß selbst die demüthigste Lage ein Glück gewähren kann, welches nicht von den Umständen, sondern von der Gemüthsbeschaffenheit abhängt.
Unser Zufluchtsort lag in einer von Pächtern bewohnten Gegend, die ihre Felder selbst pflügten und von Ueberfluß und Armuth gleich weit entfernt waren. Da sie sich fast alle Lebensbedürfnisse selbst erwarben, so besuchten sie selten die benachbarten Marktflecken und Städte, um Luxusartikel zu holen. Fern von der verfeinerten Welt bewahrten sie noch die ursprüngliche Einfachheit der Sitten, und mäßig von Natur, wußten sie kaum, daß Enthaltsamkeit eine Tugend sei. Sie arbeiteten mit fröhlichen Muthe an Werktagen; doch die Feiertage waren der Ruhe und dem Vergnügen geweiht. Sie sangen noch ihre alten Weihnachtslieder, schickten einander Liebesbänder am Valentinstage, aßen Pfannkuchen um Fastnacht, zeigten ihren Witz am ersten April und knackten am Michaelisabend gewissenhaft Nüsse auf. Von unserer Ankunft benachrichtigt, zogen sämmtliche Bewohner des Ortes in ihrem Sonntagsstaate ihrem neuen Prediger entgegen. Pfeifer und Trommelschläger gingen voran. Auch hatten sie zu unserem Empfange ein Festmahl bereit, zu dem wir uns fröhlich niedersetzten; und wenn es der Unterhaltung an Witz fehlte, so wurde desto mehr gelacht.
Unsere kleine Wohnung lag am Abhange eines Hügels und war an der hintern Seite durch ein schönes Gebüsch geschützt. Vor dem Hause plätscherte ein Bach und auf der einen Seite befand sich eine Wiese, auf der andern ein Rasenplatz. Meine Pachtung bestand aus zwanzig Morgen vortrefflichen Bodens, welche mein Vorgänger mir für hundert Pfund abgetreten hatte. Nichts übertraf die Zierlichkeit meiner kleinen Gehege mit ihren Ulmen und Hecken, die einen unbeschreiblich schönen Anblick gewährten. Mein Haus bestand aus einem Stockwerk und war mit Rohr gedeckt, welches ihm ein sehr zierliches Ansehen gab. Von innen waren die Wände weiß abgesetzt, und meine Töchter übernahmen es, sie mit selbstgezeichneten Bildern zu schmücken. Da uns dasselbe Zimmer als Küche und Wohnstube dienen mußte, so war es nur um so wärmer darin. Da es sehr zierlich gehalten wurde, und die Schüsseln, Teller und das Kupfergeräth wohlgescheuert in langen Reihen auf dem Gesimse aufgestellt war, so fiel das Ganze sehr gut ins Auge, und man vergaß darüber den Mangel einer reichen Ausschmückung. Außerdem hatten wir noch drei andere Gemächer – eins für meine Frau und mich, ein anderes dicht neben uns für unsere beiden Töchter und ein drittes mit zwei Betten für die übrigen Kinder.