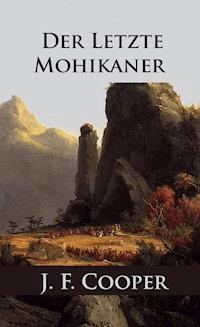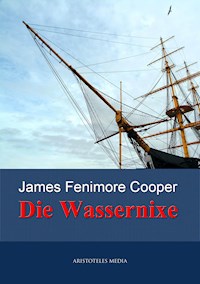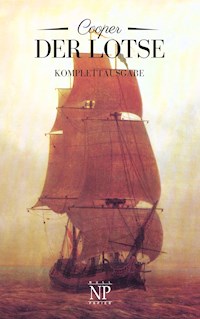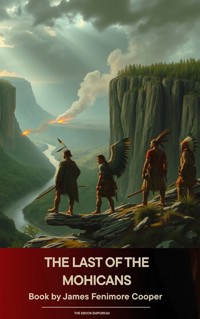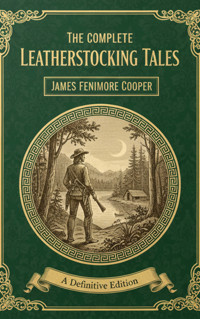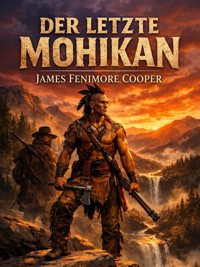Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: neobooksHörbuch-Herausgeber: hoerbuch.cc
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Mitte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Krieges zwischen Franzosen und Engländern um die Vorherrschaft in Nordamerika, haben sich beide Seiten mit Indianerstämmen verbündet; die einen mit den Huronen, die anderen mit den Mohikanern. Dies ist die legendäre Geschichte von Uncas, Chingachgook und Falkenauge, die zwei weiße Frauen aus der Gewalt von Magua befreien wollen. Eine große Geschichte, erzählt in atemberaubenden Bildern, die die archaische Wucht der Erzählung Coopers auf unvergessliche Weise einfangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J. F. Cooper
Der letzte Mohikaner
1. Kapitel
Es war eine Eigenart der Kriege, die in den Kolonien Nordamerikas geführt wurden, daß zuvor große Mühen und Gefahren der Wildnis zu überwinden waren, ehe sich die feindlichen Heere begegnen konnten. Ein breiter Streifen undurchdringlicher Wälder trennte damals die Besitzungen der feindlichen Provinzen Frankreichs und Englands. Der kühne Pflanzer und der geübte Europäer kämpften oft monatelang mit reißenden Strömen und mußten rauhe Gebirgspässe gangbar machen, ehe sie dann ihren Mut im kriegerischen Kampf zu zeigen vermochten. Zusammen mit den eingeborenen Kriegern lernten sie diese Schwierigkeiten überwinden.
Am grausamsten tobten die barbarischen Kriege zu jener Zeit in dem Land, das zwischen den Quellen des Hudsons und den anstoßenden Seen liegt.
Schon drei Jahre führten England und Frankreich einen erbitterten Kampf um jenen Landstrich, der keinem von ihnen später gehören sollte. Die Unfähigkeit der Heerführer und die mangelnde Energie der Staatsmänner hatte Großbritannien von seiner stolzen Höhe herabgestürzt. Erst vor kurzem war ein erlesenes Heer aus dem Mutterlande unter den Befehlen eines Führers, der wegen seiner großen kriegerischen Verdienste besonders geachtet war, von einer Handvoll Franzosen und Indianern schimpflich zersprengt worden. Die bestürzten Kolonisten glaubten nun das Geheul der Wilden in jedem Windstoß zu hören, der aus den endlosen Wäldern des Westens pfiff. Der grausame Charakter der erbarmungslosen Kampfweise vermehrte noch die natürlichen Schrecken des Krieges. Zahllose Gemetzel, bei denen die Eingeborenen in ihrer Grausamkeit die Hauptrolle spielten, lebten noch in ihrer Erinnerung. Selbst die Zuversichtlichsten und Standhaftesten meinten, daß der Ausgang des Kampfes zweifelhaft wäre und daß bald alle Besitzungen der englischen Krone in Amerika an ihre Feinde verlorengingen.
Als daher in dem Fort, das das Südende zwischen dem Hudson und den Seen sichern sollte, die Nachricht eintraf, der französische Heerführer Montcalm käme mit einem Heere, »zahllos wie das Laub auf den Bäumen«, den Champlain-Strom herauf, machten sich bald Furcht und Verzagtheit breit.
Die Nachricht war an einem Sommerabend durch einen indianischen Läufer eingetroffen. Munro, der Befehlshaber eines Festungswerkes am Ufer des »Heiligen Sees«, ließ um schnelle und nachhaltige Verstärkung bitten. Die Entfernung zwischen diesen beiden Festungen betrug etwa fünf Stunden. Der rauhe Pfad, der die Verbindungslinie bildete, war für Wagen erweitert worden, so daß der Weg, den der Sohn der Wildnis in nur zwei Stunden bewältigte, von einem Korps Soldaten mit dem erforderlichen Gepäck bequem an einem Sommertag zurückgelegt werden konnte. Die Engländer hatten eine dieser Waldfestungen »William Henry« und die andere »Fort Edward« genannt. Im Fort »William Henry« lag Munro mit einem Regiment ausgebildeter Soldaten und einer Anzahl Kolonisten. Eine Besatzung, die in der Tat zu schwach war, einer so furchtbaren Macht wie Montcalm und seinem Heer standzuhalten. In der Festung »Edward« befehligte General Webb ein Korps von mehr als fünftausend Mann. Bei einer Vereinigung aller Truppenteile unter dem Befehl des Generals hätte dieser fast die doppelte Anzahl Kämpfer dem Franzosen entgegenzustellen vermocht.
Von ihrem früheren Mißgeschick niedergedrückt, schienen Offiziere und Mannschaften mehr geneigt, die Annäherung ihres furchtbaren Feindes innerhalb ihrer Festungswerke zu erwarten, als sich dem vorrückenden Gegner entgegenzusetzen.
Nachdem sich die erste Bestürzung über diese Nachricht gelegt hatte, lief durch das Lager das Gerücht, daß ein auserlesenes Detachement von eintausendfünfhundert Mann bei Tagesanbruch nach Fort »William« abzugehen habe. Das Gerücht bestätigte sich bald, da aus dem Quartier des Generals an die dazu ausersehenen Korps die Order erging, sich zum schleunigen Abmarsch bereitzuhalten.
Das Wirbeln der Trommeln unterbrach am frühen Morgen den Schlaf des Heeres, als eben der anbrechende Tag die Umrisse einiger hohen Fichten abzuzeichnen begann. Im Augenblick war das ganze Lager in Bewegung. Selbst der einfachste Soldat sprang von seinem Lager auf, um Zeuge des Abmarsches seiner Kameraden zu sein. Bald hatte sich die kleine ausgewählte Truppe in Marschordnung aufgestellt. Während sich die ausgebildeten Soldaten stolz auf den rechten Flügel stellten, bezogen die weniger anspruchsvollen Kolonisten ihre bescheidenere Stellung auf dem linken. Die Patrouillen brachen auf, starke Bewachungen zogen vor und hinter den schwerfälligen Packwagen, dann schwenkte die Hauptmacht der Streiter in eine Kolonne ein und verließ das Lager mit dem Ausdruck soldatischen Stolzes.
Die Marschtritte der bereits entschwundenen Kolonne waren schon verklungen, aber immer noch wurden Anstalten zu einer anderen Abreise getroffen. Vor einem Blockhause stand ein halbes Dutzend Pferde beisammen. Zwei der Tiere schienen, nach ihrem Sattelzeug zu urteilen, für Frauen bestimmt zu sein. Ein drittes Pferd trug das Geschirr und die Waffen eines Stabsoffiziers, während die anderen mit Decken und Reisetaschen beschwert, offenbar für Diener bestimmt waren. In einiger Entfernung stand eine Gruppe neugieriger Zuschauer, unter ihnen auch ein Mann, dessen Äußeres einen höchst ungünstigen Eindruck hinterließ. Seine Glieder besaßen keinerlei Spur von Ebenmaß. Stand er, so überragte er alle, saß er dagegen, so schien er nur die gewöhnliche Größe der Männer zu haben. Sein Kopf war groß, seine Schultern eng, seine Arme lang und schlotternd, seine Hände dagegen klein, seine Beine und Schenkel dünn, ausgemergelt und überlang. Der geschmacklose Anzug dieses Menschen unterstrich noch seine unvorteilhafte Gestalt.
Dieser Mann ging unbedenklich unter den Dienern umher und lobte und tadelte die Pferde.
»Freund, ich möchte fast sagen, dieses Tier stammt nicht aus heimischer Zucht, sondern aus fremden Landen. Vielleicht ist es gar von der kleinen Insel über dem blauen Wasser nach hier gekommen?« sprach er in einem milden und sanften Ton. Da auf diese Rede keine Erwiderung kam, wandte er sich um. Dabei fielen seine Augen auf die schweigsame Gestalt des indianischen Läufers, der die unwillkommene Nachricht vom vorigen Abend in das Lager gebracht hatte. Obgleich der Wilde das aufgeregte und geräuschvolle Hasten nicht beachtete, so lag doch in seiner äußeren Ruhe ein mürrischer Trotz. Der Eingeborene trug den Tomahawk und das Messer seines Stammes. Die Farben auf seinem nach Kriegerart bemalten Gesichte waren ineinandergeflossen und machten seine Gesichtszüge noch wilder. Einen Augenblick nur begegnete sein forschender Blick dem verwunderten Auge des anderen.
Eine allgemeine Bewegung unter den Dienern kündigte das Nahen der erwarteten Personen an. Ein junger Mann, in der Uniform eines Offiziers, führte zwei Damen zu den Pferden. Nachdem die Damen und der Offizier aufgesessen waren, verbeugten sich alle drei gegen General Webb, der auf der Schwelle seiner Wohnung erschienen war. Dann ritten sie, von der Dienerschaft gefolgt, nach dem nördlichen Eingang der Verschanzungen. Während des kurzen Rittes entfuhr der jüngeren Dame ein erschreckter Ausruf, als sie den indianischen Läufer erblickte, der vorüberglitt und auf der Heerstraße ihnen vorauseilte.
2. Kapitel
»Sind solche Gespenster häufig in diesen Wäldern zu sehen, Heyward? In diesem Falle bedürfen Kora und ich großen Mutes, ehe wir dem gefürchteten Montcalm begegnen.«
»Der Indianer dort ist ein Läufer des Heeres und gilt bei seinem Volke für einen Helden«, versetzte der Offizier. »Er hat sich erboten, uns auf einem fast unbekannten Pfad schneller und angenehmer nach dem See zu bringen.«
»Der Mensch gefällt mir auch nicht«, sprach die ältere Dame. »Sie kennen ihn doch genau, Duncan, sonst vertrauten Sie sich doch nicht so unbedenklich seiner Führung an?«
»Ich kenne ihn genau. Man sagt, er sei ein Kanadier – und doch diente er unseren Freunden, den Mohikanern, Wie Sie wissen, gehören die Mohawks zu den mit uns verbündeten Stämmen. Er wurde durch einen seltsamen Vorfall zu uns gebracht, bei dem Ihr Vater beteiligt war und der Wilde hart behandelt wurde – aber ich vergaß die Geschichte, jetzt ist er unser Freund.«
»Wenn er meines Vaters Feind war, so gefällt er mir noch viel weniger!« rief das nun wirklich erschrockene Mädchen. »Wollen Sie nicht mit ihm sprechen, Major Heyward, damit ich seine Stimme höre?«
»Das wird vergeblich sein. Wenn er auch Englisch versteht, so tut er doch so, als verstünde er nichts davon. Aber er bleibt stehen, wahrscheinlich beginnt dort der geheime Weg, den wir einschlagen sollen.«
Die Vermutung Major Heywards war richtig. Als sie an die Stelle kamen, wo der Indianer stand, wies er mit der Hand auf ein Dickicht zur Seite der Heerstraße, und ein schmaler Pfad, der nur eine Person aufnehmen konnte, wurde sichtbar.
»Dahin also geht unser Weg«, sprach der junge Mann mit gedämpfter Stimme. »Zeigen Sie kein Mißtrauen!«
»Kora, was denkst du?« fragte das junge Mädchen. »Ist es nicht besser, wenn wir mit der Truppe reisen, selbst wenn es für uns unangenehm ist?«
»Sie sind mit den Kunstgriffen der Wilden zu wenig bekannt, Alice«, fiel Heyward ein. »Wenn sich der Feind überhaupt schon in unserer unmittelbaren Nähe befinden sollte, dann geht er sicher darauf aus, die Kolonne zu umzingeln, weil es hier am meisten zu skalpieren gibt. Die Straße, auf der das Detachement marschiert, ist bekannt, während unser Weg erst vor einer Stunde beschlossen wurde und somit für ihn ein Geheimnis sein muß.«
»Sollen wir dem Mann mißtrauen, weil seine Sitten nicht die unseren sind und seine Haut dunkel ist?«
Alice zögerte nicht länger. Sie gab ihrem Pferde einen Schlag mit der Gerte, drückte die Zweige des Gebüsches beiseite und folgte dem Läufer den dunklen, verschlungenen Pfad entlang. Der junge Mann bahnte nun ebenfalls einen Weg für die andere Dame, die Kora genannt worden war. Die Diener folgten auf der Heerstraße der Kolonne, eine Maßnahme, die der Führer angeraten hatte, um nicht zuviel Spuren zu hinterlassen. Sobald der Wilde merkte, daß die Damen wieder freier über ihre Pferde verfügen konnten, schlug er ein rascheres Tempo an. Doch schon nach kurzer Zeit blieb die Gruppe stehen, da entfernte Hufschläge zu hören waren. Bald sah man ein Füllen durch die Fichtenstämme schlüpfen und gleich darauf die Person des eigenartigen Mannes, der durch seine seltsame Gestalt bereits vor der Abreise der Gesellschaft aufgefallen war. Er trieb sein mageres Tier zu größter Eile an. Der Eifer und die Bewegungen des Reiters waren nicht minder merkwürdig als die seines Rosses. Bei jeder Bewegung erhob der Reiter seine hagere Gestalt in den Steigbügeln und bewirkte durch die ungebührliche Verlängerung seiner Beine ein ständiges Wachsen und Zusammensinken seiner Gestalt.
Die ärgerlichen Falten, die sich auf der offenen männlichen Stirn Heywards gesammelt hatten, glätteten sich, und um seinen Mund flog ein leichtes Lächeln, als er den Fremden betrachtete.
»Suchen Sie jemand?« fragte Heyward, als der andere näher gekommen war.
»Ja gewiß«, erwiderte der Fremde. »Ich hörte, Sie reiten nach ›William Henry‹, und da ich den gleichen Weg habe, möchte ich mich Ihrer Gesellschaft gern anschließen.«
»Wenn Sie nach dem See reisen wollen«, versetzte Heyward, »dann sind Sie nicht auf dem rechten Weg, die Heerstraße liegt eine halbe Meile hinter uns.«
»So ist es«, entgegnete der Fremde. »Ich müßte stumm gewesen sein, wenn ich mich nicht im Fort ›Edward‹ nach dem Weg erkundigt hätte. Und wäre ich stumm, dann könnte ich auch meinen schönen Beruf als Gesangsmeister aufgeben.«
»Lassen Sie den Fremden in unserem Gefolge reisen, Heyward«, bat Alice, und fuhr in gedämpftem Tone fort, »vielleicht kann er als Freund im Falle der Not unsere Kräfte verstärken.«
Heyward gab ihrem bittenden Blicke nach, stieß seinem Pferde die Sporen ein und war mit wenigen Sprüngen wieder an Koras Seite.
»Es freut mich, Sie zu treffen«, fuhr Alice fort, dem Fremden mit der Hand winkend, weiterzureiten. »Es wird mir ein besonderes Vergnügen sein, die Meinungen und Erfahrungen eines Meisters des Gesanges zu hören.«
»Es ist erfrischend für Geist und Leib, sich durch Singen von Psalmen zu erquicken«, erwiderte der Fremde. »Doch vier Stimmen sind erforderlich, um eine Melodie schön auszuführen. Die Stimme ist dem Menschen wie andere Talente zum Gebrauch gegeben.«
»So haben Sie denn Ihre Kunstversuche auf den heiligen Gesang beschränkt?«
»Ja, wie die Psalmen Davids jede andere Poesie weit übertreffen, so übertrifft auch die Psalmodie, die von den Gottesgelehrten und Weisen des Landes ihnen angepaßt worden ist, alle weltliche Musik.«
Während dieser Lobpreisung hatte der Fremde ein Buch aus seiner Tasche gezogen und eine in Eisen gefaßte Brille auf seine Nase gesetzt. Dann begann er mit vollen Tönen mehrere Strophen eines Psalmliedes abzusingen. Den Gesang begleitete der Fremde mit Bewegungen seiner rechten Hand.
Solche laute Unterbrechung der Waldesstille konnte gefährlich werden. Der Indianer murmelte einige Worte in gebrochenem Englisch zu Heyward, der den Fremden bat, seine musikalischen Versuche zu beenden. Nach dieser kurzen Unterbrechung ritt die Gesellschaft weiter. Der Zug war noch nicht lange vorüber, als sich die Zweige eines Gebüsches vorsichtig teilten und die dunkelbemalten Gesichtszüge eines Wilden sichtbar wurden, der frohlockend den Reitern nachblickte.
3. Kapitel
An jenem Tage saßen zwei Männer an dem Ufer eines kleinen, aber reißenden Stromes, der ungefähr eine Tagesreise von dem Lager Webbs entfernt war. Das weite Laubdach des Waldes überwölbte den Rand des Flusses. Die Strahlen der Sonne wurden bereits schwächer und die starke Hitze des Tages begann sich zu mildern. Immer noch herrschte in dieser Einsamkeit jene Stille, die die drückende Schwüle einer amerikanischen Landschaft im Hochsommer kennzeichnet. Sie wurde nur von den leisen Stimmen der Männer, dem müden Klopfen eines Waldspechtes, dem Schrei eines bunten Hähers oder dem dumpfen Rauschen eines fernen Wasserfalles unterbrochen.
Diese schwachen Laute waren jedoch den Waldbewohnern vertraut, so daß sie sich dadurch nicht von ihrer Unterhaltung ablenken ließen. Einer der Männer war sofort durch die rote Hautfarbe als Indianer zu erkennen, der andere verriet – trotz seines sonnengebräunten Gesichtes – den Europäer. Der Indianer saß auf dem Rande eines bemoosten Baumstammes. Sein Gesicht und sein fast nackter Körper waren mit weißen und schwarzen Farben bemalt. Sein kahlgeschorener Kopf trug nur die Skalplocke und auf die linke Schulter hing eine einzige Adlerfeder herab. Ein Tomahawk und ein Skalpiermesser staken in seinem Gürtel, während eine Büchse über seinen bloßen, sehnigen Knien lag. Die gewölbte Brust, die wohlgeformten Glieder und die ernste Haltung dieses Kriegers ließen erkennen, daß er sich in der Vollkraft seines Lebens befand.
Die wettergebräunte Gestalt des Weißen zeigte, daß er seit seiner frühesten Jugend gelernt hatte, Mühseligkeiten und Anstrengungen zu ertragen. Die Kleidung bestand aus einem grünen Jagdhemd und einer Sommermütze von geschorenem Fell. Auch er trug ein Messer in einem Wampumgürtel. Seine Mokassins waren nach der Art der Eingeborenen verziert. Eine Jagdtasche und ein Pulverhorn vollendeten seinen Anzug. Eine lange Büchse lehnte an einem, Baum. Das Auge des Jägers oder Kundschafters war lebhaft, scharf und unruhig, als ob es irgendein Jagdwild suche oder um die plötzliche Annäherung eines Feindes besorgt sei. Sein Gesicht machte einen offenen und ehrlichen Eindruck.
»Selbst Eure Überlieferungen sprechen für mich, Chingachgook«, sagte der Weiße in der Sprache der Delawaren. »Eure Väter kamen von der untergehenden Sonne her, kämpften mit dem Volke des Landes und nahmen es ihnen weg. Meine Väter kamen vom roten Morgenhimmel über den Salzsee und taten ganz nach dem Beispiel, das die Eurigen ihnen gegeben hatten. So laß denn Gott unsere Sache entscheiden und darüber keine Worte mehr verlieren.«
»Meine Väter fochten mit dem nackten, roten Mann«, versetzte ernst der Indianer. »Es ist doch ein Unterschied, Falkenauge, zwischen einem gespitzten Pfeil des Kriegers und der bleiernen Kugel, womit ihr tötet?«
»Ein Indianer hat Verstand, auch wenn ihm die Natur eine rote Haut gegeben hat«, sprach der Weiße kopfschüttelnd. »Ich bin kein Gelehrter. Wenn ich aber nach dem urteile, was ich von den Burschen bei meinen vielen Jagden auf Wild gesehen habe, dann meine ich, daß eine Büchse in den Händen Eurer Vorfahren nicht so gefährlich gewesen wäre wie ein Bogen aus Nußbaumholz und ein Pfeil in der Hand eines Indianers.«
Eine kurze Stille folgte. Der Indianer saß stumm da und schien über das soeben Gehörte nachzudenken. Nach einer Weile begann er mit einer Feierlichkeit, die die Wahrheit seiner Worte bekräftigen sollte, das Gespräch wieder aufzunehmen.
»Nein, Falkenauge, dein Ohr soll keine Lüge hören. Mein Stamm ist der Ahnherr von Nationen. Das Blut von Häuptlingen rollt in meinen Adern. Die Holländer landeten mit ihren Schiffen und gaben meinem Volke das Feuerwasser. Die roten Männer tranken es, bis sich Himmel und Erde zu berühren schienen, und glaubten, sie hätten den Großen Geist gefunden. Dann mußten sie von ihrem Lande scheiden. Schritt um Schritt wurden sie zurückgetrieben, bis ich, ein Häuptling meines Stammes, die Sonne nie anders als durch die Bäume habe leuchten sehen. Noch nie konnte ich die Gräber meiner Väter besuchen!«
»Gräber bringen das Gemüt in eine feierliche Stimmung«, bemerkte der Kundschafter, von der Schilderung seines Begleiters sichtlich gerührt.
»Doch wo befinden sich die Gräber deines Geschlechtes?«
»Wo sind ihre Gräber? Wo sind die Blüten jener Sommer? – Gefallen einer nach dem anderen. Alle von meiner Familie sind, wie die Reihe an sie kam, in das Land der Geister hinübergegangen. Ich stehe oben auf dem Berg und muß ins Tal hinab. Wenn Unkas, mein Sohn, meinen Fußstapfen folgt, so ist keiner mehr übrig vom Blute der großen Häuptlinge. Denn mein Knabe ist der letzte Mohikaner!«
»Unkas ist da!« sprach eine andere Stimme in sanftem Kehllaut. »Wer fragt nach Unkas?«
Der Weiße machte bei dieser plötzlichen Unterbrechung eine unwillkürliche Bewegung mit der Hand nach seiner Büchse. Der Indianer aber blieb ruhig sitzen, ohne den Kopf nach der unerwarteten Stimme umzuwenden.
Im nächsten Augenblick schritt ein junger Krieger mit geräuschlosem Tritt zwischen sie und setzte sich zu ihnen an das Ufer des Stromes. Kein Laut der Überraschung entfuhr dem Vater. Mehrere Augenblicke herrschte Stille, und jeder schien zu warten, wann er sprechen könnte. Der Weiße ahmte ihrem Beispiel nach, zog seine Hand von der Büchse zurück und blieb ebenfalls still. Endlich wandte Chingachgook seine Augen langsam nach seinem Sohne und fragte:
»Wagen die Maquas, die Spuren ihrer Mokassins diesen Wäldern einzudrücken?«
»Ich war ihnen auf der Fährte«, antwortete der junge Indianer. »Ich weiß, daß ihrer so viele sind als Finger an meinen Händen. Aber sie haben sich wie Feiglinge verkrochen.«
»Die Diebe sind auf der Lauer nach Skalpen und Beute!« sprach Falkenauge.
»Der rührige Franzose Montcalm wird seine Spione noch bis in unser Lager schicken.«
»Genug!« erwiderte Chingachgook. »Sie sollen vertrieben werden wie das Wild aus den Büschen. Jetzt, Falkenauge, wollen wir zu Abend essen und morgen den Maquas zeigen, daß wir Männer sind.«
»Ich bin zu dem einen wie zu dem anderen bereit. Doch um mit den Irokesen zu kämpfen, muß man sie in ihrem Verstecke aufsuchen. Und um zu essen, braucht man ein gutes Wildbret – doch da«, sprach er flüsternd weiter, »bewegt sich ein Paar der stärksten Geweihe, die ich in diesen Jahren gesehen habe! Ich wette, daß ich den Rehbock genau zwischen den Augen treffen werde.«
Der Kundschafter wollte gerade sein Gewehr anlegen, da hielt Chingachgook seine Hand auf die Büchse und sagte:
»Falkenauge! Hast du Lust mit den Maquas zu kämpfen?«
»Diese Indianer kennen die Wälder durch ihren Instinkt!« versetzte der Jäger, ließ die Büchse sinken und wandte sich ab, da er seinen Irrtum einsah. »Ich muß den Bock deinem Pfeil überlassen, Unkas.«
Kaum hatte der Vater diese Worte mit einer Handbewegung gutgeheißen, da warf sich Unkas zu Boden und näherte sich mit vorsichtigen Bewegungen dem ahnungslosen Tiere. Als er nur noch wenige Meter von dem Verstecke entfernt war, legte er mit großer Sorgfalt einen Pfeil auf den Bogen. Im nächsten Augenblick fuhr der Pfeil durch das Gebüsch und der verwunderte Hirsch stürzte aus dem Versteck zu den Füßen des verborgenen Feindes. Dem Geweih des wütenden Tieres ausweichend, sprang Unkas zur Seite und stach ihm dann das Messer in die Kehle.
»Das nenne ich ein indianisches Meisterstück!« lobte der Kundschafter.
»Howgh!« pflichtete sein Begleiter bei. Doch plötzlich wandte sich der ältere Indianer um, wie ein edler Jagdhund, der die Fährte eines Wildes wittert.
»Da ist ein ganzes Rudel!« flüsterte der Kundschafter. »Was horchst du, Chingachgook?«
»Hier ist nur ein Rehbock und der ist tot«, sprach , der Indianer und bückte sich im gleichen Augenblick nieder, bis sein Ohr die Erde berührte. »Ich höre Fußtritte!«
»Vielleicht haben die Wölfe den Hirsch in das Versteck getrieben und sind ihm jetzt auf der Spur.«
»Nein, Pferde weißer Männer kommen!« erwiderte Chingachgook bestimmt, erhob sich und nahm seinen Sitz auf dem Baumstamm wieder ein. »Falkenauge, es sind deine Brüder, sprich mit ihnen!«
»Das will ich gerne tun«, erwiderte der Jäger und blickte sich um. »Da höre ich auch schon dürres Holz krachen – ja, es sind Pferdetritte, die ich für das Fallen des Wassers hielt.«
4. Kapitel
Noch während der Kundschafter sprach, wurden die Reisenden sichtbar, die so unerwartet die Stille des Waldes gestört hatten.
»Wer da?« rief der Kundschafter, indem er seine Büchse lässig über den linken Arm warf.
»Freunde des Königs«, antwortete der vorderste Reiter, »Menschen, die seit Sonnenaufgang gereist und von den Anstrengungen des Weges erschöpft sind.«
»So habt ihr euch wohl verirrt?« unterbrach ihn der Jäger.
»So ist es! Wie der Säugling eine gute Amme braucht, so benötigen wir einen sicheren Führer. Wißt Ihr, wie weit es nach der Festung ›William Henry‹ ist?«