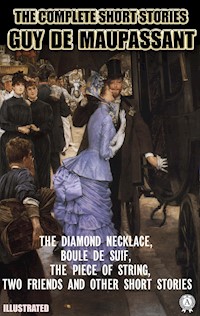Der Liebling / Bel-Ami - Zweisprachige Ausgabe (Deutsch-Französisch) / Edition bilingue (français-allemand) E-Book
Guy de Maupassant
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Guy de Maupassants "Der Liebling" (Bel-Ami) ist ein fesselnder Roman, der die aufsteigende Karriere des charmanten Journalisten Georges Duroy thematisiert. In einem eleganten, präzisen Stil schildert Maupassant die widersprüchlichen Gesellschaftsstrukturen des 19. Jahrhunderts in Paris, während er die Themen Macht, Gier und Sexualität auseinanderlegt. Der Leser wird in Duroys Manipulationen und Intrigen hineingezogen, die seine Aufstiegschancen in einer von Korruption und Heuchelei geprägten Welt verdeutlichen. Die Zweisprachigkeit der Ausgabe bereichert zudem das Leseerlebnis und bietet einen Einblick in die sprachliche Raffinesse des Originals. Maupassant, geboren 1850 in der Normandie, gilt als einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des Realismus. Sein umfangreiches Werk ist stark von seinen eigenen Erfahrungen geprägt, die er in einem sich wandelnden Paris sammelte. Die Beobachtungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die menschliche Natur fließen unverkennbar in Duroys Charakter und seine unaufhörliche Jagd nach Erfolg ein, was Maupassants tiefe Kenntnisse der menschlichen Psyche widerspiegelt. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die deutsche und französische Literaturgeschichte interessieren. Maupassants meisterhafte Erzählkunst und die komplexe Charakterzeichnung machen "Der Liebling" zu einem zeitlosen Klassiker, der sowohl unterhaltsam als auch erhellend ist. Die bilinguale Ausgabe ist besonders geeignet für Studierende und Sprachliebhaber, die sich auf eine sprachliche Entdeckungsreise begeben möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der Liebling / Bel-Ami - Zweisprachige Ausgabe (Deutsch-Französisch) / Edition bilingue (français-allemand)
Inhaltsverzeichnis / Table des matières
Der Liebling
Erster Teil
I
Georg Duroy wechselte bei der Kassiererin ein Fünffrankenstück, zahlte und verließ das Restaurant.
Von Haus aus ein hübscher Kerl, sah er besonders gut aus in der militärischen Haltung, nach der er sich als ehemaliger Unteroffizier trug. Er warf sich in die Brust, wirbelte schneidig seinen Schnurrbart und ließ über die Verspäteten rings an den Tischen einen schnellen, aber umfassenden Blick gleiten, dem nichts entging.
Die Frauen hatten ihm nachgeschaut, drei kleine Arbeiterinnen, eine Musiklehrerin von mittlerem Alter, die schlecht frisiert war, etwas vernachlässigt aussah, einen immer staubigen Hut auf hatte, und deren Kleid schief saß; und dann zwei Bürgerfrauen mit ihren Männern, die für gewöhnlich hier ihr Mittagsessen im Abonnement einzunehmen pflegten.
Als er hinausgetreten war, blieb er einen Augenblick auf dem Trottoir stehen und überlegte sich, was er thun sollte. Es war der achtundzwanzigste Juni und er besaß gerade noch drei Franken vierzig, womit er den Monat auskommen mußte. Das bedeutete soviel, wie zwei Mittagessen ohne Abendbrot oder zwei Abendessen ohne Mittag, je nach Wahl. Er überlegte, daß, da das Mittagessen ihm zweiundzwanzig Sous kosten würde, während er dreißig für sein Abendbrot anlegen mußte, ihm ein Frank zwanzig Überschuß bliebe, wenn er sich mit zweimal Mittagessen allein begnügte. Der Überschuß reichte noch für zwei Portionen Brot und Wurst und zwei Glas Bier, die er irgendwo auf dem Boulevard zu sich nehmen könnte. Das war seine einzige Ausgabe und sein einziges Amüsement. So bummelte er denn die Straße Notre Dame de Lorette hinab.
Er ging genau so, wie er früher einst das Pflaster getreten in seiner Husarenuniform, die Brust herausgedrückt, die Kniee ein wenig nach außen, als ob er eben vom Pferde gestiegen wäre. Und rücksichtslos schritt er in die Menschenmenge hinein, streifte die Schultern, rempelte hier und da einmal jemanden an und machte nicht einen Zoll breit Platz. Den Cylinder, der etwas ramponiert war, hatte er schief auf’s Ohr gesetzt, und seine Schritte klangen laut auf dem Pflaster. Er sah aus, als blickte er alles herausfordernd an, die Vorübergehenden, die Häuser, die ganze Stadt, wie’s eben ein schöner Husar thut, der zu seinem Leidwesen den Civilrock tragen muß.
Obgleich er nur einen Anzug für sechzig Franken trug, hatte er doch eine gewisse, etwas aufdringliche Eleganz an sich, die zwar ein wenig ordinär war, doch thatsächlich bestand. Er war groß, gut gewachsen, blond, von einem kastanienfarbenen leicht rötlichen Blond, mit aufgedrehtem Schnurrbart, der sich auf seiner Oberlippe zu kräuseln schien. Er hatte blaue, klare Augen und eine ganz kleine Pupille, natürlich-gelocktes Haar, das in die Mitte gescheitelt war und sah so ein wenig aus wie die Schwerennöter in den Schundromanen.
Es war einer jener Sommcrabende, wo man das Gefühl hat, als wäre nicht genug Luft in Paris. Die Stadt war glühend heiß und schien zu schwitzen bei der erstickenden Hitze. Die Schleußen strömten durch ihren granitnen Mund ihre verpesteten Dünste aus und die Küchen im Untergeschoß hauchten auf die Straße durch ihre niedrigen Fenster die gräßlichen Gerüche von Anfwaschwasser und alten Saucen hinaus.
Die Portiers saßen in Hemdsärmeln rittlings auf ihren Rohrstühlen und rauchten unter dem Hofeingang ihre Pfeife. Und die Vorübergehenden gingen mit müden Schritten barhäuptig, den Hut in der Hand.
Als Georg Duroy an den Boulevard kam, blieb er noch einmal stehen, unschlüssig, was er thun sollte. Er hatte jetzt eigentlich Lust, in die Champs - Elysses und in die Avenue du bois de Boulogne zu gehen, um unter den Bäumen ein Wenig frische Luft zu schöpfen. Aber es quälte ihn auch ein anderer Wunsch: irgend ein Liebesabenteuer zu erleben.
Wie das kommen sollte, wußte er noch nicht. Aber er wartete seit drei Monaten darauf, jeden Tag, jeden Abend.
Dank seines guten Aussehens und seines galanten Wesens, stahl er wohl hier und da ein bißchen Liebe, aber er hoffte doch immer noch auf mehr und Besseres,
Mit seinem leeren Portemonnaie und heißen Blut regte er sich auf, wenn die Mädchen vorüberstrichen und an der Straßenecke zu ihm sagten:
– Komm mit, Kleiner!
Aber er wagte nicht, ihnen zu folgen, denn er konnte sie nicht zahlen. Und dann hoffte er doch auch auf etwas anderes, auf eine andere, weniger gemeine Liebe.
Und doch liebte er die Orte, wo die öffentlichen Mädchen herumwimmelten, ihre Balllokale, Cafés, ihre Straßen. Er traf sie gern, und es machte ihm Spaß, mit ihnen zu schwatzen, sie zu duzen, ihr starkes Parfüm zu riechen, ihre Nähe zu fühlen. Es waren doch immerhin Frauen, Frauen, die Liebe geben konnten, und er verachtete sie nicht mit jenem Gefühl, das dem in der Familie aufgewachsenen Manne angeboren ist.
Er wandte sich zur Madeleine-Kirche und folgte dem Menschenstrom, der, von der Hitze bedrückt, dahin flutete. Die großen Cafés waren Menschen-überfüllt. Die Leute faßen bis auf das Trottoir, beim hellen scharfen Licht, das durch die erleuchteten Spiegelscheiben fiel. Auf kleinen viereckigen Tischen standen Gläser mit roter, gelber, grüner, brauner Flüssigkeit, alle Farbenspiele waren vertreten. Und in den Karaffen glänzten die großen, durchsichtigen Eiskrystalle, die das schöne klare Wasser abkühlen sollten.
Duroy hatte seinen Gang verlangsamt, seine Kehle war wie ausgetrocknet und das dringende Bedürfnis etwas zu trinken quälte ihn.
Ein brennender Durst, wie er sich an heißen Sommerabenden einstellt, hielt ihn gefangen, und er dachte immer wie wundervoll erquickend es doch wäre, wenn ihm das kalte Getränk durch die Kehle laufen würde. Aber wenn er an diesem Abend auch nur zwei Glas Bier trank, mußte er auf sein mageres Abendbrot morgen verzichten. Und die Hungerqualen der letzten Tage des Monats kannte er zu genau.
Er sagte sich: bis zehne muß ich mich hinschleppen, dann trinke ich im Americain mein Bier. Gott verdamm mich noch mal, hab’ ich einen Durst!
Und er betrachtete all die Menschen, die dort an den Tischen saßen und tranken, all diese Menschen, die ihren Durst löschen konnten, soviel sie nur mochten. Wenn er an den Cafés vorüberkam, nahm er eine renommistische kecke Haltung an, und mit einem Blick taxierte er nach Aussehen und Kleidung die einzelnen Leute, die da ruhig saßen. Wenn man ihnen die Taschen leerte, würde man schon Gold finden, Silber und Kupfer; durchschnittlich hatte Wohl jeder gewiß zwei Zwanzig-Frankenstücke bei sich. In dem Café saßen mindestens hundert, hundert mal zwei Zwanzig-Frankenstücke das gab viertausend Franken. Er brummte in sich hinein: Schweinebande! und wiegte sich in den Hüften. Wenn er nur an der Straßenecke im Dunkeln einen von den Kerls hätte anhalten können, dem hätte er den Hals umgedreht, weiß der Teufel, ohne irgend welche Gewissensbisse, wie er’s früher im Manöver mit den Hühnern beim Bauer gethan.
Und er dachte an die beiden Jahre, die er in Afrika gestanden, wie er damals in den kleinen Garnisonen im Süden die Araber ausgeplündert. Ein grausam-lustiges Lächeln lief über seine Züge, als er sich eines tollen Streiches erinnerte, der drei Mann des Stammes der Ouled-Alane das Leben gekostet und ihm wie seinen Kameraden zwanzig Hühner, zwei Schafe und eine Menge Gold eingebracht hatte, sowie Lachstoff auf mindestens ein halbes Jahr.
Die Thäter hatte man nie entdeckt, die man übrigens auch weiter nicht gesucht hatte, denn der Araber wurde mehr oder weniger als selbstverständliche Beute des Soldaten angesehen.
In Paris war das ganz was anderes. Dort konnte man nicht den Säbel an der Seite, den Revolver in der Hand, weit von jeder bürgerlichen Gerichtsbarkeit, frei wie man war, auf Plünderung ausgehen. Er fühlte sich wie ein Unteroffizier im eroberten Lande. Ach, er dachte doch mit Bedauern an die zwei Jahre zurück, die er in der Wüste zugebracht. Es war eigentlich schade, daß er nicht dort geblieben war. Aber er hatte gehofft, sich verbessern zu können, wenn er zurückkehrte. Und nun? Na, das war eine schöne Bescheerung!
Er wälzte die Zunge im Munde herum und schnalzte, als ob er die Trockenheit seines Gaumens feststellen wollte. Die Menge bewegte sich um ihn herum, matt und langsam, und er dachte immer: elendes Pack, diese ganzen Rindviecher da, haben nu Geld in der Tasche.
Er stieß die Leute beim Gehen mit der Schulter an und pfiff sich eine lustige Weise. Ein paar Herren, die er angerempelt, drehten sich schimpfend um und ein paar Frauen riefen:
– So ein Flegel!
Da kam er am Vaudeville vorbei und blieb vor dem Café Americain stehen. Er fragte sich, ob er nicht doch ein Glas Bier trinken sollte, der Durst quälte ihn zu schauderhaft. Ehe er zu einem Entschluß kam, blickte er noch einmal nach dem erleuchteten Zifferblatt der Uhren auf der Straße. Es war ein viertel auf zehn Uhr. Er kannte sich genau: wenn einmal das Glas Bier vor ihm stand, hatte er es auch schon ‘runtergeschüttet, und was sollte er dann bis elf Uhr anfangen?
Er ging weiter und sagte sich: ach, ich gehe lieber bis zur Madeleine und dann bummele ich ganz sachte zurück.
Als er an die Ecke des Opernplatzes kam, begegnete ihm ein dicker, junger Mann, dessen Gesicht er meinte schon einmal irgendwo gesehen zu haben.
Er folgte ihm und suchte in seinem Gedächtnis, indem er halblaut zu sich sagte: Teufel noch mal, wo bin ich nur dem Kerl schon mal begegnet?
Er suchte hin und her, aber es fiel ihm nicht ein. Dann plötzlich durch ein eigentümliches Spiel des Gedächtnisses stand derselbe Mann vor ihm, weniger dick, jünger, in Husarenuniform und er rief ganz laut:
– Herr Gott, Forestier!
Er verlängerte seine Schritte und klopfte dem Herrn, der vor ihm ging, auf die Schulter. Der andere drehte sich um, blickte ihn an und fragte:
– Bitte, was wünschen Sie?
Duroy fing an zu lachen:
– Was, Du kennst mich nicht mehr?
– Nein.
– Georg Duroy. Sechster Husar.
Forestier streckte ihm beide Hände entgegen:
– Alter Kerl! Wie geht Dir’s denn?
– Ausgezeichnet! Und Dir?
– Na, nicht besonders. Weißt Du, ich bin nicht ganz taktfest auf der Brust. Sechs Monate im Jahr huste ich. Das kommt von einem Bronchialkatarrh, den ich mir in Bougival jetzt vor vier Jahren, als ich nach Paris zurückkam, geholt habe.
– Aber Du siehst doch ganz gesund aus!
Und Forestier nahm den Arm seines Kameraden und erzählte ihm von seiner Krankheit, von den Konsultationen, den verschiedenen Meinungen und Reden der Ärzte. Er sagte, Wie schwierig es sei in seiner Stellung ihren Verordnungen zu folgen. Er sollte den Winter im Süden zubringen, aber das könnte er doch nicht. Er war nämlich verheiratet, Journalist und hatte eine vorzügliche Stellung.
– Ich redigiere den politischen Teil der ›Vie francaise‹, besorge beim ›Salut‹ den Artikel Senat und schreibe ab und zu literarische Feuilletons für den ›Planeten.‹ Ja! ja! Ich habe meinen Weg gemacht.
Duroy blickte ihn erstaunt an. Er fand ihn sehr verändert, sehr viel fertiger geworden. Er hatte eine Art und Weise, Haltung und Anzug wie ein Mann in guter Stellung, der seiner selbst sicher ist und war wohlbeleibt wie jemand, der gut zu essen pflegt. Früher war er mager, dürr, gelenkig, ein Leichtfuß, ein Lärm-und Radaumacher, der immer in der Fahrt war. Und ein dreijähriger Aufenthalt in Paris hatte aus ihm einen ganz anderen Menschen gemacht, einen wohlbeleibten, gesetzten Herrn mit einigen grauen Haaren an der Schläfe, obgleich er erst siebenundzwanzig Jahre zählte.
Forestier fragte:
– Wo gehst Du hin?
Duroy antwortete:
– Nirgends. Ich bummle bloß noch einmal herum, ehe ich nach Hause gehe.
– Schön. Weißt Du was, komm’ doch mit zur Vie francaise. Ich habe nämlich Korrekturen durchzusehen Und dann trinken wir ein Glas Bier zusammen.
– Gern!
Und sie gingen Arm in Arm davon, mit jener leichten Familiarität, wie sie zwischen Schulfreunden und Regimentskameraden besteht.
– Was machst Du denn so in Paris? fragte Forestier.
Duroy zuckte die Achseln:
– Nu, ich krepiere einfach vor Hunger. Als ich meine Zeit abgerissen hatte, wollte ich hierher kommen, um – na Gott, um mein Glück zu machen oder vielmehr um eben Pariser Pflaster zu treten. Und jetzt bin ich seit anderthalb Jahren bei der Nordbahn im Bureau angestellt und kriege fünfzehn hundert Franken jährlich, keinen Deut mehr.
Forestier brummte:
– Verflucht, das ist nicht gerade viel!
– Ja, das finde ich auch. Aber was soll ich machen. Ich stehe allein, kenne niemanden, und kann mich bei niemandem in die Wolle bringen. Am Willen fehlt’s nicht, aber es geht eben nicht.
Sein Kamerad sah ihn von Fuß bis zu Kopf an, als praktischer Mann, der jemanden sofort beurteilt, und sagte dann in überzeugtem Ton:
– Weißt Du, Alter, hier hängt alles vom Auftreten ab. Ein Kerl, der ein bißchen gerissen ist, wird hier eher Minister als Büreauchef. Man muß sich einfach den Leuten aufdrängen und nicht erst groß fragen. Aber Teufel noch einmal, hättest Du nichts Besseres finden können, als eine Beamtenstelle an der Nordbahn?
Duroy antwortete:
– Ich habe mich überall umgethan, aber nichts gefunden. Allerdings jetzt grade habe ich was in Aussicht, ich soll nämlich als Bereiter in den Tatterfall von Pellerin eintreten. Dort kriege ich wenigstens dreitausend Franken.
Forestier blieb stehen:
– Thu bloß das nicht! Das wäre zu dumm. Und wenn Du zehntausend Franken verdientest! Aber damit riegelst Du Dir die Zukunft zu. In Deinem Bureau bist Du wenigstens verborgen. Kein Mensch kennt Dich und wenn Du sonst das Geschick hast, Deinen Weg zu machen, gehst Du eben eines Tages einfach fort; aber bist Du einmal Stallmeister, dann ist’s aus, das ist genau so, als ob Du Diener werden wolltest in irgend einem Haus, wo Ganz-Paris verkehrt; wenn Du erst mal den Herren aus der Gesellschaft oder ihren Söhnen Reitstunden gegeben hast, sehen sie Dich niemals mehr als ihresgleichen an.
Er schwieg, dachte ein Paar Augenblicke nach, dann fragte er:
– Hast Du eigentlich das Abiturientenexamen gemacht?
– Nein, ich bin zweimal durchgefallen.
– Das macht nichts, wenn Du nur so weit gekommen bist; wenn man von Cicero spricht oder Tiberius, so wirst Du doch so etwa wissen, wer das ist?
– O ja, so ziemlich.
– Also gut, eigentlich weiß doch niemand mehr von ihnen, höchstens so zwei Dutzend Kamele, die doch nicht im stande sind, sich aus der dümmsten Sache herauszusitzen. Ach, weißt Du, schwer ist das weiter nicht, für einen riesig klugen Kerl zu gelten. Man muß sich nur nicht gerade mit Dummheit klappen lassen. Man redet so ‘rum, vermeidet die Schwierigkeiten, umgeht jedes Hindernis und macht kolossalen Eindruck, indem man das Thema, über welches man quasseln will, vorher genau im Konversationslexikon nachliest. Die Männer sind alle dumm wie die Gänse und unwissend wie Karpfen.
Er redete wie ein ruhiger vernünftiger Mensch, der das Leben kennt wie es eben ist. Und wie die Menge so an ihm vorüberflutete, lächelte er. Aber plötzlich fing er an zu husten, blieb stehen, um den Anfall vorübergehen zu lassen und sagte dann mutlos:
– Ist das nicht zum Verzweifeln, daß ich diesen verfluchten Katarrh nicht los werden kann und dabei ist’s jetzt Sommer. O, diesen Winter gehe ich unbedingt nach Mentone. Der Teufel soll den ganzen Kram holen, die Gesundheit geht mir vor.
Sie kamen auf dem Boulevard Poissonnière an eine große Glasthür, hinter der eine auseinandergefaltete Zeitung angeklebt war. Drei Leute standen davor und lasen.
Ueber der Thür stand, wie ein Aufruf an das Volk, in großen feurigen Buchstaben, durch Gasflammen gebildet, die Inschrift: La vie française. Und die Vorübergehenden, die unvermutet in den Lichtkreis traten, den die drei leuchtenden Worte warfen, erschienen plötzlich hell bestrahlt, scharf und deutlich wie am lichten Tage, um dann wieder in das Dunkel zurückzutauchen.
Forestier öffnete die Thür und sagte:
– Komm!
Duroy trat ein, ging eine schmutzige Treppe hinauf, die man von der Straße aus sehen konnte und kam in ein Vorzimmer, wo sich zwei Büreaudiener befanden, die seinen Begleiter begrüßten. Dann machten sie Halt in einer Art von Wartezimmer, staubig und schlecht gehalten, das mit unechtem, gelblich grünem Sammt tapeziert war, voller Flecke, hier und da abgestoßen, als ob die Mäuse daran herumgeknabbert hätten,
– Setz Dich, sagte Forestier, ich komme in fünf Minuten wieder.
Und er verschwand durch eine der drei Thüren, die in den Raum führten.
Ein seltsamer eigentümlich-unerklärlicher Geruch, der Geruch der Redaktionszimmer, lag hier in der Luft. Duroy blieb unbeweglich, ein wenig eingeschüchtert, vor allem aber erstaunt stehen. Ab und zu kamen Leute, die eilig durch eine Thür eintraten und durch die andere, ehe er sie recht betrachten konnte, den Raum wieder verließen.
Es waren bald sehr junge Leute, die thaten, als ob sie sehr beschäftigt wären und in der Hand ein Blatt Papier hielten, das beim Gehen im Luftzug flatterte. Bald kamen Setzer vorbei, aus deren Druckschwärze-bespritzten Blousen ein leuchtend weißer Hemdkragen herausschaute und unten eine Hose, wie sie nur ein Herr trägt. Vorsichtig hielten sie Papierstreifen in der Hand, frische Korrekturen, die noch ganz naß waren. Ab und zu trat ein kleiner Herr ein, elegant aber zu auffallend gekleidet, die Taille eng im Gehrock zusammengeschnürt, die Hose zu prall sitzend, die Stiefel zu spitz – irgend ein Reporter für die feine Welt, der die Neuigkeiten des Abends überbrachte.
Dann kamen noch andere, ernst, mit wichtiger Miene, einen Cylinder mit flacher Krempe auf dem Kopf, als ob diese Form des Hutrandes sie von der ganzen übrigen Menschheit unterschieden hätte.
Forestier erschien wieder. Arm in Arm mit einem großen hageren Herrn zwischen dreißig und vierzig in Frack und weißer Kravatte, von dunkler Hautfarbe, den Schnurrbart spitz gedreht und mit ungezogener selbstzufriedener Miene.
Forestier sagte zu ihm:
– Adieu, lieber Meister.
Der andere drückte ihm die Hand:
– Auf Wiedersehen, lieber Freund!
Und vor sich hinpfeifend, den Stock unter den Arm geklemmt, ging er die Treppe hinab.
Duroy fragte: – Wer ist denn das?
– O, das ist Jacques Rival, weißt Du, der ausgezeichnete Plauderer, der immer so viele Duelle hat. Er hat eben die Korrektur durchgesehen. Garin, Montel und er sind die drei einzigen Feuilletonisten in Paris, die wirklich Geist haben. Er verdient bei uns dreißig tausend Franken jährlich für zwei Artikel die Woche.
Wie sie fortgingen, begegneten sie noch einem kleinen Mann mit langen Haaren, dick, etwas unsauber, der keuchend die Treppe herauf kam.
Forestier zog tief den Hut und erklärte:
– Norbert von Varenne, der Dichter, der Verfasser der ›erloschenen Sonnen‹. Das ist auch so einer, der viel Geld verdient! Jede kleine Erzählung, die er uns giebt, kostet drei hundert Franken und die längsten sind noch nicht zwei hundert Zeilen lang. Aber wir wollen doch in den Neapolitaner gehen, ich verdurste bald.
Sobald sie im Café am Tisch saßen, rief Forestier:
– Zwei Bier!
Und er schüttete auf einen Zug das seine hinunter, wahrend Duroy das Bier langsam in kleinen Schlückchen kostete und schlürfte, wie etwas Köstliches, Seltenes.
Sein Begleiter schwieg, er schien nachzudenken, dann sagte er plötzlich:
– Wie wärs, wenn Du’s mal mit dem Journalismus versuchtest?
Der andere blickte ihn erstaunt an:
– Ja aber hör’ mal, ich habe noch nie eine Zeile geschrieben.
– Ach was, das versucht man eben, man muß eben anfangen. Ich könnte Dich vielleicht verwenden, Du müßest mir Nachrichten holen, allerlei notwendige Gänge und Besuche machen. Für den Anfang könntest Du zweihundertfünfzig Franken monatlich bekommen, außerdem kriegst Du die Auslagen für Wagen ersetzt. Was meinst Du, soll ich mal mit dem Chefredakteur sprechen?
– Ja, gewiß, mir ist’s schon recht.
– Dann will ich Dir einen Vorschlag machen. Komm morgen zu mir zu Tisch. Wir haben fünf oder sechs Personen zum Diner: den Besitzer des Blattes, Herrn Walter, seine Frau, dann Jacques Rival und Norbert von Varenne, die Du eben gesehen hast, endlich eine Freundin meiner Frau. Einverstanden?
Duroy zögerte und ward rot. Schließlich sagte er:
– Ja weißt Du, ich habe keinen anständigen Anzug. Forestier war sehr erstaunt:
– Du hast keinen Frack? Verflucht! Das ist allerdings durchaus nötig. Weißt Du, in Paris braucht man lieber kein Bett zu haben, als keinen Frack.
Dann suchte er in der Westentasche, holte eine Anzahl Goldstücke hervor, nahm zwei Zwanzig-Frankenstücke, legte sie auf den Tisch vor seinen alten Kameraden und sagte herzlich und familiär:
– Weißt Du was, Du giebst mir’s mal wieder wenn Du’s kannst. Jetzt pumpe Dir oder kaufe Dir gegen monatliche Abzahlung den Anzug, den Du brauchst. Kurz, Du mußt dich eben so einrichten, daß Du morgen zu mir zum Diner kommst, ein halb acht Uhr, Rue Fontaine 17.
Duroy war verlegen. Er steckte das Geld ein und stammelte:
– Du bist ja aber zu liebenswürdig, ich danke Dir tausend Mal, ich werde es gewiß nicht vergessen.
Der andere unterbrach ihn:
– Ach, laß doch gut sein. Du trinkst doch noch ein Glas Bier, was?
Und er rief sofort:
– Kellner, zwei Bier!
Als sie dann ihr Bier getrunken hatten, fragte der Journalist:
– Wollen wir ein bißchen herumbummeln, vielleicht noch ein Stündchen!
– Gewiß, sehr gern.
Und sie gingen der Madeleine zu.
– Was sollen wir los lassen? fragte Forestier. Man behauptet, in Paris kann sich ein Bummler stets unterhalten, aber das ist nicht wahr, wenn ich herumbummle abends, weiß ich nie, wo ich hingehen soll. Ins Bois de Boulogne fahren, hat doch nur einen Zweck mit Frauenzimmern und man hat doch nicht immer gleich eine bei der Hand. Tingeltangel, ist doch bloß was für den Bierphilister und seine Frau, aber nicht für mich. Also was soll ich machen? Nichts. Es müßte hier irgend einen Sommergarten geben wie den Park Monceau …. der die ganze Nacht offen ist und da müßte man gute Musik hören, bei irgend einem guten Getränk im Freien. Es dürfte kein eigentliches Vergnügungslokal sein, sondern ein Ort um herumzubummeln. Der Eintritt müßte natürlich hoch sein, damit die hübschen Damen kämen, dann könnte man sich dort auf Kies-bestreuten Wegen ergehen, die das elektrische Licht bestrahlen, sich irgendwo hinsetzen, wenn man die Musik hören will, weit oder nah. Weißt Du, das gabs früher so ungefähr bei Musard. Aber es hatte doch ein bißchen einen Kneipenanstrich und war mehr Tanzlokal und dann war’s auch nicht groß genug, nicht genug Schatten und Dunkelheit! Es müßte ein sehr schöner, sehr großer Garten sein, das wäre doch reizend. Sag mal, wo möchtest Du denn hingehen?
Duroy wußte nicht, was er antworten sollte. Endlich entschied er sich:
– Ich kenne die Folies-Bergère nicht. Da ginge ich ganz gern einmal hin.
Sein Begleiter rief:
– Die Folies-Bergère, verflucht noch einmal, da schwitzen wir aber wie im Backofen. Na, aber meinetwegen, dort ist’s immer ganz ulkig!
Und sie wandten sich auf dem Absatz herum, um nach der Straße des Faubourg-Montmartre zu gehen.
Die erleuchtete Front des Etablissements warf einen breiten Lichtschein auf die vier Straßen, die dort zusammenstoßen. Und eine ganze Reihe Droschken wartete am Ausgang.
Forestier trat ein. Duroy wollte ihn zurückhalten:
– Wir müssen doch erst an die Kasse.
Der andere antwortete wichtig:
– Wer mit mir geht, zahlt nicht.
Als er an den Eingang kam, grüßten die drei Kontroleure und der in der Mitte streckte ihm die Hand entgegen. Der Journalist fragte:
– Haben Sie noch eine gute Loge?
– Natürlich, Herr Forestier.
Er nahm den Coupon, den man ihm hinhielt und stieß die gepolsterte Thür mit den zwei Leder-bezogenen Flügeln auf. Dann standen sie im Saal.
Tabakrauch verschleierte wie feiner Nebel die entfernter liegenden Gegenstände, die Bühne und die andere Seite des Theaters. Von all den Cigarren und Cigaretten, die all die Menschen rauchten, stieg er in feinen, weißlichen Wolken hinauf, immer höher, sammelte sich an der Decke und bildete unter der großen Kuppel rings um den Kronleuchter über der Galerie des ersten Ranges, die vollgepfropft von Menschen war, einen Wolkenhimmel.
Im weiten Eingangs-Korridor, der an den rund umlaufenden Promenadengang führte, wo die geputzte Horde der Mädchen herumstrich, mitten zwischen den dunkel gekleideten Männern, warteten ein Paar Frauenzimmer auf die Ankommenden vor einem der drei Ladentische, hinter denen drei geschminkte und verlebte Verkäuferinnen von Liebe und Getränken thronten. Die hohen Spiegel hinter ihnen warfen ihre Rückansichten und die Gesichter der Vorübergehenden zurück.
Forestier drängte sich schnell durch die Menge, wie ein Mann, der Rücksicht beanspruchen kann.
Er trat zu den Logenschließern:
– Loge Nummer siebzehn!
– Hier, mein Herr!
Und man schloß sie in einen kleinen offenen Holzkasten ein, der rot tapeziert war und vier Stühle von derselben Farbe enthielt, die so nahe beieinander standen, daß man kaum dazwischen vorbei konnte.
Rechts wie links lag eine lange Reihe ähnlicher kleiner Abteilungen, die sich von einem Ende der Bühne bis zum andern im Bogen herumzogen und wo ebenfalls Menschen saßen, von denen man nur Kopf und Schultern sah.
Auf der Bühne arbeiteten drei junge Leute in enganliegendem Trikot, ein großer, ein mittlerer und ein kleiner am Trapez.
Zuerst trat der große vor, kurzen schnellen Schrittes, lächelnd mit einer Handbewegung die Menge grüßend, als wollte er einen Kuß hinüberschicken.
Unter dem Trikot sah man die Muskeln der Arme und Beine sich abzeichnen. Er blies die Brust auf, um den zu starken Leib zu verbergen. Dabei sah er wie ein Friseur aus, denn ein sorgfältig gezogener Scheitel teilte oben auf der Mitte des Kopfes sein Haar in zwei gleiche Hälften. Mit einem graziösen Sprung schwang er sich ans Trapez und an den Händen hängend drehte er sich im Kreise herum wie ein Rad, oder hing unbeweglich mit steifen Armen und gradeaus gestrecktem Leibe, horizontal im leeren Raum am Trapez, nur durch die Kraft der Fäuste gehalten.
Dann sprang er zur Erde, grüßte noch einmal lächelnd unter dem Beifall des Publikums, und blieb seitwärts an der Coulisse stehen, indem er bei jeder Bewegung möglichst die Muskulatur seines Beines zeigte.
Nun ging der zweite, der untersetzt und kleiner war, seinerseits vor und machte dieselbe Übung, die dann auch der letzte wiederholte unter immer größerem Klatschen des Publikums.
Aber Duroy kümmerte sich nicht weiter um das Schauspiel. Er wandte den Kopf ab und blickte unausgesetzt hinter sich auf die große Wandelbahn, wo lauter Herren und Halbweltdamen auf und niedergingen.
Forestier sagte zu ihm:
– Sieh mal, das Parquet. Alles brave Bürgersleute mit Kind und Kegel, die herkommen, um etwas zu sehen. In den Logen dagegen sitzen nur Boulevardbummler, ein paar Künstler und ein paar Mädchen so zweiter Güte und hinter uns siehst Du die sonderbarste Mischung von Menschen, die man in Paris finden kann. Wer mögen die Männer wohl sein? Sieh sie Dir mal genau an. Da ist alles vertreten, alle Berufe und Klassen, obgleich allerdings die meisten mehr oder weniger Gesindel sind; da giebt’s Commis, Bankbeamte, Ladenschwengel, Leute aus den Ministerien, Reporter, Zuhälter, Offiziere in Civil, Dandies im Frack, die eben im Restaurant gegessen haben oder aus der Oper kommen, und dann noch eine ganze Menge zweifelhafter Existenzen, die man nicht recht unterbringen kann. Die Frauenzimmer dagegen sind zweifellos nur von einer Klasse, die, die vom Souper im Americain kommt, das Mädchen für ein oder zwei Zwanzig-Frankenstücke, das dem Fremden fünf abluchst und es seine regelmäßigen Kunden wissen läßt, wenn es gerade frei ist. Die kennt man alle schon seit zehn Jahren. Jeden Abend sieht man sie das ganze Jahr hindurch am selben Ort, sie fehlen höchstens mal, wenn sie in Saint-Lazare oder Lourcine im Lazaret liegen.
Duroy hörte nicht mehr zu. Eins jener Frauenzimmer hatte sich an ihre Loge gelehnt und fixierte ihn. Es war eine dicke Brünette, mit weißgeschminkter Haut, schwarzen länglichen Augen, einem Kohlestrich darunter und mächtigen falschen Augenbrauen darüber. Der zu starke Busen spannte die dunkle Seide ihres Kleides, und ihre gemalten Lippen, rot wie eine blutende Wunde, gaben ihr etwas Viehisches, Glühendes, Uebertriebenes, das aber dennoch reizte.
Durch ein Zeichen mit dem Kopfe rief sie eine ihrer Freundinnen, die gerade vorüberkam, herbei, eine Blonde mit roten Haaren, dick wie sie, und sagte ihr laut genug, um verstanden zu werden:
– Sieh mal, der Kleine da, ist ein hübscher Junge. Für zehn Louis ginge ich gleich mit.
Forestier drehte sich herum, lächelte und schlug Duroy auf den Schenkel:
– Das gilt Dir, Du hast aber Ankratz, mein Alter, ich gratuliere!
Der ehemalige Unteroffizier war rot geworden und tastete mechanisch mit den Fingerspitzen nach den beiden Goldstücken in der Westentasche.
Der Vorhang hatte sich gesenkt und die Musik spielte einen Walzer.
Duroy schlug vor:
– Wir wollen doch mal ‘n bißchen ‘rumbummeln.
– Wie Du willst.
Sie traten aus der Loge und wurden sofort von der flutenden Menge mit fortgerissen, gestoßen, geschubst, gedrückt, hin und hergeworfen, ließen sich treiben, immer vor Augen einen ganzen Wald von Cylindern. Und unter dieser Herrenmenge liefen die Mädchen zu zwei und zwei hin und her, schoben sich mit Leichtigkeit hindurch, glitten zwischen den Ellbogen, den Vorder-und Rückseiten hin, als wären sie ganz zu Haus, als fühlten sie sich sehr behaglich, wie der Fisch im Wasser, mitten in dieser Flut von Männern.
Duroy war entzückt, ließ sich gehen und sog mit Wonne die schlechte Luft ein, die Tabak, allerlei menschliche Ausdünstung und die Parfüms der Mädchen verdorben hatten. Aber Forestier war in Schweiß geraten, atmete schwer und hustete.
– Wir wollen doch in den Garten gehen, sagte er.
Sie wandten sich nach links und kamen in eine Art bedeckten Garten, wo zwei große ordinäre Springbrunnen die Luft verbesserten. Dort standen Lebensbäume und Taxus in großen Töpfen und in ihrem Schatten saßen Männer und Frauen an Tischen und tranken.
– Willst Du noch ein Glas Bier? fragte Forestier.
– Ja gern.
Sie setzten sich und sahen die Leute vorübergehen. Ab und zu blieb ein Mädchen stehen und fragte mit albernem Lächeln:
– Wollen Sie mich nicht auf was stoßen?
Und als Forestier antwortete:
– Gewiß, ein Glas Wasser frisch vom Brunnen! lief sie davon und brummte:
– Alberner Fatzke!
Aber die große Braune, die sich vorhin an die Loge der beiden Freunde gelehnt, tauchte wieder auf und ging, den Arm in den der dicken Blonden geschoben, in unverschämter Haltung vorbei. Die beiden sahen wirklich nicht übel aus und paßten gut zu einander.
Als sie Duroy sah, lachte sie, als ob ihre Blicke sich bereits süße Heimlichkeiten gesagt hätten. Sie nahm einen Stuhl und setzte sich ganz ruhig ihm gegenüber, ließ auch ihre Freundin Platz nehmen, und befahl dann mit lauter Stimme:
– Kellner, zwei Syrup.
Forestier sagte erstaunt:
– Na, Du genierst Dich wirklich nicht!
Sie antwortete:
– Dein Freund hat mirs angethan. Der ist weiß Gott ein hübscher Mann, ich glaube um den könnte ich schon ‘ne Dummheit machen.
Duroy war verlegen und wußte nicht, was er antworten sollte. Er drehte den Schnurrbart und lachte nichtssagend. Der Kellner brachte die Syrupliköre, die Mädchen leerten sie auf einen Zug. Dann standen sie auf und die Braune sagte zu Duroy mit kleinem freundschaftlichen Gruß und einem leichten Schlag mit dem Fächer auf den Arm:
– Na Kleiner, wie ein Wasserfall redest Du gerade nicht.
Und sie gingen davon und wiegten sich in den Hüften.
– Sag mal, Alter, weißt Du, daß Du wahrhaftig Riesenankratz bei den Weibern hast. So was muß man pflegen! Damit kannst Du weit kommen!
Er schwieg eine Sekunde, dann fuhr er fort in einer Art träumerischem Ton wie Leute, die laut denken:
– Durch die Frauen kommt man doch am weitsten.
Und als Duroy noch immer lächelte ohne zu antworten, fragte er:
– Willst Du noch hier bleiben? Weißt Du, ich gehe nach Haus, ich habe weiß Gott, genug davon.
Der andere murmelte:
– Ja, ich bleibe noch ein bißchen hier, es ist noch nicht spät.
Forestier stand auf:
– Also gut. Dann sage ich Dir Lebewohl. Morgen auf Wiedersehen. Vergiß nicht Rue Fontaine Nummer siebenzehn um halb acht.
– Abgemacht. Auf Wiedersehen morgen. Danke schön.
Sie gaben sich die Hand und der Journalist ging.
Sobald er verschwunden war, fühlte sich Duroy frei und nun tastete er noch einmal glückselig nach seinen beiden Goldstücken in der Tasche. Dann stand er auf und stürzte sich in den Menschenstrom, indem er ihn mit den Blicken durchsuchte.
Bald entdeckte er die beiden Weiber, die Blonde und die Braune, die immer noch mit ihrem Bettelstolz durch den Haufen Männer dahin steuerten.
Er ging gerade auf sie zu, aber als er ganz nahe war, wagte er nicht zu sprechen.
Die Braune fragte:
– Na, hast De denn die Sprache wieder gefunden?
Er stammelte nur:
– Bei Gott, ja.
Mehr brachte er nicht heraus.
Nun blieben sie alle drei stehen, den Vorüberschreitenden im Weg, sodaß eine Stockung um sie herum eintrat.
Da fragte sie plötzlich:
– Kommst Du mit?
Er zitterte vor Begier und antwortete brutal:
– Ja. Aber ich habe nur einen Louis bei mir.
Sie lächelte gleichgiltig:
– Das schadet nichts.
Und sie nahm seinen Ann zum Zeichen der Besitzergreifung.
Als sie hinaus gingen, überlegte er sich, daß er mit den ihm verbleibenden zwanzig Franken sich leicht einen Frackanzug für den folgenden Abend würde borgen können.
II
– Bitte, wohnt hier Herr Forestier?
– Dritter Stock links.
Der Portier hatte mit liebenswürdiger Stimme geantwortet, aus der eine gewisse Achtung für seinen Mieter klang. Und Georg Duroy stieg die Treppe hinauf.
Er fühlte sich noch ein wenig eingeschüchtert und etwas unsicher. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Frack und er hatte einiges Bedenken gegen seine Toilette. Er fühlte, daß sie doch etwas mangelhaft sei. Seine Stiefel waren kein Lack, wenn auch ganz sein gearbeitet, denn er liebte es, einen hübschen Fuß zu zeigen. Und dann war das Hemd, das er heute morgen für vier Franken fünfzig im Louvre gekauft hatte und dessen zu dünne Hemdenbrust bereits zerknitterte, eben nicht ganz auf der Höhe.
Seine andern Hemden, die er für gewöhnlich trug, hatten alle mehr oder weniger Defekte. Nicht einmal das verhältnismäßig beste von ihnen hätte er gebrauchen können.
Seine Hose war ein wenig zu Weit und saß schlecht, es war, als schlüge sie eine Falte an der Wade. So sah man ihr sofort das Verbrauchte, Getragene an, das eben solche Mietanzüge haben. Nur der Frack saß ganz gut. Es hatte sich gerade einer gefunden, der ihm ziemlich genau paßte.
Er stieg langsam die Stufen hinauf, sein Herz klopfte, ihm war doch etwas ängstlich zu Sinn. Vor allen Dingen fürchtete er, lächerlich zu sein, und plötzlich bemerkte er sich gegenüber einen Herrn im Frack, der ihn anblickte. Sie waren so nah von einander, daß Duroy eine Rückwärtsbewegung machte und dann ganz verdutzt stehen blieb – er war es selbst, dessen Bild ein hoher Spiegel zurückwarf, der auf dem Treppenabsatz des ersten Stocks stand. Er fuhr zusammen vor Freude, soviel besser aussehend fand er sich, als er gedacht hatte.
Da er zu Haus nur seinen kleinen Rasierspiegel besaß, hatte er sich nicht in ganzer Figur betrachten können, und weil er die verschiedenen Stücke seines improvisierten Anzuges nur schlecht sehen konnte, meinte er, daß sein Anzug schlechter sei, als er wirklich war. Der Gedanke, er spiele eine lächerliche Figur, hatte ihn fast außer sich gebracht.
Aber als er sich nun plötzlich im Spiegel entdeckte, hatte er sich gar nicht wieder erkannt. Er meinte, ein Fremder stünde da vor ihm, ein Herr aus der Gesellschaft, ein Herr, von dem er auf den ersten Blick fand, er sehe sehr gut und sehr chic aus.
Und wie er sich nun sorgsam betrachtete, fand er, daß er im ganzen wirklich einen guten Eindruck machte.
Da studierte er sich, wie es die Schauspieler thun, wenn sie ihre Rollen lernen. Er lächelte sich an, streckte sich die Hand entgegen, machte Bewegungen und drückte Gefühle aus: Erstaunen, Vergnügen, Zustimmung. Dann probierte er verschiedene Abstufungen des Lächelns und allerlei Augenverdrehungen, mit denen man sich bei den Damen niedlich macht und ihnen zeigt, daß man sie bewundert und sie begehrt.
Im Treppenhaus ging eine Thür, und da er fürchtete, in dieser Stellung überrascht zu werden, lief er schnell die Stufen hinauf, denn er hatte Angst, von irgend einem der Gäste seines Freundes hier vor dem Spiegel gesehen zu werden.
Als er an den zweiten Stock kam, bemerkte er wieder einen Spiegel; er verlangsamte seinen Gang, um sich zu betrachten. Sein Anzug und Äußeres schienen ihm wirklich elegant. Es paßte doch alles sehr schön und eine übermäßige Sicherheit bemächtigte sich seiner. Mit diesem Äußern und mit dem festen Vorsatz Carrière zu machen, mit der Energie, die er an sich kannte, und mit seiner Skrupellosigkeit, würde es ihm schon glücken. Eine Lust überkam ihn zu laufen und in ein paar Sätzen den letzten Stock zu erreichen. Vor dem dritten Spiegel blieb er stehen, drehte sich den Schnurrbart in der Art und Weise, wie er es immer that und nahm seinen Hut ab, um seine Frisur zu ordnen; dann murmelte er vor sich hin, wie er’s auch oft that:
– Famose Erfindung.
Dann streckte er die Hand zur Glocke aus und klingelte.
Beinahe sofort ging die Thür auf, und vor ihm stand ein Diener in schwarzem Frack, der sehr würdig aussah, glattrasiert und so vorzüglich angezogen, daß Duroy wieder eine Verlegenheit beschlich, ohne daß er wußte, woher das eigentlich kam. Vielleicht verglich er unbewußt den Schnitt ihrer Kleider. Dieser Diener, der Lackschuhe an hatte, fragte, indem er Duroy den Überzieher abnahm, den er auf dem Arme trug, damit man die Flecken darauf nicht sehen sollte:
– Wen darf ich melden?
Dann schlug er die Portière zur Seite, und rief den Namen in den Empfangs-Salon.
Aber plötzlich verlor Duroy seine ganze Haltung. Er war wie gelähmt vor Furcht. Jetzt sollte er den ersten Schritt in das neue geträumte und erwartete Leben thun. Aber er trat trotzdem ein. Da stand eine blonde junge Frau ganz allein in einem großen, hell erleuchteten Zimmer, das voll Blumen und Pflanzen war, wie ein Gewächshaus und erwartete ihn.
Er blieb kurz stehen, ganz außer Fassung. Wer mochte die Dame sein, die ihn da anlächelte? Dann erinnerte er sich, daß Forestier ja verheiratet war. Und der Gedanke, daß dieses junge blonde Wesen die Frau seines Freundes sein könnte, machte ihn vollends verlegen.
Er stammelte:
– Gnädige Frau, ich bin –
Sie streckte ihm die Hand entgegen:
– Ich weiß, Herr Duroy. Karl hat mir erzählt, wie Sie sich gestern getroffen haben und ich freue mich sehr über seinen guten Gedanken, Sie zu bitten, heute bei uns zu essen.
Er ward rot bis über die Ohren und wußte nicht, was er sagen sollte. Er fühlte, wie sie ihn beobachtete, musterte von Kopf bis zu Füßen, ihn einschätzte und beurteilte.
Er wollte sich eigentlich entschuldigen und irgend einen Grund erfinden, um das Mangelhafte seines Anzuges zu erklären. Aber er fand nichts und wagte nicht an dies peinliche Kapitel zu rühren.
Er setzte sich in einen Stuhl, auf den sie deutete. Und als er fühlte, wie unter ihm der weiche Sammt des Sessels sich niederbog, als er fühlte, wie er versank und die Lehnen dieses weichen Stuhles ihn umfaßten und stützten, dieses Stuhles, dessen Rücken und Seitenarme ihn weich in ihren Polstern hielten, da war es ihm, als träte er wirklich in ein neues schönes Leben, als ob er etwas Köstliches in Besitz nehme, als würde er nun erst Mensch, als wäre er jetzt gerettet nnd geborgen. Und er blickte Frau Forestier an, welche die Augen nicht von ihm gewandt hatte.
Sie trug ein Kleid von blaßblauem Cachemir, das ihre schlanke Figur und ihren starken Busen gut abzeichnete.
Das Fleisch ihrer Arme und der Brust leuchtete aus einer Flut von weißen Spitzen, mit denen die Taille und die kurzen Ärmel besetzt waren. Ihr Haar war auf dem Kopf zusammengerafft, fiel hinten ein wenig in Löckchen herab und bildete eine leichte Wolke von feinem Flaum im Nacken.
Duroy ward wieder sicherer unter ihrem Blick, der ihn, ohne daß er wußte warum, an den des Mädchens erinnerte, das er am Abend vorher in den Folies-Bergère getroffen. Sie hatte graue Augen von einem bläulichen Grau, das einen ganz eigentümlichen Eindruck hervorbrachte, eine schmale Nase, kräftige Lippen, das Kinn ein wenig fleischig und ein unregelmäßiges verführerisches Gesicht, liebenswürdig und boshaft zugleich. Es war eines jener Frauenantlitze, in denen jede Linie einen besonderen Reiz besitzt, eine besondere Bedeutung zu haben und bei der jede Bewegung irgend etwas zu sagen oder zu verbergen scheint.
Nach kurzem Schweigen fragte sie ihn:
– Sind Sie schon lange in Paris?
Er antwortete und gewann allmählich wieder die Herrschaft über sich selbst:
– Gnädige Frau, erst seit ein paar Monaten. Ich bin an der Eisenbahn angestellt, aber Forestier hat mir Hoffnung gemacht, daß ich vielleicht Dank seiner Hilfe zum Journalismus umsatteln könnte.
Sie lächelte etwas mehr, etwas wohlwollender und murmelte, indem sie die Stimme senkte:
– Ich weiß schon.
Die Glocke war von neuem erklungen. Der Diener meldete:
– Frau von Marelle.
Es war eine kleine brünette Dame.
Sie trat lebhaft ein; von Kopf bis Fuß war sie ganz einfach gekleidet, nur eine rote Rose im dunklen Haar zog sofort die Blicke an, und schien ihre Art und Weise festzustellen, ihr etwas Besonderes zu geben, einen lebhaften und energischen Ton, wie er zu ihr paßte.
Ein kleines Mädchen in dunklem Kleide folgte ihr. Frau Forestier ging ihr entgegen:
– Guten Tag, Clotilde!
– Guten Tag, Magdalene!
Sie umarmten sich, dann bot das Kind mit der Sicherheit eines Erwachsenen Frau Forestier die Stirn und sagte:
– Guten Tag, Cousine.
Frau Forestier küßte sie. Dann stellte sie vor:
– Herr Georg Duroy, ein guter Freund von Karl.
– Frau von Marelle – meine Freundin. Wir sind so ein bißchen verwandt.
Sie fügte hinzu:
– Wissen Sie, wir sind hier ganz unter uns und machen gar keine großen Geschichten, nicht wahr?
Der junge Mann verbeugte sich.
Aber die Thür öffnete sich von neuem und ein kleiner, dicker Herr, gedrungen und rund, erschien, der eine große schöne Frau am Arm führte. Sie war größer als er, viel jünger und hatte ein gemessenes vornehmes Auftreten. Es war Herr Walter, Abgeordneter, Finanz-und Geschäftsmann, Jude, Südfranzose, Herausgeber der › Vie française‹, und seine Frau, eine geborene Basile-Ravalau, Tochter des Bankiers dieses Namens.
Dann erschienen kurz hinter einander Jacques Rival, sehr elegant und Norbert von Varenne, dessen Rockkragen speckig glänzte, weil die langen Haare, die ihm bis auf die Achsel fielen, abgefettet und einen weißen Schuppenregen darauf hinterlassen hatten.
Seine Kravatte war unordentlich gebunden und schien nicht gerade frisch zu sein. Er trat auf sie zu mit der Geckenhaftigkeit eines alten Lebemannes, nahm Frau Forestiers Hand und küßte sie. Bei der Bewegung fiel, als er sich bückte, seine lange Mähne herab und umrieselte wie ein Wassersturz den bloßen Arm der jungen Frau.
Nun trat Forestier ein und entschuldigte sich, daß er zu spat gekommen. Aber er war wegen des Falles Morel in der Redaktion ausgehalten worden. Der radicale Abgeordnete Morel hatte nämlich die Regierung interpelliert wegen einer Kreditforderung bezüglich der Kolonisation Algeriens.
Der Diener meldete:
– Es ist angerichtet.
Und man ging ins Eßzimmer. Duroy saß zwischen Frau von Marelle und ihrer Tochter. Er war wieder etwas verlegen. Er hatte Angst, sich irgendwie bei der Handhabung von Messer und Gabel, Löffel oder der Gläser nicht richtig zu benehmen. Es gab vier Gläser, das eine hatte einen leicht bläulichen Schein. Was trank man wohl daraus?
Während der Suppe wurde nicht gesprochen.
Dann fragte Norbert von Varenne:
– Haben Sie den Prozeß Gauthier gelesen? Das ist doch eine eigentümliche Sache.
Und nun sprach man über diesen Ehebruchsfall, der noch verwickelter geworden war durch eine Erpressung, aber man sprach nicht davon, wie man sich in Familie wohl von Ereignissen unterhält, die in der Zeitung gestanden haben, sondern wie Ärzte unter sich über eine Krankheit oder Grünwarenhändler über Gemüse reden. Man war weiter gar nicht empört und nicht erstaunt über das, was zu Tage gekommen. Man suchte nach den tieferen geheimen Ursachen mit professionsmäßiger Neugierde und einer vollkommenen Gleichgültigkeit gegen das Verbrechen selbst. Man suchte die ersten Anfänge genau zu erklären und wie die Gemütsverfassungen gewesen, denen das Verbrechen entsprungen. Bei diesen Auseinandersetzungen fingen auch die Damen Feuer und da wurden andere kürzlich stattgehabte Ereignisse untersucht, besprochen, von allen Seiten betrachtet, auf ihren Wert abgeschätzt mit jenem praktischen Blick und jener ganz besonderen Manier der Neuigkeitskrämer, wie man beim Kaufmann die Gegenstände, die verkauft werden sollen, betrachtet, umdreht und bewertet.
Dann war die Rede von einem Duell und Jacques Rival nahm das Wort. Das war sein Fach, kein anderer hätte darüber sprechen können.
Duroy wagte es nicht, ein Wort zu sagen. Ab und zu blickte er seine Nachbarin an, deren runde Büste ihn anzog. Am Ohr hing ihr ein Diamant, der nur durch einen kleinen Goldfaden gehalten wurde, wie ein Wassertropfen, der auf die Haut hinabgeglitten. Ab und zu machte sie eine Bemerkung, die stets die andern zum Lachen brachte. Sie hatte eine nette, komische Art, ganz unerwartete Wendungen anzubringen, einen schelmischen Geist, der die Dinge sorglos betrachtet und sie mit wohlwollendem, leichtem Skepticismus beurteilt.
Duroy suchte vergebens, ihr irgend eine Artigkeit zu sagen. Er fand nichts und beschäftigte sich mit ihrer Tochter, der er zu trinken einschenkte, die Schüsseln reichte und vorlegte. Das Kind, das ernster war wie die Mutter, dankte mit gemessener Stimme und kurzem Kopfnicken:
– Sie sind sehr liebenswürdig.
Dann hörte sie mit nachdenklicher Miene den Erwachsenen zu.
Das Diner war ausgezeichnet und alle gerieten in Entzückung. Herr Walter fraß wie ein Wolf, sprach fast nichts und betrachtete nur von der Seite mit einem Blick unter den Brillengläsern die Schüsseln, die man ihm präsentierte. Norbert von Varenne half ihm dabei und ließ ab und zu einen Tropfen Sauce auf seine Hemdenbrust fallen.
Forestier überwachte lächelnd und ernsthaft das Diner, tauschte ab und zu mit seiner Frau einen Blick des Einverständnisses, wie zwei Genossen, die eine schwierige Arbeit miteinander abzuwickeln haben und froh sind, daß alles klappt.
Die Wangen röteten sich, die Stimmen wurden lauter. Ab und zu flüsterte der Diener den Gästen zu:
– Corton – Chateau-Larose?
Duroy hatte der Corton geschmeckt und er ließ sich jedesmal das Glas wieder füllen. Eine köstliche Lustigkeit durchströmte ihn, eine warme Fröhlichkeit, die ihm vom Leib zu Kopfe stieg, ihm über die Glieder lief und ihn völlig durchdrang. Er fühlte sich unendlich wohl, körperlich wie geistig, an Leib und Seele.
Und nun überkam ihn die Lust zu sprechen, sich bemerkbar zu machen, angehört zu werden und beachtet von diesen Männern, deren geringste Äußerung man wie eine Offenbarung entgegennahm.
Aber das Gespräch, das immer hin und her flog, einmal hier und einmal dort hängen blieb, sprang von einem Gegenstand zum andern, kam auf irgend einen Ausdruck, ein Nichts. Nachdem die Tagesereignisse durchgehechelt waren und dabei tausend Fragen gestreift worden, kehrte man zur Interpellation Morel über die Kolonisation zurück.
Herr Walter machte zwischen zwei Gängen ein Paar Witze, denn er nahm nichts ohne Zweifel hin. Forestier erzählte seinen Artikel für morgen, Jacques Nival verlangte Militärgewalt und daß allen Offizieren, nach dreißig Jahren Kolonialdienst, Land überwiesen werden sollte.
Er sagte:
– Auf diese Art würde man eine thatkräftige Kolonie schaffen, die seit langer Zeit das Land kennen und lieben gelernt hat, die die dortige Sprache spricht und über alle jene wichtigen Lokalfragen unterrichtet ist, bei denen Neuangekommene zweifellos Schiffbruch leiden.
Norbert von Varenne unterbrach ihn:
– Jawohl, sie werden alles verstehen, nur nicht das Land zu bebauen. Sie werden arabisch reden, aber keine Ahnung davon haben, wie man Zuckerrüben pflanzt und Getreide sät. Sie werden vorzüglich mit den Waffen umgehen können, aber wenig Ahnung vom Dung haben. Im Gegenteil, man müßte das neue Land jedermann im weitesten Umfange öffnen, dann werden die intelligenten Leute ihr Fortkommen finden und die übrigen zu Grunde gehen. Das ist einmal soziales Gesetz.
Man schwieg einen Augenblick und lächelte.
Georg Duroy öffnete den Mund und sagte, selbst erstaunt über den Ton seiner Stimme, als ob er sich noch nie hätte sprechen hören:
– Was da drüben am meisten fehlt, ist guter Boden. Wirklich fruchtbarer Grund und Boden kostet genau soviel wie in Frankreich und wird als Geldanlage von reichen Parisern gekauft; die wirklichen Kolonisten, die Armen, die in die Kolonien gehen, weil sie nichts zu essen haben, sind dadurch auf die Wüste angewiesen, wo nichts wächst, weil das Wasser fehlt.
Alles blickte ihn an und er fühlte, wie er errötete. Herr Walter fragte:
– Sie kennen Algerien, wie es scheint? Er antwortete:
– Gewiß, ich bin über zweieinviertel Jahr dort gewesen und habe mich in allen drei Provinzen aufgehalten.
Da befragte ihn plötzlich Norbert von Varenne, indem er ganz das Gesprächsthema Morel beiseite ließ, über Einzelheiten der Gebräuche, die er von einem Offizier hatte. Es handelte sich um Mzab, diese eigentümliche, kleine arabische Republik mitten in der Sahara in dem ödesten Teil dieser glühenden Gegenden.
Duroy war zweimal in Mzab gewesen und erzählte nun von Sitten und Gebräuchen in diesem eigentümlichen Lande, wo ein Tropfen Wasser mit Gold aufgewogen und jeder Bewohner zu allen öffentlichen Diensten herangezogen wird und wo Rechtschaffenheit in Handel und Wandel stärker entwickelt ist als bei den civilisiertesten Völkern.
Er redete mit einer gewissen großsprecherischen Art: der Wein war ihm zu Kopf gestiegen und er wollte gefallen. Er erzählte Soldatengeschichten, Züge aus dem arabischen Volksleben und Kriegserlebnisse. Ihm standen sogar einige beschreibende Worte zu Gebot über diese gelben, öden Sandflächen, die trostlos unablässig in der glühenden Sonnenhitze liegen.
Alle Damen blickten ihn an. Frau Walter sagte in ihrer langsamen Sprechweise:
– Sie könnten eigentlich aus Ihren Erinnerungen eine Reihe reizender Artikel machen.
Da sah Walter den jungen Mann über die Brillengläser an, wie er es immer that, wenn er Gesichter genau betrachten wollte.
Forestier benützte den Augenblick:
– Verehrter Chef, ich habe Ihnen schon einmal von Herrn Georg Duroy gesprochen und Sie gebeten, ihn mir zur Verfügung zu stellen als Adlatus für die Politischen Nachrichten. Seitdem uns Marambot verlassen hat, habe ich niemanden, um dringende und vertrauliche Erkundigungen einzuziehen! Unser Blatt leidet darunter.
Der alte Walter wurde ernst und schob seine Brille hinauf, um Duroy zu mustern. Dann sagte er:
– Herr Duroy hat unbedingt eine sehr originelle Anschauungsweise, er soll doch mal morgen um drei Uhr zu mir kommen. Wir können uns dann darüber unterhalten und werden die Sache schon in’s Reine bringen.
Dann sagte er nach einem Augenblick Pause, indem er sich zu dem jungen Mann wandte:
– Aber schreiben Sie uns doch jedenfalls gleich einmal eine Reihe von kleinen phantastischen Artikeln über Algerien. Erzählen Sie Ihre Erlebnisse und bringen Sie doch die Kolonisationsfrage hinein, so wie wir eben davon gesprochen haben! Das ist aktuell, sehr aktuell und ich glaube bestimmt, daß das unseren Lesern gefallen wird. Aber beeilen Sie sich, ich muß den ersten Artikel morgen oder übermorgen haben, während man noch in der Kammer über das Thema debattiert. Das zieht Publikum an.
Frau Walter fügte mit jener ernsten Liebenswürdigkeit hinzu, die sie allen Dingen entgegenbrachte und die ihren Worten den Stempel einer Gunsterteilung aufdrückte:
– Ich wüßte einen famosen Titel: Erinnerungen eines Chasseur d’Afrique. Nicht wahr Herr Norbert?
Der alte Dichter, der spät zu Ruhm gelangt war, haßte und fürchtete alle neu Auftauchenden. Er antwortete in trockenem Ton:
– Gewiß, ausgezeichnet, vorausgesetzt daß der Schluß in der richtigen Stimmung bleibt, denn darin liegt die große Schwierigkeit. Das ist genau wie in der Musik der Ton, die richtige Note.
Frau Forestier ließ auf Duroy mit lächelnd gönnerischer Miene den Blick ruhen, den Blick eines Menschen, der den Rummel kennt und damit sagen will: du wirst schon deinen Weg machen. Frau von Marelle hatte sich verschiedene Male zu ihm gewandt und der Brillant in ihrem Ohr zitterte unausgesetzt, als ob der seine Wassertropfen sich ablösen würde und herabfallen.
Das kleine Mädchen blieb ernst und unbeweglich sitzen, die Blicke auf den Teller geheftet.
Aber der Diener ging um den Tisch herum und goß in die farbigen Gläser den Johannisberger und Forestier brachte ein Hoch aus, indem er sich gegen Herrn Walter verneigte:
– Auf langes Gedeihen der ›Vie française‹!
Alle tranken dem lächelnden Chef zu. Und Duroy, der sich in seinem Triumph ganz berauscht hatte, schüttete das Glas auf einmal hinab. Ihm schien, als hätte er genau so gut ein ganzes Faß austrinken, als hätte er einen Ochsen verzehren oder ein Löwen erwürgen können. Er fühlte in den Gliedern übermenschliche Kraft und in seinem Gehirn unbesiegbare Energie, unendliche Hoffnung. Hier unter diesen Leuten saß er jetzt fest, er hatte sich schon eine Stellung gemacht und seinen Platz erobert. Mit ganz neuer Sicherheit blickte er die übrigen an und zum erstenmal wagte er es, ein Wort an seine Nachbarin zu richten:
– Gnädige Frau, Sie haben die schönsten Ohrringe, die ich je gesehen habe.
Lächelnd wandte sie sich zu ihm:
– Das ist aber auch eigene Erfindung, die Brillanten so aufzuhängen, nur an einem Fadchen. Sieht das nicht aus wie ein Tautropfen?
Er murmelte etwas befangen über seine Verwegenheit und in der Befürchtung, er möchte eine Dummheit sagen:
– Reizend! Wirklich reizend! Aber das Ohr hebt auch den Stein!
Sie dankte ihm mit einem Blick, mit einem jener leuchtenden Frauenblicke, die zum Herzen gehen.
Und wie er den Kopf wandte, trafen seine Augen die der Frau Forestier, die immer wohlwollend ihn anblickten, aber er meinte in ihnen etwas Heiteres, Lustiges zu lesen, eine Art Bosheit, eine Ermutigung.
Jetzt sprachen die Herren alle zu gleicher Zeit mit lebhaften Armbewegungen und lauter Stimme. Man redete über das große Projekt einer Stadtbahn. Der Gesprächsstoff ging erst mit dem Dessert zu Ende, denn jeder wußte eine Menge zu sagen über die Langsamkeit der Verbindungen in Paris, die Unbequemlichkeit der Pferdebahnen, das Unpraktische der Omnibusse, die Grobheit der Droschkenkutscher.
Dann verließ man das Eßzimmer um den Kaffee zu trinken. Duroy bot zum Scherz dem kleinen Mädchen den Arm. Sie dankte ernsthaft und reckte sich auf den Fußspitzen in die Höhe, um ihre Hand auf den Unterarm ihres Nachbars zu legen.
Als sie in den Salon traten, hatte er wieder das Gefühl, als käme er in ein Gewächshaus. Große Palmen sandten ihre Zweige in den vier Ecken des Raumes bis zur Decke hinan, und teilten sich oben in langen Wedeln. Zu beiden Seiten des Kamins befanden sich Gummibäume mit runden Stämmen wie ein paar Säulen und streckten eins über das andere ihre langen, dunkelgrünen Blätter hinaus. Auf dem Klavier standen zwei exotische Pflanzen ganz bedeckt mit Blüten, die eine rosa, die andere schneeweiß. Sie sahen wie künstliche, seltsame Blumen aus, viel zu schön, um natürlich zu sein.
Die Luft war frisch, und ein süßer, unbestimmter Duft zog durch das Zimmer, ein Duft, den man nicht hätte erklären, nicht bei Namen nennen können.
Und der junge Mann, der mehr Herr seiner selbst geworden war, betrachtete aufmerksam das Gemach. Es war nicht groß und nichts zog außer den Blumen in der Mitte auf dem Klavier die Aufmerksamkeit auf sich. Keine lebhafte Farbe traf sein Auge. Aber man fühlte sich wohlig, ruhig und beruhigt. Das Zimmer mußte gefallen, es hatte etwas Gemütliches und umfing einen wie mit einer Liebkosung.
Die Wände waren mit alten Stoffen bespannt von verschossenem Violett; kleine gelbe Blumen nur so groß wie Fliegen fanden sich eingestickt darauf.
Die Thüren waren durch Portieren in grau-blauem Soldatentuch verhüllt, auf die mit roter Seide Nelken gestickt waren. Und Sitzgelegenheiten von allen Formen, von allen Größen standen zerstreut in den Räumen herum, Chaiselongues, riesige oder winzige Stühle, Puffs; alle mit Seide im Stil Ludwig XVI. oder mit schönem crêmefarbenem Utrechter Sammt mit Granatmuster überzogen.
– Trinken Sie Kaffee, Herr Duroy?
Und Frau Forestier brachte ihm eine volle Tasse mit liebenswürdigem Lächeln, das auf ihrem Gesicht stehen blieb.
– Ja wohl, gnädige Frau, ich danke vielmals.
Er nahm die Tasse in Empfang und wie er sich ängstlich vorbeugte, um mit der silbernen Zange ein Stück Zucker aus der Zuckerdose, die das kleine Mädchen trug, zu nehmen, sagte die junge Frau mit halber Stimme zu ihm:
– Machen Sie doch Frau Walter ein bißchen den Hof! Dann ging sie davon, ehe er ein Wort erwidern konnte.
Er trank zuerst seinen Kaffee, weil er fürchtete, er möchte ihn auf den Teppich schütten. Dann ward er sicherer und suchte irgend eine Gelegenheit, sich der Frau seines neuen Chefs zu nähern um mit ihr in’s Gespräch zu kommen.
Plötzlich entdeckte er, daß sie in der Hand eine leere Tasse hielt, und da kein Tisch in der Nähe war, wußte sie nicht, wohin sie sie stellen sollte. Er stürzte auf sie zu:
– O bitte, gnädige Frau.
– Danke sehr!
Er setzte die Tasse fort und kehrte dann zu ihr zurück:
– Gnädige Frau, wenn Sie wüßten, wie oft mir die ›Vie française‹, damals, als ich dort in der Wüste war, die Zeit vertrieben hat. Sie ist die einzige Zeitung, die man im Auslande lesen kann, denn sie ist litterarischer, geistreicher und vielseitiger als alle andern. In dem Blatt findet man alles!
Sie lächelte mit liebenswürdiger Gleichgiltigkeit und antwortete ernst:
– Ach, mein Mann hat auch große Mühe gehabt, um diese Art Zeitung zu schaffen, die wirklich einem Bedürfnisse entsprach.
Und sie fingen an sich zu unterhalten. Es wurde ihm leicht, banale Dinge zu sagen, seine Stimme hatte etwas Angenehmes, in seinem Blick lag etwas Liebenswürdiges und sein Schnurrbart hatte etwas unwiderstehlich Anziehendes. Er war über der Lippe wie ganz zerzaust, kraus, lockig und hübsch, von einem leicht rötlichen Blond, das an den Spitzen der Haare etwas heller wurde.
Sie sprachen von Paris, von der Umgegend, von den Ufern der Seine, von Badeorten, Sommervergnügungen, von allem Möglichen, was in der Luft liegt, worüber man reden kann, ohne sich gerade zu sehr anzustrengen.
Dann trat Herr Norbert von Varenne heran, ein Likörglas in der Hand und Duroy entfernte sich taktvoll.
Frau von Marelle, die mit Frau Forestier gesprochen hatte, rief ihn heran:
– Nun? sagte sie plötzlich. Sie wollen’s mit dem Journalismus versuchen?
Da sprach er von seinen Projekten mit ungewissen Ausdrücken und dann fing er mit ihr dieselbe Unterhaltung an, die er eben mit Frau Walter gehabt. Aber da er nun den Gegenstand besser beherrschte, so konnte er es auch mit größerer Sicherheit thun und wiederholte all die Dinge, die er eben gehört, als ob er sie aus sich selbst hätte. Und immer fort blickte er ihr in die Augen, als wollte er dem, was er sagte, einen tieferen Sinn verleihen.
Sie erzählte ihm nun ihrerseits Anekdoten mit der Leichtigkeit einer Frau, die weiß, daß sie geistreich ist und die immer gern etwas komisch sein will. Dann wurde sie familiär, legte ihm die Hand auf den Arm, senkte die Stimme und sagte ihm wieder kleine Nichtigkeiten, die aber auf diese Weise einen intimen Charakter annahmen. Es regte ihn auf, die junge Frau zu streifen, die sich mit ihm beschäftigte. Er hätte sofort sich in ihren Dienst stellen mögen, sie verteidigen gegen alle Welt, um sich ins rechte Licht zu setzen. Und das Zögern in seinen Antworten deutete an, wie sehr sie ihm im Kopfe herumging.
Aber plötzlich rief Frau von Marelle ohne irgend welchen Grund:
– Laurachen!
Und das kleine Mädchen kam.
– Setz Dich mal dahin, mein Kind, Du erkältest Dich am Fenster.
Und Duroy packte eine tolle Lust, das kleine Mädchen zu küssen, als ob von diesen Küssen etwas auf die Mutter hätte zurückfallen müssen.
Mit väterlichem, liebenswürdigem Ton fragte er:
– Nun Fräuleinchen, darf ich Ihnen einen Kuß geben?
Das Kind blickte ihn erstaunt an und Frau von Marelle sprach lachend:
– Sage ihm doch: – Jetzt meinetwegen, aber später nicht mehr.
Duroy setzte sich sofort, nahm die kleine Laura auf die Knie und berührte leise mit den Lippen die gewellten, feinen Haare des Mädchens.
Die Mutter war erstaunt:
– Nein, so was, das ist ja ganz sonderbar, sie ist wahrhaftig noch nicht ausgerissen! Sonst läßt sie sich nur von Damen küssen. Herr Duroy Sie sind unwiderstehlich!
Er errötete ohne zu antworten und mit leichter Bewegung wiegte er das Kind auf den Knieen.
Frau Forestier kam dazu und rief erstaunt:
– Nein, so was! Laurachen ist ja ganz zahm geworden!
Nun näherte sich auch Jacques Rival, eine Cigarre im Munde und Duroy stand auf, um zu gehen. Er hatte Angst, durch irgend ein ungeschicktes Wort den guten Eindruck, den er bisher gemacht, zu zerstören.
Er empfahl sich, nahm und drückte leise die entgegengestreckte Hand der Damen und schüttelte kräftig die Hand der Männer. Dabei bemerkte er, daß die von Jacques Rival trocken und warm war und seinen Druck herzlich erwiderte, die von Norbert von Varenne naß, kalt und ihm kraftlos zwischen den Fingern entzogen ward, die des alten Walter dagegen kühl, weichlich, ohne Energie, ohne Ausdruck, die Hand Forestiers aber fett und lauwarm. Sein Freund sagte zu ihm halblaut:
– Morgen um drei Uhr vergiß nicht!
– Nein, nein. Du brauchst keine Angst zu haben.