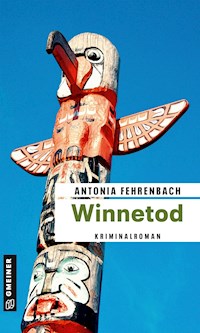Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Viel zu spät bemerkt die junge Biologin Wanda Waals, dass sie sich in die betrügerischen Machenschaften ihres neuen Chefs, Max Sturm, verstrickt hat. Denn eigentlich wollte sie nur ihrer Kollegin Sabine helfen. ... Allzu gut kennt Wanda den Druck, der auf jungen Wissenschaftlern lastet, wenn sie "im Rennen" bleiben wollen. Es ist ein Leben wie auf einer Klinge, über die man früher oder später springen kann. Die "weißen Lügen", verdeckte Datenfälschungen zur besseren Vermarktung der Ergebnisse, mit denen die Kollegen andere und sich selbst betrügen, sind auch Wanda nicht fremd. Aber die Nummer, die Sturm abziehen will, geht ihr zu weit. Hinter dem Projekt NANOSNIFF verbirgt sich eine Substanz von höchst bedrohlichem Potenzial. Wanda ermittelt und gerät, gemeinsam mit ihren Komplizen, in einen Wirrwarr von Intrigen und mysteriösen Todesfällen, die sie von Marburg via München und Berlin in die USA führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Viel zu spät bemerkt die junge Biologin Wanda Waals, dass sie sich in die betrügerischen Machenschaften ihres neuen Chefs, Max Sturm, verstrickt. Denn eigentlich wollte sie nur ihrer Kollegin Sabine helfen. Allzu gut kennt Wanda den Druck, der auf jungen Wissenschaftlern lastet, wenn sie „im Rennen“ bleiben wollen. Es ist ein Leben wie auf einer Klinge, über die man früher oder später springen kann. Die „Weißen Lügen“, verdeckte Datenfälschungen zur besseren „Vermarktung“ der Ergebnisse, mit denen ihre Fachkollegen andere und sich selbst betrügen, sind auch Wanda nicht fremd. Aber die Nummer, die Max Sturm abziehen will, geht ihr zu weit. Hinter dem Projekt NANOSNIFF verbirgt sich eine Substanz von höchst bedrohlichem Potenzial.
Wanda ermittelt und gerät, gemeinsam mit ihren Komplizen, in einen Wirrwarr von Intrigen und mysteriösen Todesfällen, der sie von Marburg via München und Berlin in die USA führt.
Über die Autorin
Die Diplom-Biologin, Antonia Fehrenbach, studierte, promovierte und forschte in Freiburg, Göttingen und Marburg bis sie im Jahr 2005 zu einer alten Leidenschaft zurückfand: der Lust am Schreiben. Inzwischen lebt sie in Schleswig-Holstein, schreibt Kriminalromane, Drehbücher, veranstaltet Erzählabende, verfasst Biografien und begleitet autobiografische Vorhaben.
Weitere Veröffentlichungen
Klärschlamm (2014) und
Windige Hunde (Juli 2017), beide im Gmeiner-Verlag
Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
„Je planmäßiger die Menschen vorgehen,
desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen.“
Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil Eins
Kapitel 1: Unter den Wolken
Kapitel 2: Historische Verbindung
Kapitel 3: Weisse Lügen
Kapitel 4: Nanosniff
Kapitel 5: Das Tagebuch
Kapitel 6: Monday, Monday
Kapitel 7: Das Kennwort
Kapitel 8: Nach(t)forschungen
Kapitel 9: Schwarze Katze
Kapitel 10: Gelöscht
Kapitel 11: Abseits der Altstadt
Kapitel 12: Die Explosion
Kapitel 13: Im Brownschen Universum
Kapitel 14: Schnittstellenkonfusionc
Kapitel 15: Geschenkt
Kapitel 16: Caipirinha um neun
Kapitel 17: Versteckte Pfade
Kapitel 18: In silico
Kapitel 19: Der Lotus-Effekt
Teil Zwei
Kapitel 20: Der Zeuge
Kapitel 21: Nachrichten aus Übersee
Kapitel 22: Der Chat
Kapitel 23: Die Liste
Kapitel 24: Red Button
Kapitel 25: Chilis und Glückskekse
Kapitel 26: Die Aussprache
Kapitel 27: Schneeluft
Kapitel 28: Der erste Schnee
Kapitel 29: Das Care-Paket
Kapitel 30: Die Hypothese
Kapitel 31: Altersgraue Schokolade
Kapitel 32: VIP
Kapitel 33: Meißen und dünner
Kapitel 34: Self assembly
Kapitel 35: Ruhe in Frieden
Kapitel 36: Easy to clean
Kapitel 37: Im Verlies
Kapitel 38: SLAM
Kapitel 39: Koryphäen und Knallfrösche
Kapitel 40: Prost Neujahr
Kapitel 41: Jagdfieber
Kapitel 42: Katzen zählen auf Sansibar
Kapitel 43: Ausgebremst
Kapitel 44: Darwins Korallen
Kapitel 45: Mogelpackung
Kapitel 46: Notbremse
Kapitel 47: Analysten und Kaffeesatz
Kapitel 48: Blaubarts Vermächtnis
Kapitel 49: Schmuggelware
Danksagung
Glossar
Prolog
Die Rockwell-Bronco fliegt eine sanfte Kurve. Tony Stampa blickt aus dem Seitenfenster seines Cockpits. Weiße Dunstfahnen schweben wie Fremdkörper in der klaren Luft. Fast wie ein Wunder. Vor wenigen Sekunden hatte sein Funkspruch an das Tankflugzeug dicht hinter ihm dessen Ventile geöffnet. Es spuckte seine wässrige Fracht in mehreren kräftigen Schüben in den Himmel über der Wüste. Jetzt zieht sich der feine Tröpfchenteppich allmählich in die Breite und schickt sich an, auf dem kargen Land niederzugehen.
Für Tony ein ungewöhnlicher Einsatz. Bald wird diese feuchte Spur verschwunden sein, als hätte es sie nie gegeben. Die Natur hat Wasser für das Gebiet nicht vorgesehen: Die Luft ist auf der Mesa New Mexikos, in fast 2500 Metern Höhe, klar und trocken. Hier ist Nebel ein Fremdwort, das nur bei den Löscheinsätzen im Sommer verwendet wird.
Tonys Blick fliegt über die faltigen Buckel und Runzeln des Gebirges, das wie ein müder Saurier den Nationalpark unter ihm bewacht. Die Gegend hat Geschichte. Bandelier National Monument, das war Indianerland. Die Felsen, ein löchriges Labyrinth aus Höhlen, haben Menschen und Tieren Zuflucht geboten. Heute ist das Terrain ein Museum in freier Natur mit ein paar Dorfruinen aus der Zeit der Pueblo. Viele Orte ihrer zuweilen geheimen Zeremonien sind noch nicht entdeckt.
Er spürt das Prickeln unter der Kopfhaut, wie es den Nacken, schließlich den Rücken hinabläuft, ihn aufrichtet. Es kommt jedes Mal, wenn er mit seiner Rockwell aufsteigt und über das steinige Land jagt. Auf einmal ist er Pionier und Sheriff zugleich. Fünfzehn Jahre Kommandoflieger und immer sind es Brände gewesen. Leben retten, Häuser schützen. Seine Arbeit macht Sinn. Und noch immer der verbissene Krampf in seinen Kiefern, wenn er an die Buschbrände von vor drei Jahren denkt. Dieser verrückte Park Service! Tony schnauft. Der glühend rote Streifen, der damals den Himmel über Los Alamos verfärbte, war kein Sonnenaufgang gewesen. Eine Fehlentscheidung war es. Die vom Nationalparkmanagement gehörten alle entlassen. Kontrollierter Brand! Und das bei der hiesigen Trockenheit. Tony schüttelt den Kopf. Nein. Es war kein Fehler gewesen, ein Vergehen war das, verantwortungslos und dumm. Er stellt sich die Leute vom Parkservice vor, wie sie von einem Bein aufs andere treten, sich langweilen, dann auf Geheiß ihres Vorgesetzten, der sie zu beschäftigen versucht, Buschwerk zusammentragen, es ohne ein Quäntchen Verstand anzünden.
Keiner von ihnen hatte mit dem Wind gerechnet.
Der wirbelte die Glut hoch in die Luft und blies sie weiter nach Westen. Vor Tonys geistigem Auge fällt ein rot glitzernder Funkenregen auf trockenes Holz, frisst sich in fremdes Gewebe hinein wie ein Tumor, der alles assimiliert und schließlich zerplatzt. Zerstäubt. Noch mehr Funken, Flammen, Rauch. Das Feuer lebt. Sein rötlicher Schein stand bedrohlich am Himmel über Los Alamos. Fast 60 Meter hoch schossen die Flammensäulen aus den Pinienwäldern um die Stadt herum in die Luft. Überall Brandgeruch und Rauchfahnen. Rund 1000 Feuerwehrleute rangen vom Boden aus mit den Flammen. Ein halbes Dutzend Löschflieger waren im Einsatz. Alle kämpften bis zur Erschöpfung. Am sechsten Tag ging der Drache endlich in die Knie. Zwar vernichtete das Feuer mehr als 500 Gebäude, aber einen Übergriff auf die Atomwaffenlaboratorien in Los Alamos konnten sie abwehren. Der Boss des Parkservice, der den Brand angeordnet hatte, war nach der Katastrophe gefeuert worden. Wenn der Gouverneur es nicht getan hätte, wäre Tony womöglich die Faust ausgerutscht, so wütend war er gewesen.
Ein leichter Zug am Steuergriff bewegt das Höhenruder. Schon hebt sich die Nase der Maschine. Tony schaut in den blauen Himmel hinauf, er hält kurz die Luft an. Ausatmen! Dieses Mal ist es kein Feueralarm. Lediglich ein wissenschaftliches Experiment. Eine kalifornische Firma hat ihn dafür geheuert. Der Auftrag lautet anders als sonst. Keine Kriegserklärung an das Feuer, sondern eine versöhnende Geste, um die Brandwunden und Blasen, mit denen das Erdreich hier noch bedeckt ist, endlich zu heilen. Eine Substanz zur Entgiftung des Bodens, hieß es. Zielgebiet: eine Fläche von 560 Hektar zwischen der nördlichen Parkgrenze und Los Alamos. Übersichtlich. Kein Risiko. Damals war hier ein Treibstofflager bei der großen Brandkatastrophe den Flammen zum Opfer gefallen, und seine schädlichen Hinterlassenschaften hatten den Boden unbrauchbar gemacht.
Tony schaut auf die Uhr im Bordcomputer. 11:30. Der Kalender daneben zeigt den 23. Mai 2003. Alles ist nach Plan verlaufen. Aus seinem Cockpit verfolgt Tony den Weg eines Reisebusses über die South Route Four, die von White Rock aus in einem weiten Bogen die nördliche Grenze des Nationalparks berührt. Wie ein ferngesteuertes Spielzeugauto fährt der Bus unbeirrt weiter in Richtung Westen. Inzwischen schwebt der feine Sprühschleier tief unten. Als er die Straße erreicht, ist er nur noch ein vager Hauch, über den der Bus arglos hinwegrollt.
Teil Eins
1
Unter den Wolken
Das Flugzeug setzte mit einem Ruck auf. Wanda war sofort hellwach. Die Zeiger ihrer Uhr standen auf halb fünf, Ortszeit von Chicago. Auf dem Zifferblatt las sie das Datum: 15/04/05. Es gab ihr die Gewissheit, dass seit ihrer Abreise tatsächlich ein ganzer Tag vergangen war.
Während die Maschine zum Terminal rollte, zogen Bilder der vergangenen 24 Stunden an ihrem inneren Auge vorbei. Der strahlend blaue Himmel, der sich gestern Mittag beim Abflug von Rochester über dem Ontario See wölbte. Es war kalt gewesen, aber zum Glück hatte es nicht mehr geschneit. Mitte April war das in der Region keine Seltenheit. Dann die Dunstglocke über Chicago. Am Abend war Wanda in die Maschine nach Europa gestiegen. Amerika. Europa. Sie wechselte die Kontinente schneller als ihre Unterwäsche. Und auf einmal schob sich das Flugzeug zwischen die Wolkenberge über Frankfurt, durchdrang den Tröpfchenvorhang, der sich hinter ihr sogleich wieder zuzog. Es gab kein Entrinnen, und zum ersten Mal spürte sie am ganzen Körper die Unumstößlichkeit ihrer Rückkehr.
Weshalb bin ich überhaupt hier? Und warum ausgerechnet jetzt diese Frage? Es war doch alles ganz klar. Ich musste weg, damit die Sache ein für alle mal vergessen wird. Und jetzt habe ich eine neue Chance.
Die Maschine erreichte den Flugsteig, stand still. Die Metallverschlüsse der Sicherheitsgurte klackten. Auf den Kabinenfenstern zog der Wind seinen Pinsel durch die Regentropfen. Ein hellgrauer Himmel schimmerte in den zarten Wasserstrichen. Sie linste verstohlen auf die Armbanduhr ihres Nachbarn. Zwanzig vor 12. Pünktlich gelandet.
Wanda folgte dem Strom der Passagiere in das Labyrinth des Flughafens. Am Kofferband musste sie eine Weile warten. Ihr Rucksack war unter den letzten Gepäckstücken. Sie lief ihm entgegen, begrüßte ihn wie einen alten Freund: der einzige, der sie nach langer Abwesenheit zu Hause Willkommen hieß. Dr. Wanda Waals stand in fetten Buchstaben auf dem kleinen Kofferschild und die Adresse in Marburg, bei der sie für ein paar Tage unterkommen konnte. Es stimmte also. Sie war wieder da.
An der Rolltreppe zu den Bahnstationen schulterte sie den Rucksack und stellte den großen Koffer quer, sodass er nicht weg rutschen konnte. Hinter ihr drängten Menschen. Ihr wurde heiß. Deutschland war so eng. Auf der nächsten Ebene lief sie hilflos zwischen den Plänen mit den Abfahrtszeiten der S-Bahnen hin und her. Keine elektronische Hinweistafel, die auf Reiseverbindungen für Fernzüge verwies. Auch keine Schwarze in Uniform, die ihr mit einem „nice trip, mam“ den Weg zeigte. Die Menschen hasteten an ihr vorbei, schienen zu wissen, wohin es ging. Sie spürte den Sog, aber widerstand der Versuchung, der Menge zu folgen. Eher zufällig entdeckte sie den Hinweis auf eine Verkaufsstelle der Bahn.
Der Rollkoffer ratterte über den Bodenbelag. Die holperige Strecke nahm kein Ende. Der Lärm ohrenbetäubend. Passanten schauten auf. Strafende Blicke. Willkommen in Deutschland. Endlich erreichte sie den Schalterraum. Eine Menschenschlange vor der einzigen besetzten Verkaufsstelle. Sie reihte sich ein und wartete. Der Raum war klein, roch nach feuchten Wintermänteln und kaltem Schweiß. Kein Ort zum Atmen. Am Schalter kaufte sie eine Fahrkarte für die nächste Verbindung nach Marburg und eilte zur S-Bahn.
Im Frankfurter Hauptbahnhof meldete die große Anzeigetafel Verspätungen für Fernzüge aus dem Süden. Menschen drängten aus überfüllten Waggons, schoben sich zwischen den Strom der Abreisenden, den sie teilten und unterspülten wie salzige Flutwellen die Mündung des Flusses, der sich nicht aufhalten lässt, sein Ziel zu verfolgen, sich in der Weite aufzulösen. Wanda rempelte sich einen Weg durch die Menge zu ihrem Gleis. Sie war überrascht, wie leicht ihr dieses Verhalten nach zwei Jahren amerikanischer Sozialisierung noch fiel. Hundemüde sehnte sie sich nach einem warmen Plätzchen, an dem sie die Augen schließen und sich ihrer Mattigkeit hingeben konnte.
Ein Regionalexpress nach Treysa wartete auf Anschlusszüge. Aus dem Fenster der Lok baumelte ein rot behaarter Arm.
„Excuse me.“ Sie bemerkte sogleich ihren Fehler. Dann tauchte der verstrubbelte Kopf des Lokführers auf. Seine blauen Augen strahlten. Wieder lag ihr ein englischer Satz auf der Zunge, den sie diesmal verschluckte.
„Ich möchte nach Marburg.“ Es klang ein bisschen wie das Betteln eines kleinen Mädchens.
Der Mann nickte ihr aufmunternd zu. „Nur einsteige, junge Frau!“
Im Zug waren die meisten Plätze bereits besetzt. Wanda kämpfte sich an sperrigen Gepäckstücken vorbei und fand schließlich einen Fensterplatz im unteren Teil des Waggons an der Zugspitze. Den Koffer ließ sie im Gang stehen. Ihren Rucksack nahm sie auf den Schoß. Schräg gegenüber ließ sich ein junger Typ auf den Sitz fallen. Er atmete heftig wie nach einem Spurt. Die dunklen Klamotten unterstrichen seine Blässe. Er nahm die Brille ab und rieb die beschlagenen Gläser an seinem Sweatshirt. Dabei trafen sich für einen Moment ihre Blicke. Er lächelte nicht.
Wanda schaute zur Seite. Aus den Augenwinkeln konnte sie sehen, wie er bald die Arme vor der Brust verschränkte und sich zum Fenster drehte. Sie ließ ihren Kopf auf den Rucksack sinken. Sie spürte die Schwere ihrer Lider, die Augen fielen ihr zu, und sachte glitt sie durch die ersten Nebelschwaden schläfriger Bewusstlosigkeit. Ein leichter Ruck riss sie wach. Mit 15 Minuten Verspätung rollte der Zug langsam in Richtung Norden.
Durch das Fenster sah sie in eine Puppenstube. Selbst die Hochhäuser hatten etwas Niedliches. Dann eine Schrebergartenkolonie, Wiesen, ein paar Weiler. Die Dinge, die sie umgaben, schrumpften, als spulte ein Film die Kulisse ihrer Kindheit am Fenster vorbei. Es ging zurück aufs Land, dort wo sie nie wieder hin gewollt hatte. Zum Frühschoppen am Sonntag, der Vater trank das kleine Gedeck, am Mittag sprach die Mutter das Tischgebet und der Pastor hielt Andacht am Nachmittag. Mit 14 gab es flüchtige Küsse unter der Raupe beim Schützenfest und später eine entzündete Blase vom Motorradfahren zur Disco in einen Nachbarort. Im Winter ging es nach Winterberg, im Sommer an den Möhnesee. Mit 19 ging sie fort, ohne noch einmal zurück zu schauen. Vor einem Jahr waren die Eltern gestorben. Ganz kurz hintereinander. Sie empfand keine Trauer, nur dumpfe Erleichterung. Deshalb war sie auch nicht zu den Beerdigungen gefahren, sie hätte die Heuchelei am Grab nicht ertragen. Zuviel Arbeit und kein Geld für die Flüge nach Europa. Es stimmte und war zugleich vorgeschoben. Ihr Bruder Robert schrieb ihr schon seit einer Weile nicht mehr. Bestimmt war er verärgert. Sie konnte es ihm nicht verdenken. Irgendwo im Koffer steckte der Brief des Notars. Da werde ich hinfahren müssen.
Draußen mischten sich die Grautöne zu einem düsteren Landschaftsbild. Wie Marburg wohl ist? „Nice place.“ Ricks Stimme war ihr noch deutlich im Ohr. Hatte ihr amerikanischer Boss nicht etwas von einem Schloss gemurmelt? Klang alles ein bisschen verstaubt. Hamburg wäre ihr lieber gewesen.
Der Typ schräg gegenüber telefonierte. Ob sie ihn ansprechen sollte? Sie wollte nur anrufen, um sicher zu sein, dass Kirstens Bekannte den Wohnungsschlüssel bei der Nachbarin abgegeben hatte. Ja, Kirsten war ein Geschenk des Himmels gewesen. Sie kam genau zur richtigen Zeit nach Rochester, um ihr Laborpraktikum zu machen. Wanda war total abgebrannt und dankbar, für zwei Wochen in ihrer Marburger Studentenbude bleiben zu dürfen. Eine Starthilfe, die es ihr erlaubte, in Ruhe eine Wohnung zu suchen und die Formalitäten für die neue Stelle zu regeln.
Der Typ mit dem Handy beendete das Gespräch. Er steckte das Telefon in seine Tasche zurück und zog einen Zettel hervor, den er langsam entfaltete. Seine Augen sprangen unruhig über das Papier. Mit seinem zerzausten Haar hatte er etwas von einem Dirigenten, in dessen Kopf gerade eine Musik tönte. Es musste etwas Dramatisches sein. Kein Klassiker. Bedrohlicher. Spiel mir das Lied vom Tod. In ihrem Schädel vibrierte noch das Katzengeheul der Mundharmonika, als er das Blatt zusammen faltete und es in der Innentasche seines Anoraks verstaute.
Er war sich sicher, dass sie ihn schon seit einer Weile beobachtete. Als Andreas aufschaute, drehte die junge Frau schnell ihren Kopf zum Fenster. Sollte er sie kennen? Sie zeigte nicht gerade viel von sich. Ein hübsches Gesicht, ohne Zweifel, obwohl ihm kein Detail daran wirklich gefiel. Ihr Blick war stumpf. Ihre Haut blass, die Lippen zu schmal, die Nase mit den Sommersprossen ein wenig zu kindlich. Er mochte ihr pechschwarzes Haar. Allerdings trug sie es für seinen Geschmack viel zu kurz. Es war nichts gegen Larissas duftende Haarpracht.
Weshalb hatte er ihr neulich nicht die Wahrheit gesagt? Er hätte nur „Ja“ sagen müssen. Er sah sich noch einmal an den Rahmen der Badezimmertür gelehnt. Die Hände in den Hosentaschen vergraben, schaute er seiner Freundin beim Packen zu. Sie traf ihre Reisevorbereitungen. Er selbst war auf dem Sprung nach München. Seine Mutter hatte gebeten, schnell zu kommen. Sein Vater war eben ein hohes Tier gewesen, die Trauerfeierlichkeiten für seine Beerdigung entsprechend aufwendig.
„Soll ich nicht doch mitkommen?“, hatte Larissa ihn gefragt.
Es war das Mitleid in ihren Augen, das seine Abwehr entfachte.
„Du musst jetzt an dich denken. Meine Familie ist meine Angelegenheit.“ Er hatte lässig wirken wollen und mit tiefer Stimme gesprochen. Mit seinen Problemen wolle er ihr nicht die Vorfreude auf die lang ersehnte Reise verderben. Ihr Nicken kam ihm dankbar vor. Es war ihm wichtig, dass ihr letzter Eindruck von ihm nicht dieses hilflose Bündel aus Schuldgefühlen war, als das er sich fühlte. Inzwischen sehnte er sich danach, seinen Kopf in Larissas dunkler Löwenmähne zu vergraben und sich selbst zu vergessen. Aber sie war auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen. Er wünschte sich, dass sie aus dem Zugfenster schaute so wie er jetzt, dass sie sich für Bruchteile von Sekunden wieder erkannten.
Irgendwann klingelte sein Handy.
„Wo bist du gerade?“ Ihre Stimme war voller Zuversicht. Aber ihre Züge waren längst aneinander vorbei gefahren. Er blickte auf den großen Rolli im Gang. Der Papierstreifen der Fluggesellschaft mit der Gepäcknummer hing noch am Koffergriff. Er seufzte. Die einen kommen, die anderen gehen.
Andreas zog noch einmal den Zettel aus der Tasche, den ihm ein Fremder vorgestern auf der Beerdigung seines Vaters zugesteckt hatte. Andreas stand am Grab neben der Mutter. Die Trauergäste zogen an ihnen vorbei, drückten ihm die Hände. Menschen, die er nie zuvor gesehen hatte, berührten ihn, wühlten ihn auf und ließen ihn doch ausgehöhlt zurück. In ihren Augen stand immer dieselbe Frage, als könnte er ihnen eine Antwort auf den plötzlichen Tod seines Vaters geben. Manchmal waren die Begegnungen auch vollkommen blicklos, ein flüchtiges Streifen von Fingerspitzen.
Irgendwann senkte auch er die Augen. Er konnte sich nicht erinnern, wie lange er dem Zug der Trauernden seine Hände überlassen hatte. Und auf einmal hielt er dieses Papier in den Fingern. Als er aufblickte, stand ein junger Mann vor ihm, Mitte 20, kaum älter als er selbst. Seine Augen blickten ernst, beinahe aufmunternd. Es dauerte eine Weile bis Andreas begriff, dass hier etwas anderes geschah. Da war es auch schon vorbei. Der Typ verschwunden. Im ersten Moment hatte er an seinem Verstand gezweifelt. Eine Erscheinung? Aber da war dieser Zettel.
Er überflog die Namen, die dort aufgelistet waren. Nur wenige klangen deutsch. Eine internationale Gesellschaft. Er zählte nach. Er kam auf 20 Personen. Die meisten trugen einen Titel. Bis auf den Namen seines Vaters, sagten sie ihm nichts. Vor zwei Monaten, im Februar, hatte er noch mit ihm gestritten. Das übliche Streitgespräch.
Damals konnte er nicht wissen, dass es das letzte sein würde.
2
Historische Verbindung
Andreas Hilberg saß im Büro seines Vaters. Das Weiß des väterlichen Kokons ließ ihn blinzeln. Er sah zur Seite. Sein Blick fiel auf das Kalenderbild. Eine Afrikanerin großformatig, und farbenprächtig auf Hochglanz gedruckt. Die Touristenperspektive. Das heile Afrika. Darüber das Logo einer Pharmafirma. Und das im Februar. Wo war der Bezug zur Jahreszeit? Andreas kapierte nicht. Er schaute zurück zum Vater, der hinter seinem Schreibtisch saß. Professor Günther Hilberg trug wie immer eine Krawatte. Sein Chefarztkittel war zugeknöpft.
„Woran arbeitest du gerade?“ Die Frage seines Vaters hing noch im Raum.
Was sollte er ihm sagen? Dass er sich Gedanken um seine Doktorarbeit machte, dass er über das Ausschalten des Denkens in der modernen medizinischen Forschung schreiben wollte, über den gefräßigen Reduktionismus in der Sprache der Wissenschaftler, den Fehler im westlichen Wissenschafts- und Technologiekonzept, die vermeintliche Illusion von Handlungsfreiheit und dem Dilemma vom Gelingen menschlichen Handelns und der Unabsehbarkeit seiner Folgen?
Vermutlich würde sein Vater es wieder als philosophische Spinnereien abtun, nichts, mit dem er Erfolg haben würde, nicht einmal eine Familie davon ernähren könnte. Ihm kam ein Satz in den Sinn, der nicht sein eigener war, aber über eine Sprengkraft verfügte, die er jetzt brauchte. „Atombomben können so eingesetzt werden, wie man eine Gewehrkugel einsetzt.“ Andreas hatte diese Worte des amerikanischen Präsidenten Eisenhower auf die Brust seines Vaters gerichtet. Er sah, wie sein Vater die Lippen schürzte und mit dem Kopf leicht von links nach rechts pendelte, als suchte er nach einer Mitte.
„Ich dachte, das Thema hätten wir endlich hinter uns. Du kennst meine Meinung. Das hat ein alter Mann vor 50 Jahren gesagt. Längst überholte Prognosen. Junge, hör endlich auf, dich selbst zu bemitleiden. Komm zurück in die Wirklichkeit.“ Dann dozierte er über Atomwaffensperrverträge, dass man daraus für die Zukunft gelernt hätte, dass jede sinnvolle Technologie missbraucht werden könnte, jede Nutzung daher reguliert, ja kontrolliert werden müsste und dass wir, bei aller Betroffenheit über das, was in der Vergangenheit geschehen wäre, inzwischen verantwortlich handelten.
Andreas hatte längst aufgehört, ihm zuzuhören. Er mochte es nicht, wenn sein Vater predigte. Aber das Wir, dieses scheinbar verbindliche Wir in seinen Sätzen grub sich in sein Gedächtnis, während seine Augen auf dem Schreibtisch zwischen ihm und seinem Vater ruhten. Kirsche, wie dieser zu sagen pflegte und dabei so tat, als würde er gerade einen Kern ausspucken. Andreas blickte auf das Familienfoto mit Hundebaby. Designerrahmen, die Gesichter kaum wiederzuerkennen, ein Junge nur halb so groß wie er und das Hündchen inzwischen grau, lahm und inkontinent. Neben dem Bild lag die Kugel aus Glas, die er seinem Vater, vor was wusste er wie vielen Jahren, geschenkt hatte. Auf einmal war es wieder da, dieses Wir und während er die Glaskugel im Blick behielt, sagte er leise: „Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken.“
Für einen Augenblick wurde es still. Ein Vogel flog zeternd am Fenster vorbei. Unten im Park modellierte die Sonne schon seit Tagen sanfte Kuppeln aus den kantigen Schneehaufen und Eisbrocken. Sie säumten die Spazierwege, als hätte ein Schneemann seine Spielzeugkiste in die Landschaft gekippt.
Unmittelbar zu Füßen der Krankenhausfestung lag Großhadern, ländlich, beinahe idyllisch, im Südwesten von München. Eigentlich wollte Andreas nach dem Skiurlaub nur auf einen Sprung bei den Eltern in München vorbeischauen. Er hätte es wissen müssen, dass die Mutter sofort den Vater in der Klinik anruft. Der bat ihn nach Großhadern zu kommen, weil er dringende Termine hätte, die sich nicht verschieben ließen. Andreas war zu ihm gefahren. Nun saß er wie ein Patient dem Chefarzt gegenüber und verweigerte dessen Rezepte.
Günther Hilberg schob die Glaskugel beiseite und seufzte. Er sprach heiser und seine Stimme war leiser als früher. Es klang auf eine seltsame Weise kraftlos. „Ja, denken, das konntest du schon immer gut … und schlaue Sprüche machen.“
Andreas hob die Augenbrauen und schmunzelte. „Du schmeichelst mir. Der Satz ‚Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken‘ ist nicht von mir. Ich habe ihn nur zitiert. Es stammt aus einem Manifest von Albert Einstein, sozusagen seinem ethischen und politischen Nachlass. Einstein starb sechs Tage nachdem es erschien.“ Ausdruckslos starrte er in das Gesicht seines Vaters. Es fiel ihm nicht leicht, seinen Triumph zu verbergen. Er mochte die Einsteinschen Aphorismen. Sie ließen sich wunderbar in jedem beliebigen Kontext verwenden. Die Menschen versanken dann nachdenklich in inneren Bildern. Vermutlich sah jeder dabei etwas anderes. Sie öffneten ein Fenster zu ihrer Seele und machten sie auf einer intimen Ebene empfänglich für neue Ideen. Andreas wartete mit seiner Frage bis sich sein eigener Hohn in die Mundwinkel seines Vaters legte. „Und was willst du der Menschheit hinterlassen?“
„Sicherlich keine Gedanken, die ausreichend Kalorien in sich haben, damit sich eine Generation von Philosophiestudenten daran laben könnte.“
Andreas wusste, dies war der Hieb gegen seine Abtrünnigkeit. Zwei Semester Medizin hatten ihn kuriert. Der Sohn des Chefarztes hatte sich tatsächlich getraut, das Studium zu schmeißen. Sie standen wieder an dem Graben, von dem aus ihre Leben seit nunmehr fünf Jahren auseinander drifteten, ihren San Andreas Graben wie seine Mutter die Kluft zwischen ihren beiden Männern gerne bezeichnete. Als müsse er die Hauptschuld daran tragen. Auf dem Rückflug von San Francisco im vergangenen Jahr hatte Andreas nach einem gewaltigen Riss in der Erdkruste gesucht. Aber er erkannte nur einen schwarzen Strich, eine feine Bruchstelle in der rostigen Hülle der Erde, aus der Entfernung beinahe lächerlich und dabei doch ein Pulverfass.
„Wir stehen vor einem großen Durchbruch. Hyperthermie. Wir schicken Nanopartikel in Hirntumoren und heizen sie auf. Das Gewebe zerfällt. Der Tumor verschwindet. Es ist unglaublich. Aber es funktioniert.“
Es hörte sich so an, als wollte sein Vater mit einem Vortrag beginnen. Er sprach weiter, dass die Nanotechnologie einen wunderbaren Werkzeugkasten für den medizinischen Fortschritt bereit hielte, mit dem sich das Wachstum von Tumoren besser kontrollieren, Medikamente gezielter und wirksamer applizieren ließen. Der Kollege Jordan aus Berlin habe da bereits hervorragende Arbeit geleistet.
Andreas lauschte dem betörenden Schnarren in der Stimme seines Vaters, das er wie ein Netz über seine Zuhörer warf, wenn er von seinen Erfolgen sprach.
„Andreas Jordan ist einer von den Besten. Er gibt nicht so schnell auf.“ Die Pause, die jetzt folgte, war einer von Günther Hilbergs rhetorischen Kunstgriffen. „Ein verbaler Angriff ist wie eine Injektion“, hatte sein Vater einmal gesagt. „Die größte Wirkung erzielst du, wenn sich der andere nach einem überraschenden Einstich nicht bewegt. Dann fließen deine Worte wie von selbst hinüber.“
Aber dieses Mal wollte Andreas die väterliche Nadel erst gar nicht an sich heranlassen. „Habt ihr denn immer noch nichts kapiert?“ Seine Stimme stolperte über den schrillen Ton. „Ihr werkelt an einer winzigen Stelle und redet vom großen Durchbruch für die Medizin. Blickt ihr wirklich nicht durch oder tut ihr nur so?“ Spöttisch verzog er die Lippen. „Es ist nicht überall Kompetenz drin, wo Exzellenz draufsteht! Das Geld fließt in den Größenwahn.“
Günther Hilberg drehte den Kopf zur Seite. „Das ist doch närrisch.“
„Alles ist irgendwie miteinander verbunden“, fuhr Andreas unbeirrt fort. „Du kannst nicht an einem Punkt etwas verändern, ohne dass es eine Wirkung auf etwas hat, das weiter entlegen ist. Uns fehlt die Übersicht.“
„Ah, die Geschichte vom Schmetterling, dessen Flügelschlag ausreicht, irgendwo in der Welt einen Hurrikan auszulösen, hatten wir schon.“ Hilberg wirkte müde.
„Erstaunlich, nicht wahr?“, setzte Andreas nach. „Was eine zarte Luftbewegung nicht alles bewirken kann. Auf einmal ist nichts mehr festgelegt. Wir müssen damit rechnen, dass die Apfelsine, die uns hier vom Tisch rollt, im Himalaya einen Steinschlag auslöst, unter dem ein Yak stirbt. Du preist die Vorzüge der Nanowissenschaften, obwohl gerade du wissen solltest, dass bisher niemand die Folgen dieser Technologie wirklich einschätzen kann.“
„Dafür sind andere zuständig. Ich kann nur Katastrophen abwenden.“
„… und erfindest doch nur neue Gummisohlen, um nicht von der Karriereleiter zu rutschen. Die Vorstellung, ganz unten zu liegen, muss schlimm für dich sein.“ Andreas biss sich auf die Lippen. Es war zwecklos. Er konnte nicht anders. Er musste jetzt weitermachen.
„Du bekämpfst Krankheiten, weil du nur in den Kategorien von Gut und Böse denken kannst. Aber was ist, wenn Krankheiten nichts anderes sind, als der Versuch eines Organismus sich anzupassen, also eine Suche nach Lösungen, eine schlichte Laune der Natur, Lust am Experimentieren? Nennen wir es doch einfach die Fähigkeit zur Wandlung, die du nicht akzeptierst, weil du dich hinter deinem teueren Schreibtisch verschanzt und Statistiken wälzt, damit wenigstens die dich bestätigen, auch wenn der Patient leider gestorben ist. Spätestens dann stellst du das Denken ein. Vielleicht ist es auch nur ein unwillkürlicher Kurzschluss. Alle Sicherungen fliegen raus. Bumm. Auch eine Form von Chaos. Ordnung und Kontrolle und die eindimensionalen Wirkketten, die ihr postuliert, sind so selten, wie das Glück …“ Er überlegte kurz. „Na, wie das Glück, beim Quidditch einen Schnatz zu fangen.“
Andreas atmete heftig. Er hatte sich zu einer Predigt hinreißen lassen. Er war kein bisschen anders als sein Vater.
„Wenn ich mich recht erinnere, ist dazu nicht nur Glück, sondern auch ein besonderes Geschick erforderlich.“ Günther Hilberg stand auf. Die ersten Schritte wirkten steif und unbeholfen. Fast stolperte er. Dann fing er sich und trat zum Fenster.
„Was ist?“, fragte Andreas.
Sein Vater schüttelte den Kopf. Er schob die Hände in die Taschen, bis auf die beiden Daumen, die wie zwei einsame Fender über der Reling seiner Kitteltaschen hingen. Sie zitterten leicht. „So spricht nur jemand, der zu viel Zeit zum Grübeln hat. Junge, wenn du wüsstest was hier los ist.“
„Ich weiß das gut genug. Schließlich war ich Zivi in diesem Laden hier.“
Sein Vater hatte ihm den Rücken zugewandt. Andreas sah wie er sich spannte.
„Ich glaube nicht, dass du mir wirklich zuhörst.“ Günther Hilberg sprach jetzt zum Fenster, als würde unten im Park ein Publikum lauschen. „Wir möchten das Glück herausfordern, und dazu müssen wir wirklich gut sein. Das ist unsere einzige Chance.“
Andreas ärgerte sich vor allem über den Neid, den er plötzlich empfand. Da sprach der Arzt, leidenschaftlich, stets um das Wohl seiner Patienten besorgt, der Retter in der Not. Applaus und Vorhang. Sein Vater wirkte so echt in seinem aufgeblasenen Selbstbild, so von sich überzeugt. Es hatte etwas Magnetisches.
„Wir müssen die Gesetze verstehen, von denen die lebendigen Prozesse gesteuert werden“, fuhr Hilberg fort. „Erst dann können wir Einfluss darauf nehmen.“ Er wandte sich wieder Andreas zu. „Es ist wie ein großes Puzzle, dessen Komplexität wir erst richtig erfassen können, nachdem wir die einzelnen Teile herausgenommen und genau untersucht haben.“
„Und wenn du Sandkorn um Sandkorn untersucht hast und die Körner am Ende zusammenfügst, findest du dich vor einem kurzlebigen Sandhaufen an einer Baustelle wieder und nicht an dem Palmenstrand, den du einmal vor Augen hattest“, widersprach Andreas. „Was ist schon ein einzelnes Korn? Erst der Zusammenhang lässt dich erahnen, wo du dich gerade befindest. Wirklich ist, wenn heiße Luft über dem Sandstrand flimmert und das Bild leicht vor deinen Augen verschwimmt. Dann bist du angekommen. Die Annahme, das Universum bestünde aus Teilen, ist nur eine Idee.“
Günther Hilberg schüttelte müde den Kopf. „Ist das wieder so ein Zitat? Du hörst dich an wie der Dalai Lama persönlich.“ Er trat neben seinen Schreibtisch. Auf dem Beistelltischchen türmten sich Zeitschriften und Papierstapel. Er hob ein paar Blätter hoch und legte sie an anderer Stelle wieder ab. Das Papier raschelte in seinen flattrigen Händen. „Nein, uns helfen keine romantischen Vergleiche. Wir brauchen handfeste Instrumente, um die Probleme in den Griff zu bekommen.“
Ein sanftes beständiges Beben durchdrang seine kompakte Gestalt. Im selben Moment meldete sich der Pieper. Günther Hilberg ging an sein Telefon und gab eine Nummer ein. „Ja, bin gleich bei Ihnen“, sagte er. Dann wandte er sich an Andreas. „Tut mir leid, ich habe zu tun.“ Das Handy glitt ihm aus der Hand, als er es in die Ladestation zurückstellen wollte. Er ließ es auf dem Schreibtisch liegen. Auf dem Weg zur Tür drehte er sich noch einmal um. „Gute Reise. Wir telefonieren“, sagte er matt.
Die Audienz war zu Ende. Sein Abgang wirkte verkrampft. Andreas fiel auf, dass er sich langsamer bewegte als üblich. Sein Vater war erstaunlich ruhig geblieben. Kein Wutausbruch, keine Vorwürfe, wie sonst so oft. Nichts, das Andreas Grund genug gegeben hätte, aufzuspringen und die Tür hinter sich zu zu schlagen.
In einer Stunde fuhr sein Zug zurück nach Marburg. Aber ihm fehlte der Impuls für den Quantensprung in sein eigenes Leben. Eben noch wäre er am liebsten ausgebrochen, jetzt sehnte er sich danach, hier zu bleiben, in diesem Raum, in dem noch die Duftmarken seines Vaters hingen. Andreas musste lächeln. Eine historische Verbindung eben. Wenigstens die konnte sein Vater nicht leugnen.
Auf der Rückfahrt damals nach Marburg hatte Andreas sich leichter gefühlt. Kündigte sich da nicht ein Stimmungswechsel zwischen ihm und seinem Vater an? Dass er dann eine Weile nichts von ihm hörte, beunruhigte Andreas nicht weiter. Das war nicht ungewöhnlich. Erst als seine Mutter zwei Wochen später bei ihm anrief, erinnerte er sich wieder an den verhaltenen Tremor, den er an seinem Vater beobachtet hatte.
Die Nachricht kam wie ein Schock. Sein Vater war plötzlich ins Koma gefallen. Günther Hilberg lag in seiner eigenen Klinik, und mit jedem Besuch dort erkannte Andreas, wie sich der Vorhang der Verzweiflung vor die Hoffnung schob und die Angst festhielt, die bald alle Gemüter infizierte und deren Virulenz erst nach dem Tod des Vaters allmählich verebbte. Schlaganfall, sagten die Ärzte und furchten die Stirn, als ob sie etwas für sich behielten. Sie erwähnten das Zittern und die motorischen Ausfälle, die seinen Vater wohl schon seit geraumer Zeit plagten, die er jedoch nicht hatte wahr haben wollen, zuletzt selbst therapierte.
Dann ging alles ganz schnell. Andreas wurde die Sätze, die er seinem Vater noch sagen wollte, nicht mehr los. Günther Hilberg wachte nicht mehr auf. Selbst im Sterben unerreichbar. Er war erst 57 Jahre alt. Er besaß ein starkes Herz. Niemand konnte Andreas erklären, weshalb es dennoch nach wenigen Wochen aufgab. Er konnte nichts dagegen tun, dass seine Wut zuweilen die Gefühle der Trauer überschattete. Diese Stimmung war ihm seit Jahren vertraut, aber jetzt zog sie ihn nach unten wie ein Strudel, in den er sich selbstvergessen stürzte. Er machte sich Vorwürfe, dass er seinem Vater niemals gesagt hatte, wie sehr er ihn vermisste.
3
Weisse Lügen
Wanda erwachte aus einem unruhigen Schlummer. Ein Blick aus dem Fenster verriet ihr, dass sie standen. Gießen las sie auf dem Schild am Bahnsteig. Ihre Armbanduhr zeigte immer noch Chicagoer Zeit: 7:00. Sie rechnete nach. Es musste etwa 14:00 sein. Sie hatte eine gute halbe Stunde geschlafen.
Gegenüber saß immer noch der Typ. Er hatte den Kopf ans Fenster gelehnt. Schaute er oder schlief er? Sie konnte sein Gesicht nicht sehen. Ihre Lust, ihn anzusprechen, war verflogen. Sie reckte sich und gähnte. Freu dich, versuchte sie sich aufzumuntern. Du kannst bald das tun, von dem du immer geträumt hast. Ein toxikologisches Labor aufbauen, eigene Projekte entwickeln, ein Team leiten. Sie hatte nicht lange überlegen müssen, als Max Sturm bei der Tagung im vergangenen Herbst auf sie zugekommen war, um ihr eine Stelle in seinem Institut in Marburg anzubieten. Er hatte regelrecht mit dem vorzüglichen technischen Inventar und den finanziellen Mitteln in seiner Abteilung geprahlt und ihr obendrein in Aussicht gestellt, sie zu habilitieren. Professor Dr. med. Maximilian Sturm schien ihr nicht gerade der väterliche Typ, den sie als Vorgesetzten bevorzugte. Er hatte etwas von einem magersüchtigen Frettchen.
Der Zug setzte seine Fahrt fort. Wanda seufzte und blies ihren Atem auf die kalte Fensterscheibe. Ein feiner Nebel schlug sich dort nieder und verschwand sogleich wieder. Verträumt schaute sie in die graue, regennasse Landschaft.
Ich bin wieder zu Hause in Deutschland. Sie musste sich in die Wange kneifen, um sich zu überzeugen, dass sie nicht träumte. Wie aus der Ferne in eine andere Welt gebeamt. Ein einsamer Seelenzustand aus Abermillionen von Partikeln neu materialisiert. Was will ich eigentlich hier? Die Nestwärme einer Gemeinschaft, die es nicht gibt? Oder habe ich Angst, den Anschluss zu verpassen? Torschlusspanik? In Amerika war ich nur eine unbedeutende Postdoktorandin unter vielen. Die Stelle war auf zwei Jahre befristet. Natürlich hätte sie das Angebot für ein weiteres Forschungsjahr in Rochester annehmen können. Aber da war es wieder dieses Hämmern, das langsam aus der Brust nach oben stieg und gegen ihre Kehle pochte. Zuweilen überfiel es sie nachts, ließ sie stundenlang wach liegen. Nein, sie wollte keine Angst mehr haben müssen. Es war richtig, jetzt zu gehen, versuchte sie sich zu beruhigen. Die eine Sache wird schon niemand bemerken. Jetzt, wo ich weg bin, schon gar nicht. Das Projekt war abgeschlossen. Niemand würde es überprüfen.
Rick hatte gedrängt, weil er ihre Ergebnisse für die Veröffentlichung brauchte. Sie hatte ein paar Zahlen weggelassen. Damit war sie in guter Gesellschaft. Ein bisschen Kosmetik an der Statistik unterstrich nur die Glaubwürdigkeit der Daten, von denen sie sowieso überzeugt war. Sie hatte sich in der Autorenzeile sehen wollen, sich die Gelegenheit, in einer so renommierten Zeitschrift zu veröffentlichen, nicht entgehen lassen können. Auf die Publikation verzichten? Niemand wäre so dumm gewesen. Sie musste so handeln, wenn sie weiter kommen wollte. Schließlich hatte sie nichts gefälscht. Nur ein wenig geglättet. „White lies“ nannten es die Kollegen. Nicht gelogen. Nur bereinigt. Für mehr Klarheit und ein besseres Verständnis. Für eine gute Sache eben. Allerdings nur die halbe Wahrheit. Natürlich konnte man sich dabei die Finger verbrennen. Die Grenzen zum Betrug waren fließend.
Sie öffnete den Reißverschluss ihrer Daunenjacke und fuhr sich mit der Hand über den Hals. Dort war die weiche Falte, das leidige Erbe ihrer Mutter. Sie hatte zugenommen. Der Stress war Schuld. Zwei ruhelose Jahre lagen hinter ihr. Ein Leben wie auf einer Klinge, über die man früher oder später springen konnte. Das musste sich ändern. Die neue Stelle war auf drei Jahre befristet.
Nach ihrer Zusage hatte Sturm gelacht und seine Krawatte glatt gestrichen. „Mal sehen, wie Sie sich so machen.“
Ein Geschmack von Galle war ihr in den Mund gestiegen.
4
Nanosniff
Max Sturm blickte durch das Fenster des Sitzungszimmers. Um diese Jahreszeit unterschied sich der Himmel über Boston kaum von dem über Marburg. Ein leichter Aprilregen fiel auf den blassgrünen Rasen. Wie ein Teppich schmiegte er sich an die Mulden und Wellenberge des Erdreichs. Sturms Augen brannten. Er ließ seinen Blick durch den lichten Regenvorhang in die Ferne schweifen. Aber dieses Grün besaß nicht die Kraft, seine Netzhaut wieder aufzuladen.
Gestern Mittag war er von Frankfurt abgeflogen und fast zu selben Zeit in Boston gelandet. Sechs Stunden Flug gen Westen und bei der Ankunft sechs Stunden Zeitverschiebung nach hinten. Trotzdem war ihm die Reise lang vorgekommen. Seine innere Uhr spielte ein wenig verrückt.
Die Boston Innovative Therapeutics, kurz BIT, hatte einen Wagen zum Flughafen geschickt, der ihn in ein Hotel in der Nähe der Firma brachte. Sie verließen die Stadt. Er kannte die Strecke. Über verknotete Highways fuhren sie nach Nordwesten, bis sie nach etwa einer Stunde Bedford erreichten.
Der Gewinn an Zeit machte ihm zu schaffen. Ausgerechnet ihm, der immer unter Zeitdruck stand. Mit viel Mühe hatte er sich bis zum Abend wach gehalten. Nach dem Essen mit der Geschäftsleitung war er früh zu Bett gegangen. Gegen vier Uhr morgens wachte er auf und konnte nicht mehr einschlafen. Er stand auf, kochte sich einen dieser faden Hotelzimmerkaffees und ging noch einmal seinen Vortrag durch. Er durfte die Aufmerksamkeit der Zuhörer nicht auf die falsche Fährte lenken.
Sabine Mertens war sehr aufgeregt gewesen, als sie ihm kurz vor seiner Abreise nach Boston ihre Beobachtungen geschildert hatte. Zwar mochte er keine Gefühlsausbrüche, doch hatte er ihr zugehört und versucht, sie zu beruhigen. Schließlich war sie eine seiner besten Wissenschaftlerinnen. Nur manchmal ein bisschen zu engagiert. Hoffentlich konnte sie den Mund halten. Er hatte nicht vergessen, sie noch einmal ausdrücklich an die Geheimhaltungserklärung zu erinnern, die sie für diese Kooperation mit der BIT unterschrieben hatte. Ihr Verdacht betraf ausschließlich die Vorversuche für die zweite Studienphase. Solange keine eindeutigen Beweise vorlagen, durfte niemand davon erfahren. Ausgerechnet jetzt, wo die Amerikaner mit ihm weiterarbeiten wollten, musste das passieren. Ein Gerücht, eine undichte Stelle und ihm würden 500.000 Dollar an Projektgeldern durch die Lappen gehen.
Auf dem Tisch vor ihm lag ein Blatt Papier mit dem Zeitplan für die heutige Sitzung. Sturm zog seine Brille ab und rieb sich die Augen. Er setzte die Brille wieder auf. Es fiel ihm schwer, sich an die neuen Gleitsichtgläser zu gewöhnen. Er nickte bedächtig, bis er den Punkt fand, an dem die Buchstaben scharfe Konturen bekamen. Seine Gedanken kehrten noch einmal zu Sabine Mertens zurück. Sie war bloß ein Rädchen in seinem Unternehmen. Austauschbar. Im nächsten Monat sollte die neue Wissenschaftlerin aus Rochester bei ihm anfangen. Die Mertens würde schon still halten, beruhigte er sich selbst.
Er zog ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und drückte seine Finger in den blütenweißen Stoff. Die feuchte Schwüle seines Händedrucks war ihm peinlich. Zum Glück waren die Amis nicht so versessen auf Hautkontakt. Er schaute auf seine Rolex. Noch fünf Minuten bis zum offiziellen Beginn der Sitzung um neun.
„Hello, Max!“
Sturm spürte die schwere Pranke des Geschäftsführers auf seiner Schulter. „Guten Morgen, Paul“, erwiderte er. Der Schreck über diesen jähen Aufprall ließ seine Stimme brechen wie einen dünnen Ast. Er versuchte, es hinter einem missglückten Lacher zu verbergen.
„Sorry, ich weiß, es ist fruh fur euch, die verschobene Zeit und der Klima, aber es is ixtriem wichtig.“ Der amerikanische Akzent klebte an der Aussprache des Geschäftsführers. Sein Deutsch war so gut, dass er alles verstand – was Sturm insgeheim bedauerte, weil es ihm nicht erlaubte, sich mit seinem Anwalt während der Sitzung unbemerkt abzustimmen.
Paul Torman hatte sich in voller Größe am Kopfende des Tischovals aufgebaut und ließ seine Bass-Stimme durch den Raum dröhnen. „Wo is Doktor Looser?“
„Luther“, korrigierte der Jurist, der soeben von der Toilette zurückkehrte, „wie Martin Luther. Einen guten Morgen, Mister Torman.“
„Oh ja, Martin Looser, ich erinnere mich.“ Torman grinste aus seinen dunklen Knopfaugen.
Der Anwalt legte seinen Aktenkoffer auf den Tisch und rückte ihn zurecht, bis die Vorderseite parallel zur Tischkante lief. Er war blass. Sturm lachte ihm aufmunternd zu. Auch wenn er selbst Torman sein plumpes Benehmen nicht wirklich verübelte, so würde er es niemals wagen, ihm den Rücken zuzuwenden. Hinter Tormans Plüschtiercharme verbarg sich ein hungriger Eisbär.
Linda Varn betrat das Sitzungszimmer. Sie war die Produktmanagerin für die Sektion Nanotherapeutics. Sturm hatte sie beim Geschäftsessen am Vorabend kennengelernt. Er schätzte sie auf Ende 20. Blond, blauäugig, schlank und glatt wie ein Aal schien sie gerade von den Dreharbeiten zu einer Doku-Soap in ihre nächste Rolle zu schlüpfen. Auf der Synchronklappe vor ihrem Gesicht stand in fetten Kreidestrichen die Anweisung ‚Bitte lächeln‘. Ihr folgten drei Männer, die er nicht kannte. Das mussten wohl Tormans Anwälte sein.
„Darf ich Sie miteinander bekannt machen?“, wandte sich Torman an die Anwesenden. Der Klang des Amerikanischen nahm seinem Ton die Schärfe. „Doktor Steven Bright, von Lynx-Pharmaceuticals, herzlich willkommen Steve, und das sind Mike Barnfield und Jim Ross, meine Bodyguards.“ Er lachte laut, als er den beiden zunickte. „Natürlich nur ein Joke. Aber wir sind glücklich darüber, dass wir sie vor wenigen Monaten ganz für uns gewinnen konnten. Sie müssen wissen, die BIT hat inzwischen eine eigene Rechtsabteilung.“ Dann zeigte Torman auf Sturm.
„Professor Maximilian Sturm aus Deutschland, Institut für Toxikologie der Universität Marburg sowie Geschäftsführer von NPEX und sein Anwalt Doktor Rolf Loother.“
Sturm hörte wie Luther neben ihm erleichtert ausatmete.
Torman bat alle Sitzungsteilnehmer, am oberen Ende des Tischovals Platz zu nehmen. Er selbst blieb vorne stehen. „Keine Ahnung weshalb es ausgerechnet 12 Plätze gibt“, sagte er achselzuckend. „Ich kann euch versichern, dass wir es hier mit keiner religious Verschwörung zu tun haben.“ Er schaute zu Luther herüber, der wie beiläufig etwas notierte. „Wussten Sie, dass Judas Iskariot beim Abendmahl gar nicht dabei gewesen ist? Jesus hatte ihn weggeschickt.“ Er grinste und machte eine kurze Pause. „Außerdem sind wir nur sieben, was statistisch gesehen die Überführung eines traitors einfacher macht, sollte er unter uns sein.“
Sturm verspürte ein leichtes Zucken am linken Augenlid. Torman hatte die unsichtbaren Grenzen, die ohnehin schon zwischen den Teilnehmern dieser Sitzung bestanden, gerade mit einem Rotstift nachgezogen.
Die Linse des Beamers oben an der Decke des Sitzungszimmers warf das übliche Microsoft-Einheitsdesign, die Blue Jeans für Computeroberflächen, an die Wand, vor die sich Torman inzwischen gestellt hatte. Er nahm die Fernbedienung zur Hand und ließ eine weiße Pfeilspitze über das Wandbild huschen. Sofort erschien dort die Skyline von Boston im Abendlicht.
Sturm stutzte. Hatte er dieses Foto nicht auf einem Prospekt in seinem Hotelzimmer gesehen?
Linda Varn war aufgestanden und zur Tür gegangen. Sie drückte auf ein paar Schalter, worauf sich ein schwarzer Stoff leise surrend aus der Decke herabließ und von innen vor die Fenster schob. Es wurde Nacht im Raum, und wäre nicht der schmale Lichtstreifen am unteren Horizont zwischen Fensterrahmen und den Jalousien geblieben, so hätte Sturm dies hier für die Kulisse einer Zeitreise gen Osten gehalten, auf die andere Seite des Kontinents.
Als nächstes erschien das Firmenlogo der Boston Innovative Therapeutics mit ihrem eingängigen Kürzel.
„Wir möchten heute die zweite Phase unserer Kooperation besiegeln.“ Torman rieb sich die Hände, als wollte er sogleich zur Tat schreiten. „Dazu müssen wir noch ein paar, aus meiner Sicht, nebensächliche Formalitäten klären.“ Er räusperte sich, griff in seinen Hosenbund und zog ihn zum Äquator seines mächtigen Leibs hinauf. „Vielmehr unsere Juristen müssen das tun. Und damit auch die verstehen, was wir machen wollen, möchte ich den Dienern der Justitia den Hauptschauplatz unserer Vorhaben kurz umreißen.“ Seine wachsamen Augen wanderten zwischen den drei Anwälten hin und her. „Also heute eher National Geographic und weniger Nature Medicine. Das sollte Ihnen entgegen kommen. Und bitte, unterbrechen Sie mich, wenn ich mich nicht klar genug ausdrücke.“
Auf der Wand erschien nun ein Bildausschnitt von einer Straße, über die Menschenmassen strömten. Während Torman den stufenlosen Zoom betätigte, kam es Sturm so vor als würden die Personen im Bild auf ihn zukommen. Als einzelne Gesichter deutlich erkennbar wurden, gefror die Bewegung. Es waren alles Köpfe von älteren Menschen, weißhaarige Frauen und glatzköpfige Männer mit würdevollen Mienen und leuchtenden Augen. Sturm musste an die Werbung einer Lebensversicherung denken, die er neulich im Kino gesehen hatte.
„Bisher war der Weg das Ziel“, begann Torman in ruhigem Ton. „Aber wir werden älter und weiser.“ Schweigend schaute er in die Runde, und Sturm begriff sofort, worauf Torman hinaus wollte.
„Wir haben NANOSNIFF entwickelt, um Wirkstoffe mit Hilfe winziger Nanopartikel als Transportfähren über die Riechbahn ins Gehirn zu schleusen“, sprach der Geschäftsführer weiter. „Das ist ein vollkommen neuer Weg. Ich denke an Krebstherapie, Darreichung von Schlafmitteln und Psychopharmaka. Ein breites Spektrum. Wir werden dabei sein, wenn die ersten Sniff-Medikamente auf den Markt kommen. Nose-only. Das Patent ist uns so gut wie sicher.“
Auch Sturm war von der Genialität des Verfahrens überzeugt. Nasenschleimhaut und die Schaltstelle für die Riechnerven im Gehirn lagen so nah beieinander, dass es nur eines Sprungs über den Gartenzaun bedurfte, um Nanopartikel ins Gehirn zu schleusen. Genau genommen war es eine Lücke im Maschendraht, durch die sich die Nano-Zwerge hindurch mogelten, eine uralte Schwachstelle, die von den gefürchteten Viren für Polio und Meningitis schon immer genutzt wurde. Man hatte sich bloß wieder daran erinnert.
Erst im vergangenen Monat hatte Sturm seine BIT-Aktienanteile aufgestockt, auch wenn er in die Hintergründe dieses Projektes nicht wirklich eingeweiht war. Schließlich bestätigten die jüngsten Ergebnisse aus seinem Labor das Prinzip dieser Anwendung als erfolgreich. Noch hütete die BIT das Konzept für NANOSNIFF wie ein Staatsgeheimnis. Nach Deutschland schickten sie nur streng begrenzte Mengen der Nanosubstanz. Der Kooperationsvertrag sah hohe Geldstrafen vor, sollten sie etwas anderes damit machen als die vereinbarten Untersuchungen.
Nanopartikel über die Luft an den gewünschten Ort ihrer Wirkung zu bringen, ohne dass sie verklumpten, war bisher noch niemandem gelungen. Dies machte es unter anderem schwierig, sie in medizinischen Sprays einzusetzen. Die Wissenschaftler der BIT hatten offensichtlich ein Verfahren entwickelt, mit dem sich diese störenden Effekte unterbinden ließen. Sturm mutmaßte, dass das eigentliche Geheimnis von NANOSNIFF auf der Oberfläche der Nanopartikel lag. Ein besonderer Trick, der den starken Anziehungskräften zwischen den Teilchen entgegenwirkte.
Es ärgerte ihn zwar, dass er nicht mehr erfuhr. Gleichzeitig aber machte es ihn stolz, mit an der Front einer so innovativen Entwicklung zu stehen. Für ihn lag die Schnittstelle zwischen Globalisierung von Humankapital und Internationalisierung exzellenter Forschungscluster in den Nanowissenschaften. Inzwischen kamen ihm diese Begriffe so charmant über die Lippen, dass er solche Sätze auch in Momenten größter Erschöpfung, ja sogar aus dem Schlaf heraus, formulieren konnte. Es sparte ihm Zeit und war den Gesellschaften, in denen er sich bewegte, angemessen. Es störte ihn nicht, wenn er sich zuweilen selbst nicht verstand. Es ging nicht darum, was er sagte sondern wie er es sagte. Dennoch wünschte er sich manchmal einen winzigen Sensor an seinem linken kleinen Finger wie eine hauchfeine Nadel. Er würde sie in die NANOSNIFF-Lösung tauchen, um ihr Geheimnis zu erkunden.
Was immer es auch war, es gab keinen Zweifel, dass ihnen eine der größten medizintechnischen Errungenschaften ins Haus stand. Ein Meilenstein auf dem Weg zur Nanotherapie. Weshalb jetzt die Auftraggeber verunsichern? Auf ihren Leerfahrten erwies sich die NANOSNIFF-Sonde als äußerst zuverlässiges Verkehrsmittel und diese Erfolgsmeldung kam aus seinem Labor. Bisher war alles gut gelaufen. Es würde auch weiterhin gut gehen. Zweifel ist Gift für den Wettbewerb. NANOSNIFF funktionierte. Die Zielvereinbarungen waren getroffen, und er war mit im Boot.
„Aber wir wollen mehr“, drang Tormans dunkle Stimme zu ihm durch. Der Geschäftsführer wies dabei mit einer Hand zu den großformatigen Gesichtern auf der Wand. „Wir wollen die Weisheit erhalten, die in all diesen Köpfen steckt. Dort läuft unser künftiges Klientel. Es bewegt sich direkt auf uns zu.“ Mit diesen Worten zoomte er das Bild wieder auf seine ursprüngliche Größe zurück.
Sturm war jetzt klar, dass es hier um mehr ging, als um Kooperationsgespräche mit seiner Firma. Gestern beim Abendessen hatte Torman angedeutet, dass die BIT zurzeit von zwei Pharmariesen umworben wurde. Seine Augen wanderten zu Steven Bright hinüber. Lynx-Pharm wäre sicher kein schlechter Partner.
„Haben Sie schon einmal etwas von epigenetischen Modifikationen gehört?“, fragte nun Torman seine Zuhörer und gab sogleich selbst die Antwort. „Ich würde sagen, die Epigenese bestimmt, was schließlich aus unserem Leben wird. Insbesondere wenn es ein langes ist. Sie ist so etwas wie eine höhere Instanz, die unseren Genen das Wort erteilt oder sie zum Schweigen bringt. Man weiß inzwischen, dass epigenetische Vorgänge in unseren Zellen einen nicht unerheblich Beitrag dazu leisten, dass und wie wir altern. Neurodegenerative Erkrankungen, Demenz, jegliche Art von mentalen Hinfälligkeiten, die mit dem Älterwerden einhergehen, darin liegt unsere Zukunft.“
Feine Risse zogen sich durch das Bild auf der Projektionswand, und schon zerfiel es in winzige Quadrate während sich aus der Tiefe eine Art Rosette in den Vordergrund schraubte. Es sieht aus wie ein Mandala, dachte Sturm. Aber nicht ganz so ebenmäßig. Schließlich hatte es die Natur erschaffen. Er erkannte sogleich die Molekülstruktur der DNA.
„Sie schauen hier auf das Modell eines Nukleosomenkerns“, führte Torman seinen Vortrag fort. „Die farbigen Zylinder in der Mitte stellen Histonproteine dar. Sie bilden so etwas wie eine Spule, um die sich der DNA-Faden wickelt. Im menschlichen Genom soll es 25 Millionen solcher Nukleosomen geben. Stellen Sie sich einfach ein Buch vor, ein Lexikon, das statt auf großflächigen Seiten auf einem schmalen Papierstreifen gedruckt ist. Der Buchbinder hat ihn fein säuberlich um eine lange Kette gewickelt, die er bequem aufrollen und in einer Schublade verstauen kann.
Zum Glück wurde für den Druck nicht starres Papier sondern ein elastisches Material verwendet, das Sie aufdehnen können, denn Sie wollen gezielt nach Begriffen suchen. Nur dort, wo Sie den Streifen von der Kette lösen, können Sie den Text auch lesen. Sie müssen dafür eine Pinzette verwenden, weil der Textfaden so zart ist, dass Sie ihn mit den Fingern nicht fassen können. Genauso verhält es sich in einem Nukleosom. Wie die Pinzette in Ihrer Hand so lockern bestimmte Enzyme in unseren Zellkernen die Bindungen zwischen der Histonspule und dem DNA-Faden. Nur dort kann nämlich der genetische Code gelesen werden.
Nun ist Ihr Lexikon inzwischen in die Jahre gekommen. Der Textfaden klebt an vielen Stellen bereits so fest an der Kette, dass Sie ihn nicht mehr öffnen können. Immer mehr Textstellen werden unlesbar. Das geschieht auch in unseren Zellen, wenn wir älter werden. Wichtige Textstellen unserer Erbsubstanz sind für immer verriegelt. Mundtot. Einfach dicht gemacht. Diesen Vorgängen wollen wir mit einem neuen Therapieansatz entgegen wirken.“
Torman nickte kurz zu seiner Mitarbeiterin herüber, die sogleich aufstand und das Licht anmachte. „Dank NANOSNIFF sind wir mittlerweile in der Lage, kurze Gensequenzen ins Gehirn von Versuchstieren zu schleusen. Wir koppeln sie an unsere Nano-Fähre und schicken sie auf die Reise. Es sind Enzymgene, das heißt, hinter ihrer Sequenz verbirgt sich die Botschaft für verschiedene Enzyme, Katalysatoren, die in das Geschehen der Epigenese eingreifen sollen. Wir liefern sozusagen die Pinzetten, das Werkzeug, das die Hirnzellen benötigen, um verriegelte Textstellen ihres Genoms wieder aufzusperren.“ Er fuhr sich mit der rechten Hand über den Mund. „Das soll genügen. Sie werden verstehen, dass ich über Details aus Gründen des Firmengeheimnisses nicht reden darf.“
In dem Moment glitt Linda Varn zurück an ihren Platz. Sturms Augen hefteten sich an ihren Hintern, der sich wie ein munterer Ball unter dem engen Stoff des blauen Kostümrocks drehte. Da zerriss Tormans Stimme jäh diesen Zauber.
„Unser Experte, Professor Sturm, wird mich bestätigen, wenn ich sage, dass die ersten Gentransfers mit NANOSNIFF erfolgversprechend sind.“
5
Das Tagebuch
Marburg empfing sie mit einem Wolkenbruch.
Wanda schaute gespannt aus dem Fenster, während der Zug einlief. Aber sie sah so gut wie nichts. Was ist ein Bahnhof anderes, als ein Tor zu einem Ort? Er kann Illusionen wecken und zerstören. Hinter riesigen Bahnhofshallen vermutete sie das Flair einer Großstadt. Wenn sie an Flughäfen erinnerten, war die Welt dahinter bestimmt wohlhabend und mächtig. Glichen sie Bushaltestellen, gab es an dem Ort mit Sicherheit nur ein einziges Hotel, wenn überhaupt. Die Ankunft in Marburg ließ sie für einen Moment an ihrer Entscheidung zweifeln.
Das Kofferband an der Treppe zur Unterführung war so tot wie die abgestreifte Haut einer Schlange. Auch auf dem Weg nach oben in die Bahnhofshalle erwies sich das Gepäckgutbeförderungsband als reiner Blickfang. Man hätte Blumen darauf pflanzen sollen. Dieses Mal folgte sie dem Strom der Menschen auf die beiden Türen zu, die sich wie Nadelöhre zur Stadt hin öffneten. Was würde sie dahinter erwarten? Schlammige Wege kamen ihr in den Sinn und nikotingelber Putz, der von den Häuserwänden bröckelte. Der Pfeil zum Ausgang wies auf einen riesigen Schriftzug darüber. ‚Marburger Bier‘ war dort zu lesen. Draußen fiel das Wasser in Sturzbächen vom Himmel. Eines war sicher. Verdursten würde sie hier nicht.
Wanda trat in den Regen hinaus. Eine Bildstörung zog sich quer durch ihr Blickfeld. Laster brausten darüber hinweg. Unter ihren Reifen zischelte nasser Asphalt. Der Unterschied zwischen neuronaler und digitaler Bildbearbeitung wurde ihr schmerzlich bewusst. Mit Photoshop hätte sie die Betonbrücke, die sich vor der Eingangskulisse spannte, einfach ausradiert. Was wohl dahinter lag? Heute schien die Brücke den wolkenschweren Himmel zu tragen.
Wanda eilte durch den Regen hinüber und fand ihre Vermutung bestätigt. Weit und breit bot sie das einzige trockene Plätzchen, und Wanda überlegte, ob sie nicht besser umkehren und ein Taxi nehmen sollte.
Das Wetter wurde allmählich besser, aber Wanda war in den ersten Wochen mit Wohnungssuche und den Aufgaben am neuen Arbeitsplatz so beschäftigt, dass sie es gar nicht bemerkte. Die Welt um sie herum hätte untergehen können, sie wäre im Institut geblieben und hätte weitergemacht.
Sturm hatte natürlich übertrieben. Jetzt, wo sie da war, hieß es auf einmal Humankapital sei kostenintensiv. Sie müsse ihre Projekte schon selbst finanzieren. Also stellte sie eigene Anträge. Sie musste dafür im allgemeinen Computerraum mit den Doktoranden und Postdocs um die heiß begehrten PC-Plätze rangeln. Wissenschaftliche Mitarbeiter bekamen zwar einen eigenen Computer. Nur an Wandas Arbeitsplatz war er noch nicht installiert. Außerdem fehlte ihr Personal. Also packte sie selbst im Labor mit an. Zellkulturen kannten schließlich keine Wochenenden.
Sie war es gewohnt, viel zu arbeiten und auf Freizeit zu verzichten. Allerdings hatte sie mit ein bisschen mehr Starthilfe gerechnet. Hinzu kamen die Kämpfchen mit der Bürokratie, wichtige Bestellungen, die aus unerfindlichen Gründen nicht weitergeleitet wurden. Zwei Monate lang wartete sie auf ihren Computer. Der Vorgang blieb einfach liegen, eine Karteileiche, die erst auf ihre Nachfrage hin langsam zu stinken anfing. Angeblich ein selbst verschuldeter Formfehler bei der Bestellung, über den sie der Einkauf jedoch nicht informierte.
Sie hatte Glück. Kurz darauf verabschiedete sich ein Kollege, dessen Rechner sie übernahm. Endlich konnte sie in Ruhe am eigenen Schreibtisch ihre Texte verfassen, lesen, recherchieren, Datensätze auswerten, Protokolle erstellen. Ihr rauschte der Kopf. Abends fiel sie in einen narkotischen Schlaf. Sie hörte einfach auf, zu denken. Sie funktionierte. Ob sie glücklich sei?, hatte ihre Kollegin Sabine sie einmal gefragt. Wenn Glück bedeutete, dass wir die Zeit vergessen, ja, dann war sie es wohl.
Da Wanda den Sommer nicht wahrnahm, blieb sie blass. Mit einem Mal war die Wohnung kalt, wenn sie spät abends nach Hause kam. Manchmal hörte sie, wie sich der Wind heulend um die Hausecken drückte und an den Fenstern rüttelte.
An jenem Morgen im November hatte sie wieder diesen Traum. Sie ist im Haus ihrer Kindheit. Sie läuft durch die Zimmer, lässt Jalousien herunter, verschließt Fenster und Türen. Sie weiß, draußen ist ein Fremder, ein Einbrecher. Sie spürt seine Bewegungen, wie er heimlich ums Haus herum streift, nach einem Schlupfloch sucht, einer unverschlossenen Tür, einem gekippten Fenster. Etwas, das sie vergessen hat. Ihre Eltern und Robert, ihr Bruder, sitzen wie Wachsfiguren im Wohnzimmer, vor Entsetzen gelähmt. Aber sie hält das Schweigen nicht aus. Sie greift zum Telefonhörer, will die Polizei rufen. Doch die Nummer fällt ihr nicht ein. Sie starrt in das dämmerige Zimmer. Sie ist drinnen und gleichzeitig schleicht sie mit ihm ums Haus herum, kann sie jeden seiner Schliche am eigenen Körper spüren.
Wo ist er gerade? Verdammt. Die Kellertür. Ich habe die Kellertür vergessen.
Sie war mit pochendem Herzen aufgewacht. Diesmal war der Traum weiter gegangen. Der Fremde hatte es geschafft, in ihr Haus einzudringen. Auf ihrer Stirn lastete ein dumpfer Druck. Bitte keine Kopfschmerzen, flehte sie im Stillen. Ihr Konsum an Schmerztabletten war in letzter Zeit bedenklich gestiegen. In der Wohnung war es noch dunkel.
Sie knipste die kleine Stehlampe neben dem Bett an. Vier Uhr. Viel zu früh, um aufzustehen. Aber sie fand keine Ruhe. Barfuss tappte sie ins Badezimmer und schaltete die Therme ein. Sie streifte den langen Rollkragenpulli über den Schlafanzug, zog sich Wollsocken an und schlüpfte in die alten Filzpantoffeln. Noch schlaftrunken schlurfte sie in die Küche. Es war ihr bereits zur Gewohnheit geworden, den Backofen einzuschalten, die einzige Heizquelle in diesem Raum. In ihren Schränken bewahrte sie stets einen Vorrat an Mehl, Zucker und Eiern auf, den sie vorausschauend auffüllte.
Als sie nach einem Rezept suchte, stieß sie auf eines ihrer Tagebücher. Es klemmte im Küchenschrank zwischen den Rezeptbüchern hinten in der zweiten Reihe. Wanda schaltete den Backofen wieder aus, wickelte sich in eine Wolldecke und setzte sich an den Schreibtisch, eine massive Platte aus Kiefernholz, die auf zwei mit Farbspritzern verkleckerten Holzböcken ruhte. Sie klappte das Tagebuch auf. Eigentlich war es nur ein Heft. Eine Metallspirale hielt die Blätter zusammen. Wanda mochte keine Notizbücher, aus denen sich Blätter nicht sauber heraustrennen ließen. Sie hatte viele Tagebücher angefangen, aber nie lange durchgehalten. Irgendwann musste sie auch dieses umgedreht haben, weil sie eine Kladde für ihre Rezepte brauchte. Da waren die Walnussmuffins, die sie zu Sabines Geburtstag gebacken hatte. Über dem verlockenden Titel Französischer Liebeszauber klebte ein eingetrockneter Tomatenkern. Sie kratzte ihn mit dem Daumennagel ab. Wanda hatte diese Salatvariation ausprobiert, um sie bei passender Gelegenheit Thomas zu servieren.
Sie blätterte über etliche unbeschriebene Seiten hinweg. Dann kamen gestauchte Sätze, Buchstaben, die sich duckten. Alles stand auf dem Kopf. Sie drehte das Heft um und las den letzten Eintrag.
Marburg, 20. Juli 2005
Es fällt mir so schwer, mich zu erinnern. Was sind eigentlich Erinnerungen? Winzige Molekülstrukturen, die in unseren Neuronen schlummern? Gebundene Energie, die uns in der Zeit verankert? Der Traum ist wieder zurückgekommen. Ich hatte ihn völlig vergessen. Es kommt mir so vor, als suchte ich unablässig nach einer wichtigen Datei. Eine Fehlstelle in meinem Datenspeicher. Ich kann nicht glauben, dass sie gelöscht ist.
Wäre mein Gehirn jetzt gescannt, ließe sich mit Sicherheit mehr in Erfahrung bringen. Umkehrtechnik. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das einmal gehen soll. Ein Supercomputer soll meine Gedanken denken? Jedenfalls schwärmt Thomas immer davon. Er ist fest entschlossen, sein Gehirn „in Silizium gießen zu lassen“, wie er sagt, oder in einem winzigen Würfel aus Nanoröhrchen unterzubringen, wenn es irgendwann einmal möglich sein sollte. Er behauptet, damit würden künftige Computer das Denken übernehmen.
Ich stelle mir vor, wie die Menschen sich jede Woche zu einer bestimmten Zeit, zum Beispiel montags in der Mittagspause, statt unter die Sonnenbank kurz in die Röhre legen und ein CT ihres Gehirns machen lassen, um die Daten der letzten Woche zu sichern. Wie lästig! Ich schaffe das nicht einmal bei meinem Computer. …
Wanda hob den Kopf und schaute zum Fenster. Auf der noch schwarzen Scheibe erkannte sie sich selbst. „Was ist mit Programmfehlern?“, wollte sie damals von Thomas wissen. „Was ist, wenn die Datei irgendwo hängt und die Erinnerung versperrt?“
„Dann nimmst du ganz einfach ein älteres Backup“, war seine Antwort gewesen.