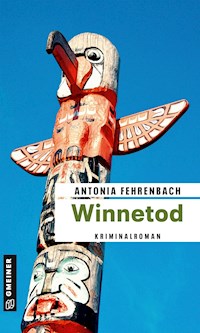Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Polizeimeisterin Franziska Wilde
- Sprache: Deutsch
Ein Aussiedlerhof in der Holsteinischen Schweiz. Schutzpolizistin Franziska Wilde und Karo, die Besitzerin des Hofes, stehen am Fenster und blicken hinaus auf einen Windpark. Karos Sohn Jan wird verdächtigt, am Attentat gegen Henning Pahl, Bürgermeister des Dorfs, beteiligt zu sein. Der »klebt« vor ihren Augen am Rotorflügel seiner Windkraftanlage. Die Zeit drängt. Ein Orkan ist im Anzug und der elektronische Bremsmechanismus des Rotors ist außer Funktion. Werden sie den Bürgermeister rechtzeitig befreien können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonia Fehrenbach
Windige Hunde
Franziskas zweiter Fall
Zum Buch
Schwindelerregend Karo liebt die Vögel und sie liebt ihr Zuhause, einen Aussiedlerhof in der Holsteinischen Schweiz. Doch mit der Idylle wird es bald vorbei sein, denn hinter ihrem Hof ist ein großer Windpark geplant. Gemeinsam mit Charlotte, einer Frau aus dem Dorf, widersetzt sie sich dem Bauvorhaben, um die Vögel zu schützen. Ihre Bemühungen scheitern. Der Windpark wird gebaut. Eines Morgens steht Karo gemeinsam mit Schutzpolizistin Franziska Wilde am Fenster. Sie blicken auf den rotierenden Flügel der nächsten Windkraftanlage. Dort »klebt« Bürgermeister Henning Pahl. Drei weitere Männer, die in anderen Windparks des Landes ebenfalls an Rotorblätter gefesselt wurden, können befreit werden. Nur der Bürgermeister nicht, denn der Bremsmechanismus des Rotors ist außer Funktion. Wer hat ihn manipuliert? Die Polizei sucht nach Jan, Karos Sohn, und einer Bande, die sich Azawakh nennt. Die Zeit drängt. Ein Orkan ist im Anzug. Wird Henning Pahl überleben?
Es ist der schwärzeste Tag ihres Lebens, und Karo erinnert sich, wie es dazu kam.
Die Diplom-Biologin Antonia Fehrenbach studierte, promovierte und forschte in Freiburg, Göttingen und Marburg, bis sie im Jahr 2005 zu einer alten Leidenschaft zurückfand: der Lust am Schreiben. Inzwischen lebt sie in Schleswig-Holstein, schreibt Romane, Drehbücher, veranstaltet Erzählabende, verfasst Biografien und begleitet autobiografische Vorhaben. Die Schönheit des Nordens, seine weiten Landschaften und sein einzigartiges Licht inspirieren ihre Geschichten, in denen auch die Schattenseiten ihren Raum bekommen. Mit »Windige Hunde«, ihrem dritten Roman, widmet sich die Autorin dem aktuell sehr umstrittenen Thema »Windkraft« und zieht den Leser mit in einen Strudel menschlicher Verirrungen. Es geht um die Verortung des Glücks und andere Träume.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag: Klärschlamm (2014)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © jala / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5466-0
Widmung
Für Juma
Zitat
Sie sind wieder da!
Sie sind wieder zurück!
Komm mit mir auf das freie Feld!
Klaus Hoffmann, Sehnsucht
Prolog
Ich war vielleicht 14 Jahre alt, als mich meine Kunstlehrerin auf den Druck eines Gemäldes aufmerksam machte. Ich erinnere mich noch an die zarten, hellen Linien, die sich wie eingraviert über den dunklen Grund zogen. Damals interessierten mich nur die Tiermotive, die darauf zu sehen waren. Kunstvoll gestaltet wirkten sie dennoch naturgetreu, obwohl etwas an ihnen befremdete. Meistens war es nur eine Winzigkeit, wie der Insektenflügel, der die Aderung eines Blattes trug, oder der Fuchs, der wie ein Dachs da stand, und dem Fuchs gar nicht wohl dabei war. Auch ein großer Vogel war darauf zu sehen, der dem Betrachter den Rücken zuwandte.
»Deine Zeichnungen erinnern mich an ihre Bilder«, sagte meine Lehrerin und schenkte mir den Druck. Auf der Rückseite las ich ›Letter to Dana von Leonora Carrington‹. Ich wollte mehr davon sehen, und eines Tages gab mir die Lehrerin einen ganzen Katalog über diese Malerin mit nach Hause. Die Bilder waren verstörend und düster und doch faszinierend und atemberaubend schön. Die Zwitterwesen aus Mensch und Tier hatten es mir angetan, und ich sah sie mir oft vor dem Einschlafen an, um von ihnen zu träumen.
Bald stieß ich auf Leonoras Erzählungen. Zuerst las ich ›The Debutante‹, dann ›La Maison de la Peur‹, später ›The Oval Lady‹ und jede ihrer bizarren Geschichten, die ich ergattern konnte. Ich las sie auf Englisch und Französisch, vermutlich weil es noch keine Übersetzungen gab. Diese entdeckte ich erst vor wenigen Jahren, gebunden in ein kleines Buch. Damals, jedenfalls, stürzte ich mich in die fantastischen Welten der Leonora Carrington wie in ein neues Leben. Es war wie Heimkommen. Das Mädchen, von dem sie erzählte, war genauso verrückt wie ich. Sie blickte in die Seele der Tiere wie in ihr eigenes Spiegelbild, und sie verwandelte sich nach Belieben in sie. Es gab keine Grenzen. So kam es, dass ich meine eigenen kleinen Geschichten erfand. Das stillte für einen Moment meinen Lebenshunger. Ich schrieb gegen die Langeweile, die Enge und manchmal auch gegen die Wut und die Verzweiflung wie in der folgenden Geschichte über jenen Tag, als das mit dem Seeadler geschah.
Seit ein paar Tagen ist der Rote Milan zurück. Das Fenster steht offen, und ich atme die Kühle der ersten Stunden des Tages. Dunst rollt sich schlaftrunken über die Wiesen. Das Frühjahr lässt auf sich warten.
Ich rufe in die Stille des Morgens hinein. Da blitzt sie schon auf – die schlanke Silhouette meines Ritters der Lüfte, stürzt aus dem Nichts auf mich zu. Die Krallen voraus greifen den Rahmen meines Fensters, suchen nach Halt. Viel zu lang die Zehen, um das schmale Holz zu fassen. Seine Brust leuchtet dunkelorange. Im Sitzen ist er kein Riese.
»Zieh dich aus!«, raunt der Vogel mir zu und schlägt mit den Schwingen. Es klingt wie das Hissen von Segeln. Ein Duft nach Staub und Gras hängt in der Luft.
Mein Nachthemd gleitet zu Boden. Ich werfe den Kopf in den Nacken, blicke herausfordernd. »Dieses Mal will ich alles!«
Das Gelb seiner Iris tastet mich ab, erkundet die sanften Rundungen meiner Jugend. Ich glühe, greife in mein offenes Haar und ziehe den lichten Vorhang aus Strähnen vor mein Gesicht. »Das bekommst du«, hauche ich.
Er hechelt, dann stößt er hervor: »Ich bin Loplop, der Vogelobere.«
Ich schüttle den Kopf. »Das war ein anderer. Du bist viel zu zart, zu verletzlich.« Mein Haar fällt zur Seite, gleitet über die Schulter nach hinten. Ein Kitzeln im Rücken. Warum auch nicht?, denke ich. Dann bin ich Aëlla, die Schnellste, die Windsbraut.
Da breitet der Milan die Flügel aus, spreizt den Fächer seiner Handschwingen in fünf schlanke schwarze Federfinger, dazwischen, wie fein gepinselt, Striche von Frühlingshimmel. Im weißen Licht seines Flügelspiegels zwei dunkle Flecken, die mich beäugen, lassen mich zögern. Weshalb bin ich unruhig? Ich lausche. Im Haus ist es still. Ein Sonntag. Die Eltern schlafen noch. Was würden sie sagen, wenn sie mich so sähen, schamlos entblößt? Weshalb fürchte ich mich? Ich sehe in die leblosen Flügelaugen, fühle mich durchschaut, kalt und unverschämt. Ich habe Angst und spüre doch maßlose Neugier.
Da lässt sich der Vogel hinter den Vorhang gleiten, kopfüber taucht er hinab. Der schwere Stoff bäumt sich auf, umhüllt seine Zuckungen, hält sie gefangen wie der Sack des Wilderers, der sich um seine Beute zuzieht.
Ich hatte gesehen, wie Henning den Seeadler schoss.
Aus dem Schutz eines Knicks ragte der Lauf seines Gewehrs, wies in den offenen Himmel hinauf. Mein Blick suchte das Ziel seiner Büchse. Weit oben kreiste ein Greif im Sinkflug.
Noch hielt ich es für ein Versehen. Ich lief. Ich rief. Ich wedelte mit den Armen. Als hätte ich seine Aufmerksamkeit erregt, ließ sich der Vogel weiter hinuntergleiten, ein Riese mit mächtigen Flügeln. Still und ruhig segelte er durch die Luft, friedlich ohne jeglichen Argwohn, als kennte er keine Feinde.
»Henning«, schrie ich. »Tu es nicht!« Aber er nahm mich nicht wahr, verharrte in der Pose des Lauernden, reglos, den Greif fest im Visier.
Während ich rannte, ließ ich den Adler nicht aus den Augen, als könnte mein Blick das Unheil abwenden. Ich stolperte. Ich stürzte. Im selben Moment fiel der Schuss. Ich lag am Boden und sah doch den Ruck, der den Körper des Riesen durchfuhr. Oder spürte ich ihn? Ich sah Federn in einer dunklen Wolke zerstäuben, und mittendrin stand der edle Aar am fahlblauen Himmel … Die Flügel gespreizt schaukelte er wie ein einziges Staunen. War es möglich, dass …? Da krachte es wieder. Der Kopf des Vogels zerplatzte, und ein feiner Strahl schoss hervor, fiel in die Tiefe, verlor sich. Die mächtigen Arme schlugen wild. Dann kippte der Rumpf vornüber, trudelte mit willenlos schlenkernden Schwingen hinab. Ich rannte los, blind vor Tränen und doch zielstrebig zu der Stelle der Koppel, wo ich ihn hatte niedergehen sehen. Atemlos fiel ich vor ihm auf die Knie. Meine Finger zitterten, als sie das braune Gefieder berührten. Der Stoß trug noch nicht das Weiß des Erwachsenen. Sein Kopf …? Ich schaute mich um. Meine Augen streiften die Stelle im nicht mehr fernen Gebüsch, wo Henning gestanden hatte. Er war nicht mehr da.
Ein silbrig schimmerndes Haupt reckt sich hinter dem Vorhang hervor. »Jetzt du!« Loplop erwartet mich schon.
»Deinen Schopf will ich auch«, sage ich, »… und Vergeltung.« Ich gleite zu ihm hinter das blickdichte Tuch.
1
4. November
8.30 Uhr. Das Fenster zeigt nach Südosten. Davor ein Tisch und zwei kleine Sessel. ›Vista splendida‹, hatte Tom diesen Platz genannt, bevor die Windräder kamen. Hier hatten wir immer gefrühstückt.
Ich blicke hinaus in die Landschaft. Der dunkle Fleck auf einem der Rotorflügel der Windkraftanlage gleich hinter dem Knick springt mir sofort ins Auge. Scharf hebt er sich vom silbrigen Weiß des Rotorblattes ab, genau dort, wo der Flügel ansetzt, mit dem er sich gemächlich im Kreis herumdreht. Ich spüre einen Alarmstoß in mir, und doch wandert mein Blick zum Buchenwäldchen auf der anderen Seite hinüber. Der Eigentümer hatte es vor etlichen Jahren aufforsten lassen. Inzwischen steht dort ein dichter Busch. Ich habe die Bäumchen wachsen sehen. Sie sind jetzt so alt wie mein Jan. Wo er nur steckt? Schon habe ich seine Stimme im Ohr: »Mama, ich bin erwachsen.« Ich werde mich nie daran gewöhnen. Den Buchenbestand werden sie irgendwann lichten müssen. Aber noch ist es zu früh, müssen sich die jungen Bäume im Wetteifer ums Licht hinaufstrecken, sich gegenseitig in die Höhe schieben. Eigentlich ist es kein Boden für einen Laubbaumbestand. Mischwald würde auf dem sandigen Grund besser gedeihen. Aber Buche lag damals im Trend. Auch forstwirtschaftliche Pflanzungen sind nicht frei von modischen Einflüssen. Wie eine trostlose Insel verliert sich das Wäldchen in der offenen Landschaft. Der letzte Sturm hatte das dünne Astwerk kahl gefegt. Darüber am Himmel schwebt eine seltsam verschleierte Sonne. Die Rotorblätter des nächstgelegenen Windkraftwerks drehen sich vor dieser Kulisse, als seien sie eigens dafür installiert, die Unschärfe von dieser frühen Ansicht des Tages zu fegen. Die Ruhe ist trügerisch.
Vor mir auf der Fensterbank liegt das Swarovski. Ich hatte es vor Toms Auszug sicher versteckt. Ich wollte keine Diskussionen über das wertvolle Fernglas. Ich empfand mich im Recht. Er ist der Jäger, ich bin die Wildhüterin.
Auf der Matte im Flur stehen die Stiefel. Ich schlüpfe hinein, werfe den Parka über und trete hinaus in den Hof. Ein Windstoß reißt mir die Kapuze vom Kopf. Es riecht nach Sturm. Der Puls der Maschine drängt sich mir auf: wusch, wusch … Ich nehme den dunklen Fleck ins Visier, aus der Entfernung ein Fliegenschiss, der hoch oben am Himmel Riesenrad fährt. Der Blick durch mein ›Adlerauge‹ lässt keinen Zweifel daran: Es ist er. Ich will nicht lügen. Ich bin nicht schockiert über das, was ich sehe, empfinde nicht einmal Mitleid. Das Schweigen in mir ist befremdlich. Es ist, wie es ist. Was hält ihn dort fest? Ich sinniere über diesen absonderlichen Klebstoff, der für gewöhnlich gierigen Leibern entströmt. Ja, so wird es wohl sein, gebe ich mir selbst die Antwort. Er hängt dort aus eigener Kraft wie ein Magnet … und kotzt … auf sein eigenes Land. Ich wende mich ab, will diesen Zorn nicht wieder spüren. Das war, bevor die Windräder kamen. Eine andere Geschichte …
2
Ich hatte wieder den Traum. Ich fahre durch eine Allee, gleite unter einem Gewölbe aus Blättern wie Buntglas. Das Licht ist weich und verspielt, wärmt schon das Auge. Weit hinten ein Leuchten, das mich erwartet … Es begann vor vier Jahren. Aber, wenn ich ehrlich bin, fing alles viel früher an. Diese, meine persönliche Geschichte nahm vor mehr als 40 Jahren ihren Anfang. Sie mündete in einer Katastrophe, für die allein ich die Verantwortung trage. Ich blicke zurück, um zu begreifen, wie es zu diesem 4. November gekommen war, dem schwärzesten Tag meines Lebens. Ich versuche, es aufzuschreiben, um mich von einer Last zu befreien, und werde sie doch nicht los. Immerhin hilft es, die Ohnmacht zu ertragen. Die Geschehnisse, über die ich berichten will, trafen mich mit der Wucht einer Ohrfeige. Zuerst fühlte ich Scham, dann Schmerz und danach nur noch Wut. Es heißt, das größte Problem des Berufsschreibers sei der erste Satz. Aber ich bin keine Schriftstellerin. Ich bin Übersetzerin, war es, bis ich damit aufhörte. Auch für mich sind Wörter das Rohmaterial meines Handwerks. Am Anfang bin ich Spinnerin und verdrille die Fasern zu Fäden für die Weberin, die daraus etwas Tragfähiges macht. Erst dann kommt die Malerin zum Zug. Manchmal sind Wörter auch Nägel, Kanthölzer oder schlichte Leisten. Greifbar sollten sie sein, damit ich sie anfassen, sie benutzen oder als nutzlos erachten und einfach wegschleudern kann. In meinem Beruf gibt es Grenzen. Ich muss den Stoff verwenden, den mir der Redner anvertraut. Dennoch nehme ich mir das Recht auf Modulationen, so wie es Singvögel tun. Die Windräder bliesen neue Wörter in meinen Mund, wohlklingende und gemeine, technisch sachliche Wörter und Lügenbegriffe. Ich übersetze sie in alter Gewohnheit, erlaube mir, mit ihnen zu spielen. Als Schriftstellerin bin ich freier.
Ich erfuhr es von Charlotte. Vor vier Jahren tauchte sie an einem warmen Spätsommertag vor meinem Gartentor auf. Ich kannte sie nicht. Sie jedoch rief mich beim Namen und wedelte mit etwas, das wie ein Klemmbrett aussah. Sportverein? Landfrauen? Ab und an kam jemand vorbei und bat um eine Spende. Die vom Vogelschießen konnten es nicht sein, die waren schon da gewesen. Ich streifte die erdigen Handschuhe ab und ging langsam zum Tor hinüber. Ich hatte richtig gesehen. Sie hielt eine Schreibunterlage in der Hand. Eine Namensliste klemmte darauf. Der Hinweis auf meine Vereinsneurose entlockte der Frau ein einsichtiges Lächeln und entblößte eine hübsche kleine Zahnlücke. Nur deswegen schickte ich sie nicht fort. Gebannt starrte ich auf ihre schmalen Lippen, wartete, dass er sich endlich wieder zeigte, dieser winzige Spalt zwischen diesen niedlichen Schneidezähnen, die so viel kleiner waren als meine, irgendwie kindlich. Ich hatte Glück, denn die Frau redete langsam mit Pausen, in denen sie lächelte, lang und breit und mit offenem Mund. Ihr Hochdeutsch tönte gefällig in Moll, was das Nordlicht verriet. Sie formulierte holsteinisch knapp. Nein, kein Geld, nur informieren wollte sie. Sie reichte mir ein blaues Blatt Papier mit schwarzen Buchstaben. Dann streckte sie den Arm aus, und ihr stattlicher Rumpf schmiegte sich in einen weiten Bogen, den sie schwungvoll über die Landschaft zog.
»Windräder!« Mehr sagte sie nicht.
Die Vision eines neuen, befremdlichen Raumes drängte sich mir auf. Er endete vor meinem Gartentor. Windräder hier? Was für ein Quatsch! Energisch schüttelte ich den Kopf. Vielleicht war es diese heftige Bewegung, die einen Bodensatz verkrusteter Erinnerungen in mir löste. Ich weiß noch, ich fühlte mich von verstörenden Bildern bestürmt, und die Dichte der Ahas, die ich in jenem Moment durchlief, war hoch konzentriert wie Salzsäure, ätzend, nicht auszuhalten.
Jetzt, wo ich es aufschreibe, erkenne ich die Logik hinter den Ereignissen. Geahnt hatte ich schon immer, dass mich irgendwann die alten Geschichten einholten. Alte Geschichten in neuem Gewand. Es gibt kein Entrinnen.
Blond und blauäugig stand die Frau vor meinem Gartentor, wie geschaffen für eine frohe Botschaft. Zu gern hätte ich an eine Erscheinung geglaubt. Ich starrte auf den verheißungsvollen Zettel in meiner Hand. Die Frau konnte nichts dafür. Ich bat sie ins Haus.
Der Zug war abgefahren. Das erfuhr ich von Charlotte, während wir bei Tee und Gebäck an meinem Lieblingsplatz im Wohnzimmer saßen und aus dem Fenster schauten. Die Zeitungen hätten ausführlich und früh über die Absichten der Gemeinde berichtet. Ich las die Zeitung nicht regelmäßig und wenn, dann überflog ich die Seiten nur kurz. Tom nahm sie für gewöhnlich mit in die Werkstatt. Laut Charlotte wurden die entscheidenden Beschlüsse für einen Windpark zu Beginn der Sommerferien gefasst. So hatte es kaum jemand mitbekommen. Charlotte erklärte mir auch, dass die Frist für einen Einspruch gegen den Gemeindebeschluss verstrichen war. Sechs Wochen hätten wir dafür Zeit gehabt, so lang wie die Ferien. Vor kaum mehr als einer Stunde war sie vor meinem Gartentor aufgetaucht, gefühlt hätte ich sie jedoch ins Klassenzimmer meiner alten Schule gesteckt, in die vorletzte Reihe, wo all diejenigen gesessen hatten, die ich immer für ihren Mut bewundert hatte, weil sie kein Blatt vor den Mund nahmen, sich mit den Lehrern stritten, auch für andere, wenn ein Unrecht im Gang war. Ich hatte hinter ihnen in der letzten Reihe gekauert, hatte es vorgezogen, mich still zu verhalten, hatte Wechselbäder aus Bangen und Hoffen durchlebt so wie in jenem Moment. Was Charlotte mir schilderte, während sie meinen Chai schlürfte und Mariannes Kokoskekse verputzte, machte mir Angst. Doch solange sie blieb, erhielt ich Antworten, und Antworten boten Auswege, Möglichkeiten, Lösungen. Zumindest empfand ich es so. Ich löcherte sie mit Fragen, suchte nach einer Schwachstelle, einem Ansatzpunkt, der es mir erlaubte, in die Ereignisse einzugreifen, sie zurückzuspulen, um all das einzufangen, was ich verpasst hatte. Wo war die Taste für das Reset? Ich spendierte noch mehr Tee und Kekse und ermunterte sie, mir von der Einwohnerversammlung zu berichten, obwohl sie es bereits, ich weiß nicht wie oft schon, getan hatte. Ich suchte nach einer Fehlstelle in ihrem Bericht. Ich wollte sie des Widerspruchs überführen. Ich hörte, ich weiß nicht zum wievielten Male, dass unser Bürgermeister selbst Besitzer einer Fläche im Plangebiet wäre. Nur wenige Bürger waren zur Versammlung gekommen. Ich ärgerte mich über mich selbst. Seit Jahren hielt auch ich mich vom Dorfhaus fern. Genau genommen war ich nicht mehr hingegangen, nachdem sie Henning zum Bürgermeister bestellt hatten. Ich hatte ihn nicht gewählt. Trotzdem hätte ich hingehen müssen. Ich hatte einen Fehler gemacht. Ich hatte Henning Pahl unterschätzt.
Ich schaute aus dem Fenster, versuchte, mir 16 Windkraftanlagen hinter meinem Haus vorzustellen. Ich sah die Pferde, die Einsteller, die mir ein kleines eigenes Zubrot verschafften, seitdem ich nicht mehr arbeitete. Jeden Morgen ging ich zu ihnen, nur um mir, wie eine Süchtige, ihren würzig weichen Duft in die Nase zu ziehen. Ein haushoher Knickstreifen trennte unsere Hauskoppel vom Ackerland dahinter. Wenn ich Charlotte richtig verstanden hatte, begann jenseits dieses Knicks das Planungsgebiet für Windenergie. Sie streckte die Hand nach dem Kokoskeksteller, schaute mich fragend an. Ich ermunterte sie zuzugreifen und sah versonnen auf das platte Land hinaus. Ich hatte nichts gegen Windkraftanlagen. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Meinung dazu. Aber inmitten dieser Landschaft und so dicht hinter meinem Haus waren sie mir unvorstellbar. Weiter hinten reihten sich im Frühjahr und Sommer die Felder, ein bunter Flickenteppich aus Mais, Rüben, Raps, Gerste und Triticale, dieser Wunderkreuzung aus Weizen und Roggen. Vereinzelt dazwischen dehnten sich Grünflächen. Die Ernte war eingefahren, nur der Mais stand noch. Tom hatte im letzten Winter die Wallhecke zwischen unserem Hof und der Hauskoppel auf den Stock gesetzt. So hatten wir die Pferde besser im Blick. Der hohe Knickstreifen, der den Pahlschen Maisacker von unserer Koppel trennte, würde uns Schutz bieten, beruhigte ich mich. Außerdem war es weit genug weg. Plötzlich hörte ich Charlotte prusten. Sie rang nach Luft. Ihr Gesicht war knallrot, und aus ihrem Blick sprang das blanke Entsetzen. Dann ging ein Platzregen aus Kokoskekskrümeln auf dem Biedermeiertischchen zwischen uns nieder. Sie hustete, bis sich der letzte Krümel aus ihrer Kehle befreit hatte. Hastig tupfte sie sich die Tränen aus den Augen. Sie wollte sprechen, aber brachte nur ein Krächzen hervor, eine holsteinische Krähe, blond und blauäugig mit Zahnlücke. Was sie dann sagte, kam mir vor wie das Echo meiner eigenen Gedanken. Es verhöhnte mich. Hatte ich etwa laut gedacht? War es denn nicht weit genug weg? Charlotte erklärte mir, was Schattenschlag ist, und dass es mit der Vista splendida hier bald vorbei wäre.
Richtig wütend wurde ich später, da war Charlotte schon fort. Wer war diese Frau überhaupt? Was erlaubte sie sich, in mein beschauliches Leben zu platzen? Ich wollte nicht, dass es so war, wie sie sagte. Aber etwas in mir gab ihr recht, und ich konnte nicht umhin, mir auszumalen, wie just in dem Moment, in dem all diese widerstrebenden Gedanken meinen Kopf durchquerten, Henning Pahl in seiner Scheune den Hammer schwang und die bösen Geister, die ich zu vertreiben versuchte, wieder herbeirief.
3
Henning Pahl richtete sich auf, den Hammer fest im Griff der rechten Hand. Ein paar Schweißtropfen kullerten seine Schläfen hinab. Er rang mit sich selbst und dem Grollen in seiner Brust, das ihn antrieb, den Hammer zu heben, wie schon so oft versäumt, und … wie schon so oft hielt er inne und nutzte den Schwung für einen gezielten Wurf. Der Hammer polterte in den Werkzeugkasten. Das Handy, das Henning vorsorglich darauf abgelegt hatte, tat einen Hüpfer. Glück gehabt!, dachte er und sog die Luft scharf ein. Das Gefühl der Erleichterung besänftigte seinen Unmut. Seit einer Stunde bemühte er sich vergeblich, die Radmuttern an dem alten Opel zu lösen. Die Vorderräder hatte er geschafft. An den beiden hinteren war kein Weiterkommen. Er hatte es mit Kriechöl versucht, dabei eine Ratsche gehimmelt. Die lag nun irgendwo hinten unter dem Gerümpel in einem dunklen Winkel der Scheune. Wütend hatte er sie in die Weite des Raumes gepfeffert. Die Hammerschläge auf die Radbolzenköpfe waren sein letzter Versuch gewesen. Nichts hatte sich bewegt. Henning stieß einen verzweifelten Laut aus. So war sein Leben. Nichts bewegte sich mehr.
Er zog den ölverschmierten Lappen aus der Brusttasche seines Overalls und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Angewidert rümpfte er die Nase und pfefferte den klebrigen Stofffetzen in eine Ecke. Ein Rascheln im Hof weckte seine Aufmerksamkeit. Er ging zum Fenster hinüber und schaute hinaus. Mitten im Hof spielte die Katze mit einer Maus. Das Opfer versuchte zu fliehen, aber es war zu geschwächt, um dem tödlichen Spiel zu entkommen. Seine Hand fuhr durch die Staubschicht auf dem Glas, die alles an diesem verlorenen Ort mit einem zarten Pelz überzog. Er benutzte die alte Scheune nur noch als Lager für Unbrauchbares und als Garage für Ausgedientes wie den Opel Kadett. Sein Blick glitt an den hohen Linden vorbei durch die Hofeinfahrt hinaus und trug ihn in ein anderes Leben. Er hatte nicht gezählt, wie oft er mit dem alten Opel dort hinausgefahren war, um alles hinter sich zu lassen. Er hatte den betagten Wagen nie abgemeldet. Wenn ihm der Stillstand unerträglich wurde, hatte er sich hineingesetzt und war losgefahren. Auf seinen Spritztouren durch die Feldmark war er wieder dieser junge Mann gewesen, ambitionierter Absolvent der Landwirtschaftsschule und voller Ideen für den Betrieb der Familie, den er einmal übernehmen sollte. Nach einer Weile hatte er diese kleinen Fluchten jedoch aufgegeben, weil er fürchtete, es irgendwann zu tun – abzuhauen, alles zurückzulassen. Allein der Gedanke an Anne-Rose und die Kinder hielt ihn davon ab. Mittlerweile hatte er sich damit abgefunden. Er hatte sich in die Bahnen gefügt, die sein Großvater für ihn vorgesehen hatte, nachdem sein Vater, noch jung, bei einem Jagdunfall tödlich verunglückt war. Henning war damals ein Kind gewesen und erinnerte sich nur schemenhaft an das tragische Ereignis, das ihn, den einzigen Sprössling der Familie, für den Großvater in die Rolle des verlorenen Sohnes versetzte. Nach dem Tod seines Vaters musste er sich beeilen, erwachsen zu werden. Es war ein erhebendes Gefühl, so kindlich noch und doch wie ein Großer behandelt zu werden. Damals war er zu jung gewesen, den Fehler zu durchschauen. Äußerlich passte er sich an, aber tief in seinem Innern empfand er sich schwach, ein Verlierer, der sich ständig nach der Decke streckte, um den Ansprüchen des alten Hinnerk zu genügen. Die Landwirtschaft machte Henning schon lange keinen Spaß mehr. Die Zeiten hatten sich geändert. Es hatte mehr mit Wirtschaft und weniger mit Land zu tun. Man musste ›von hinten‹ denken, gewinnorientiert. Aber Hinnerk ließ ihm nicht wirklich freie Hand. Es war ein ständiges Ringen. Auch redete der Alte ihm gerne ins politische Geschäft, an dem Henning zunehmend Gefallen fand. Da war er jemand. Dem Bürgermeister im Ehrenamt zollten die Menschen Respekt. Er hätte nie gedacht, dass er Behördengänge einmal genießen würde. Da ließ sich noch etwas bewegen. Auch für sich selbst. Lucas wollte studieren, Andy demnächst für ein halbes Jahr in die USA. Das Altenteil für seine Mutter und Hinnerk musste aufgebracht werden und, und, und … Die Hypothek, gut eine halbe Million, die er vor vier Jahren für den neuen Kuhstall aufgenommen hatte, lag ihm am schwersten im Magen. Er hatte Lucas zum Geburtstag ein Auto versprochen. Er hätte ihm gerne ein neues gekauft. Aber das ließ die Betriebskasse nicht zu. So blieb ihm nichts anderes übrig, als den alten Kadett flottzumachen. Sein Sohn sollte an seinem Geburtstag wenigstens ein paar Runden drehen können.
Henning grinste. Er würde den Rost schon lösen, den vom Kadett und seinen eigenen. Es war nur eine Frage der Zeit – und des Geldes. Das Leben bot ihm eine zweite Chance. Vielleicht seine letzte. Er hatte die 50er Marke bereits überschritten, danach kam nicht mehr viel. Alle setzten jetzt auf erneuerbare Energien. Kein Glücksspiel, sondern Gesetz. Die da oben hatten den Ausbau der Windenergie über alle anderen Interessen gestellt. Sie nannten es ›privilegiert‹. In der Gemeinde gab es genügend Flächen dafür, und der liebe Gott schickte den Wind. Er, Henning, wäre doch blöd, wenn er da nicht mitziehen würde. Er wollte diesen Windpark. Es war ein dreifaches Win-win-win. Ein Segen für alle Seiten. Klimaschutz, Wohlstand für die Gemeinde, was ihm die Wiederwahl in Aussicht stellte, außerdem entschädigte es ihn selbst für den Verzicht auf ein eigenes Leben. Vielleicht war es sogar das Tor zu einem neuen. Wer wusste das schon? Henning fand, dass ihm das zustand. Als Bürgermeister im Ehrenamt hatte er sich für das Dorf über viele Jahre für nichts und wieder nichts den Arsch aufgerissen. Niemand sonst wollte diesen Job machen. Mag sein, dass dies seine zweite und letzte Chance war, wegzugehen und ganz neu anzufangen, irgendwo, so wie Frank Lunau. Der machte jetzt groß in Windenergie, verwaltete Windparks und investierte in neue. Bei ihrem letzten Treffen hatte Lunau angedeutet, dass es im Dorf Widerstand geben könnte. Aber damit würde man schon fertig werden. Das Vorhaben besser nicht an die große Glocke hängen, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Nur so viel Öffentlichkeit, wie es die Bürokratie erforderte. Am besten weniger, hatte ihr künftiger Investor erklärt und grinsend den Finger gehoben. »Aber keine Formfehler machen!« Als Bürgermeister stünde er doch in einem guten Verhältnis zu seinem Amtsvorsteher. Diese Leute wären Spezialisten für die Grauzonen des Verwaltungsapparates. Außerdem wären er und seine Hess & Co stets für ihn da, um zu helfen. Henning hatte dazu geschwiegen. Er brauchte keine Hilfe. Er war Jäger und kannte die richtigen Leute. Er würde Lunau mal zum Hubertusfest mitnehmen.
Henning wandte sich vom Fenster ab. Wehmütig und ein wenig stolz betrachtete er den Kadett. Baujahr 1985. Für sein Alter sah der Wagen echt klasse aus. Nach der Ausbildung, er war gerade 25 geworden, hatte er sich das Auto selbst zum Geschenk gemacht. Fast zu schade für einen Fahranfänger, aber er hatte es Lucas versprochen. Das einzige Problem waren die Reifen und die schsch…eiß Radmuttern. Sie hatten sich verdammt festgefressen. Er schaute auf die Uhr. Kurz nach fünf. Feierabend, zumindest für Autowerkstätten. Wie sollte er das bis morgen schaffen? Er überlegte, dann nahm er das Handy aus dem Werkzeugkasten und drückte die Nummer von Tom.
4
4. November
9 Uhr. Seit ein paar Minuten sitzt sie hier an dem Biedermeiertischchen, schaut aus dem Fenster, sagt kein Wort. Ein wenig betreten hatte sie vor der Haustür gestanden und die Dienstmütze zwischen den blassen Fingern gedreht. Der Wind spielte mit ihrem roten Haar. Ich schickte sie ins Wohnzimmer.
Dort sitzt sie nun, blickt hinaus auf das Windradkarussell mit seinem unfreiwilligen Fahrgast. Ich muss an Charlotte denken, an die Kokoskekskrümel, die sie damals angesichts meiner Dummheit über dieses Tischchen gehustet hatte. Sie hatte recht behalten. Irgendwann kamen die Bagger und rissen den Knick auseinander. Bautechnisch erforderlich, hieß es. Dafür gäbe es Ausgleichsmaßnahmen, meinte der Sachbearbeiter auf dem Amt. Nicht hier, sondern irgendwo in Nordfriesland. Wir fühlten uns nackt, unseres Schutzes beraubt. Dabei hätte uns die hohe Wallhecke nicht wirklich geschützt. Der Trend ging zu noch höheren Windkraftanlagen, dafür sollten es dann ein paar weniger sein. Innerhalb weniger Monate schossen zehn 120 Meter hohe Türme aus dem Boden, überragt von rund 70 Metern Propellerradius. Zuerst bauten sie zwei, sozusagen zum Eingewöhnen. Bald danach kamen weitere acht Anlagen dazu. Vor dieser surrealen Kulisse duckten sich die Überhälter, die hohen Bäume in der Wallhecke, wie gestutzte Buchsbaumkugeln in die flache Landschaft. Rollos mussten wir so oder so anbringen lassen, wegen der 30 Schattenschlagminuten, die uns per Gesetz am Tag zuzumuten sind. Diesen Sommer wurde die Belastungsgrenze oft überschritten. Aber das zählt nicht. Die Werte würden über das Jahr gemittelt, so unser Amtsvorsteher, als ich ihm meine Beschwerde vortrug. Der viele Regen im Frühjahr hatte die Schattenschlagstatistik verdünnt. Selbstgerechte Menschen machen mich hilflos, und es verschlägt mir jedes Mal die Sprache, mit welcher Selbstverständlichkeit mir dieser Mann seine Bären aufbindet.
Nach meinem Notruf heute früh traf als Erstes die Feuerwehr ein. Steifbeinig und mit verrenkten Hälsen staksen die Männer um den Betonfuß der riesigen Anlage herum. Die neue Technologie ist weit über die Reichweite ihrer Leitern hinaus gewachsen. So muss es sich anfühlen, wenn unsereins nach Liliput kommt. Sie tun mir leid. Wie kann man Menschen, die diesen Job freiwillig im Ehrenamt ausführen, derart verschaukeln? Ein Feuerwehrmann schüttelt sich, fährt sich umständlich übers Gesicht. Hastig klappt er das Visier herunter. Ich schaue prüfend zum Himmel. Ein zerschlissener Wolkenteppich fliegt, von Norden her kommend, übers Land, viel zu hoch für Regen. Ratlos blicken die Männer von der mächtigen Säule aus Stahl und Beton zu ihrem roten Gefährt hinüber, ein Spielzeugmodell vor dieser Megakulisse.
Auch sie schaut hinaus auf diese unwirklich anmutende Szene. Der Notarztwagen ist eingetroffen, steckt fest. Der Sportsmann am Steuer hatte die Vorderräder im Eifer seines Einsatzes in einer Traktorfurche versenkt. Die Feuerwehrleute machen sich daran, ihn aus dem Acker zu ziehen. Eine Polizeistreife rollt ins Blickfeld, das uns dieser Logenplatz am Fenster eröffnet. Ich nehme an, ihre Kollegen, mit denen sie zu mir gekommen ist.
Aufmerksam beobachtet sie das Geschehen. Über ihren Rücken schlängelt sich der rote Zopf. Ein krauslockiger Flaum umspielt seine Schlingen. Hier hat nicht Wella, sondern Aphrodite die Hand im Spiel. In einem tiefen Auberginerot schimmern goldene Lichter wie feines Lurex. Ich stelle fest: Blau steht ihr nicht. Das altbewährte Grün hätte ihrer hellen Haut eher geschmeichelt. Ein sanftes Beben der Nasenflügel verrät ihre Anspannung.
»Magst du Krimis?«, frage ich.
Eine zarte Röte steigt ihr in die Wangen, und das verhaltene Schmunzeln der Ertappten leuchtet in ihren Augen. »Ich brauche keine Kriminalgeschichten«, entgegnet sie trotzig. »Schon gar keine Regionalkrimis. Ich lebe in einem Krimi.«
»Dann haben wir etwas gemeinsam«, erwidere ich. »Tee oder Kaffee?«
»Was trinkstdu?«
»Tee ist schon aufgebrüht.«
Genüsslich lässt sie sich zurück in den Sessel sinken. »Ich nehme Kaffee.« Ihre Augen funkeln mich an.
»Mit viel Milch, wie immer«, füge ich wissend hinzu.
Sie nickt, und auf ihren Wangen schimmert wieder die Porzellanblässe der Rothaarigen.
Auf dem Weg in die Küche werfe ich einen Blick auf das Handy. Es hatte bei ihrem Eintreffen leise gehupt. Ich hatte den Signalton bewusst überhört, wollte mich nicht ablenken lassen, keinen Fehler machen. Eine Nachricht von Jan. Ich spüre ihren Blick im Rücken. Später, denke ich und lasse das Mobiltelefon liegen.
Das Teegeschirr meiner Mutter, das ostfriesische mit der roten Rose, ist eine gute Wahl. Zum Glück hat Jan die Keksdose nicht vollends geplündert. Die Kuhmilch platscht in seinen Kakaobecher, auf dem ein Karatekämpfer einem anderen die Nase einschlägt. Jan hätte es anders ausgedrückt, aber ich weigere mich, trotz meines Sprachtalents, auch noch Japanisch zu lernen. Der Duft des frisch aufgebrühten Kaffees kitzelt meinen Geruchssinn. Ich mag ihn nicht trinken, aber ich rieche ihn gern. Als ich mit dem Tablett ins Zimmer zurückkehre, sehe ich, wie sie auf das Abschleppmanöver draußen im Feld starrt.
»So funktioniert Lobbyismus«, rutscht es mir heraus. »Die Protagonisten ziehen sich gegenseitig aus dem Dreck.«
Ihr Blick tadelt mich kurz. Dann wendet sie sich ab, schaut wieder hinaus. Ich ärgere mich über meine bitteren Worte, will sie mir nicht zur Feindin machen.
»Weshalb …?«, frage ich zögerlich.
»Weshalb sie ausgerechnet mich zu dir schicken?« Sie schaut noch immer hinaus. »Muss ich dir das wirklich erklären?«
Ein Ruck, und der Notarztwagen ist wieder frei. Da wendet sie den Kopf, sieht mich an. »Die Kollegen aus Kiel haben für diesen Sondereinsatz Unterstützung bei meiner Dienststelle angefordert.« Sie hebt den Kaffeebecher und lächelt entschuldigend. »Personalmangel.«
Ich glaube ihr nicht. Ich schiebe meine Lippen über den Rand des zarten Porzellans. Ein heißer Dunst streift meine Haut. Vorsichtig nippe ich an meinem Tee und sehe, wie ihr Daumen sachte über das Abbild auf Jans Tasse streicht.
»Uraken-uchi ist ein Konter aus dem Shotokan-Karate«, sagt sie und hebt die Augenbrauen. »Das ist schon Hohe Schule.«
»Davon verstehe ich nichts. Jan …« Ich beiße mir auf die Lippen. Wie dumm von mir, ihn zu erwähnen!
Sie reagiert unmittelbar. »Was ist mit ihm?«, fragt sie. Im selben Moment zuckt sie zurück, als hätte sie etwas Unbedachtes getan. Wie beiläufig wandert ihr Blick zur Fensterbank. »Wow«, entfährt es ihr, und sie zeigt auf das Fernglas. »Ein Juwel! Darf ich?« Sie sieht mich genauso neugierig und entschlossen an wie in dem Sommer, als sie zu uns kam, um uns zu helfen. Eine Verbündete im Kampf gegen das Unrecht.
Ich beuge mich vor und suche ihren Blick, will ihn festhalten, will nicht, dass sie sich mir wieder entzieht. »Franziska, weshalb bist du hier?«, frage ich.
5
Am Morgen nach Charlottes Besuch erwachte ich aus einem Traum. Der Vorhang bewegte sich leicht, und ich hatte wieder diese vollen Lippen vor Augen. Es war nur ein Bild, aber die Intensität des Gefühls war die gleiche wie damals, als ich sie live erlebt hatte. Sie war zu einer Lesung aus ihrem neuen Buch nach Deutschland gekommen. Ihre dunklen Augen hatten mich angesehen. »Mögen Sie rohe Zwiebeln?«, hatte die junge Schriftstellerin aus Algier gefragt und eine Antwort nicht abgewartet. »Sie müssen Sie nicht mögen. Aber Sie sollten sich mit ihnen auseinandersetzen. Man lebt und überlebt nur, wenn man die Fähigkeit hat, bittere und widerwärtige Dinge zu schlucken und zu verdauen.« Sie hatte Französisch gesprochen. Ich hatte sie verstanden.
Ich weiß nicht, weshalb mir diese Szene in jenem Moment frühmorgens im Bett durch den Kopf ging. Vielleicht war es eine Vorahnung, vielleicht war es Charlottes Botschaft gewesen und die vielen Ahas, die nun im Raum standen und sich nicht mehr verscheuchen ließen. Die Zeit war reif für eine Konfrontation.
Gleich nach dem Aufstehen ging ich zu Henning Pahl, unserem Bürgermeister. Die Sache mit dem Windpark ließ mir keine Ruhe. Es war Sonntag, und Henning war Landwirt, also hatte ich gute Chancen, ihn zu Hause anzutreffen. Er schleuste mich schnell an der Küche vorbei ins Wohnzimmer, als wäre mein Besuch ihm unangenehm.
Es war ein Fehler, mir keinen Stuhl anzubieten. So überragte ich ihn, diesen Hänfling, diesen klöterigen Kerl, um gut einen halben Kopf. Mein Blick glitt über ihn hinweg durch eine Tür in ein hinteres Zimmer. Dort stand ein Waffenschrank offen. Die Jagdgewehre weckten in mir ein Grollen, das ich geflissentlich unterdrückte. Ich hatte ihn wohl beim Putzen der Flinten gestört. Ich trug ihm meine Bedenken vor, untermalt vom Ticken der alten Wanduhr, dem Puls seiner Vorfahren, einer unendlichen Reihe von verbürgten Land- und Leibeigentümern, Bürgermeistern … und Jägern. Die Pahls hatten schon immer das Sagen im Dorf gehabt. Während ich redete, starrte Henning mir Löcher ins Brustbein. Dann hob er hilflos die Schultern. Sein Blick wurde stumpf. Er sprach von Landesvorschriften, als wäre er nur eine Marionette im Spiel der da oben, und er benutzte Worte, die ich nicht verstand.
Zu Hause schlug ich das Wörterbuch auf. Er hatte »Einzelschicksal« gesagt. Die Erklärung im Lexikon führte zu mir zurück. Ich war das betroffene Einzelwesen. Mein Haus steht nicht im Dorf. »Wer wohnt schon im Außenbereich?«, hatte er mich verhöhnt. Außenbereich. Ein Ort, der nicht dazu gehörte, den man ausgrenzen durfte, für den andere Regeln galten. Er hätte auch »Ausland« sagen können. Es war die erste rohe Zwiebel, die ich in dieser Geschichte schluckte. Aber die Sache ließ mir keine Ruhe. Am Nachmittag ging ich noch einmal hin. Ich war wütend, wollte ihn zur Rede stellen, aber ich kam nicht dazu. Sie hatten Besuch.
Gleich an der Haustür fing er mich ab. Ob ich Krieg wollte, knurrte er mich an. Ich sollte mein Haus doch verkaufen. Unverrichteter Dinge ging ich nach Hause. Zwei rohe Zwiebeln im Bauch waren schwer zu verkraften. Ich machte mir Vorwürfe. Ich hätte zurückbrüllen sollen: »Das ist Vorteilsnahme im Amt!« Ich hätte ihm drohen sollen, ihn für seine Machenschaften zu belangen. Weshalb tat ich es nicht? Immerhin bin ich ein Jahr älter als er. Weshalb also wehrte ich mich nicht? Ich hatte nichts zu verlieren. Oder doch? In seinem Haus waren Gäste. Ich mag keine Szenen und schon gar keine Zuschauer. Außerdem: Henning hatte noch nie Respekt vor dem Alter gehabt. Mein Vater hatte ihn nicht gemocht. Er hatte seine Gründe, ich habe meine.
Am Abend sprach ich mit Tom. Wir saßen beim Essen. Schweigend löffelte er seine Suppe.
»Ich war heute bei Henning.« Ich wollte nicht, dass es gereizt klang, aber der beiläufige Ton, um den ich mich bemühte, klang falsch. Tom schaute nicht einmal auf. Er griff nach einem Stück Brot, brummte etwas Unverständliches.
»Der Windpark …«, begann ich zögerlich. Das nervöse Zucken auf seiner Wange bremste mich aus. Ich spürte, ich riskierte einen handfesten Streit. Am Vorabend hatte ich ihm von Charlottes Besuch erzählt.
»Wir reden später«, hatte er erwidert und war zur Jagdhütte aufgebrochen. Er wollte den Sonntag im Revier verbringen. Ich überlegte, ob dies nun der richtige Moment für ein ›Später‹ wäre. Aber der Gedanke an Henning beschleunigte meinen Puls und trieb mich voran. »Er hat mich weggeschickt«, sagte ich schließlich.
Toms höhnisches Schnaufen drückte eine Delle in die goldgelbe Suppe und ließ die Fettaugen zum Tellerrand driften. »Was hast du erwartet?«, presste er hervor.
Ich war enttäuscht, hätte mir mehr Anteilnahme gewünscht, hatte gehofft, er, mein Ehemann, würde für mich, für uns in den Ring steigen und Henning Pahl den Marsch blasen. Aber Tom schüttelte den Kopf. Er hätte keine Lust, jetzt, am Sonntagabend, darüber zu sprechen. Mehr sagte er nicht. Da war mir klar, dass er es längst wusste.
»Seit wann?«, hakte ich nach.
Tom tauchte den Löffel in den dampfenden Sud, hielt auf halbem Weg zum Mund inne. Ein Stück Möhre schwebte gefährlich über dem Löffelrand. Er stierte ins Leere. Dieses bedrohliche Mienenspiel aus Schmerz und Wut war mir allzu vertraut. Ich war kurz davor einzulenken, den Gesprächsfaden loszulassen, das ›Später‹ auf später zu vertagen, aber Toms Hand zitterte leicht, und das Möhrenstückchen kippte und platschte in den Teller zurück. Ein Spritzer Suppe landete auf dem Holztisch just über der Kerbe, wo ich vor etlichen Jahren in jugendlicher Wut auf meinen Vater das Brotmesser hineingerammt hatte. Vater war mir über den Mund gefahren. Ich hatte es gewagt, das verbotene Thema anzuschneiden. Dieser unbändige Zorn, mit dem ich das Messer in die Tischplatte gestoßen hatte, war auf einmal wieder da, so wach und unverbraucht wie an jenem Tag. Ich wusste, es war falsch weiterzumachen. Aber ich konnte nicht anders. Mit der alten Narbe brachen all meine verletzten Empfindlichkeiten auf. Die Munition vieler versäumter Gelegenheiten entzündete sich an diesem Moment zu einem Feuerwerk, dessen Funkenregen über dem Esstisch niederging und in die unschuldige Suppe fiel.
»Später!«, blaffte ich Tom an. »Wenn nicht jetzt, wann dann?«
Tom zog das Kinn auf die Brust. Ich mochte sein rundliches, von der Sonne gegerbtes Gesicht mit den silbrigen Bartstoppeln. An den Schläfen verloren sie sich in einem lichten weißen Flaum. Er mündete in einem akkurat zurechtgetrimmten Haarkranz, der die gebräunte Hochebene seines Schädels säumte. Diese blankpolierte Platte senkte sich nun in meine Richtung, wie bei einem Bock kurz vor dem Stoß. Tom knallte den Löffel in den Teller. Eine bunte Mischung aus Gemüsestücken spritzte über den Tisch. Eines traf mich im Gesicht. Er entschuldigte sich nicht. Er stand auf, stieß den Stuhl nach hinten und ging aus der Küche. Kurz darauf fiel die Haustür ins Schloss. Später stellte ich fest, dass er das Swarovski mitgenommen hatte.
In der Nacht schlief ich unruhig. Alle paar Stunden wachte ich auf. Aber das Bett neben mir blieb leer. Vermutlich war er zur Hütte seines Jagdvereins gefahren, um dort zu schlafen und beim ersten Licht auf Wild anzusitzen. In diesen seltenen Mußestunden fand er seinen Ausgleich. Meine Gedanken kreisten um den gestrigen Abend. Tom hatte es also gewusst. Weshalb hatte er nie mit mir darüber gesprochen? Und beim ersten Streit gleich abhauen! Das war mal wieder typisch Mann! Wenn seine Jagdkollegen es auch so machten, dann wäre er in guter Gesellschaft.
6
Der Kies knirschte unter den Reifen des Peugeot. Ein Lichtschein fiel durch das Fenster der Jagdhütte, aber der Parkplatz davor war leer. Unschlüssig hielt Tom den Wagen an. Wer mochte um diese Zeit noch hier sein? Vielleicht hatte einer der Jäger aus Versehen das Licht angelassen. Auf gar keinen Fall wollte er an diesem versauten Sonntagabend jemanden sehen, wollte einfach nur seine Ruhe haben. Kein Gejammer, kein Gelabere. Stille. Für ihn war der Wald ein Ort des Schweigens, des Nachts zuweilen vertieft durch den Ruf einer Eule. Tom wendete das Auto in Richtung Ausfahrt und schaute noch einmal zur Hütte zurück. Zu dumm! Wohin sollte er jetzt fahren? Bloß nicht nach Hause! Karo würde keine Ruhe geben. Noch fehlte ihm die zündende Idee, wie er ihr seinen Plan schmackhaft machen könnte, damit sie ihm zuhörte und nicht gleich wieder dichtmachte.
Die Umrisse eines Gesichts erschienen am Fenster und eine Hand, die ihm einladend winkte. Tom stöhnte. Zu spät. Sein Verstand arbeitete bereits an der Ausrede, während er den Wagen abstellte. Bloß schnell wieder weg, dachte er, stieg aus und überquerte den Kiesplatz zur Hütte hinüber. Erst als er vor der Haustür stand, entdeckte er das Heck des Mercedes. Ungewöhnlich!, ging es Tom durch den Kopf. Henning versteckte seine Angeberlimousine doch sonst nicht. Tom drückte die Klinke und dachte gerade noch rechtzeitig daran, sich unter dem niedrigen Türsturz zu ducken.
Ein Geruch nach starkem Tabak reizte seine Nase. Seitdem er nicht mehr rauchte, war er empfindlich geworden. Am Tisch saßen drei Männer unter einer wabernden Glocke aus Qualm und pafften. Er kannte sie alle. Die Pfeife, das war Staatsanwalt Uwe Donath, die Zigarette Amtsvorsteher Niels Zürn, und Henning Pahl schmökte seine Cohiba, angeblich Fidel Castros Lieblingszigarre. Sie alle waren Jagdkollegen, die sich vermutlich für ihre Ehefrauen gerade auf dem Hochsitz die Finger abfroren. Eine heftige Niesattacke nahm Tom für einen Moment die Sicht. Als er wieder aufschaute, stand Henning am weit geöffneten Fenster.
»Für unseren Asthmatiker!«, rief er lauthals lachend. »Du solltest wieder rauchen, du Weichei!« Dann wies er zum Tisch hinüber. »Komm, setz dich zu uns!«