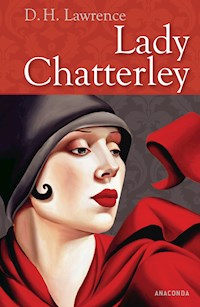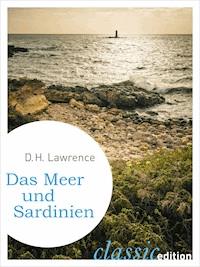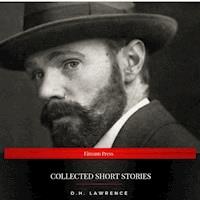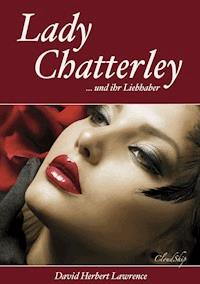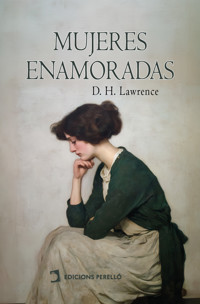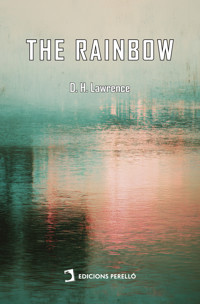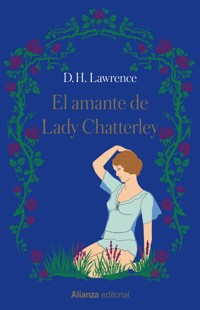Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Wie kann sich der Einzelne in einer Welt, die zunehmend einengender wird, seine Freiheit bewahren? Ein Mann, der Inseln liebt, versucht es auf seine Weise: Er zieht auf eine einsame Insel, um sein eigenes kleines Paradies zu finden. Als er merkt, dass es dort nicht einsam genug ist, sucht er sich eine neue, noch einsamere Insel. Bis er schließlich ganz allein lebt, auf einer Insel mitten im Meer, nur den Elementen ausgesetzt.D. H. Lawrence schrieb diese kurze, geheimnisvolle Anti-Robinsonade 1926, gegen Ende seines Lebens. Wie eine lange verschollene Flaschenpost offenbart sie noch heute, fast hundert Jahre nach der Niederschrift, magische Botschaften. Ob der Mann, der Inseln liebt, am Ende sein Glück findet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 61
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D. H. Lawrence
Der Mann, der Inseln liebte
Mit einem Nachwort von Thierry Gillyboeuf
Aus dem Englischen von Manfred Allié
Kampa
Die erste Insel
Es war einmal ein Mann, der liebte Inseln. Er war auf einer geboren, aber die gefiel ihm nicht, denn es wohnten zu viele andere dort. Er wollte eine Insel ganz für sich – nicht unbedingt um in Einsamkeit dort zu leben, aber um sie zu seiner eigenen Welt zu machen, einer Welt für sich.
Wenn eine Insel eine bestimmte Größe überschreitet, dann ist sie nicht besser als jedes Festland. Sie muss recht klein sein, erst dann fühlt sie sich auch wie eine Insel an; und am Ende dieser Geschichte wird man sehen, wie winzig klein sie sein muss, bevor ein Mensch glauben kann, er könne sie ganz mit seiner eigenen Persönlichkeit erfüllen.
Nun ergab es sich, dass dieser Inselliebhaber, inzwischen fünfunddreißig Jahre alt, tatsächlich eine Insel erwarb. Es war zwar kein Grundbesitz, aber er hatte sie auf neunundneunzig Jahre gepachtet, und das ist doch, wenn es einen Mann und eine Insel anbetrifft, schon beinahe ewig. Denn wenn ein Mann vom Schlage Abrahams ist und will, dass seine Nachkommen zahlreich sind wie der Sand am Ufer des Meeres, dann gründet er seine Familie nicht auf einer Insel. Nicht lange, und es würde Übervölkerung herrschen; Gedränge, Slums würden entstehen. Und das ist ein grässlicher Gedanke für jemanden, der eine Insel ihrer Einsamkeit wegen liebt. Nein, eine Insel ist ein Nest mit nur einem Ei darin, einem einzigen. Und dieses Ei ist der Inselbewohner selbst.
Die Insel, die unser zukünftiger Insulaner erworben hatte, lag nicht in den Weiten des Ozeans. Sie lag ganz nah bei seinem Zuhause, keine Palmen, kein Tosen der Brandung auf dem Riff, überhaupt nichts in dieser Art, aber ein gutes, solides Wohnhaus, recht düster, oberhalb des Bootsanlegers, und weiter im Inneren ein kleines Bauernhaus mit Nebengebäuden und einigen Feldern ringsum. Unten an der schmalen Hafenbucht standen in einer Reihe drei Häuschen, wie die Küstenwache sie früher gern baute, sehr hübsch und weiß gestrichen.
Was hätte gemütlicher und anheimelnder sein können? Es waren vier Meilen, wenn man die Insel einmal ganz umrundete, durch Stechginster und Schlehdorn, oben über die steilen Felsenklippen und hinunter zu den Lichtungen mit den Schlüsselblumen. Wenn man quer hindurch über die Buckel der zwei kleinen Hügel wanderte, über die steinigen Wiesen, wo wiederkäuend die Kühe lagerten, durch das recht spärliche Haferfeld und wieder hinaus in den Ginster und immer so weiter bis an die Kante des niedrigen Kliffs, brauchte man nur zwanzig Minuten. Und wenn man an dieser Kante ankam, sah man eine weitere, größere Insel in der Ferne liegen. Doch zwischen dieser und der anderen Insel lag die See. Und wenn man dann über die Wiese wieder zurückkehrte, wo einen die kräftigen Butterblumen des Hügellands grüßten, sah man im Osten noch eine Insel, winzig diesmal, als wäre sie das Kalb zu dieser Kuh. Und auch diese winzige Insel gehörte dem Insulaner.
Es scheint also, sogar Inseln haben gern Gesellschaft.
Unser Bewohner liebte seine Insel sehr. Zu Frühlingsbeginn waren die schmalen Pfade und die kleinen Waldwiesen ein Schnee aus Schlehdornblüten, ein flirrendes Weiß inmitten der keltischen Stille des dichten Grüns und der grauen Felsen; Amseln riefen aus diesem Meer weißer Blüten ihr erstes langes, triumphierendes Lied. Nach dem Schlehdorn, den Schlüsselblumen, die sich an den Boden schmiegten, erschienen blau die Hyazinthen, wie Elfenseen, wehende blaue Laken zwischen den Büschen und unter den Bäumen. Und viele Vögel, in deren Nester man schauen konnte, wenn die Insel einem ganz allein gehörte. Was für ein Wunder, wie großartig war diese Welt!
Dann kam der Sommer, die Schlüsselblumen waren verblüht, Heckenrosen verströmten ihren leisen Duft im Dunst. Auf der Wiese wurde Heu gemacht, und der Fingerhut stand dabei und schaute zu. In einer kleinen Bucht lag Sonne auf dem hellen Granit, dort wo man badete, und Schatten auf den Felsen. Schon stahl der Nebel sich herbei, und man ging zwischen reifendem Hafer nach Hause; das Gleißen der See verlor sich in der hohen Luft, und von der anderen Insel kam das Muhen des Nebelhorns. Und dann verschwand der Nebel, der vom Meer aufstieg, wieder, es wurde Herbst, die Halme des Hafers lagen gebündelt; riesig, auch er eine Insel, erhob sich golden der Mond aus dem Meer und tauchte, wenn er höher stieg, die Wasserwelt in Weiß.
So endete der Herbst mit Regen, und der Winter kam, finsterer Himmel, Feuchtigkeit und Regen, doch selten Frost. Die Insel, die eigene Insel, duckte sich düster, sie entzog sich. Man spürte unten in den feuchten, finsteren Niederungen den Geist des Beharrens, zusammengerollt wie ein nasser, knurriger Hund oder wie eine Schlange, weder wach noch schlafend. In der Nacht dann, wenn der Wind nicht mehr in Stürmen und Stößen wehte wie auf See, da spürte man, dass diese Insel ein Universum war, so alt und grenzenlos wie das Dunkel, gar keine Insel, sondern eine unendliche dunkle Welt, wo all die Seelen all der Nächte aller Zeiten weiterlebten, und die unendliche Ferne war nah.
Seltsam, wie man von dieser kleinen Insel im Raum in die dunkle, weite Sphäre der Zeit gekommen war, wo all die unsterblichen Seelen überallhin kreuz und quer unterwegs sind, mit allerlei Dingen beschäftigt. Die kleine irdische Insel ist, ein bloßes Sprungbrett, zu Nichts geschwunden, und gesprungen ist man, man weiß nicht wie, in das dunkle, große Geheimnis der Zeit, wo die Vergangenheit voller Leben ist und die Zukunft nicht von allem anderen geschieden.
Das ist die Gefahr dabei, wenn man zum Inselbewohner wird. Solange man in der Großstadt unterwegs ist, Hundedeckchen über den Schuhen, solange man darauf achten muss, dem Straßenverkehr zu entkommen, immer mit der Todesfurcht im Nacken, bleibt man gefeit gegen die Unendlichkeit der Zeit. Dann ist der Augenblick unsere Insel in der Zeit, und es ist das Universum des Raumes, das um uns wogt.
Sitzt man aber erst einmal für sich allein auf einer kleinen Insel im Meer des Raumes, wo der Augenblick zu atmen beginnt, sich auszuweiten in großen Kreisen, dann verschwindet der feste Boden unter den Füßen, und unsere glitschige, nackte, finstere Seele findet sich in der zeitlosen Welt wieder, wo die Triumphwagen der Totgesagten die alten Straßen der Jahrhunderte hinauf- und wieder hinunterpreschen, und die Seelen drängen sich auf den Fußwegen, die wir, im Augenblick gefangen, vergangene Jahre nennen. Die Seelen sämtlicher Toten sind wieder lebendig, sie pulsieren munter um uns her. Jetzt sind wir draußen in der anderen Unendlichkeit.
Etwas in dieser Art ging mit unserem Insulaner vor. Geheimnisvolle »Empfindungen« stellten sich ein, Gefühle, an die er nicht gewohnt war; er spürte die Gegenwart früherer, längst verstorbener Menschen und anderes mehr; Männer aus Gallien, mit gewaltigen Schnurrbärten, die einmal auf seiner Insel gelebt hatten und von dem Erdboden verschwunden waren, doch nicht aus der Nachtluft. Sie waren noch immer da, hievten ihre massigen, ungestümen, ungesehenen Leiber durch die Nacht. Und es gab Priester mit goldenen Sicheln und Mistelzweigen; dann andere Priester mit einem Kruzifix; dann Piraten, Mörder zur See.