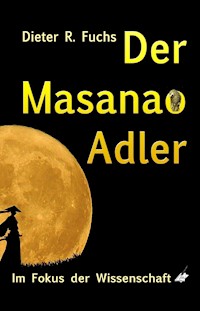
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karina Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peking im Jahr 2036: Im unterirdischen Kulturgüter-Hort und Wissenschaftszentrum der Vereinten Nationen erforscht das Team um den Experten Dr. Marco Renke die Geheimnisse eines japanischen Netsuke, einer wertvollen Elfenbein-Schnitzerei aus dem alten Japan. Sie ahnen nicht, dass im Hintergrund der Milliardär Yamagata Aritomo skrupellos die Fäden zieht, mit einer sehr persönlichen Motivation. Die Forscher werden in unglaubliche und verwirrende Zusammenhänge verstrickt. Aus seriöser wissenschaftlicher Archäometrie wird immer mehr eine Abenteuerreise in die Vergangenheit ihres Untersuchungsobjekts. Schritt für Schritt erkennen sie die wahre Dimension ihres Projekts …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dieter R. Fuchs
Der Masanao-Adler
im Fokus der Wissenschaft
Bibliografische Information der Nationalbibliotheken: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Österreichische Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Österreichischen Nationalbibliothek.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags, Herausgebers und der Autoren unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Personen und Handlungen in dieser Geschichte sind erfunden. Ähnlichkeiten mit toten Personen entsprechen nicht der Wahrheit. Die Namen Lebender werden mit deren Einverständnis genannt.
Impressum:
1. Auflage 2020
www.karinaverlag.at/
Coverfototeile: Lizenzfrei Pixabay
Covergestaltung: Karina Pfolz
Lektorat/Layout: Renate Zawrel
Druck: tredition GmbH, Hamburg, Deutschland
© Karina Verlag, Wien, Österreich
ISBN Print 978-3-903161-76-4
ISBN E-Book 978-3-903161-77-1
Dieter R. Fuchs
Der Masanao- Adler
im Fokus der Wissenschaft
Prolog
Erinnerungen
Verwirrende BefUnde
Tod in Afrika
Unter Beobachtung
The Wall
Unerwartete Entwicklungen
Leben im UNTACH
Ein langes Dinner
Nächtliche Schatten
Verpasste Chancen
Zwei zufriedene Chefs
Ein Adler stellt sich vor
Rückenwind
Die Schatulle
Das Vermächtnis der Ikeda
Gestrandet
Yakuza-Pläne
Nachtlektüre
Die Holzkugel
Überraschungen am Freitag
Freundschaftsdienste
Moralische Bedenken
Mikrokosmos Himotoshi
Absturz und Höhenflug
Forschung im Verborgenen
Kehrtwende
Rätsel in vielen Sprachen
Neue Einsichten
Trouvaille der besonderen Art
Zeitensprünge
Zwischenfazit
Gipfeltreffen mit Tiefgang
Reisepläne
Aufbruchsstimmung
Lichtblitze vor der Finsternis
Epilog
Prolog
Magie und Wissenschaft – wie passt das zusammen? Ist in den Wortdefinitionen hierfür und im allgemein üblichen Verständnis nicht bereits vorbestimmt, dass diese Welten es schwer miteinander haben?
Eigentlich nicht, denn auch die Wissenschaft wird durch den menschlichen Geist getrieben, und jener Geist hat einen weiteren Horizont als reine Logik und basiert auf mehr als messbaren, sichtbaren Erscheinungen. Kein Fortschritt und keine echte Vernunft ohne Intuition, ohne Visionen und ohne diffuse Ahnungen. Der freie menschliche Geist vermag zu spüren, dass da etwas jenseits des physikalisch, chemisch und logisch Nachprüfbaren existieren kann und muss.
Was sich dem kritischen und skeptischen Verstand, im wahrsten Sinne dieses Wortes, nicht real erschließt, spürt doch jene andere Dimension in uns – manchmal Seele genannt – als etwas jenseits solcher Grenzen wohl Vorhandenes. Und manchmal berühren sich das Magische und die faktensüchtige Wissenschaft sogar hautnah.
Wie in der Geschichte um eine mysteriöse Elfenbein-Schnitzerei aus dem alten Japan, aufgedeckt durch die akribische Forschungsarbeit eines Wissenschaftler-Teams im Jahr 2036 in Peking.
Die magische Verwobenheit der Dinge über Raum und Zeit hinweg ist nicht zu leugnen. Lasst euch verzaubern!
Erinnerungen
Der alte Mann hockte in sich zusammengesunken und mit halb geöffnetem Mund in dem zerschlissenen Ohrensessel am Sprossenfenster und schnarchte laut vor sich hin. Er war bei der Betrachtung der unten am Ufer vor seinem Fachwerkhaus spielenden Kinder eingenickt – wie so oft am frühen Nachmittag, wenn er sich in diese Fensternische zurückzog, um in nostalgischen Erinnerungen zu schwelgen.
In jenem kalten Februar des Jahres 2012 war der Main teilweise zugefroren, einige in der Sonne blassblau schimmernde Eisschollen hatten sich auf die Böschung hochgeschoben und boten der Dorfjugend einen grandiosen Abenteuerspielplatz. Trotz der grimmigen Kälte versuchte gerade eine Horde als Indianer verkleideter Jungs neben einem aus Holzlatten und einer Plane improvisierten Zelt ein Lagerfeuer anzuzünden, wobei sie einige hochgestellte Eisplatten als Windschutz benutzten.
Bevor sich die Augen des unter zunehmender Altersdemenz leidenden Mannes vor Müdigkeit geschlossen hatten, musste sich diese Szene wohl in seinen wegdämmernden Verstand magisch eingeprägt haben. Wenig später geisterten ähnliche Bilder durch sein Unterbewusstsein.
In diesem Traum blickte er wie aus einer Vogelperspektive herab auf eine aus Reisig und Fellen gebaute Schwitzhütte am Ufer eines weiten, still daliegenden Sees inmitten seltsam bläulich schimmernder und tief verschneiter Wälder. Aus einem kleinen Luftauslass in der Decke der Hütte stiegen Rauch und feuchte, sofort zu Eisnebel kondensierende Luft auf. Ein Zeichen, dass gerade jemand die spirituelle Reinigungszeremonie mit heißem Dampf und glimmenden Kräutern und Pilzen darin vollzog.
Nun kroch ein Mensch unter einem langsam zur Seite geschobenen Fellstück hervor und richtete seinen schweißglänzenden, tätowierten Körper auf, mit weit geöffneten Armen die eisige Luft begrüßend. Es war ein etwa dreißigjähriger Indianer, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, an dessen Gürtel ein Jagdmesser und ein ledernes Behältnis hingen. Er murmelte mit weiterhin ausgestreckten Armen und zum Himmel gerichtetem Blick eine Weile lang gutturale rituelle Worte. Im, auf der berauschenden Wirkung der Pilze beruhenden, Trancezustand war er in den letzten zwei Stunden wie auf Adlerflügeln in fremde Welten und Zeiten gereist.
Die seltsame Gestalt setzte sich – ungeachtet der Witterung – auf den Boden und breitete zwischen überkreuzten Beinen den Inhalt eines Medizinbeutels aus. Es waren mehrere Holzstückchen und heilige Steine, eine Hasenpfote sowie eine kleine Figur, die anscheinend aus einem Knochen oder Tierzahn geschnitzt war und einen Adler mit einem Beutetier in seinen Fängen darstellte. Nachdem er ehrfürchtig vor allem dieses Totem-Objekt betrachtet und seine Gedanken darin versenkt hatte, verbarg er alles wieder in dem mit Adlerflaum und Tabakblättern ausgepolsterten Beutel. Der Indianer beendete das Treffen mit seinem Geistwesen, indem er es noch dreimal mit »A-wa-hi-li« anrief. Er zog die Beinkleider und den Jagdrock an, die auf einem Ast hingen, griff seinen Bogen sowie den Köcher mit den im heiligen Rauch gereinigten Pfeilen und schritt von neuer Kraft erfüllt ins dichte Unterholz des Waldes. So wie der Indianer verschwand, löste sich augenblicklich die Szenerie auf bis sie gänzlich verblasste. Im Unterbewusstsein des Träumenden verblieb nur noch eine große Leere …
Der alte Mann im Ohrensessel wachte auf und öffnete langsam und noch schlaftrunken die Augen. In seinen Mundwinkeln war Speichel festgetrocknet, aber er bemerkte es nicht. Genauso wenig wie er den säuerlich scharfen Geruch in seinem verwahrlosten Haus wahrnahm. Im Halbdunkel des kleinen, mit Unmengen Gerümpel vollgestellten Wohnzimmers humpelte er auf unsicheren Beinen zu einer Seitenwand, an der ein Setzkasten – gefüllt mit asiatischen Schnitzereien – hing. Mit zittriger, ausgezehrter Hand und dennoch schlafwandlerischer Sicherheit nahm er eine dieser kleinen Figuren heraus und hielt sie ganz nah vor seine schwachen Augen. Der Alte hatte keinerlei Erinnerung mehr an die gerade geträumte Geschichte. Dennoch lächelte er zärtlich, fast ehrfürchtig die kleine Adler-Schnitzerei an, die ihn so viele Jahre begleitet hatte.
Nichts wünschte er sich sehnlicher in diesem Moment, als noch einmal auf die große, fantastische Reise zu gehen, auf die ihn dieses kleine Objekt einst geleitet hatte.
Von einem Augenblick zum anderen glitt sein Verstand wieder ab und er verfiel in dumpfes Nachdenken, was er heute noch tun wollte. Er wusste es nicht mehr.
Verwirrende Befunde
Vierundzwanzig Jahre nach dieser Szene in Unterfranken entwickelten weit entfernt, in Peking, manche damit eng verknüpften Vorgänge eine neue Dynamik. Bis tief unter die Erdoberfläche, wie ein gigantisches, an einen riesigen Ameisenhaufen erinnerndes Labyrinth aus Gängen, Schächten und Räumlichkeiten, breitete sich eine seltsame, von der restlichen Welt abgeschottete unterirdische Wissenschaftsstadt aus. Hier und in den darüber liegenden Gebäuden gingen tausende Wissenschaftler ihrer ganz auf die Forschung und den Erhalt des menschlichen kulturellen Erbes konzentrierten Beschäftigung nach.
Genau zu dieser Zeit spielte plötzlich derselbe kleine Elfenbein-Adler wieder eine zentrale Rolle, der einst den alten Mann bei Würzburg so bewegt hatte.
»Marco, das ist total irre - das musst du dir ansehen! Ich flipp aus!«
Es kam atemlos von den Lippen der quirligen, seltsam schrill gekleideten und geschminkten, jungen Japanerin. Sie wirkte im nüchternen Ambiente des grau-in-grau möblierten, fensterlosen Raumes so fremd wie ein schillernder Kolibri, der sich hierher verflogen hatte. Dieser hübsche bunte Vogel stand in ziemlichem Kontrast zu dem älteren Herrn in seinem biederen Tweed-Sakko, der sich nun mit seinem Schreibtischstuhl zu ihr herumschwenkte.
Tomomi Kasai bot einen Anblick, der keinem der zahllosen Modetrends zuzuordnen war, denen man im Jahr 2036 begegnen konnte. Sie hatte ihren persönlichen Style schon als Teenie in einem uralten Jugendjournal entdeckt und sich entgegen allen damals geltenden Normen dafür entschieden und seither beibehalten.
Sie war eine ›Ganguro‹, also übersetzt ein ›Schwarzgesicht‹. In der hippen Szene von Shibuya, dem Vergnügungsviertel von Tokyo mit seinen vielen Clubs, Karaoke-Schuppen und Love-Hotels, hatten in den 1990er Jahren junge Mädchen auf der Suche nach einem verrückten und auffallenden Outfit diesen Look erfunden. Sie bräunten mit verschiedensten Mitteln ihre Haut dunkel, legten ein kontraststarkes weißes Augenmakeup auf, trugen pechschwarze überlange künstliche Wimpern, dazu hellen, pastellfarbenen Lippenstift. Die langen Haare färbten sie sich orange- oder wasserstoffblond, oft mit pinkfarbenen Strähnen. Kombiniert mit farblich passenden, schrillen Shirts und Hütchen, superkurzen Miniröcken und üppigem Modeschmuck schufen sie so einen Trend, der sich etliche Jahre in der Subkultur Japans halten konnte.
Die Ganguro hatten etwas schockierend Dämonisches an sich, erinnerten die Älteren sogar an junge Shintō-Priesterinnen in ihrer Andersartigkeit. Einige von ihnen mit besonders grellem Make-up nannten sich selbst auch ›Yama-uba‹, also ›Berghexen‹ und empfanden sich als ganz in der Tradition alter Überlieferungen stehend. Nur eben modern!
Jetzt, fast ein halbes Jahrhundert später, wirkte die vierundzwanzigjährige Tomomi in dieser Aufmachung ebenfalls reichlich exotisch, wohl noch provozierender ›individuell‹ als die Girlies damals, was sie aber keineswegs störte. Im Gegenteil! Sie genoss es, anders zu sein und deutlich zu machen, dass sie nichts von altbackenen Konventionen hielt. Die Zeiten des Konformismus gehörten auch für Japanerinnen schon lange der Vergangenheit an. Außerdem hatte sie im Alter von vierzehn Jahren Mangas mit mythologischem Hintergrund geradezu verschlungen und fühlte sich dieser schönen Fantasiewelt durch ihr Äußeres irgendwie nah.
Doktor Marco Renke, der jetzt wie immer wohlwollend und sogar etwas bewundernd seine jüngste Mitarbeiterin anlächelte, hatte von Anfang an das exzentrische Äußere dieser hoch begabten und absolut zuverlässigen jungen Wissenschaftlerin als etwas Positives, für eine starke Persönlichkeit Sprechendes gesehen.
Nach ihrer ersten Begegnung und seiner spontanen Begeisterung hatte er sich damals zunächst gefragt, ob so etwas wie ein Zauber von der Japanerin auf ihn eingewirkt habe. Doch rasch wischte er diesen Gedanken zur Seite und war sich sicher, dass ihn alleine die Intelligenz und angenehme Persönlichkeit beeindruckt hatten. Er erinnerte sich, damals bei diesem Gedanken gelacht zu haben. Denn welcher Unterschied bestünde wohl zwischen einer ›magischen Ausstrahlung‹ und einer ›gewinnenden Persönlichkeit‹, wenn man es genau nahm! Egal: Die positive Einschätzung hatte sich in jeder Hinsicht bestätigt, seit sie in sein Team gekommen war. Tomomi entwickelte sich zu einer wichtigen Stütze im aktuellen Forschungsprojekt und strahlte trotz ihrer Jugend professionelle Souveränität aus. Umso irritierter war er über diesen leicht hysterischen Auftritt.
Tomomis Körpersprache drückte beim Betreten des Büros ihres Chefs den aufgewühlten Gefühlszustand aus, in dem sie sich seit zwei Stunden befand. Außerdem hatte sie den recht weiten Weg von ihrem Apartment im Hochhaus bis zum unterirdischen Bürotrakt in ziemlicher Eile zurückgelegt. Sie war nicht nur vor Aufregung, sondern auch vom raschen Laufen außer Atem. Der Gebäudekomplex der United Nations Treasury and Archives of Cultural Heritage in Peking, kurz UNTACH genannt, nahm ein sehr weitläufiges Areal ein. Diese zentrale Kulturgüterbehörde und Kunstschatzkammer der Vereinten Nationen war wie eine kleine, eigene Stadt innerhalb des Häusermeers von Chinas Hauptstadt – und sicher einer der geheimnisvollsten Orte auf der Welt.
Die Japanerin hatte die Analyseergebnisse aus dem Labor in Grenoble sofort überflogen, nein, regelrecht in sich aufgesogen, als sie an diesem frühen Morgen des sechzehnten Julis im Jahr 2036 eingegangen waren. Sie hatte gegen fünf Uhr das leise »Pling« ihres Smartpads im Halbschlaf wahrgenommen und wusste intuitiv, dass dies die dringend erwartete Nachricht aus Frankreich sein musste. So war es, und beim Lesen der angehängten Dateien jagte ihr ein ungewohnter, aber nicht unangenehmer Schauer über den Rücken. Es war kaum zu glauben, was diese Analysen bestätigten, eigentlich gar nicht möglich … oder etwa doch?
Nach mehrfacher Plausibilitätsprüfung der neuen Daten hatte sie sorgfältig die Zahlenkolonnen mit den Ergebnissen verglichen, die bereits aus Untersuchungen hier im Pekinger Labor vorlagen. Bloß keine Fehler machen! Es galt, sich nicht gleich am Anfang ihres neuen Jobs durch voreilige Schlüsse zu blamieren.
Dieses Projekt war Tomomis erster beruflicher Schritt nach Abschluss des Chemie-Studiums und sie war sich der großartigen Chance bewusst, die ihr hiermit geboten wurde. Die junge Japanerin träumte schon immer davon, beruflich im Fachgebiet der Archäometrie Fuß fassen zu können. Ihr Faible für Chemie und ihre weiterhin brennende Begeisterung für alte Kulte und Künste ergänzten sich dort perfekt und daher hatte sie ihr ganzes Studium entsprechend angelegt und zielbewusst durchgezogen. Nichts konnte die Wunschvorstellung toppen, später einmal selbst naturwissenschaftliche Methoden auf Kunst und Antiquitäten anzuwenden, und jetzt hatte dies sogar gleich bei ihrem ersten Job geklappt! Tomomi wollte Marco auf keinen Fall enttäuschen, der ihr als Anfängerin bei der Stellenbesetzung den Vorzug gegenüber Mitbewerbern mit langjähriger Forschungserfahrung gegeben hatte.
Je länger sie die Daten studierte, umso sicherer war sie sich ihrer Sache. Diese Befunde der Experten der Europäischen Akademie der Wissenschaften waren eindeutig und Grenoble galt als die weltweit führende Autorität bei diesen Analyseverfahren. Nach einer schnellen Dusche und für ihre Verhältnisse kurzen Sitzung vor dem Schminkspiegel hatte sie sich sofort auf den Weg zu ihrem Chef gemacht, obwohl es erst kurz nach sieben war. Sie wusste, dass er um diese Zeit meistens schon in seinem Büro saß.
Unterwegs wirbelten unterschiedlichste Gedanken durch ihren Kopf. Sie war regelrecht geflasht von dem, was sie hier miterlebte. Im vergangenen Jahr, als sie in München noch für ihre Studienabschlussarbeit recherchierte, war sie voller Bewunderung für die Forschungsergebnisse anderer. Vieles empfand sie als ›interessant, erstaunlich, beeindruckend‹, manchmal auch ›genial‹. Aber das hier, seit sie in Peking mit Marco zusammenarbeitete, das war wirklich atemberaubend spannend – und sie ein aktiver Teil davon! Tomomi konnte daher ihre Aufregung nicht unterdrücken, als sie nach dem Betreten des Raumes den Tablet-Computer vor ihrem Chef auf den Schreibtisch gelegt hatte.
Doktor Marco Renke blickte sie noch immer etwas verwundert an. Er schätzte an seiner jüngsten Mitarbeiterin vor allem ihr normalerweise unaufgeregtes Verhalten. Ihr völlig ungewohnter Erregungszustand, der anhand von Lautstärke und Stimmlage unüberhörbar war, machte ihm sofort klar, dass etwas Besonderes geschehen war. Wofür auch die Uhrzeit sprach – meistens war er bis etwa neun Uhr alleine im Büro. Er liebte diese Routine, denn so konnte er ungestört seine kreativste Phase am frühen Morgen nutzen. Renke kratzte sich lächelnd den grauen Dreitagebart und streckte zunächst einmal seinen schlaksigen und von der Schreibtischarbeit etwas steif gewordenen Körper. Er löste sich nur langsam aus der tiefen Konzentration, in die er bis zu dieser Störung wegen einer schwierigen Textstelle in einem Fachartikel versunken war. Mit beiden Händen fuhr er durch seinen noch immer üppigen, grauen Wuschelkopf und antwortete seiner Mitarbeiterin schließlich mit einem Augenzwinkern: »Naja, liebe Tomomi, ich denke um diese Uhrzeit wünsche ich dir erst einmal einen guten Morgen und dann sehen wir weiter. Was hat dich denn so früh aus dem Bett gejagt? Ist dir unser Adler als Geist erschienen?«
Ein leichtes Erröten breitete sich über ihr Gesicht aus, weil sie vor Aufregung sogar das Grüßen vergessen hatte, aber das starke Make-up überdeckte ihre Verlegenheit.
Marco überflog die Zahlen und Kurztexte auf dem Touchscreen, zunächst quasi diagonal im Schnelldurchgang, dann ein zweites Mal mit deutlicher sichtbarer Konzentration. Ihre Augen trafen sich.
»Also doch! Whow, Tomomi, deine Idee war echt super! Das ist wirklich sensationell – und ein wenig gespenstisch!«
In die sichtliche Anspannung mischte sich bei beiden zunehmend jene erlösende Begeisterung, wie man sie nur bei der unerwarteten Erfüllung wirklich großer Hoffnungen empfindet. Strahlende Augen, breites Lächeln und ein fast spürbares Knistern in Vorfreude auf die plötzlich noch geheimnisvollere Forschungsarbeit.
Vor einem Monat hatten sie der Elfenbein-Schnitzerei, die im Fokus ihrer momentanen Untersuchungen stand, eine winzige Materialprobe entnommen. Diese war auf Tomomis Anregung hin nach Grenoble zu einer der aufwändigsten und kostenintensivsten chemischen und material-technischen Charakterisierungen geschickt worden, die je einem solchen Objekt zuteil geworden war.
Das vorliegende Ergebnis der diversen chemischen Spezialanalysen wies selbst bei pessimistischer Auslegung der methodischen Fehlerbreiten eine Herkunft des Elfenbeins aus Westafrika, Zentralafrika und Ostafrika nach. Wohlgemerkt nicht entweder/oder, sondern sowohl/als auch. Dieses Tier musste also den ganzen afrikanischen Kontinent durchwandert haben, wie die Zusammensetzung seines Zahnmaterials eindeutig bewies!
Ungewöhnlich und bisher unerklärlich war ein extrem hoher Holmium-Wert – dieses seltene Element war bei biologischem Material normalerweise nur in minimalen Spuren vorhanden, in ihrer Elfenbeinprobe jedoch über 10.000fach erhöht. Die Radiokarbon-Altersbestimmung ergab als Todeszeitpunkt des Elefanten das Jahr 1350 +/- 20 Jahre. Die Genanalysen wiesen das Tier als einen damals etwa achtzig Jahre alten, männlichen Elefanten der Art Loxodonta Cyclotis aus. Also als einen üblicherweise kleinwüchsigen Waldelefanten, wie sie früher in den tropischen Regenwäldern Westafrikas heimisch waren. Die spezielle Population, auf welche die Vergleichsdaten der Europäischen Zoologischen Gendatenbank in London hindeuteten, war in Ghana anzusiedeln. Sie galt allerdings nach den Wirren des Westafrika-Krieges seit etwa zehn Jahren als ausgestorben. Diese Artzuweisung widersprach deutlich der aufgrund einer Strukturanalyse abgeleiteten Aussage, dass der Stoßzahn, zu dem die Probe gehörte, vermutlich eine Gesamtlänge von etwa vier Metern hatte. Also doppelt so lang war wie bei dieser Art üblich und auch länger als jeder bislang bekannte Elefantenstoßzahn überhaupt!
Die weiteren Materialanalysen bewiesen, dass der seltsame Waldelefant, der dieses Elfenbein geliefert hatte, in mehrfacher Hinsicht sehr ungewöhnlich gewesen war. Einzelne DNA-Sequenzen offenbarten eine angeborene Pigmentstörung, er war definitiv ein Albino, also einer der äußerst seltenen weißen afrikanischen Elefanten. Außerdem war das Tier aufgrund genetisch bedingter Wachstumsstörungen wohl ein grotesker Riese unter seinesgleichen, mit vermutlich über vier Metern Schulterhöhe erheblich massiger als es bei Waldelefanten jemals dokumentiert worden war. Was wiederum mit der enormen Stoßzahnlänge gut korrelierte.
Doch nicht diese an sich zwar interessanten, aber höchstens für Zoologen spektakulären Fakten bewegten die beiden Forscher. Es gab einen ganz anderen, wirklich mysteriösen Grund. Weil Tomomi jener in just diesem Moment wieder deutlich bewusst wurde, verstärkte sich ihre Erregung zu einer wohligen Gänsehaut, die ihr langsam bis in den Nacken hoch stieg.
Denn die außergewöhnliche Herkunft des Rohmaterials, aus dem dieses Kunstobjekt geschnitzt worden war, hatte jemand bereits in einem fünfzig Jahre alten Essay genau beschrieben. Der Verfasser war in der Darstellung so präzise, als sei er den Spuren dieses Elefanten zu dessen Lebzeiten im vierzehnten Jahrhundert selbst gefolgt!
Definitiv hatte in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch niemand die technischen Möglichkeiten, solche Details zur Materialherkunft einer Schnitzerei aus siebenhundert Jahre altem Elfenbein herzuleiten. Die hierzu notwendigen Analyseverfahren waren zu jener Zeit noch nicht vorhanden oder benötigten eine Mindestprobenmenge, die unmöglich von einem so kleinen Objekt hätte entnommen werden können. Das war wie Zauberei! Die beiden Wissenschaftler standen somit vor einem Rätsel, das ihre Logik momentan überforderte und ihren Forscherdrang anspornte.
Marco und Tomomi gingen langsam durch den weitläufigen Büroraum zur in der Wand eingebauten Panzerglasvitrine und blickten, wie schon so oft, fasziniert auf das Objekt ihrer Untersuchungen. Dort stand unter Schutzglas, bei definierter Luftfeuchte und Temperatur sowie durch spezielle LED-Lampen ins rechte Licht gesetzt, eine etwa fünf Zentimeter große Schnitzerei aus Elfenbein. Die Figur stellte in ausgewogenen Proportionen, detailgenau und künstlerisch ausdrucksstark einen sitzenden Adler mit angelegten Schwingen dar, der einen kleinen Affen als Beute in seinen Fängen umklammert hielt.
Es handelte sich um ein japanisches Netsuke, also einen vollplastisch geschnitzten Gürtelknebel mit zwei Schnurlöchern zur Befestigung kleinerer Gegenstände am Obi, dem breiten Gürtel des Kimonos. Im Japan des siebzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts waren diese kleinen Gürtelschmuckstücke, meistens aus Elfenbein, Hirschhorn oder Holz gefertigt, weit verbreitet. Sie dienten in erster Linie dem praktischen Zweck, Utensilien wie Pillendose, Pfeifenset oder Schreibzeug mittels einer Seidenschnur sicher und dennoch leicht abnehmbar am Obi festzuklemmen, denn die damals übliche Kleidung der Männer hatte keine Taschen. Darüber hinaus boten Netsuke auf elegante Weise die Möglichkeit, den Kunstsinn und Wohlstand des Trägers dezent zur Schau zu stellen. Später hatten sich diese Schnitzereien, insbesondere in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, weltweit zu beliebten Sammlerobjekten entwickelt. Künstlerisch hochwertige, nachweislich von prominenten Schnitzern stammende Netsuke erzielten ab Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts auf Kunstauktionen und im internationalen Antiquitätenhandel enorme Preise. Gute Stücke konnten einen Marktwert von mehreren zehntausend bis zu dreihunderttausend Euro erreichen.
Dass es sich bei diesem Netsuke hier um ein Spitzenstück handelte, davon konnten die beiden Forscher zweifelsfrei ausgehen. Das belegte ein vor fünf Jahren hausintern durch die Japonika-Experten des UNTACH angefertigtes Gutachten. Bei jeder Neueinlieferung war eine solche Bewertung durch ein Team fachkundiger Kunsthistoriker ein Routinevorgang. In dieser Expertise wurde die an der Unterseite des Netsuke markant eingeschnitzte Signatur ›Masanao‹ als authentisch bewertet. Als Schöpfer war also jener Meisterschnitzer belegt, der im achtzehnten Jahrhundert in Kyoto wirkte und in Standardwerken über Netsuke als einer der künstlerisch herausragenden Meister seiner Zeit galt.
Es gab noch weitere Belege für die außergewöhnliche Qualität dieses Netsuke, die aus wissenschaftlicher Sicht gleichermaßen hoch zu bewerten waren. So existierte eine alte, auf Dezember 1989 datierte Einschätzung eines deutschen Auktionshauses in Köln. Dessen Experten waren auf Asiatika spezialisiert und seit zwei Generationen in der Fachszene als eine der höchsten Instanzen bei der Bewertung dieser Gürtelknebel bekannt. Außerdem fand sich die Abbildung und Dokumentation exakt dieses Netsuke in einem anerkannten Standardwerk über japanische Kleinkunst aus dem Jahr 2018. Die Identität des Stücks war hierin zusätzlich optisch abgesichert durch mehrere stark vergrößerte Detailaufnahmen der Signatur ›Masanao‹ sowie weiterer charakteristischer Schnitzdetails. Es war unzweifelhaft genau dieses Netsuke, das im Original vor ihnen lag, sie beide in den vergangenen Wochen so intensiv in ihren Bann gezogen hatte und in den kommenden Monaten weiter beschäftigen würde.
Als Tomomi, wie immer seltsam gebannt und fasziniert beim Anblick der Schnitzerei, schon wieder ein seltsames Kribbeln am Körper spürte, wurde der kleine Adler in ihren Gedanken regelrecht lebendig, so sehr berührte seine Aura ihre Fantasie. Im Innersten glaubte die Japanerin fast zu hören, wie es aus der Vitrine in sie drang und säuselte: ›So löst doch endlich mein Rätsel und gebt mir meinen Frieden zurück.‹
Tomomi riss sich zusammen, rief ihre Gedanken wieder zu logischer Ordnung und war sich bewusst, dass es eigentlich nicht nur das Netsuke selbst war, das ihnen so große Rätsel aufgab. Es war vielmehr auch der Inhalt jener seltsamen Schatulle, die zu diesem Netsuke zu gehören schien und von der Marco Renke immer recht geheimnisvoll sprach.
Die junge Chemikerin hatte nur ein einziges Mal einen Blick auf diese ungewöhnliche Beigabe werfen können, denn ihr Chef hielt diese stets in dem kleinen Tresorraum verschlossen, der an sein Büro angrenzte. Sie erinnerte sich aber gut an die mit Schnitzereien verzierte Holzschatulle von der Größe eines Pilotenkoffers. Diese öffnete sich mittig und die beiden dann zugänglichen Hälften ließen sich ein weiteres Mal nach außen aufklappen, sodass vier gleich große flache Behältnisse nebeneinander vor dem Betrachter lagen, durch kunstvolle Messingscharniere miteinander verbunden. Diese einzelnen Abteile waren jeweils weiter untergliedert, teilweise in Dokumentenfächer, teilweise in mit Samt ausgepolsterte Behältnisse und Futterale, manche mit Deckeln oder Befestigungen versehen.
Der Koffer schien nur teilweise gefüllt zu sein mit Schriftstücken und kleinen Objekten. Zumindest soweit sie es damals sehen konnte, als ihr Marco einen kurzen Blick auf seine ›Schatztruhe‹ gönnte, wie er ihn ironisch nannte. Er hatte Tomomi bei dieser Gelegenheit auf zwei Details des Inhalts näher hingewiesen, bevor er die Schatulle wieder zusammenklappte und wegschloss: Auf ein Dokument, das er einem der flacheren Fächer entnahm und ihr vor die Augen hielt, sowie auf eine im Koffermittelteil integrierte Miniaturvitrine, die aus dickem, glasklarem Kunststoff bestand. Im Zentrum dieses kleinen aufklappbaren Quaders war eine exakte Negativform des Adler-Netsuke zu erkennen, ausgekleidet mit einer dünnen, weichen Silikonschicht. Dies stellte einen sicheren und maßgefertigten Aufbewahrungsort für das kleine Prachtstück dar.
»Nun hast du auch das Original gesehen – nicht, dass du glaubst, ich will dich zum Narren halten.«
Er hatte es damals mit einem Schmunzeln gesagt, aber sein Blick drückte etwas anderes aus. Es ging ihm ernsthaft darum, sie ins Vertrauen zu ziehen und sicherzustellen, dass sie sich der Seriosität ihrer gemeinsamen Nachforschungen trotz derart skurriler Umstände bewusst war.
Den Text auf dem handgeschriebenen, leicht vergilbten Dokument kannte sie bereits aus einem Scan, den ihr Marco einige Tage zuvor spät abends überraschend zum Lesen gemailt hatte. Normalerweise belästigte er seine Mitarbeiter nicht in ihrer Freizeit, so gut kannte sie ihn schon. Sein Begleittext in der Mail lautete damals: ›Was hältst du von diesem netten Stück Prosa? Viel Spaß bei der Lektüre, ich freu' mich auf dein Feedback in den nächsten Tagen.‹
Sie hatte den Text sofort gelesen, anfangs eher verwundert und amüsiert, dann plötzlich alarmiert und schließlich hellwach. In der folgenden Stunde studierte sie die wenigen Seiten dann intensiv und hinterfragte einzelne Aussagen darin mittels diverser Internet-Recherchen. Zunächst erschien es ihr völlig abwegig, dass diese Kurzgeschichte tatsächlich einen realen Bezug zur Herkunft des Elfenbeins haben sollte, aus dem Masanao dieses Netsuke geschaffen hatte. Aber wenn sie die rein logische Bewertung der Sachlage ignorierte, räumte sie intuitiv ein, dass an dieser Geschichte vielleicht doch etwas dran sein könnte. Irgendeine Verbindung musste es geben, schließlich hatte jemand jene Schatulle anfertigen lassen, um genau diese Schnitzerei zusammen mit genau diesen Schriftstücken, unter anderem dem Dokument mit der Überschrift ›Tod in Afrika‹ als eine Einheit aufzubewahren.
Die merkwürdige Erzählung war Tomomi, während sie mit Marco schweigsam vor der Wandvitrine stand, wieder sehr präsent. Es kam ihr fast beängstigend vor, dass der Inhalt dieses Dokuments mit der Datumsangabe ›Fünfter Mai 1986‹ so perfekt mit ihren neuesten Forschungsergebnissen übereinstimmte. Damals beim ersten Lesen hatte sie sich anfangs ein süffisantes Schmunzeln aufgrund des etwas schwülstigen Schreibstils und der blumigen Darstellung nicht verkneifen können. Das Ende allerdings ernüchterte sie und der letzte Satz wirkte wie ein kleiner Schock.
Tod in Afrika
Er strotzte vor Kraft und strahlte Gelassenheit und Zielstrebigkeit aus, als er den durch Felsen verengten Eingang des ausgetrockneten Flussbetts passierte. Aber sein Leben sollte hier bald ein Ende finden.
Die Herde, in der er vor vielen Jahrzehnten aufgewachsen war, hatte ihn bereits im Alter von acht Jahren verstoßen, also lange vor der für die Separierung von Jungbullen üblichen Zeit. Denn er war anders. Er war viel größer und kräftiger als seine Altersgenossen und überragte schon in jungen Jahren die ausgewachsenen Elefanten in seiner Herde. Seine Haut war fast rosa-weiß, was ihn im dichten, grünen Dschungel an den Ufern des großen Flusses, den man später Volta nennen sollte, wie einen Fremdkörper wirken ließ. Seine Augen, die mit deutlich verminderter Sehkraft ausgestattet waren, funkelten blutrot aus dem unförmigen hellfarbenen Kopf. Der Schädel war bei dem Jungtier grotesk erhöht im Vergleich zu seinen Spielgefährten, die eigentlich keine waren für ihn – er blieb von Anfang an ein Einzelgänger und wurde ausgegrenzt von einer artspezifischen Sozialisierung im Herdenverbund. Im Gegensatz zu den anderen besaß er nur einen einzigen wirklichen Stoßzahn, aber was für einen! Während der linke verkümmert und kaum eine Handspanne lang war, ragte der rechte schon bald über einen Meter aus seinem mächtigen Oberkiefer heraus und zwang seinen jungen Nacken, sich immer wieder und immer tiefer zu beugen. Im dichten Wald war dies anfangs ein Problem für den rasch heranwachsenden Jungbullen, denn sein sperriger Stoßzahn verfing sich oft in den Schlingpflanzen und im Unterholz, zumal er leicht nach außen gebogen war, nicht wie bei seinen Artgenossen nach innen. Während diese sich flink und problemlos durch den Urwald bewegen konnten, musste er sich halbblind seinen Weg mit brachialer Gewalt durch das Dickicht bahnen, um mit ihnen Schritt zu halten. Doch mit wachsenden Kräften und seltsam geschärften anderen Sinnen für seine Umgebung gelang ihm dies zunehmend besser.
So wenig wie ihn die Natur bei der Geburt begünstigt hatte, als sie ihn mit derartigen genetischen Absonderlichkeiten versah, so wenig meinte es auch das weitere Schicksal gut mit ihm. Noch keine fünf Jahre alt verlor er seine Mutter und Tanten durch einen verheerenden Waldbrand, der die halbe Herde in Panik in einen Abgrund stürzen ließ. Nachdem er so auf einen Schlag seine direkte Protektion und sein vertrautes Habitat verloren hatte, war es nur eine Frage weniger Jahre, bis die Herde ihn vollends ausgrenzte und er schließlich seiner eigenen Wege ging.
Es war jedoch nicht nur dieser Gruppendruck, der auf ihm lastete. Da wirkten auch seltsame Antriebskräfte in seinem Innern, die ihn auf die äußeren Umstände plötzlich und willig eingehen ließen. Vielleicht könnte man das, was in seinem Körper und Gehirn vorging, mit den geheimnisvollen Sinnen und Leitprozessen von Zugvögeln vergleichen. Oder mit jenen von Fischen, die – durch Instinkte und uralte Prägungen getrieben – zu fernen Laichplätzen aufbrechen, an denen die Vorfahren einst geboren worden waren. Es zog den Elefanten nach Osten, immer weiter nach Osten.
Seine Wanderung dauerte über siebzig Jahre, immer weiter und weiter getrieben, der aufgehenden Sonne entgegen. Er durchquerte auf seiner von höheren Kräften bestimmten Wanderschaft schier endlose Wälder, durchschwamm unzählige Flüsse und Seen und zog seine deutliche Spur schließlich durch nicht enden wollende Savannen und Trockengebiete. Weder er noch ein anderes Wesen hätten nachvollziehen können, wie viele und dramatische Abenteuer er in dieser Zeit erlebte. Dies alles blieb nicht in seiner eingeschränkten Erinnerung festgehalten, sondern wäre nur mit Fantasie aus den zahlreichen Narben in seiner außergewöhnlichen hellen Haut erahnbar gewesen.
Und nun sollte sich also sein Lebenskreis schließen, seine lange Wanderschaft ein Ende finden.
Die etwa zwanzigköpfige Jagdgruppe vom Stamm der Mbuti aus der Untergruppe der Efe folgte den Spuren des riesigen Albino-Elefanten schon seit mehreren Wochen. Sie waren wie versteinert gewesen, als sie ihm plötzlich auf einer Lichtung im dichten Wald gegenüberstanden. Er verschwand wie ein Geist, noch bevor einer von ihnen aus der Erstarrung erwachte. Sein einziger Stoßzahn musste über drei Armspannen lang sein und seinen Rücken hätten wohl auch drei übereinandergestellte Jäger nicht erreicht – es war ein unglaublicher Anblick für die kleinen Menschen. Von diesem Moment an waren ihre Gedanken nur noch auf diesen Geisterelefanten fokussiert und sie folgten seiner Fährte, als würde ihr Überleben davon abhängen. Zeit bedeutete ihnen genauso wenig wie ihrer Jagdbeute, denn diese Jagd war die bedeutendste spirituelle Handlung, die jemand aus ihrem Volk je unternommen hatte.
Es war ungewöhnlich für diese ethnische Gruppe von Pygmäen, deren Ursprünge am Oberlauf des Flusses Kongo lagen, sich so weit von ihrem eigenen Stammesgebiet zu entfernen. Normalerweise fanden die Jagdzüge räumlich stets im engeren Umland des Sippenverbandes statt, auch wenn sie mehrere Wochen dauern konnten. Doch diese spezielle Untergruppe der Efe hatte ihre angestammten Jagdgründe bereits vor drei Generationen den überlegenen Bantu-Stämmen überlassen müssen und war in eine weniger wildreiche Gegend weit im Osten am Fluss Bahr Al Arab verdrängt worden. Von dort war der kleine Stammesverband später weiter nach Südosten gewandert, bis an die Ufer des Naivasha Sees. Viele ihrer originären, von den Ahnen übernommenen Riten und Lebensweisen hatten sich im Lauf der Zeit verändert und die daher in vieler Hinsicht entwurzelten Efe passten sich den neuen Rahmenbedingungen auf bestmögliche Weise an.
Elefantenjagd war für die kleinwüchsigen Waldmenschen früher ein absolutes Tabu, denn sie waren aus tiefer Spiritualität heraus unfähig, Nahrung zu verschwenden. Die Fleischmenge eines erlegten Elefanten hätte aufgrund nicht vorhandener Konservierungsmethoden somit einen Tabubruch ohnegleichen dargestellt. Doch in diesem Fall lagen die Dinge völlig anders. Eine der wenigen Überlieferungen, die die Vertreibungen überlebt hatten, wurde plötzlich zur greifbaren Realität.
In den traditionellen Jagdgesängen der Mbuti wurde die Erscheinung eines riesenhaften weißen Elefanten mit nur einem Stoßzahn vorausgesagt und mit ihm der Beginn einer neuen, glücklichen Zukunft für ihr Volk. Diese Stammes-Legende, die schon den Kleinsten am Lagerfeuer erzählt und so über viele Generationen lebendig gehalten wurde, beschrieb sehr genau, wie die Jagd enden würde und welche weiteren Schritte erforderlich wären, um ihnen den Geist des getöteten weißen Elefanten wohlgesinnt zu machen. Das Schicksal des Stammes solle sich damit für immer zum Guten wenden. Fern gen Sonnenaufgang würden die erfolgreichen Jäger einen fremden Stamm finden, am Rand des östlichen Salzmeeres. Hochgewachsene weißhäutige Menschen mit langen Bärten und weißen Gewändern, die auf riesigen schwimmenden Häusern sogar das unendliche Wasser am Rande der Welt bereisten. Deren Medizinmann sollte nach der Überlieferung als einziger in der Lage sein, die erforderlichen Opferriten mit dem Stoßzahn des weißen Elefanten richtig durchzuführen und die Efe als Heilsbringer wieder nach Hause zu senden. Dort würde man ihren Mut und ihre Geschicklichkeit loben und die siegreiche Jagd überall laut verkünden, sodass sogar die mächtigen Bantu erzitterten und ihr Stamm wieder in die eigenen Wälder zurückkehren konnte.
Doch noch war es nicht soweit, auch wenn alle Gedanken der Jagdgruppe trotz der Entbehrungen der letzten Wochen nur um dieses eine Ziel, die Erlegung und Opferung des sagenhaften weißen Elefanten, kreisten.
Sie hatten ihn in den vielen Tagen nach der ersten Begegnung nur noch ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, am gegenüberliegenden Ufer eines breiten Flusses kurz vor Sonnenuntergang. Die Jäger sahen wieder deutlich seine ungewöhnliche Hautfarbe, seine Größe und einige körperliche Entstellungen, die für sie weitere Zeichen höherer Spiritualität waren. Aber der Elefantenbulle war an diesem Tag für sie unerreichbar. Am nächtlichen Lagerfeuer besangen sie leise und in Ehrfurcht ihre Vision und beschlossen, die unausweichliche Jagd zum prophezeiten Ende zu führen, wie lange und wie weit sie sie auch noch führen möge.
Das Objekt ihrer Gedanken ahnte nichts von dieser Bedrohung durch die kleinen Zweibeiner. Die Augen des Albino-Elefanten waren in den letzten Jahren deutlich schwächer geworden und auf seine Instinkte war kein Verlass mehr. Auch sein Geruchssinn hatte ihm in den letzten Wochen seiner Wanderung nie die drohende Gefahr signalisiert. Stets standen die Winde zu seinen Ungunsten, wie hätte es anders sein sollen. Dass die Jäger ihn trotzdem nicht einholten, sondern seit Wochen immer einige Stunden hinter ihm seiner unübersehbaren, breiten Spur folgten, lag wohl nicht an einem konkreten Fluchtinstinkt. Es lag eher an der ihm eigenen inneren Unruhe, die ihn schon seit Jahrzehnten antrieb und die von Jahr zu Jahr zu höherer Geschwindigkeit und größeren Tagesstrecken anspornte. Vielleicht war dem Elefanten aber tief im Inneren auf unerklärliche Weise bewusst, dass das Ende seiner langen Reise nahte.
Zwei weitere Wochen später war es soweit: Eine steile Schlucht versperrte ihm den Weg nach Osten. Sein Versuch, diese zu umgehen, führte ihn in ein kleines Trockental, das sich als Sackgasse erwies und dessen steile Felswände für den Koloss nicht zu erklettern waren. Er drehte also wie schon so oft in seinem Leben um und stand auf dem Rückweg seinen Verfolgern erstmals bewusst gegenüber. Die instinktive Flucht zurück in das Wadi konnte ihn nicht retten. Die Jagdgruppe folgte ihm vorsichtig und als ihnen klar wurde, dass es hier kein Entkommen mehr für ihn gab, begann man in Ruhe und mit viel Routine eine Fallgrube am engen Eingang des Wadi auszuheben. Ein anderer Teil von ihnen hielt die wertvolle Beute am Ende des Canyon in Schach. Sie errichteten Lagerfeuer quer durch das Tälchen, welche den Elefanten daran hinderten, durch ihre Reihen zu brechen. Einen Tag später ließen sie diese Feuer erlöschen und hetzten ihn mit viel Geschrei und von oben auf ihn herab geworfenen brennenden Büschen. Als er auf seiner panischen Flucht unausweichlich in die mit dürren Baumstämmen, Zweigen und Gras abgedeckte Fallgrube einbrach, durchstachen die mutigsten von ihnen mit ihren Lanzen seine Fußsehnen und fügten ihm mehrere große Wunden am Körper zu. Es dauerte noch drei lange Tage und Nächte, bis er an seinen Wunden verendete und kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Aber die entsetzlichen Trompetenstöße, die erst in der dritten Nacht langsam erstarben, sollten ihnen allen nie mehr aus dem Gedächtnis weichen.
Keiner sah die roten Augen erlöschen, die wie kein anderes Elefantenauge zuvor den afrikanischen Kontinent von weit im Westen bis weit im Osten gesehen hatten. Keiner von ihnen konnte ahnen, dass dies nicht nur das Ende der langen Wanderung dieses einzigartigen riesigen Albino-Elefanten war, sondern auch der Beginn der noch viel größeren Reise von etwas, was erst lange später aus der Spitze seines Stoßzahns erschaffen werden würde: einem Adler mit seiner Jagdbeute.
Unter Beobachtung
Tomomi und ihr Chef verweilten einige Minuten vor der Vitrine und sahen das Adler-Netsuke sinnierend, fast zärtlich an, denn keiner von ihnen konnte sich dem Zauber entziehen, der sich gerade wieder entfaltet hatte. Sie tauschten dann, etwas krampfhaft bemüht, einige Ideen zu dessen möglicher Verbindung mit dieser mysteriösen Geschichte aus. Es war, als wollten sich beide von der seltsam magischen Ausstrahlung des Netsuke befreien, indem sie bewusst rein logische Gedankengänge entwickelten. Als Wissenschaftler sträubte sich vieles in ihnen gegen dieses Gefühl des Übersinnlichen, das von dem kleinen Adler ausging. Schließlich brach Marco die wenig fruchtbaren Spekulationen ab.
»Tomomi, sei so nett und ruf für vierzehn Uhr das Projekt-Team zusammen. Wir treffen uns direkt in der Lounge vor dem Konferenzraum VR-16.009-A auf Ebene U-16, du weißt schon, ›The Wall‹. Bitte alle und bitte pünktlich. Ich will euch einige wichtige Infos geben, die ich bislang aus guten Gründen zurückgehalten hatte. Ihr könnt gespannt sein, es wird euch gefallen!«
Tomomis Pupillen weiteten sich und die gerade etwas abgeklungene Erregung brach wieder in ihr aus. Ein Meeting in jenem High-Tech-Besprechungsraum, von dem sie als ›The Wall‹, also ›Die Wand‹ schon so viel gehört hatten. Es blieb keine Zeit für eine neugierige Nachfrage, die ihr auf den Lippen lag, denn Marco war bereits aus dem Raum geeilt. Sie hörte ihn draußen im Vorzimmer noch kurz einige Anweisungen an Claudia erteilen, die soeben ihr Büro betreten hatte, und schon war er weg.
Zur gleichen Zeit stand etwa zwei Kilometer von ihrem Standort entfernt ein Mann an der Fensterfront des Penthouse, in der obersten Etage des Tamagi-Towers. Er war schlank, hochgewachsen und strahlte mit seinem fast weißen Bürstenhaarschnitt und den markanten, hart wirkenden Gesichtszügen Stärke und Macht aus. Sein Blick war starr in Richtung des UNTACH-Geländes gerichtet. Hätten die beiden Wissenschaftler dort von seiner Existenz und seinen Gedanken gewusst, hätte sie dies sicherlich in noch größere Verwirrung gestürzt als jene, in der sie schon jetzt waren. Denn das Objekt seiner Gedanken und Sehnsüchte war exakt jenes Netsuke mit der Signatur ›Masanao‹, das bei ihnen in der Wandvitrine lag. Diese kleine Elfenbein-Schnitzerei war seit einigen Jahren im Fokus vieler seiner Überlegungen und Aktivitäten.
Im Gegensatz zu den beiden UNTACH-Wissenschaftlern war für Yamagata Aritomo das Adler-Netsuke allerdings unerreichbar. Er kannte es sehr genau durch diverse Zeichnungen und Fotografien sowie zahlreiche Texte und Expertisen, hatte es jedoch nie im Original gesehen oder in seinen Händen gehalten. Es war ihm aber aus den Erzählungen und eindringlichen Anweisungen seines Vaters sehr vertraut. Alle die damals für ihn als kleinem Jungen zwar spannenden, aber wie Märchen erscheinenden Geschichten lagen nun, ein halbes Jahrhundert später, wie in einem undurchdringlichen Nebel diffuser Erinnerungen. Als sein Vater viel zu früh verstarb, er selbst war damals gerade vierzehn Jahre alt, erlosch für immer die Chance, ihn näher zu diesem Thema zu befragen. Aber unbewusst war in seinem Verstand verankert, dass dieses Netsuke ein Geheimnis barg, das er entschlüsseln musste, wollte er seinen Seelenfrieden finden.
Doch es kamen zunächst viele Jahre voller anderer Pflichten und die Kindheitserinnerungen an das Familienerbstück blieben in Yamagata verschollen. Dann wurde ihm vor vier Jahren anlässlich seines sechzigsten Geburtstags völlig überraschend durch den Anwalt der Familie ein Nachtrag zum Testament seines Vaters übergeben, so wie es dieser im Jahr 1985, ein Jahr vor seinem Tod verfügt hatte. Der Inhalt dieses testamentarischen Dokuments, zu dem ein Notizbuch und eine Dokumentenmappe mit historischen Zeichnungen und Plänen gehörten, bewegte ihn zutiefst. Von jenem Moment an wurde aus einer vagen Erinnerung eine Passion, mit einer für ihn hohen persönlichen Priorität.
Yamagata Aritomo zwang sich dazu, die immer wieder nach vorne drängenden Gedanken an seine Familiengeschichte und an das Masanao-Netsuke für einige Minuten auszublenden und seinen Blick vom UNTACH-Komplex abzuwenden. Er ließ seine Augen stattdessen bewusst über die Stadt zu seinen Füßen schweifen. Obwohl er so oft hier oben gestanden hatte, genoss er den grandiosen Ausblick aus seinen Privaträumlichkeiten in vierhundertfünfzig Metern Höhe auf die Skyline von Peking immer wieder aufs Neue. In den sieben Etagen unter dem Penthouse befanden sich die Büros, das Kommunikation- und Logistikzentrum sowie diverse Konferenzräume und Gästesuiten der chinesischen Tochterfirma des japanischen Tamagi-Konzerns, den er als Vorstandsvorsitzender seit fast zwanzig Jahren leitete.
Er liebte es, möglichst viel Zeit hier in der Hauptstadt Chinas zu verbringen, jener Stadt, die nicht nur nach seiner eigenen Bewertung zunehmend die Schaltzentrale der Weltwirtschaft darstellte. Yamagata hatte außerdem eine ganz besondere persönliche Verbindung zu Peking. Insbesondere zu jenem Areal, das sich nicht allzu weit von seinem Domizil entfernt durch eine riesige Grundfläche und verhältnismäßig geringe Höhe aus dem Meer der Wolkenkratzer abzeichnete: dem UNTACH-Komplex. Wieder wurde sein Blick von dessen flachen Konturen gefesselt und die ständigen Gedanken an das Netsuke waren sofort wieder präsent.
Ein leichtes Lächeln glitt über seine Züge, als er sich vorstellte, dass dort in diesem Moment Doktor Marco Renke an der Lösung seiner Probleme arbeitete, ohne dies zu wissen. Inzwischen mussten Renke sicher die Analyseergebnisse aus Grenoble vorliegen, deren Kopie samt Übersetzung der Kernaussagen ins Japanische er selbst bereits seit zwei Stunden auf seinem Schreibtisch hatte. Zunächst war Yamagata enttäuscht gewesen von den dort enthaltenen Informationen, denn sie stellten für seine eigentlichen Ziele keinen wirklichen Fortschritt dar. Doch andererseits gab ihm die Vorgehensweise von Marco Renke die Gewissheit, dass dieser sich wie erhofft mit Kompetenz seinem Forschungsauftrag widmete. Der Japaner fühlte sich bestätigt, dass man mit diesem Wissenschaftler die richtige personelle Wahl getroffen hatte.
Yamagata war ein mächtiger Mann, der es seit jungen Jahren gewohnt war, Menschen zu manipulieren und Strategien zum Nutzen seiner Familie und seiner Firma zu entwerfen sowie konsequent umzusetzen. Genauso fokussiert und klug, wie er als Konzernlenker agierte, hatte er jene privaten Pläne geschmiedet und auf den Weg gebracht, die ihm mit zunehmendem Alter mehr als alles andere am Herzen lagen. Die aktuelle Forschungsarbeit dieses Deutschen dort drüben bei UNTACH spielte hierbei eine Schlüsselrolle.
Das UNTACH war vor fünfzehn Jahren von den Vereinten Nationen in dem gigantischen, einst für militärische Zwecke künstlich geschaffenen unterirdischen Kavernensystem am nördlichen Stadtrand von Peking offiziell eröffnet worden. Bereits ein Jahr später konnten die ersten Exponate in den perfekt ausgebauten Archiven eine neue Heimat finden. Die Regierung Chinas hatte viele Jahre vorher den für diesen neuen Nutzungszweck optimalen Umbau der weitläufigen Militäranlage sichergestellt. Zum richtigen Zeitpunkt unterbreitete man der Weltgemeinschaft ein gut vorbereitetes Angebot: Hier wolle man zum Wohle der gesamten Menschheit ein umfassendes und einzigartiges internationales Archiv und Forschungszentrum für das Weltkulturerbe einrichten und auch langfristig substanziell mitfinanzieren. Dieses Konzept fand rasch die erforderlichen Mehrheiten in den Entscheidungsgremien der UNO und ihrer Mitgliedsländer. Das gigantische Projekt ging über die Dimensionen der größten nationalen Museen weit hinaus und stellte auf dem Weg der politischen und kulturellen Annäherung der westlichen und asiatischen Machtblöcke einen wichtigen verbindenden Schritt dar.
Die überwiegende Mehrheit der Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler, Konservatoren und Museumsexperten begeisterte sich längst für die Vision eines zentralen globalen Horts für eine möglichst umfassende Archivierung und Sicherung kultureller Menschheitserzeugnisse. In den vergangenen drei Jahrzehnten waren durch Naturkatastrophen, Terror und Kriege auf fast allen Kontinenten zunehmend wertvollste Kulturgüter vernichtet worden. Daher fand sich schließlich eine breite politische und gesellschaftliche Basis für einen solchen gemeinsamen Schritt.
Exquisite und repräsentative Belegstücke aus praktisch allen Kunst- und Kulturbereichen und Epochen wurden daraufhin weltweit ausgewählt und sukzessiv in die Obhut der neuen Einrichtung transferiert. Innerhalb weniger Jahre entstand ein noch nie zuvor so umfassend an einem einzigen Ort versammelter Fundus an Originalobjekten sowie relevantem Quellenmaterial.
Sowohl das Gebäude selbst als auch alle wissenschaftlichen Einrichtungen des UNTACH wurden nach höchsten musealen und wissenschaftlichen Standards realisiert und ein neues Mekka für über Kunst und Kulturgut forschende Wissenschaftler aus der ganzen Welt entstand in Peking. Da UNTACH keine der Öffentlichkeit zugängliche Ausstellung war, sondern eine reine Archiv- und Forschungseinrichtung mit sehr restriktiven Zugangsregelungen, konnten umfassende Schutzmaßnahmen getroffen werden, wie sie in Museen in der Regel unmöglich waren.
Dieses einzigartige wissenschaftliche Zentrum entsprach den gleichen Sicherheitsstandards wie in Militärzentralen von Supermächten, den Lagerorten nationaler Goldreserven oder der UNO-Zentrale in New York. Etwa sechzig Prozent der Räumlichkeiten lagen über zweihundert Meter tief unter der Oberfläche und nur weniger sensitive Bereiche waren in den oberirdischen Gebäudeteilen untergebracht. Hier befanden sich zum Beispiel die Quartiere des Personals, Sportanlagen, vielfältige Tagungs- und Sitzungsräumlichkeiten sowie diverse Shopping- und Vergnügungseinrichtungen. Die strikten Zugangsregelungen, Kommunikationsstrukturen, Dienstleistungskonzepte und Versorgungssysteme waren auf einem noch nie erreichten technischen Niveau. Der UNTACH-Komplex war praktisch autark und mit einer perfekten Infrastruktur ausgestattet.
Das Personalkonzept sah in Relation zum gigantischen Umfang der Sammlungen ein vergleichsweise kleines Stammpersonal von etwa neuntausend überwiegend technischen und administrativen Arbeitskräften vor. Der größte Teil der eigentlichen Facharbeit im UNTACH, von der Auswahl und umfassenden Dokumentation über die Konservierung und Archivierung bis zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Sammlungsbestände erfolgte durch tausende Gastforscher aus aller Welt. Diese mussten während ihrer Zeit bei UNTACH fast durchgängig vor Ort im Gebäudekomplex logieren, da das komplizierte und zeitaufwändige Zugangsprocedere für ein tägliches Pendeln von innen nach außen und umgekehrt nicht praktikabel war. Hier war quasi abgeschottet von der Megastadt Peking eine eigene, futuristische Stadt entstanden!
Für die Kunstobjekte selbst war die Entscheidung über ihre Aufnahme in die Sammlung in der Regel eine Einbahnstraße. Einmal archiviert, würden sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nie mehr diese kulturelle Schatzkammer verlassen, sondern künftig ausschließlich innerhalb des UNTACH interessierten Experten für Studien- und Forschungszwecke zur Verfügung stehen. Der Zugang zu den Sammlungen basierte auf einem sehr restriktiven Auswahlverfahren durch international besetzte Fachgremien und sah nur eine zeitbegrenzte und räumlich selektive Zutrittserlaubnis vor.
Genau diese Hürde musste Yamagata Aritomo für seine Pläne überwinden, denn in diesem Gebäude befanden sich Informationen, die selbst für ihn mit seinen weitreichenden Möglichkeiten seit der Einlieferung des Masanao-Netsuke ins UNTACH-Archiv unerreichbar geworden waren. Aber er war davon überzeugt, dass ihm mit Doktor Marco Renke und dessen Forschungsteam die perfekte Lösung seiner Probleme gelingen würde, ohne unnötige Risiken und auf höchst elegante Weise.
The Wall
Als Marco kurz vor vierzehn Uhr den Empfangsbereich vor dem Sitzungsraum VR-16.009-A erreichte, saß sein komplettes Team bereits in der kleinen, luxuriös ausgestatteten Lounge. Er erfasste mit einem Blick, dass sie wohl schon eine Weile hier versammelt waren, wie man an den diversen ausgetrunkenen Gläsern und den dezimierten Resten verschiedener Snacks auf ihren Tellern sah. Sie waren sichtlich aufgekratzt in eine angeregte Diskussion vertieft und er musste schmunzeln, weil er sich sehr gut in ihre Lage versetzen konnte. Dreißig oder vierzig Jahre zuvor hätte er noch ähnlich empfunden und sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in so exklusiver Atmosphäre die Vorfreude auf ein besonderes Erlebnis zu genießen.
Seine Mitarbeiter waren bis auf eine Ausnahme noch verhältnismäßig jung, jedenfalls im Vergleich zu ihm selbst und zum sonst üblichen Altersdurchschnitt auf dem UNTACH-Gelände. Aber jeder einzelne von ihnen besaß sehr spezielle Kompetenzen und Stärken, aufgrund derer er sie in dieser Konstellation ausgewählt hatte. Und vor allem: Sie harmonierten miteinander und ergänzten sich zu einem kreativen und leistungsfähigen Team.
Da war Doktor Frank Kramer, vierunddreißig Jahre alt, deutscher Kunsthistoriker mit Schwerpunkt Asiatika des achtzehnten Jahrhunderts, der sich nach seiner Magister-Arbeit auf japanische Volkskunst spezialisiert hatte. Er arbeitete neben seinen Studien seit fast zehn Jahren freiberuflich für verschiedene Auktionshäuser und Museen, sowie in letzter Zeit fallweise als Lektor für einen Fachverlag. Frank hatte erst vor einem Jahr an der Tongji Universität in Shanghai seine Promotionsarbeit über Handwerksgilden und Meisterschulen der Edo-Zeit abgeschlossen. Er verfügte über exzellentes Quellenwissen und ein feines Händchen, wenn es um das Auffinden und Auswerten sogenannter ›grauer Literatur‹ ging – also von Dokumenten, die nicht leicht oder gar nicht in den gängigen Datenbanken oder Bibliotheken zu finden waren. Da er seit seinem neunzehnten Lebensjahr in China gelebt hatte, sprach er ausgezeichnetes Mandarin-Chinesisch, besaß solide Kenntnisse in Japanisch und kam auch mit einigen veralteten ostasiatischen Schriftzeichen-Systemen zurecht. Frank war ein sehr zurückhaltender Typ, eher wortkarg, der wenig Privates von sich preisgab. Der gebürtige Hamburger blieb gerne im Hintergrund, was rein physisch bei seinem massigen Körper und über zwei Meter Größe nicht immer einfach war, weil er optisch überall herausragte. Aber er war bei aller Zurückhaltung nicht ungesellig und verblüffte seine Umgebung oft mit einem originellen, erfrischenden Humor.
Ganz anders wirkte Rebecca El Rouni. Die zierliche siebenundzwanzigjährige Tunesierin mit zusätzlicher französischer Staatsbürgerschaft war verbal und mit ihrer ausdrucksstarken, manchmal fast theatralischen Gestik der Wirbelwind im Team. Dieses Energiebündel riss sie alle immer wieder mit, selbst bei Themen, die eigentlich eher trocken waren. Mit ihrer gazellenhaft schlanken und sportlichen Figur und dem ungebändigten schwarzen Lockenkopf, der ihr hübsches Gesicht umrahmte, war sie eine echte Schönheit. Sie hatte einen Bachelor-Abschluss als Bibliothekarin, erworben von der Fern-Universität Hagen und einen Master der niederländischen Open Universiteit Nederland im Spezialgebiet Datenbankarchitektur. Rebecca war im Team außerdem die beste IT-Expertin, die mit Suchmaschinen, interaktiven Datenbank-Systemen und Recherche-Algorithmen so virtuos umging, dass es ihnen allen vom Zuhören und Zusehen fast schwindelig wurde. Sie sprach Arabisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch, denn als Tochter eines EUDiplomaten hatte sie trotz ihrer Jugend bereits in sechs Ländern gelebt. Mit ihrem angeborenen Enthusiasmus, gewinnenden Wesen und ihrer interkulturellen Kompetenz war sie zudem, wenn auch noch ohne jegliche praktische Berufserfahrung, die optimale Verbindungsperson zu anderen Arbeitsgruppen und Experten im Haus.
Das Team-Mitglied mit der längsten Berufserfahrung war die sechsundfünfzigjährige Claudia Mentrose, eine großgewachsene Amerikanerin mit deutsch-britischen Wurzeln. Mit ihrem ausdrucksstarken, markanten Gesicht, der rotblonden Mähne und ihrer muskulösen Statur wirkte sie auf manche wie eine nordische Kriegsgöttin. Sie hatte über dreißig Arbeitsjahre im Bereich Informationsbeschaffung und -archivierung einer der CIA zuzuordnenden Behörde an verschiedensten Standorten der Welt verbracht, unter anderem zehn Jahre lang in Berlin. Die letzten vier Jahre ihrer aktiven Berufstätigkeit war sie in der Zentrale in Langley als zweite Referentin des stellvertretenden Direktors tätig. Nachdem sie vor drei Jahren ihre Stellung dort aufgrund einer Umstrukturierung verloren hatte, setzte sie sich zur Ruhe und lebte seither in der Schweiz im schönen Urlaubsort Davos. Finanziell unabhängig war sie aufgrund einer vorteilhaften Scheidung sowie einiger gewinnbringender Börsenanlagen schon lange. Eigentlich wollte sie diese Unabhängigkeit und die reichliche Freizeit nutzen, um einen Roman zu schreiben, in dem sie ihre schillernden Lebenserfahrungen gleichermaßen spannend wie amüsant aufbereitete. Dies stellte sich jedoch rasch bei Berücksichtigung ihrer lebenslang wirksamen Geheimhaltungsauflagen als unmöglich heraus und machte ihren schriftstellerischen Ambitionen ein Ende. Am Schreiben rein fiktiver Prosa hatte Claudia kein Interesse. Es sollte schon etwas Dokumentarisches sein, was mit ihrem Leben oder zumindest realen Hintergründen zu tun hatte. Also war sie seit zwei Jahren in gewisser Weise auf neuer Sinnsuche und das Angebot, bei Marcos Projekt einzusteigen, kam ihr gerade recht. Die ehemalige Geheimdienstlerin war der organisatorische Ruhepol und Kommunikationsangelpunkt im Team. Sie besaß bei ihren ›manchmal leicht verpeilten Wissenschaftler-Kreativen‹, wie sie es scherzhaft nannte, einen immer wieder hilfreichen ordnenden Einfluss und wurde von ihnen als Respektsperson geschätzt.
Tomomi Kasai schließlich komplettierte das Team als jüngste Mitarbeiterin. Die vierundzwanzigjährige Japanerin hatte gerade mit Auszeichnung an der Technischen Universität in München ihren Abschluss in Analytischer Chemie gemacht. Ihre Master-Arbeit war nicht experimenteller Natur, sondern stellte anhand einer prägnanten Zusammenstellung und Bewertung unterschiedlichster Analysemethoden eine wertvolle Entscheidungshilfe für die Bereiche Kulturgüterschutz und Museumstechnologie dar. Auf der Basis ihrer theoretischen Ausarbeitung hatten Konservatoren und Kustoden einen hervorragend strukturierten Leitfaden zur Hand, um für unterschiedlichste Materialien an Kunstgegenständen und Kulturgütern die optimalen Beprobungstechniken und Untersuchungsmethoden auszuwählen.
Das lebhafte Geplauder seiner Mitarbeiter ebbte sofort ab, als Marco Renke die Lounge betrat, und er hatte ihre volle Aufmerksamkeit.
»Okay, Leute! Dann ist jetzt der große Augenblick da. Hat jemand eine CD von Pink Floyd mitgebracht, damit wir uns drinnen angemessen einstimmen können?«





























