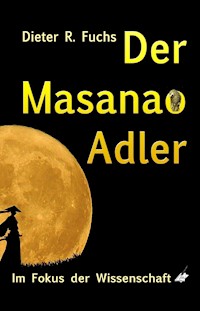Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: fabulus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Japanische Kunst und "der Blaue Reiter": eine Frau im Sog der Zeit......die junge Kunsthistorikerin Sandra Haas hat genug von flüchtigen Affären und faulen Kompromissen. Sie kippt ihre Promotion und wendet sich einem ausgefallenen Thema zu: dem Einfluss japanischer Kunst auf Franz Marc und Carl Fabergé. Ohne es zu ahnen, beschwört sie damit uralte Mythen auf. Sowohl der Maler als auch der Hochjuwelier des Zaren waren fasziniert von Miniaturschnitzereien aus Japan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2015 by Tanja Höfliger
Lektorat: Marion Voigt, www.folio-lektorat
Umschlaggestaltung: r Quadrat Röger-Röttenbacher
Satz und E-Book-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-944788-35-7
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.fabulus-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Reset
Liebesdienste
Schwabinger Erwachen
Im Tabakladen an der Türkenstraße
Jamsession
Glückliche Fügung
Das Reh im Klostergarten
Zerplatzende Seifenblasen
Aufbruch ins Ungewisse
Im Blauen Land
Der Mai der Erwartungen
Déjà-vu
Himmelstränen
Wandlungen
Sphärenwechsel
Mondwunder
Emotionale Annäherung
Feldpost
Gefühlschaos
Im Bauhaus Weimar
Vereinigung
Am Lago Maggiore
Schelmenmythos
Befreiung aus der Gruft
Rückschläge
Gefühlte Nähe
Epilog
Nachbemerkung
Netsuke – zu ihrer Bedeutung in der japanischen Volkskunst
Prolog
Sie hasste sich dafür. Weil es ihr immer wieder passierte. Und vor allem weil es ihr immer wieder mit derselben Sorte Mann passierte.
Sandra Haas blieb stoisch unter dem eiskalten Guss von oben stehen, obwohl sie bereits vor Kälte zitterte. So machte sie es immer, wenn es mal wieder so weit war. Sie stellte sich frühmorgens mit ihren vom Weinen verquollenen Augen und vom unruhigen Schlaf zerdrückten Haaren unter die Dusche, begann mit lauwarmem Wasser, drehte dann die Heißwasserzufuhr stetig zurück und das Kaltwasser gleichzeitig langsam auf und bestrafte sich so für ihre Dummheit, bis ihr ein kräftiger Schüttelfrost klarmachte, dass es nun genug sei.
Wie konnte man mit fünfundzwanzig noch so unverzeihlich blöd sein? Dieser Typ war doch schon optisch die Kopie ihrer früheren Macker gewesen! Wie konnte sie schon wieder verdrängt haben, dass diese gelackten, aalglatten und zu gut aussehenden Kerle in ihren Designerklamotten, mit ihrem gekünstelt weltmännischen Gerede und ihrer aufgesetzten pseudo-souveränen Art irgendwie alle austauschbar waren und nichts taugten? Oder lag es gar nicht an denen, sondern an ihr selbst? War sie einfach zu dumm, Menschen richtig einzuschätzen? Zu oberflächlich? Zu anspruchslos bei neuen Bekanntschaften? Sie wusste es nicht und genau diese Ungewissheit machte sie richtig wütend. Auf alles und alle, aber vor allem auf sich selbst!
Sie drehte das Wasser ab, ging nackt und noch nass zurück ins Schlafzimmer, warf sich den Bademantel um und trat barfuß hinaus auf ihren winzigen Balkon. Der Boden und die leeren Pflanztröge waren mit Schnee leicht bepudert, ein kalter Wind pfiff um die Ecken und sie nahm nur ein paar tiefe Züge von ihrer Zigarette. Dann warf sie den Stummel angewidert über die Brüstung, trat wieder in ihr Drei-Zimmer-Apartment und setzte sich fröstelnd auf die Bettkante. Sie starrte auf die Spiegelfront des Kleiderschranks und hasste diese zugegebenermaßen schöne, aber anscheinend strohdumme Frau, die sie von dort zurück anstarrte. Vorwurfsvoll.
Dann bemerkte sie den Unterschied. Bei den früheren kleinen privaten Dramen nach dem Ende einer Beziehung hatte sie diesen Blick vor allem als erbärmlich, als leidend empfunden. Diesmal sah sie in die wütenden, entschlossenen Augen einer ganz anderen Person. Und sie nahm diese Veränderung nicht nur wahr, sondern auch für sich an. Ab jetzt würde sie ihr Leben wirklich ändern. Und sie würde sofort damit anfangen, noch am selben Tag, dem zehnten Dezember zweitausenddreizehn.
Reset
Drei Stunden später betrat eine langbeinige Blondine mit tief über den Rücken herabfallenden lockigen Haaren den Friseursalon in der kleinen Seitenstraße beim Odeonsplatz. Zwei weitere Stunden später verließ eine genauso langbeinige Rothaarige mit pfiffigem Kurzhaarschnitt denselben Ort, warf im Vorbeigehen einem Bettler am Straßenrand lässig zwei noch nicht angebrochene Schachteln Zigaretten zu und reihte sich in den schlendernden Strom der Passanten ein, der sich in Richtung Marienplatz bewegte. Im Friseursalon blieben ein üppiger Berg blonder Haare am Fußboden sowie eine noch immer leicht perplexe Friseurin am Fenster zurück. Dass sich jemand so drastisch neu stylte und damit auch optisch quasi auf den Reset-Schalter des persönlichen Betriebssystems drückte – genau so hatte sich diese resolute Kundin ausgedrückt –, kam nicht oft vor. Alles auf Anfang, ein echter Neustart sollte es werden. Aus einem kultiviert-eleganten Rauschgoldengel war eine flippige, fast androgyne Amazone geworden. Die Friseurin blickte ihrer Kundin durch das Schaufenster noch eine Weile bewundernd nach. Der provokante Schnitt und die knallige Haarfarbe passten wirklich zu dieser Person, die vor Entschlossenheit und Tatendrang zu sprühen schien. Eine Zeile aus dem Roman, den sie gerade las, kam der Friseurin in den Sinn: Als wäre ein schillernder Schmetterling endlich der Lähmung seines Puppenstadiums entschlüpft und flatterte nun lebensfroh über die bunte Blumenwiese des Lebens.
Als Sandra am nächsten Morgen das Gruppenbüro im Institut für Kunstgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität in der Zentnerstraße betrat, löste sie mit ihrem Auftritt bei ihrer Kollegin Julie ein mittleres Trauma mit fast gesundheitsgefährdenden Nebenwirkungen aus. Die kleine pummelige Französin sperrte völlig entgeistert den Mund auf und schlug sich mit einer theatralischen Geste beide Hände an die Wangen. Dann stand sie so heftig und ungeschickt auf, dass sie mit dem Oberschenkel an der Schreibtischplatte hängen blieb und einen hohen Stapel von Büchern und Akten ins Wanken brachte. Dieser kippte schließlich um und nahm auf dem Weg nach unten auch die große Vase mit dem Strauß roter Rosen mit. Der Krach, der beim Zersplittern des Porzellangefäßes auf dem Steinfußboden entstand, war gewaltig. Das Geräusch klang gefährlich zischelnd ab, denn das Wasser schwappte zielsicher auf die Mehrfachsteckdose neben dem Papierkorb und löste sofort einen prächtigen Kurzschluss aus, der dem Laserdrucker auf dem Beistelltisch ein leises Prasseln entlockte, bevor schließlich Ruhe eintrat. Dann wurde die Tür zum Nachbarraum heftig aufgestoßen und ein bärtiger schwarzer Wuschelkopf schaute vorsichtig um die Ecke:
»Was ist denn hier los, Erdbeben sind eigentlich in München eher …«
Als er Sandra erkannte, blieb auch Professor Dr. Wendland versteinert und mit offenem Mund stehen und fand erst einen Moment später seine Sprache wieder: »Ach, du meine Güte, hab’ ich jetzt gerade eine luziferische Erscheinung oder bist du das, Sandra?«
Als ihm dann die wütend aufblitzenden Augen im ansonsten vertrauten Gesicht seiner Doktorandin bewusst wurden, ergänzte er rasch: »… ich meine natürlich eigentlich: Wow, das nenn’ ich mal eine tolle Veränderung, das steht dir wirklich ausgezeichnet! Also unglaublich, du bist ja plötzlich ein vollkommen anderer Typ!«
Sandras Blick verlor etwas an Giftigkeit und während sie ihre Collegetasche betont vorsichtig auf ihrem Schreibtisch ablegte und ihren Wintermantel langsam an die Garderobe hängte, antwortete sie mit für sie ungewöhnlich kräftiger Stimme:
»Also, nun kriegt euch mal wieder ein, ihr zwei. Darf man sich nicht mal mehr ’ne neue Frisur zulegen, ohne dass hier ein Chaos ausbricht? Und um es gleich zu sagen: Ab jetzt wird sich bei mir so einiges ändern und deshalb würde ich auch gerne mit dir, Martin, wenn möglich heute noch einen Termin vereinbaren. Ich glaub’, ich muss das Thema meiner Dissertation ändern. Hast du später irgendwann eine halbe Stunde Zeit für mich?«
Professor Wendland runzelte die Stirn. Das war nicht eines der üblichen Herz-Schmerz-Intermezzos, an die er schon von Zeit zu Zeit bei seinen jungen Studentinnen und Mitarbeiterinnen gewöhnt war. Dies hier klang nach einer wirklich gravierenden Neuorientierung bei Sandra und könnte auch Auswirkungen auf seine eigene Forschungsarbeit haben. Er warf einen Blick auf die Armbanduhr:
»So, so, Sandra, das klingt ja wirklich dramatisch. Ich muss jetzt, wie du weißt, in mein Seminar, hinterher hab’ ich eine Verabredung zum Lunch mit unserem Dekan, aber gegen vierzehn Uhr müsste ich wieder hier sein, passt das bei dir?«
Sandra lächelte ihn dankbar an: »Das ist nett, danke, Martin. Ich glaub’, es ist wirklich wichtig, ich hab’ da gestern einige Entscheidungen für mich getroffen, die längst überfällig waren. Aber du musst los, bis später dann.«
Ihr Chef winkte ihr und Julie noch kurz freundlich zu und verschwand wieder in seinem Büro nebenan. Sandra half ihrer Kollegin erst einmal, die Sauerei auf dem Fußboden in Ordnung zu bringen. Nachdem das Wasser aufgewischt und die Papiere wieder sortiert waren, rief sie den Hausmeister an, damit er sich um den Kurzschluss und den Drucker kümmern konnte. Als sie sich dann an ihren Schreibtischen gegenübersaßen, gab Sandra dem fragenden Blick von Julie endlich nach:
»Ja, okay, ich geb’s ja zu! Der Typ war ein Arsch und hat vorgestern Schluss gemacht. Und ja: Du hast mal wieder recht gehabt. Ich weiß selbst nicht, wieso ich immer an solche Idioten gerate – diesmal war ich mir ganz sicher, dass es der Richtige wäre. Aber weißt du, was mich am meisten nervt? Ich hab’ noch nicht mal mitbekommen, dass der die ganze Zeit was mit meiner lieben ›besten Freundin‹ Conny hatte! Und dann diese saudummen Sprüche von wegen ›gute Freunde bleiben‹ und ›wir hatten doch eine tolle Zeit zusammen‹ … Ich kann’s einfach nicht mehr hören, immer das gleiche Gesülze von diesen kindischen Vollpfosten! Aber Julie, ich bin nun endgültig kuriert, bei mir ist jetzt Schluss mit dieser ganzen bescheuerten Partyszene und mit der oberflächlichen Bussi-Bussi-Gesellschaft hier. Ich hab’ mir gestern alles ganz genau überlegt und mein Plan steht fest. Ich muss raus aus dem bisherigen Trott und auch bei meiner Dissertation einen neuen Weg einschlagen. Und ich weiß inzwischen ganz genau, in welche Richtung es bei mir gehen soll.«
Julie starrte ihre total veränderte Kollegin sichtlich skeptisch an, Ähnliches hatte sie von ihr schon mehr als einmal gehört. Seit Sandra hier zum Team gestoßen war, hatten sich bereits drei, nein, vier solche Szenen abgespielt, und entsprechend skeptisch bewertete Julie die Ernsthaftigkeit dieser Pläne. Aber das mit einer Umorientierung beim Forschungsthema war genauso neu wie Sandras äußerliche Veränderung. Am Ende meinte sie es diesmal wirklich ernst?
Julie selbst arbeitete seit vier Jahren im Team von Professor Wendland. Ihre Promotion war fast abgeschlossen und die Doktorarbeit sollte im Januar in Druck gehen. In zwei bis drei Monaten würde sie alles hinter sich haben und sie hoffte darauf, ab dem zweiten Quartal zweitausendvierzehn im Fachbereich ihres Chefs eine befristete Folgeanstellung zu erhalten, finanziert aus Projektmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Chancen standen nicht schlecht und die zielstrebige Französin konnte sich nichts Besseres vorstellen, als hier in dem inzwischen vertrauten Umfeld zu bleiben.
Die beiden jungen Frauen waren in vieler Hinsicht sehr verschieden. Sie verstanden sich dennoch bestens, seit Sandra vor einem Jahr in den Sonderforschungsbereich gekommen war, auch wenn sie privat fast nie etwas zusammen unternahmen – oder vielleicht gerade deshalb. Sie hatten praktisch keine gemeinsamen Interessen, von Fachlichem abgesehen, aber auch da gab es Unterschiede. Während Julie von Anfang an in München studierte und eher mit Mühe durchs Examen gekommen war, hatte Sandra ihr Grundstudium in Berlin absolviert und mit Auszeichnung abgeschlossen. Von ihrem Professor dort war sie dann an Martin empfohlen worden, der gerade ein neues Graduiertenkolleg aufbaute.
Sandra hatte an der Freien Universität Berlin ihre Magisterarbeit über Kunstströmungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts geschrieben und wollte auch darüber promovieren. Da in ihrem Fachbereich dort zu jener Zeit keine Stelle frei war, folgte sie gerne dem Rat ihres Professors und stellte sich in München vor. Dieser Martin Wendland war noch recht jung, Mitte dreißig, und galt als ein aufsteigender Stern am deutschen Kunsthistorikerhimmel. Außerdem war er ein cooler Typ, wie sie fand. Bei seinem jetzigen Forschungsschwerpunkt ging es um vergleichende Studien zwischen volkstümlichem Kunsthandwerk einerseits und der Entwicklung ausgewählter Malereirichtungen andererseits, insbesondere des Expressionismus. Das passte also recht gut zu ihren Interessen und so klappte es tatsächlich mit der halben Doktorandenstelle für sie, wenn auch vorerst auf zwei Jahre befristet.
Für Sandra war damals vor einem Jahr der Standort allerdings fast genauso entscheidend gewesen wie die wissenschaftliche Thematik. Bei früheren Besuchen in München hatte sie bereits in die Partyszene der Isarstadt hineingeschnuppert und sich eingeredet, dass es ihr hier definitiv besser gefallen würde als in der Hauptstadt, wo sie ihr ganzes bisheriges Leben verbracht hatte. Auf den ersten Blick war ihr alles interessant anders, übersichtlicher, wenn auch deutlich provinzieller vorgekommen als im schrillen Berlin, und das fand sie irgendwie reizvoll. Außerdem dachte sie sich, dass ihre wilden Jahre langsam ausklingen sollten und ein etwas ruhigeres, beständigeres Umfeld ihr und ihrer Promotion nicht schaden könnte.
Sandras Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht waren, schon seit sie dreizehn war, sehr intensiv und heftig verlaufen. Sie hatten sich nach ihren frühreifen Anfängen allerdings auch später nicht über das Sexuelle hinaus zu tieferen Beziehungen entwickelt. Das war anfangs okay für sie, sie lebte ganz nach der Maxime YOLO, you only live once, und das in vollen Zügen. Aber so ab ihrem zweiundzwanzigsten Lebensjahr wuchsen ihre Ansprüche an ihre jeweiligen Freunde. Sie hatte jedoch keine gute Hand bei der Partnerwahl und stolperte von einer Enttäuschung in die nächste. Auch in München änderte sich daran nichts. Diese private Unzufriedenheit färbte schließlich auf ihre Studien ab und sie verlor mehr und mehr die Freude an ihrem Thema, auch wenn ihr Umfeld dies noch nicht registriert hatte.
Aber das sollte nun Vergangenheit sein. So wie sie ihr Privatleben komplett umkrempeln würde, so wollte sie sich auch bei ihrer Doktorarbeit neu orientieren. Sie hatte hierzu sehr klare Vorstellungen und hoffte, dass sie ihren Professor am Nachmittag von diesen Plänen überzeugen konnte.
Am Abend wusste sie, dass es ihr nicht gelungen war. Das Gespräch war völlig anders verlaufen als gedacht. Sie hatte hinterher aufgewühlt und fluchtartig das Institut verlassen und sich mit einer Flasche Rotwein und einer warmen Decke auf die Couch in ihrer Wohnung verkrümelt, um das Ergebnis erst einmal zu verdauen. Also auch in Martin hatte sie sich getäuscht, das durfte doch alles nicht wahr sein!
Anfangs hatte ihr Chef sich wie üblich fast kumpelhaft und interessiert an ihren Vorschlägen gezeigt, so wie er sich eben immer gab. Als sie dann aber mit der kleinen Präsentation zu ihrem neuen Wunschthema fertig war, die sie selbst ganz gelungen und überzeugend fand, zeigte er sein wahres Gesicht.
»Sandra, tut mir leid, aber das wird nicht gehen. Dir ist doch hoffentlich bewusst, dass deine aktuelle Arbeit ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Forschung ist. Du kannst nicht einfach mal so dein Thema wechseln, aus einer momentanen Laune heraus. Das würde unser Gesamtkonzept gefährden und wäre den anderen gegenüber nicht fair. Alle hier im Team bearbeiten genau wie du ein sehr sorgfältig ausgewähltes Segment, das erst im Zusammenspiel mit den Ergebnissen der anderen genau jenes Resultat ergeben wird, das wir gemeinsam anstreben. Wir wollen erstmals umfassend darstellen, wie eng verknüpft die stilistischen Entwicklungen auf unterschiedlichen Sektoren der bildenden Kunst am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts waren und wie sie sich gegenseitig befruchteten. Wir brauchen also auch genau deinen Teil dafür! Zumal nach meiner Bewertung gerade dein Thema über die Beeinflussung der Künstlergruppe Blauer Reiter durch die Formensprache der volkstümlichen Hinterglasmalerei in Bayern eine total spannende Sache ist. Da passen deine Überlegungen zum Einfluss japanischer Importkunst auf Franz Marc in München und gleichzeitig auf Carl Fabergé in Sankt Petersburg wirklich nicht rein! Ich weiß gar nicht, welcher Teufel dich da geritten hat, mir so was überhaupt vorzuschlagen!«
In diesem Moment war es Sandra klar geworden. Er sagte zwar dauernd »wir«, meinte aber eigentlich nur sich. Auch Martin war so ein egozentrischer Arsch wie alle Männer, an die sie geriet. Ihm ging es doch ausschließlich um seine eigene Forschungsarbeit, für die sie alle in seinem Team als willige und fleißige Arbeiterbienen den Blütenstaub einsammelten, den er selbst dann zu Honig veredeln und als tolles Gesamtwerk unter seinem Namen publizieren konnte. Die einzelnen Teilbetrachtungen mochten zwar sicher jeweils für ordentliche Dissertationen ausreichen. Aber es blieb eben genau betrachtet Stückwerk, nicht mehr als trockene Fleißarbeit ohne wirklich befriedigende Kreativität und wissenschaftliche Tiefe, auch wenn die anderen in der Forschungsgruppe das irgendwie nicht wahrhaben wollten. Dafür war sich Sandra inzwischen definitiv zu schade und sie zog nun auch die entsprechenden Konsequenzen:
»Dann tut’s auch mir leid, Martin. Ich bin überzeugt, dass es total spannend und den Aufwand wert wäre, sich mit dem japanischen Einfluss auf diese beiden Künstler näher zu befassen, und genau das will und werde ich künftig tun. Und wenn das nicht innerhalb von deinem Fachbereich gehen soll, was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, dann muss ich mir eben einen anderen Doktorvater suchen und du dir eine andere Doktorandin.«
Sie hatte das aus dem Bauch heraus gesagt, war sich selbst nicht sicher, ob sie bluffte und darauf spekulierte, dass ihr Chef vielleicht nachgab und einen Kompromiss vorschlug. Hinterher war es ihr aber auch egal, ob das taktisch klug von ihr war. Hauptsache, sie hatte in dieser Sache an ihrer Überzeugung festgehalten und ihre Meinung offen vertreten.
Als sie später am Abend ihr Glas erneut nachfüllen wollte und bemerkte, dass die Flasche schon leer war, mischten sich in ihre euphorischen Gefühle langsam einige die Stimmung dämpfende Bedenken. Sie hatte Martins letzte Anregung, bevor er das Gespräch beendete, nicht befolgt. Sie wollte die Sache nicht noch mal überschlafen, sondern hatte sofort bekräftigt, dass ihr Entschluss feststand. Und Martin stellte daraufhin, angeblich bedauernd, aber ohne jegliche Gefühlsregung und mit seinem im Gesicht eingefrorenen Lächeln fest:
»Schade, aber du musst wissen, was du tust. Dann gehe ich mal davon aus, dass du mir morgen deine Kündigung reingibst, und ich werde danach umgehend eine neue Stellenausschreibung für deine Nachfolge rausschicken. Glaub’ mir, du machst da einen großen Fehler, aber das ist wie gesagt deine Entscheidung. Ich wünsch’ dir auf jeden Fall trotzdem alles Gute für die Zukunft!«
Jetzt fragte sich Sandra, ob er das Letztere überhaupt ernst gemeint hatte, so kalt wie das alles rüberkam. Nachdem sie im Kühlschrank erfreulicherweise noch eine halb volle Flasche Campari gefunden und sich ein großes Glas davon mit Eiswürfeln eingeschenkt hatte, kramte sie ihr Notebook heraus und begann eine Liste zu machen, was es nun alles zu erledigen galt. Es wurde sehr spät, bis sie schließlich über dieser zunehmend frustrierenden Arbeit einnickte. Ihr letzter Gedanke war, sich zu fragen, ob sie schon wieder Mist gebaut hatte. So richtig optimistisch stimmend war ihre Lage nun wirklich nicht, das dämmerte ihr langsam und das hatte auch der letzte Schluck Campari nicht beschönigen können!
Liebesdienste
In der Morskaja-Straße in Sankt Petersburg verließ fast genau einhundert Jahre vor diesem für Sandra Haas so wichtigen Tag ein etwa dreißigjähriger, sorgfältig gekleideter Herr am frühen Abend das Wohnhaus des renommierten Goldschmieds Carl Fabergé. Boris Rablimow war bester Laune und schlug im tiefen Schnee voller Vorfreude den kurzen Weg in Richtung der Prachtstraße Newski-Prospekt ein.
Er war mit Nicolas, dem jüngsten Sohn des Hofjuweliers, aufs Gymnasium gegangen und damals eng befreundet gewesen. Später als Student war Boris nach dem Schlaganfall seines Vaters, für den man ihn wegen eines kleinen Ungehorsams verantwortlich machte, und nach dem anschließenden Streit mit seinem älteren Bruder bei seiner eigenen Familie in Ungnade gefallen und plötzlich auf sich gestellt. Daraufhin hatte ihm Carl Fabergé auf Nicolas’ Bitte hin eine Verwaltungsposition im Familienunternehmen angeboten, wobei die perfekten Fremdsprachenkenntnisse des jungen Mannes in Französisch, Englisch und Deutsch eine wichtige Rolle spielten.
Für den aus eher bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen stammenden, aber hochbegabten Boris war dies eine glückliche Wendung und er brachte sich voller Dankbarkeit und Fleiß in die expandierende Firma ein. Über die in Moskau, Odessa und London gegründeten Filialen entwickelten sich rasch exzellente Geschäfte und die Marke Fabergé wurde bald in ganz Europa in einem Atemzug mit dem Hauptkonkurrenten Cartier genannt.
Gerade jetzt, am Ende des Jahres neunzehnhundertdreizehn, war ein Höhepunkt in der Firmengeschichte erreicht, denn alleine im Umfeld des dreihundertjährigen Jubiläums der Zarenfamilie Romanow florierte das Haus Fabergé aufgrund von über zweitausend Bestellungen diverser Schmuckwaren. In einem wahren Rausch von Luxus überboten sich die Mitglieder europäischer Fürsten- und Königshäuser wie auch des Geldadels gegenseitig mit wertvollen Preziosen. Trotz der inzwischen auf über fünfhundert Köpfe angewachsenen eigenen Werkmeister und Mitarbeiter sowie unzähliger Unteraufträge an nachgeschaltete Werkstätten konnte man diese Marktnachfrage kaum bedienen.
Doch an diesem Tag bewegten den glücklichen Boris Rablimow nicht die prall gefüllten Auftragsbücher seines Arbeitgebers, sondern etwas sehr Privates. Sein Jugendfreund Nicolas, der inzwischen seit sieben Jahren in der Londoner Niederlassung tätig war und nur noch selten nach Sankt Petersburg reiste, hatte ihn um einen Gefallen gebeten. Der Firmenpatriarch Carl Fabergé würde im nächsten Jahr seinen achtundsechzigsten Geburtstag feiern und die vier Söhne wollten ihm eine besondere Freude bereiten. Und er, Boris, war von ihnen mit der Umsetzung dieses vertraulichen Planes beauftragt worden.
Carl Fabergé war ein begeisterter Liebhaber japanischer Miniaturschnitzereien. Insbesondere für Netsuke, jene kleinen Gürtelknebel zum Befestigen von Alltagsutensilien am Gürtel des Kimonos, empfand er eine Leidenschaft, die auch Eingang in seine eigenen Kreationen fand. Viele der aus Halbedelsteinen geschnittenen Tierminiaturen des Hauses Fabergé waren nach dem Vorbild von Netsuke entworfen worden, die bekannte Künstler in Japan einhundert oder gar zweihundert Jahre zuvor aus Holz oder Elfenbein geschnitzt hatten. In einer Vitrine in seiner Privatwohnung in der Morskaja-Straße bewahrte Carl eine über fünfhundert Netsuke umfassende Sammlung auf und schöpfte hieraus unverändert persönliche Freude und Inspiration für die Entwürfe seiner Firma.
Die Idee der Söhne war es nun, eine kleine ergänzende Sammlung möglichst origineller und humorvoller Tier-Netsuke zusammenzustellen und ihrem Vater zu schenken. Dessen Sammlung enthielt zwar bereits unzählige Tierdarstellungen, bis auf wenige Ausnahmen allerdings in sehr klassischen Posen und traditionellen Ausprägungen. Den Söhnen war jedoch aufgefallen, dass sich ihr Vater gerade für die skurrilen und ungewöhnlichen Objekte seiner Menagerie besonders erwärmte.
Aus diesem Grund hatte Boris nun den familiären Geheimauftrag, sich mit dem bereits vorhandenen Bestand zunächst vertraut zu machen, ein Gespür dafür zu entwickeln, welche im Handel verfügbaren Stücke die Sammlung auf originelle Weise ergänzen könnten, und dann im Laufe der kommenden Monate Stück um Stück anzukaufen.
Als Verbündete agierte eine der Hausdamen in der Morskaja-Wohnung, die ihm, immer wenn der Hausherr auswärts zu tun hatte, Zugang zur Netsuke-Sammlung verschaffte. Boris wurde im Laufe der Tage und Wochen, die er so zeitweise mit den kleinen asiatischen Schnitzereien verbrachte, bald selbst zu einem Liebhaber und Kenner dieser Kunstrichtung. Ein wenige Jahre vorher erschienenes Buch des bekannten deutschen Lexikon-Verlegers Albert Brockhaus, damals das einzige europäische Standardwerk über diese Kostbarkeiten, förderte bei ihm bald auch ein vertieftes Verständnis für die Provenienz und Interpretation der oft schwer deutbaren Figuren. Die gleichermaßen fundierten wie faszinierenden Ausführungen in diesem Werk aus dem Jahr 1905 mit dem Titel Netsuke. Versuch einer Geschichte der japanischen Schnitzkunst weckten bei Boris ein solches Interesse an diesem Thema, dass er sich mit Rückendeckung der Fabergé-Söhne vorübergehend bei seinen dienstlichen Pflichten in der Firma entlasten ließ. Stattdessen konzentrierte er sich mehr und mehr auf die Suche und Akquisition geeigneter Netsuke.
Inzwischen hatte er über mehrere Fachhändler in Amsterdam und Paris bereits einundzwanzig solche Objekte identifiziert und erworben. Er bewahrte sie daheim in einer flachen Schatulle mit fünfunddreißig separaten, ausgepolsterten Fächern auf, welche in der firmeneigenen Werkstatt kunstvoll aus Ahornholz angefertigt worden war. Sein besonderes Augenmerk bei der Vervollständigung der Sammlung galt seit geraumer Zeit dem kleinen Fachgeschäft mit dem Namen »Japan« am Newski-Prospekt, das er soeben erreichte. Und das hatte einen speziellen Grund.
Alexandra Rudakowa erwartete ihn wie immer unten im Verkaufsraum des Geschäfts, das für seine erlesene Auswahl an ostasiatischen Kunstwerken auch über Sankt Petersburg hinaus berühmt war. Auch Carl Fabergé hatte hier über die vergangenen Jahre einen Großteil seiner Sammlung erworben und man kannte dessen Geschmack und Interessen bestens. Und die attraktive, zierliche Russin, die für den alten und inzwischen kränklichen Geschäftsinhaber den Laden die meiste Zeit alleine führte, war in vieler Hinsicht genauso mit den Vorlieben dieses jungen Mannes vertraut. Boris verkehrte seit zwei Monaten regelmäßig hier und verbrachte nach Ladenschluss oft eine oder zwei Stunden oben im separaten Privatverkaufsraum mit dieser Frau.
Sascha, wie er sie inzwischen vertraulich bei ihrem Kosenamen nannte, stammte aus besten Kreisen und hatte einige Jahre Philosophie an der Universität in Zürich studiert, da die Hochschulen in Russland für Frauen zu jener Zeit nicht zugänglich waren. Danach war sie ein Jahr bei ihrem Vater in Tokyo, der damals als russischer Diplomat in Japan lebte. Aufgrund eines Zerwürfnisses mit ihrer Familie, über dessen Gründe sie später nie mit irgendjemandem sprach, reiste die damals Fünfundzwanzigjährige im Jahr neunzehnhundertsechs alleine und quasi verstoßen zurück nach Sankt Petersburg zu einer früheren Studienfreundin. Dort fand sie dann schließlich protegiert durch deren Familie eine Anstellung in dem bewussten Japanladen, in dessen Nähe ihr der Besitzer eine kleine Wohnung zur Verfügung stellte.
Sie führte ein sehr zurückgezogenes Leben und verkroch sich ganz in ihrer kleinen Welt, die von japanischer Kunst und Literatur bestimmt war. Bis eines Tages dieser Boris Rablimow durch die Tür trat und sein Anliegen vorstellte. Es war auf beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick und von diesem Moment an entwickelte sich eine heftige Romanze zwischen den beiden Menschen, wie das Schicksal sie nur selten wahr werden lässt.
Die damals herrschende Schicklichkeit stellte nur anfangs eine Hürde dar, denn wie zu allen Zeiten fand sich auch hier ein Weg, wo ein entsprechend starker Wille war. Bald trafen sich die beiden Verliebten nicht nur kurz nach Ladenschluss in den Räumlichkeiten des Geschäfts, sondern auch im Landhaus einer Freundin der Rudakowa und nutzten alle sich bietenden Gelegenheiten für vertraute Stunden.
Doch an diesem Tag entzog sich Sascha zunächst fröhlich lachend der Umarmung von Boris, nachdem sie unten die Ladentür verschlossen hatten und oben im Privatkabinett angekommen waren:
»Später, mein Lieber, ich muss dir zuallererst etwas zeigen! Die Sendung aus Amsterdam ist heute angekommen. Der Antiquitätenhändler Jan Dekker hat sie zusammen mit anderen Lieferungen selbst vorbeigebracht, denn er ist auf der Durchreise nach Moskau.«
Sie öffnete eines der flachen Schubfächer im Unterteil einer mächtigen Glasvitrine und legte ein japanisches Kartonschächtelchen auf den Verkaufstisch. Boris küsste Sascha noch rasch auf den Hals und öffnete dann voller Spannung das Behältnis.
Vor ihm lag eingebettet in das Seidenfutter der Schachtel eine etwa sechs Zentimeter große Schnitzerei aus Elfenbein. Sie stellte eine tanzende Figur dar, mit dem nackten Körper einer Frau, aber dem Kopf und den Pfoten eines Hasen.
Der Künstler hatte gekonnt die anmutige Bewegung eines fröhlichen Tanzes eingefangen. Der linke Arm schwang soeben bis zum Kopf hoch, während das rechte Bein in harmonischem Gleichklang elegant angehoben wurde. Die langen, wohl durch die beschwingte Drehung der Hasentänzerin sich eng an den Kopf anschmiegenden Ohren wirkten bewegt und gaben dem Ganzen eine dennoch runde, geschlossene Form. Ganz so wie es sich für einen Gürtelknebel gehörte, der keine störenden Ecken und Kanten haben sollte, um die empfindlichen Seidenstoffe der Kleidung zu schonen.
Im oberen Rücken der Figur waren die beiden winzigen, sorgfältig eingeschnitzten Löcher des Schnurkanals zu sehen. Durch sie konnte man eine Seidenkordel schlingen und daran jene Dinge befestigen, die man rasch zur Hand haben wollte, also vielleicht das Pfeifenset, die Börse oder ein Siegelbehältnis. Die japanische Kleidung besaß früher keine Taschen, sodass alltägliche Utensilien auf diese Weise am breiten Seidengürtel des Kimonos festgeklemmt wurden.
Boris nahm das kleine Kunstwerk vorsichtig heraus und drehte es hin und her, aufmerksam die taktile Qualität dieses kühlen Handschmeichlers spürend. Er glitt wie von alleine mit seinen sanften, erotischen Rundungen durch seine Finger.
Sascha lachte fröhlich über seine offensichtliche Freude, konnte sich aber eine neckende Bemerkung nicht verkneifen: »Muss ich jetzt eifersüchtig sein, Borja? Verliebst du dich gerade in diese kleine sinnliche Göttin aus Elfenbein?«
Nun musste auch Boris lachen, wie immer wenn sie diese Koseform seines Vornamens benutzte. Er legte die Schnitzerei zurück ins Etui und umarmte leidenschaftlich seine Angebetete:
»Nun ja, die Kleine ist eine echte Konkurrenz, findest du nicht auch? Vielleicht sollte ich dich in Zukunft Sajtschik, Häschen, nennen! Obwohl, das fühlt sich bei dir alles noch verlockender und wohliger an als bei dieser beinernen Miniatur …«