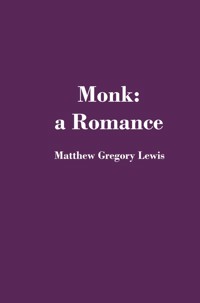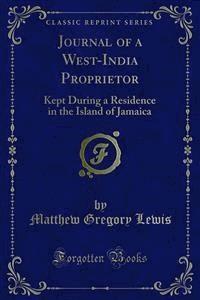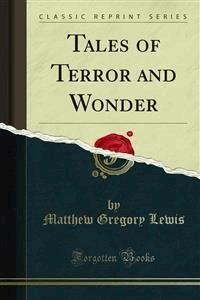Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Mönch" - das bekannteste Werk des englischen Autors Matthew Gregory Lewis - beschreibt den den durch die Hexe Mathilde verursachten moralischen Verfall, und das dadurch folgende Abgleiten des Dominikaner-Priors Ambrosius, in die abscheulichsten Verbrechen, deren furchtbare Strafe aber letztlich nicht ausbleibt. Das Buch erschien erstmals 1796. Es wurde bald über die Grenzen Großbritanniens bekannt und ist bis heute eines der berühmtesten Werke der Schauerromantik. Der hier vorliegenden Ausgabe liegt eine anonyme deutsche Übersetzung des "Mönchs" aus dem Jahre 1799 zu Grunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch.
Vorliegendes Buch enthält die anonyme deutsche Übersetzung von M. G. Lewis' The Monk aus dem Jahre 1799, welche zu jener Zeit unter dem Titel erschien:
Mathilde von Villanegas oder der weibliche Faust. Pendant zu Fausts Leben, Reisen etc. Berlin 1799.
Der Text wurde in die traditionelle deutsche Rechtschreibung übertragen und sprachlich schonend bearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
Erster Abschnitt
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Fünfter Abschnitt
Sechster Abschnitt
Siebenter Abschnitt
Achter Abschnitt
DER MÖNCH
* * *
Erster Abschnitt
MAN hatte an einem Freitage noch nicht fünf Minuten in die Dominicaner-Kirche zu Madrid geläutet, als sie schon zum Erdrücken voll war. Andacht und Lernbegierde waren wohl die Ursache dieses Zusammenströmens nicht: wer könnte bei einem so abergläubigen Volke, wie das zu Madrid ist, Empfindungen wahrer Andacht suchen? Jeder hatte seine besonderen Ursachen in die Kirche zu geben; Ursachen, die es schwer ist anzugeben, und die ganz wider den Anschein waren. Das schöne Geschlecht ging nur hin, um sich zu zeigen, und die Mannspersonen, um das, was sich zeigte, zu sehen; einige wollten den Prediger, der in überaus gutem Rufe stand, hören, andere wieder sich ein Stündchen vor der Komödie vertreiben, das ihnen außerhalb der Kirche langweilig geworden sein möchte: kurz, die eine Hälfte von Madrid erwartete hier die andere Hälfte. Deren, die der Predigt selbst wegen gekommen waren, gab es etwa wenige Sechzigjährige und ein halbes Dutzend Priester, die den, welcher jetzt auftreten sollte, wegen seines guten Rufs beneideten, und ihn kritisieren, oder wohl gar, wenn es möglich wäre, lächerlich machen wollten. Für die übrigen mochte der ehrwürdige Pater gut oder schlecht predigen, auch wohl gar predigen oder nicht predigen, das war ihre geringste Sorge.
Dem sei nun, wie ihm wolle, so viel ist ausgemacht, daß die Dominicaner-Kirche noch nie so voll, als an diesem Tage, gewesen war. Kein Sitz, kein Winkelchen war leer, und die Statuen der Heiligen und Engel, die sonst nur zur Zierde in den Säulengängen dienten, hatten wenigstens heute einigen wahren Nutzen, weil sich doch mancher auf die ersteren stellen, und die Kinder sich auf die Flügel der letzteren setzen konnten. Der heilige Dominicus, der heilige Franziskus, jeder Heilige trug seine Last, und die heilige Agathe mußte sich gar eine doppelte Bürde gefallen lassen. Ist es also wohl ein Wunder, wenn unsere zwei Ankömmlinge, die sich umsonst links und rechts umsahen, auch nicht das geringste Plätzchen für sich fanden?
Indessen drängte sich die älteste unter ihnen, alles Murrens und Unwillens gegen sie ungeachtet, immer weiter vor. Umsonst rief man von allen Seiten: „Ich versichre Sie, Madame, es ist kein Platz mehr - Aber, Señora, drängen Sie doch nicht so sehr! Sie drücken ja alles zusammen! - Noch einmal, Madame! Sie können unmöglich durchkommen! Mein Gott! wie doch manches so impertinent sein kann!“ - Die gute Tante blieb bei ihrem Kopfe: Füße, Knie und Ellbogen mußten ihre Dienste so lange leisten, bis sie sich in der Mitte der Kirche und nur zehn Schritte von der Kanzel entfernt sah: Ihre Begleiterin spürte kaum, daß die Tante einen Fuß vorwärts gesetzt hatte, so rückte sie mit dem ihrigen nach, und so war sie ihrer Führerin stillschweigend gleich gekommen.
„Heilige Mutter Gottes!“ rief nun die Alte; „was ist das für eine Hitze! Ich möchte nur wissen, warum es heute so gedrückt voll ist. Kein einziger Sitz ist leer, und keins von den Mannsbildern ist so galant, uns den seinigen anzubieten! Ich hätte wohl in Madrid mehr Lebensart gesucht.“
Diese Worte machten zwei junge Herren aufmerksam, die, sich vorwärts über die Lehne ihres Stuhls beugend, miteinander plauderten. Beide hatten ein ganz artiges Ansehen. Als sie den von einem Frauenzimmer auf ihre Lebensart gemachten Anspruch hörten, drehten sie sich ein wenig um, um die Ansprecherin selbst zu beäugeln. Sie hatte ihren Schleier in die Höhe gehoben, um die Leute, die sie umgaben, näher betrachten zu können. Da sie sahen, daß die Dame schielte und fuchsrote Haare hatte, nahmen sie wieder ihre vorige Stellung an, und setzten ihr Gespräch fort.
„Ich bitte Sie, liebe Tante“, fing die andere an, gehen wir wieder nach Hause! Die Hitze ist ja unerträglich: es ist so voll, daß einem bange wird.“
Ihre überaus süße Stimme machte auf die jungen Herren neuen Eindruck: sie drehten sich abermals um, aber jetzt genügte ihnen ein flüchtiger Anblick nicht; beide gaben unwillkürlich bei Erblickung der Person, welche gesprochen hatte, ihre Überraschung zu erkennen.
Schon die Stimme zeugte von ihrer Jugend, und ihr Ganzes erregte den Wunsch, ihr Gesicht zu sehen, von dem es sich zum voraus vermuten ließ, daß es mit jenem übereinstimmen müsse. Zum Unglück war ihr schwarzer Schleier undurchsichtbar; doch war er im Gedränge ein wenig aus der Ordnung gebracht worden, daß man ihren Hals wahrnehmen konnte, der an Schönheit dem der mediceischen Venus nicht wich. Weiß wie der Schnee, ward er von einem Walde von kastanienbraunen Haaren beschattet, die in Locken bis über den Busen herabrollten. Ihr Wuchs war schlank wie der einer Waldnymphe; ihr Busen war sorgfältig verschleiert. An ihrer Hand hing ein Rosenkranz mit großen Korallen herunter. Unter der blauen Einfassung ihres weißen Kleides ließ sich in einem netten mordreefarbigen Schuhe ein allerliebst kleiner Fuß sehen.
Der jüngste von beiden sah sich durch diesen Anblick genötigt, der Schönen seinen Stuhl aufs verbindlichste anzutragen, und dieses Beispiel forderte den anderen auf, ein Gleiches gegen die Dame mit den schielenden Augen zu tun, die von dem Antrage, ohne sich eben bitten zu lassen, unter vielen Danksagungen Gebrauch machte. Auch das junge Frauenzimmer setzte sich, nachdem sie, statt aller Komplimente, eine Verbeugung gemacht hatte. Don Lorenzo (so hieß der junge Mann) wußte sich einen anderen Stuhl zu verschaffen, und setzte sich, nach einigen seinem Freunde zugeflüsterten Worten, neben sie, und dieser hatte ihn kaum halb verstanden, als er sich neben die alte Dame setzte, und sich mit ihr in ein langes Gespräch einließ.
„Vermutlich sind Sie erst seit kurzem in Madrid, Mamsell!“ redete Lorenzo seine schöne Nachbarin an: „so viele Reize würden schon Aufsehen gemacht haben, wenn sie nicht heute zum ersten Male erschienen. Die Eifersucht der Frauenzimmer und die Aufwartungen meines Geschlechts hätten schon eine allgemeine Aufmerksamkeit erregen müssen.“
Er erwartete eine Antwort: aber da das, was er gesagt hatte, keine direkte Frage war, so glaubte das junge Frauenzimmer sich auch zu keiner Antwort verbunden. Nach kurzem fing er wieder an:
„Habe ich falsch gemutmaßt, Mamsell, wenn ich Sie für eine Fremde hielt?“
„Nein, Señor!“ war die Antwort nach einigen Augenblicken, in welchen das Frauenzimmer zweifelhaft geschienen hatte, ob sie antworten sollte.
„Glauben Sie lange hier zu bleiben?“
„Ja, Señor!“
„Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich mich Ihnen gefällig erweisen könnte. Ich bin in Madrid bekannt, und meine Familie gilt bei Hofe. Wollen Sie meine Dienste annehmen, so werde ich mir's für Ehre halten, und Sie werden mich dadurch zugleich verbinden.“
„Nun, wenn das Mädchen kein Gelübde getan hat, einsilbig zu sein“, sagte Lorenzo zu sich selbst, „so muß sie mir doch jetzt zusammenhängend antworten.“ Er sah sich in seiner Erwartung getäuscht; denn eine Verneigung war die ganze Antwort.
Daß seine Nachbarin ungesprächig war, das bedurfte nun wohl keines Zweifels: war sie es aber aus Hochmut, Bescheidenheit, Furchtsamkeit, oder Mangel an Lebhaftigkeit, das war noch die Frage.
„Man sieht wohl, Mamsell“, fing er wieder nach einigem Stillschweigen an, „daß Sie mit dem hiesigen Gebrauch nicht bekannt sind, weil Sie noch immer den Schleier herunter lassen. Erlauben Sie, daß ich ihn Ihnen zurück ziehe.“
Er streckte die Hand gegen den Schleier; sie hielt ihn zurück.
„Nein, mein Herr! Unter Leuten bleibe ich gern verdeckt.“
„Und was wird's denn sein, Nichte, wenn Sie ihn wegziehen?“ sagte Leonelle (so hieß die Alte). „Sehen Sie nicht, daß alle Damen entschleiert sind? Ich habe meinen schon lange auf die Seite getan; und wahrhaftig, wenn ich mein Gesicht der Welt bloß geben kann, so können Sie's wohl auch tun. Geschwinde, weg mit dem Schleier! Auf jeden Fall stehe ich gut dafür, daß Sie mit Ihrem Gesichte niemand zurückschrecken werden.“
„Es ist in Murcia nicht Mode, liebe Tante!“
„In Murcia! Wer wird denn so ein trauriges Land immer im Munde haben! Genug, daß es in Madrid Mode ist! Folgen Sie mir, Antonie! nehmen Sie Ihren Schleier weg! Sie wissen, daß ich mir nicht gern widersprechen lasse.“
Die Nichte gab keine Antwort, aber sie widersetzte sich auch den Bemühungen Don Lorenzos nicht, der, durch den Beifall der Tante unterstützt, sich geschäftig bewies, um ihr den Schleier hinwegzunehmen. Ein wahres Engelgesicht stellte sich jetzt seiner Bewunderung dar. Doch war Antonie mehr artig, als schön: ihr Reiz kam weniger von der Regelmäßigkeit ihrer Züge, als von dem über ihr Gesicht verbreiteten Ausdrucke von Güte und Empfindung her. Sie schien höchstens fünfzehn Jahre alt. Jeder Teil ihres Gesichts, einzeln genommen, war nicht vollkommen, aber das Ganze war anbetenswürdig. Ihre Haut war nicht ganz rein von Flecken; ihre Augen waren nicht sehr groß, und die Augenlieder nicht außerordentlich lang; aber ihre Lippen waren frisch wie die Rosen. Ihr Hals, ihre Hand, ihre Arme, alles war vollkommen. Ihre Augen waren sanft und glänzend wie der Himmel. Ein sanftes Lächeln, das auf ihren Lippen schwebte, verkündigte ihre liebenswürdige Lebhaftigkeit, die durch ihre sichtbare außerordentliche Furchtsamkeit in Schranken gehalten wurde. Die Verwirrung der Bescheidenheit malte sich in allen ihren Blicken, und begegneten sie von ungefähr denen Lorenzos, so sah man sie augenblicklich auf ihren Rosenkranz herunter fallen; ihre Wangen färbten sich, und man sah die Sammlung des Geistes, womit sie ihre Ave betete.
Mit Staunen und Bewunderung blieben Lorenzos Blicke auf sie geheftet. Leonelle glaubte ihre kindische Furchtsamkeit einigermaßen entschuldigen zu müssen.
„Sie ist ein Kind“, sagte sie, „das jetzt zum erstenmal in die Welt tritt. Sie ist in einem alten Schlosse in Murcia aufgezogen worden, und hat keinen anderen Umgang gehabt, als den mit ihrer Mutter, die nicht einmal gemeinen Menschenverstand hat, ob sie gleich meine leibliche Schwester ist.“
„Keinen gemeinen Menschenverstand?“ sagte Don Christoval mit verstelltem Erstaunen. „Das scheint mir außerordentlich zu sein.“
„Und doch - ich begreif's nicht, wie manche Leute ihr Glück machen. Ein junger Herr aus einem der ersten Häuser in Madrid bildete sich ein, daß meine Schwester Verstand hätte und schön sei: er heiratete sie ohne Vorwissen seines Vaters Ihre Verbindung blieb drei ganze Jahre ein Geheimnis aber endlich kam sie doch dem alten Marquis zu Ohren, der, erbittert darüber, die Post nach Cordua nahm, und Elviren gefangen zu nehmen, und sie so weit zu verschicken Willens war, daß kein Seelenmensch wieder etwas von ihr erfahren sollte. Lieber Himmel, was das für einen Lärm gab, als er bei seiner Ankunft hörte, daß sie sich geflüchtet habe, um ihrem Gemahl nachzureisen, und daß sich beide schon nach Ostindien eingeschifft hätten! Er schalt und fluchte, als ob er vom Bösen besessen wäre, ließ meinen Vater ins Gefängnis werfen, der doch gewiß der ehrbarste Schuster in ganz Cordua war, und als er uns verließ, war er grausam genug, den kleinen Sohn meiner Schwester mitzunehmen, der etwa zwei Jahre alt war, und den sie wegen der Eile, die ihre Flucht erforderte, bei uns hatte zurück lassen müssen. Gewiß ist dem armen Kind übel mitgespielt worden. - Wir erfuhren ein paar Monate nachher, daß es gestorben sei.“
„Wahrhaftig, Madam, das war ein böser Mann!“ fiel Don Christoval ein.
„Ein grober Mann, ein Mann ohne alle Einsicht! Sollten Sie's wohl glauben, daß er insolent genug war, mich eine Hexe zu nennen, und zu wünschen, daß meine Schwester, zur Strafe für seinen Sohn, auch so verwünscht, wie ich, aussehen möchte?“
„Entsetzlich!“ rief Don Christoval aus. „Da muß es dem Marquis freilich an Einsicht fehlen. Ich dachte, der Graf möchte bei einer solchen Gleichheit an Aussehen gewonnen haben.“
„Sie sind zu gütig, Señor! Indessen hatte ich's bei einem solchen Ausgange nicht zu bedauern, daß der Graf meine Schwester schöner fand. Die arme Elvire durfte sich eben zu ihrer Verbindung kein Glück wünschen. Nach dreizehn peinlichen Jahren, die sich beide in Amerika aufhielten, starb der Graf: sie kam nach Spanien zurück, ohne Geld ohne Hilfe, ohne Zufluchtsort. Antonie war das einzige Kind, das ihr am Leben geblieben war. Ihr noch immer unversöhnlicher Schwiegervater hatte sich während dem wieder verheirathet, und mit der zweiten Frau einen Sohn gezeugt, von dem man sagt, daß er überaus liebenswürdig sei. Der alte Marquis wollte meine Schwester bei ihrer Rückkehr nicht einmal vor sich lassen: indessen setzte er ihr doch einen mäßigen Gehalt aus, den sie mit ihrer Tochter in Murcia in einem alten Schlosse verzehren sollte, das ehemals die Lieblingswohnung seines verstorbenen Sohnes gewesen war, weswegen es auch der alte Marquis, der alles haßte, was ihn an denselben erinnerte, fast ganz hatte in Schutt fallen lassen. Hier blieb sie bis zu Ende vorigen Monats.“
„Und was hat sie nach Madrid gebracht?“ fragte Lorenzo, der Leonellens Erzählung mit dem größten Interesse zugehört hatte.
„Je nun, der alte Marquis ist vor kurzem gestorben, und der Schloßaufseher will die Pension nicht länger bezahlen. Nun will sie sich an den jungen Grafen wenden; ich fürchte aber, daß es vergebene Mühe sein wird. Ist ein Frauenzimmer nur etwas alt, so habt ihr jungen Herren kein Geld, für sie. Ich habe meiner Schwester geraten, sie sollte Antonien in ihrem Namen hinsenden; da gibt es aber tausend Besorgnisse; und doch weiß ich, daß Antonie mit ihrem hübschen Gesichte durchgedrungen wäre.“
„Und warum“, fragte Don Christoval mit boshaftem Spotte, „wendet sich Ihre Schwester nicht an Sie, Mamsell, wenn es zu dieser Sendung eines schönen Gesichts bedarf?“
„Sie beschämen mich ganz, mein Herr! Ich weiß nicht, ob meine Schwester an einen solchen Auftrag hätte denken können; aber ich meinesteils kenne die damit verbundenen Gefahren, und würde mich ihnen nie aussetzen.“
„Darf ich fragen“, fiel Lorenzo ein, wie der junge Graf heißt, an den sich Elvire werden will?“
„De las Cisternas.“
„Cisternas? Ich kenne ihn recht gut. Jetzt ist er nicht hier, aber man erwartet ihn alle Augenblicke. Er ist ein überaus liebenswürdiger junger Mann; und wenn mir die schöne Antonie erlaubt, bei ihm ihren Fürsprecher zu machen, so glaube ich ihr gute Nachricht zu bringen.“
Antonie richtete ihre schönen blauen Augen auf ihn, und dankte ihm mit einem angenehmen Lächeln. Leonelle wußte ihren Dank in mehr Pomp einzukleiden, und nahm seinen Antrag mit der lebhaftesten Erkenntlichkeit an.
„Aber, liebes Kind“, fing sie hierauf zu Antonien an, „Sie reden ja gar nicht! Ich dachte doch, so gütige Anträge verdienten die verbindlichste Antwort.“ Hierauf wandte sie sich zu Don Christoval, und fragte, was heute die Ursache eines so besonderen Zulaufs in dieser Kirche sei.
„Sie wissen also noch nicht“, war die Antwort, „daß der Pater Ambrosio, ein Prediger dieses Klosters, hier alle Freitage predigt? Ganz Madrid tönt von seinem Lobe wieder; und da er erst dreimal gepredigt hat, so strömt jedermann zu, um ihn zu hören. Ich hätte geglaubt, daß der gute Ruf, in dem er steht, schon zu Ihren Ohren gekommen sein müßte.“
„Wir sind erst seit gestern hier angekommen, und in Cordua erfährt man so wenig, was in der übrigen weiten Welt vorgeht, daß der Name Ambrosio dort noch gar nicht erschollen ist.“
„Dieser Name ist hier in jedem Munde; jung und alt spricht mit Enthusiasmus von ihm. Unsere Grands überhäufen ihn mit Geschenken, und ihre Gemahlinnen suchen nur ihn zum Beichtvater. Er ist in der ganzen Stadt unter dem Namen des göttlichen Mannes bekannt.“
„Er ist gewiß von vornehmer Herkunft? fragte Leonelle.
„Seine Herkunft ist gar nicht bekannt. Der vorige Dominicaner-Prior fand ihn als Kind vor dem Kloster ausgesetzt, und so wurde er darin erzogen, weil alle Nachfragen wegen seiner Eltern umsonst waren. Schon in seiner Jugend soll er für das einsame Leben eingenommen gewesen sein. Die Geistlichen, deren Kloster durch seine Talente nicht wenig Kredit gewinnt, scheuen sich nicht zu sagen, daß ihnen die Mutter Gottes mit ihm ein Geschenk gemacht habe; und wirklich, das eingezogne Leben dieses Mannes gibt der Fabel einen Anstrich von Wahrscheinlichkeit. Er mag etwa einige dreißig Jahre alt sein.
Von Jugend auf hat er sich der Gesellschaft ganz entzogen, und sein ganzes Leben dem Studium und den Abtötungen des Fleisches gewidmet. Als er vor drei Wochen zum Prior erwählt wurde, war er noch nicht ein einziges Mal außerhalb seiner Klostermauern gekommen, und noch jetzt verläßt er sie nicht, außer wenn er die Kanzel dieser Kirche betritt, wo, wie Sie sehen, ganz Madrid zusammen läuft, um ihn zu hören. Übrigens soll er ein eifriger Verehrer seiner Ordensregeln sein, und sie noch nicht im mindesten verletzt haben: sein Charakter ist unbefleckt, und was sein Gelübde der Keuschheit anbei langt, so soll er nicht einmal wissen, worin sich das männliche Geschlecht von dem weiblichen unterscheidet; und so wird er von dem ganzen Volke für einen Heiligen gehalten.“
„Wenn das die Heiligkeit ausmacht“, sagte Antonie, „so kann ich mir auch schmeicheln, eine Heilige zu sein.“
„Nun ja“, fiel Leonelle ein, „so was gehört ja für die Kompetenz junger Mädchen! Das wissen Sie ja, daß in der Welt Menschen sind, und daß jeder Mensch Ihres Geschlechts ist. Der ganze Unterschied besteht darin, daß die einen Bärte haben, die anderen nicht; daß - -“
Leonelle würde vermutlich in der geistreichen Unterweisung ihrer Nichte in Absicht dieses Unterschieds noch lange fortgefahren haben, hätte sich nicht in der Kirche ein Gemurmel hören lassen, welches ein allgemeines Vergnügen verriet, und die Ankunft des Predigers ankündigte. Donna Leonelle stand von ihrem Stuhle auf, um ihn besser zu sehen, und Antonie folgte ihrem Beispiele.
Der Prediger war ein sehr schöner Mann: seine Gestalt war außerordentlich angenehm, sein Wuchs lang, und sein Blick anziehend. Eine Adlernase, ein schwarzes, glänzendes Auge, dichte, zusammenstehende Augenbrauen - dies waren die auffallendsten Züge seines Gesichts. Seine Haare waren hellbraun. Ungeachtet er noch in der Blüte seines Alters war, so hatten doch Studium und Nachtwachen seine Wangen fast gänzlich entfärbt. Seine heitere Stirn schien der Sitz der Unschuld und der Tugend zu sein. Alle seine Züge drückten ein inneres Seelenvergnügen aus, welches aus dem Bewußtsein der Schuldlosigkeit entspringt. Aus seinem lebhaften und durchdringenden Blick ging jene Ernsthaftigkeit hervor, welche Ehrfurcht gebietet, und deren Anblick nur wenige ertragen konnten.
Antonie empfand bei seiner Erblickung ein außerordentliches Vergnügen. Sie erwartete mit Ungeduld den Anfang der Predigt, und als er den Mund öffnete, durchdrang der Ton seiner Stimme ihr Inneres. Auch die anderen Zuhörer, ob sie gleich weniger bewegt waren, konnten ihm nicht ohne Interesse zuhören: alle waren aufmerksam, und selbst in den entferntesten Kapellen herrschte das tiefste Stillschweigen. Auch Lorenzo konnte dem Reiz seiner Beredsamkeit nicht widerstehen, und vergaß es ganz, daß Antonie neben ihm saß.
Ambrosio entwickelte den hohen Wert der Religion in den deutlichsten, einfachsten und kraftvollsten Ausdrükken; und wenn jeden seiner Zuhörer der tiefste Schauder ergriff, weil er schon den Donner des ewigen Rächers über sich hörte, als Ambrosio mit dumpfer Stimme die Abscheulichkeit des Lasters und die Strafen, welche demselben in jenem Leben vorbehalten sind, aufs rührendste zu schildern wußte, so war ihm hernach der Übergang zum Hoffen und zum Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes um so angenehmer, als der Prediger von der süßen Heiterkeit eines reinen Gewissens, und dem Lohne, welcher die Tugend einst krönen soll, sprach. Sein Ton wurde jetzt melodisch: der Zuhörer glaubte sich schon durch ihn in die höheren Regionen versetzt, die er der Einbildungskraft mit lebhaften und glänzenden Farben malte.
So lange auch die Predigt schon gedauert hatte, so schien es doch jeder Zuhörer zu bedauern, daß sie sich ihrem Ende nahete, als der Pater zu dem Schlusse derselben überging. Noch immer währte das Stillschweigen, als er seine Rede schon einige Zeit geendigt hatte; aber nach und nach ging das Entzücken in laute Bewunderung über: man drängte sich zu der Kanzel, als der Mönch herabging; man begrüßte ihn, überhäufte ihn mit Segenswünschen, warf sich zu seinen Füßen, und küßte ehrerbietig den Unterteil seines Habits. Der Mönch ging durch den Haufen in einem feierlich langsamen Schritte mit kreuzweise auf die Brust gelegten Händen bis an die Tür, welche aus der Kirche zu seinem Kloster führte. Nachdem er über einige Stiegen hinaufgegangen war, kehrte er sich gegen die um, die ihm gefolgt waren, und sprach einige Worte des Danks und der Ermahnung. Hierbei ließ er, wie von ungefähr, den Rosenkranz aus seiner Hand fallen. Der Pöbel bemächtigte sich desselben, und jeder bemühete sich wenigstens eine Koralle davon zu erhalten, um sie wie eine prächtige Reliquie aufzuheben. Man würde sich vielleicht nicht mit mehr Lebhaftigkeit um den Rosenkranz des heiligen Dominicus selbst gezankt haben. Lächelnd über diesen Anblick erteilte ihnen der Mönch seinen Segen und verließ sie. Die tiefste Demut zeigte sich noch in diesem Augenblicke in allen seinen Zügen - war sie wohl auch in seinem Herzen?
Antonie folgte ihm, so weit sie konnte, mit ihren Augen. Es schien ihr, als sich die Pforte hinter ihm schloß, als verlöre sie mit seinem Anblicke einen wesentlichen Teil ihres Glücks, und ihre Augen netzten sich unwillkürlich mit Tränen.
„Vielleicht sehe ich ihn nie wieder“, sagte sie stille zu sich: „er lebt ja ganz von der Welt entfernt.“
Lorenzo bemerkte ihre Rührung, als sie sich mit dem Schnupftuche ihre Tränen abtrocknen wollte. „Sind Sie mit unserem Prediger zufrieden“, fragte er sie, „und billigen Sie die hohe Idee, die man sich von ihm in Madrid gemacht hat?“
Antoniens Herz war voll von Bewunderung dieses göttlichen Mannes, und nun erst war ihr Lorenzos Anrede angenehm, weil auch sie sich zum Reden gestimmt fühlte. „O“, sprach sie, ‚‚dieser Mann hat alle meine Hoffnungen übertroffen. Noch nie hatte ich eine Idee von der Allgewalt der Beredsamkeit; aber jetzt, da ich ihn gehört habe, hat er mir soviel Interesse, soviel Hochachtung, ich könnte sagen, soviel Zuneigung eingeflößt, daß ich selbst über die Lebhaftigkeit meiner Empfindungen erstaune.“
„Sie sind jung“, erwiderte Lorenzo; „natürlich mußte Ihr Herz diese ersten Eindrücke um so lebhafter empfinden. Einfach und ungekünstelt, wie Sie zu sein scheinen, ahnen sie keine Verstellung, und indem Sie die Welt nur durch das Prisma Ihrer Unschuld betrachten, scheint Ihnen alles, was Sie umgibt, achtenswert. Erwarten Sie aber immer, diese verführerischen Trugbilder einmal verschwinden zu sehen, und in jenen, die Sie zur Bewunderung dahinreißen, niedrige Gefühle zu entdecken, wohl gar Feinde in denen zu finden, in welchen Sie soviel Wohlwollen zu entdecken glauben.“
„Ach, Señor“, antwortete Antonie“, die Unglücksfälle meiner Eltern geben mir nur zuviel Beispiele von Falschheit und schändlicher Gewissenlosigkeit; indessen kann ich mich nicht überzeugen, daß ich den Zug von Sympathie gegen diesen Geistlichen, den ich so herzlich gern nähre, einmal bereuen sollte.“
„Auch ich nicht“, sprach Lorenzo. „Pater Ambrosios Ruf ist unbescholten. Überdies kann ja ein Mann, der sein ganzes Leben hindurch in Klostermauern eingesperrt ist, nicht einmal Böses tun, wenn er auch wollte. Doch kommt es darauf an, wie er jetzt die Probe aushält, da er, den Pflichten seines Standes gemäß, doch von Zeit zu Zeit seine heilige Einsamkeit verlassen, und die ihm bisher noch unbekannte Welt sehen muß.“
„O ich hoffe, daß er sie ehrenvoll aushalten wird.“
„Ich nicht minder, Mamsell! Wüßte der Geistliche von dem Interesse, das Sie an ihm nehmen, es würde ihm zur Anfeuerung seines Muts gereichen. Alles zeigt übrigens, daß er von der allgemeinen Regel eine Ausnahme macht, da es selbst der Neid nicht vermag, den Glanz seines Charakters zu trüben.“
„O wenn Sie wüßten, Señor, wie viel Freude mir diese Versicherung macht! Sie stärkt mich in dem Zutrauen, das ich bereits in ihn gesetzt habe, und ich werde meine Mutter zu bereden suchen, daß sie ihn zu unserem Beichtvater erwählt.“
„Zu unserem Beichtvater?“ fiel Leonelle ein. „Da bin ich nicht mit Akkords. Euer Pater Ambrosio ist zu finster. Wenn man ihn nur ansieht, so zittert man vom Kopf bis zu den Füßen. Ich könnte ihm jedesmal nur halb beichten, und lieber Himmel, was wäre das hernach für eine Beichte? Das Gemälde, das er uns von der Hölle machte, hat mir solchen Schauder erregt, daß ich noch nicht zu mir selbst kommen kann, und als er den Sündern den Text las, glaubte ich, er wollte uns alle fressen.“
„Sie haben Recht, Señora!“ erwiderte Don Christoval. „Übertreibung in Strenge ist Ambrosios einziger Fehler. Er soll bei der Verwaltung seiner Aufsicht über das Kloster gegen die anderen Mönche schon einige Proben von der Unbeugsamkeit seines Charakters zu erkennen gegeben haben. - Doch, das Volk zerstreuet sich. Mesdames, wollen Sie uns erlauben, Sie bis zu Ihrer Wohnung zu begleiten?“
„Lieber Himmel!“ rief Leonelle, indem sie sich rot zu werden bemühte, „um alles in der Welt möchte ich nicht, daß Sie sich soviel Mühe gäben. Auch ist meine Schwester so gewissenhaft, daß ich gewiß eine Stundenlänge Strafpredigt auszuhalten hätte, wenn sie uns in Begleitung von zwei unbekannten Kavalieren sähe. Ich muß Sie also bitten, Señor, daß Sie Ihre Bewerbung noch einige Zeit verschieben.“
„Meine Bewerbung? Ich versichre Sie, Señora - -“
„Ich will's wohl glauben, Señor, daß Ihre Zudringlichkeit aufrichtig ist, und ich kann mir Ihre Ungeduld lebhaft vorstellen. Aber in der Tat, ich muß Sie bitten, mir wenigstens einige Bedenkzeit zu lassen. Es würde von mir wenig Delikatesse zeigen, wenn ich so gerade bei der ersten Zusammenkunft Ihre Hand -“
„Auf mein Ehrenwort, Señora - -“
„Lassen Sie es als einen Beweis Ihrer Liebe gelten, Señor, daß Sie Ihre Zudringlichkeit herabstimmen! Morgen sollen Sie Nachricht von mir haben. Dies sei alles, was ich Ihnen heute versprechen kann. Leben Sie wohl. Dürfte ich noch, Señors, um Ihre Namen beim Abschiede bitten?“
„Mein Freund“, antwortete Lorenzo, „ist der Graf von Ossorio, und ich heiße Lorenzo von Medina.“
„Don Lorenzo, ich werde meine Schwester von Ihrem verbindlichen Antrage unterrichten, und Ihnen das Resultat von unserer Unterredung darüber wissen lassen. Wohin habe ich meinen Brief zu adressieren?“
„In den Medina'schen Palast.“
„Genug! Leben Sie wohl, Señors, und Sie, Herr Graf, mäßigen Sie das Feuer Ihrer Leidenschaft. Um Ihnen aber zu beweisen, daß sie mir nicht unangenehm ist, und daß ich Sie nicht verzweifeln zu lassen Willens bin, so nehmen Sie dies zum Zeichen meiner Zuneigung, und denken Sie zuweilen an Leonellen.“
Sie reichte ihm bei diesen Worten eine ausgetrocknete, zusammengeschrumpfte Hand hin, die Don Christoval mit solchem Widerwillen küßte, daß sich Lorenzo dabei kaum eines lauten Gelächters enthalten konnte. Leonelle verließ jetzt die Kirche eilig, und die liebenswürdige Antonie folgte ihr stillschweigend. Erst als sie am Portal war, fand sie sich wider Willen genötigt, sich noch einmal umzublicken und Lorenzo'n zu betrachten. Dieser hatte sie noch nicht aus dem Gesichte verloren, machte ihr eine Verbeugung, und gab ihr durch Gesten zu verstehen, wie sehr ihn die Trennung von ihr kränke: auch sie verbeugte sich, und eilte ihrer Tante nach.
„Da haben Sie mich in einen schönen Handel verwickelt“, sagte Don Christoval zu seinem Freunde, als sie allein waren. Um Ihre Absicht auf Antonien zu begünstigen, sage ich der Alten einige Schmeicheleien, und kaum geht eine Stunde vorbei, so bin ich schon dem Knoten des heiligen Ehestandes nahe. Wie werden Sie mir's vergelten, mein Lieber, was ich alles ertragen habe, um Ihnen gefällig zu sein? daß ich Ihnen zuliebe eine Hand dieser alten Hexe geküßt habe, die, Gott weiß nach welcher Küche, roch, und den Geruch auf mich fortgepflanzt hat? An meinen Lippen habe ich seit dem Kusse einen wahren Knoblauchsgeschmack. Im Prado würden sie mich nach meinem Geruche für einen spazierengehenden Eierkuchen halten.“
„Ich bekenne es, lieber Graf, daß Sie sich in einer gefährlichen Lage befunden haben; aber ich bin weit davon entfernt, zu glauben, daß sie unerträglich gewesen sei, und ich möchte Sie wohl bitten, daß Sie das Geschenk nicht vernachlässigen, welches Ihnen ein glückliches Ungefähr in die Hand spielen will.“
„Ein glückliches Ungefähr? So können Sie wohl von Ihrer kleinen Antonie sagen.“
„Nun wirklich, ich bin von ihrer Schönheit bezaubert. Mein Onkel, der Herzog von Medina, gibt mir's ohnehin seit dem Tode meines Vaters immer zu verstehen, daß er mich verheiratet zu sehen wünscht. Bis jetzt habe ich's immer vermieden, seinen Wunsch zu erfüllen, und mich gestellt, als ob ich ihn nicht verstände; aber seit ich dieses liebenswürdige Mädchen, gesehen habe - -“
„Wie, Lorenzo? Sie werden sich doch nicht so weit vergessen, die Enkelin des ehrbarsten Schusters in Cordua zu Ihrer Gemahlin machen zu wollen?“
„Vergessen Sie nicht, Christoval, daß sie auch die Enkelin des verstorbenen Marquis de las Cisternas ist. Doch ohne allen Streit über Geburt und Titel: noch nie habe ich soviel Anteil an einer Schönheit genommen - -“
„Wohl möglich! aber an eine Verbindung mit ihr können Sie doch nicht denken.“
„Und warum nicht, lieber Graf? Ich bin reich genug für sie und für mich, und Sie wissen, wie weit meines Onkels Denkart in diesem Punkt über die gemeine erhaben ist. Nach dem, was ich von Raymund de las Cisternas gesehen habe, bin ich überzeugt, daß er Antonien gern für seine Nichte erkennen wird: ihre Geburt kann also der Erfüllung meiner Wünsche zu keinem Hindernisse gereichen. Ohne einen Verstoß wider den Wohlstand, und ganz offen darf ich ihr daher meine Hand anbieten; und unter anderen Bedingungen mich um sie zu bewerben, ist mir unmöglich. Welches Glück, das man in der Ehe sucht, könnte sie mir nicht gewähren? Welche Eigenschaft, könnte ihr mangeln? Sie ist jung, sanft, liebenswürdig, empfindsam, und besitzt Verstand.“
„Wie wissen Sie das? Sie hat ja nichts als Ja und Nein gesprochen.“
„Das ist wahr: aber Sie werden doch auch bekennen müssen, daß sie ihr Ja und Nein immer am rechten Orte anbrachte? Und redet nicht alles an ihr? reden nicht ihre Augen, ihre Verwirrung, ihre Bescheidenheit, ihre Unschuld?“
„Nun, daran dachte ich nicht. Ich sehe wohl, baß Sie Recht haben. Doch das wird sich im Theater besser ausmachen lassen. Sie gehen doch mit? Dort können wir gemächlicher davon sprechen.“
„Heute ist mir's nicht möglich. Ich habe, seit ich hier bin, meine Schwester noch nicht gesprochen, und es ist doch schon der zweite Tag. Mich hat ohnehin nur die Neugierde hier herein getrieben, weil ich das Volk sich in die Kirche drängen sah; denn ich war im Begriff zu ihr zu gehen, und nun will ich meinen Vorsatz erfüllen. Das Kloster ist ja in der Nähe; ich werde also diesen Abend bei ihr im Sprechzimmer zubringen.“
„Hatte ich's doch ganz vergessen, daß Ihre Schwester im Kloster ist! - Die liebenswürdige Donna Agnes! Ich bin wirklich darüber erstaunt, Don Lorenzo, daß Sie daran Anteil nehmen konnten, daß ein so schönes Mädchen in die traurigen Mauern eines Klosters gesperrt wurde.“
„Ich, Don Christoval? Können Sie mich einer solchen Grausamkeit für schuldig halten? Sie müssen sich erinnern, daß sie freiwillig den Schleier nahm, und daß sie selbst, Gott weiß aus was für Grillen, sich von der Welt zu entfernen verlangte. Ich habe alles getan, um sie zu einer anderen Entschließung zu bringen; aber jeder Versuch scheiterte, und ich verlor meine Schwester.“
„Ei nun, Sie können sich immer über dieses Unglück trösten, Lorenzo! Wenn ich mich recht erinnere, so kam auf Donna Agnes ein Erbteil von zehntausend Piastern, wovon also die Hälfte Ihnen zufällt. Beim heiligen Jakob, ich wünschte mir fünfzig solche Schwestern, und aus Herzensgrund wollte ich um den Preis in ihren Verlust willigen.“
„Wie?“ erwiderte Lorenzo in einem Tone, welcher davon zeugte, daß er aufgebracht war; „könnten Sie mich wirklich für so niederträchtig halten, daß ich mir Einfluß auf die Entschließungen meiner Schwester zu machen gesucht hätte? Glauben Sie, daß die schändliche Absicht, mich zum Herrn ihres Erbteils zu machen - -“
„Leben Sie wohl, Don Lorenzo! Ein Wort hat Sie ganz in Feuer gebracht. Möge die liebenswürdige Antonie diese übertriebene Empfindlichkeit herabstimmen! sonst wäre es gerade nötig, daß man immer den Degen in der Hand hätte. Leben Sie wohl, mäßigen Sie Ihre Hitze, und erinnern Sie sich, daß Sie, wenn es darauf ankommt, Ihnen zu gefallen einem alten Weibe die Cour zu machen, auf meine Dienste rechnen können.“
Er hatte kaum ausgeredet, so eilte er zur Kirche hinaus.
„Wie übel der Mensch doch erzogen ist!“ sagte Lorenzo zu sich selbst. „Wie doch bei einem so guten Herzen, wie das seinige ist, so schiefe Urteile stattfinden können!“
Der Tag ging schon zu Ende: indes waren die Lampen der Kirche noch nicht angezündet. Kaum konnte der schwache Abendschein in das gotische Dunkel dieses großen und weiten Gebäudes dringen. Von seinen Gedanken dahingerissen, beschäftigt mit Antonien, deren Abwesenheit ihm schon peinlich war, und mit seiner Schwester, deren Opfer ihm jetzt nach Christovals Bemerkungen um so schmerzlicher fiel, übergab er sich einer Menge trauriger Ideen, welche die Ansicht der religiösen Gegenstände, von denen er umgeben war, noch vermehrte. An einen Pfeiler gelehnt, zog er mit einer Art von Wollust die frische Luft ein, welche zwischen den langen Kolonnaden kreiste. Bald darauf färbten die durch die Fenster dringenden Strahlen des Mondes die Gewölbe und die überaus großen Pilaster, welche die Kuppel unterstützten. Das tiefe Stillschweigen, welches hier herrschte, war etwa höchstens von dem Geräusch unterbrochen, welches manchmal das Zuschließen der Klosterpforte verursachte. Lorenzo setzte sich auf einen Stuhl, der neben ihm stand, und überließ sich seinen Träumereien. Antonie war der Hauptgegenstand seiner Gedanken: er dachte an die Hindernisse, die er vor der Vereinigung mit ihr finden würde, und an die Mittel, wodurch er dieselben besiegen könnte. Da er von Natur aus zur Melancholie geneigt war, so gewährte ihm selbst das Traurige dieser Betrachtungen einige Annehmlichkeit. Er schlief ein, und Träume, die aus seiner Lage entsprangen, stellten seiner Einbildungskraft die lebhaftesten Szenen dar.
Lorenzo träumte, daß er auf einmal an den Ort selbst gebracht würde, wo er sich jetzt wirklich befand, nämlich in die Dominicaner-Kirche, die ihm aber im Traume nicht so düster und einsam vorkam. Viele silberne Lampen erleuchteten den großen runden Platz vor dem Altar und die Seitenteile der Kirche, die zugleich die melodische Stimme der Orgel und religiöse Gesänge auf dem Chore erfüllten. Der Altar war, wie an hohen Festtagen, ausgeschmückt, und von schöngekleideten Personen umgeben. Antonie befand sich am Fuße des Altars in einem prächtigen Hochzeitkleide und mit allen Reizen jungfräulicher Bescheidenheit geschmückt.
Geteilt zwischen Hoffnung und Furcht sah Lorenzo diesem Schauspiele zu. Alsbald eröffnete sich die Tür, und er sah den Prediger, welchen er mit so vieler Bewunderung gehört hatte, mit einem Gefolge von Mönchen des nämlichen Ordens eintreten. Ambrosio nahte sich Antonien, und sagte: „Ich sehe ja Ihren Bräutigam nicht, wo ist er denn?“
Antonie sah sich in der ganzen Kirche umher. Lorenzo machte unwillkürlich einige Schritte vorwärts; sie bemerkte ihn, errötete, und gab ihm ein Zeichen sich zu nähern. Der junge Mann eilte, sich zu ihren Füßen zu werfen. Nachdem sie ihn einige Augenblicke betrachtet hatte, rief sie: „Ja, er ist's; dies ist mein bestimmter Gatte.“
Indem sie dies sagte, war sie bereit, sich in seine Arme zu werfen: aber ehe er sie noch umfassen konnte, stürzte sich ein Unbekannter zwischen sie. Seine Gestalt war riesenmäßig, seine Farbe gräßlich schwarz, seine Augen feurig und schrecklich; sein Mund spie Ströme von Feuer, und auf seiner Stirn stand mit lesbaren Zügen: „Hochmut, Geilheit, Unmenschlichkeit.“
Antonie stieß ein durchdringendes Geschrei aus. Das Ungeheuer nahm sie in seine Arme, sprang mit ihr um den Altar, und quälte sie mit verhaßten Liebkosungen. Umsonst suchte sie sich seinen Armen zu entwinden. Lorenzo flog zu ihrer Hilfe; aber im nämlichen Augenblicke ließ sich ein fürchterlicher Donnerschlag hören. Die Kirche wurde erschüttert; die Mönche flohen; die Lampen verlöschten; der Altar versank; an seiner Stelle, sah er einen Abgrund, aus dem sich Feuer und Rauch emporwirbelte. Das Ungeheuer stieß einen heftigen Schrei aus, stürzte sich hinein, und suchte das junge Mädchen nach sich zu ziehen; aber beseelt von übernatürlicher Stärke entriß sie sich seinen Armen, und ließ ihm ihr Hochzeitkleid. Eine glänzende Wolke erschien, und hob sie in die Höhe: sie streckte ihre Arme gegen Lorenzo'n aus, und rief: „Wir sehen uns, wieder; an einem anderen Orte sehen wir uns wieder.“ Die Kirche erschallte von tausend harmonischen Stimmen; die Wolke durchdrang das Gewölbe, und schwand gen Himmel.
Ermüdet von dem strengen Nachblicken, befand sich Lorenzo bei seinem Erwachen auf dem Pflaster der Kirche ausgestreckt. Die Lampen waren indes angezündet worden, und da er von weitem einige singende Stimmen der Mönche hörte, so hatte er anfangs Mühe, sich zu überzeugen, daß das, was er gesehen hatte, ein bloßer Traum war. Doch sah er, sobald er mehr zu sich kam, seinen Irrtum ein. Er merkte nun, daß die Lampen der Kirche während seines Schlafs angezündet worden sein müßten, und daß die Stimmen aus dem kleinen Chore von den Mönchen herhallten, welche ihr Offizium sangen.
Lorenzo machte sich nun auf, um ins Kloster zu seiner Schwester zu gehen; aber ehe er noch die Haupttür erreicht hatte, trat zu seinem Erstaunen ein in einen Mantel gewickelter Mann herein, der sich wie ein Dieb an der Mauer hinweg schlich, und mit aller Vorsicht nicht bemerkt zu werden, fortschleppte. Dies erregte Lorenzos Neugierde, und er verbarg sich hinter eine Säule, um zu bemerken, was der Unbekannte beginnen würde.
Dieser schlich sich immer auf den Zehen weiter fort. Endlich sah ihn Lorenzo einen Brief aus der Tasche ziehen, und mit vieler Eile an dem Piedestal einer kolossalischen, Bildsäule des heiligen Dominicus, die auf der einen Seite des freien Platzes vor dem Altare stand, niederlegen. Er ging ebenso eilig wieder zurück, um sich in einer ziemlichen Entfernung von der Bildsäule in einem dunkeln Winkel der Kirche zu verbergen.
Lorenzo sah wohl ein, daß die ganze Heimlichkeit eine Liebesintrige zum Grunde habe; und das den Liebenden mit seiner Gegenwart nicht gedient sein konnte, so wollte er sich wieder entfernen. Es schien aber im Buche des Schicksals geschrieben zu sein, daß er heute seine Schwester nicht sprechen sollte; denn eben ging er einige Stiegen an der Haupttüre hinunter, als jemand anderes heraufstieg und so heftig an ihn stieß, daß fast beide niedergefallen wären. Lorenzo griff nach seinem Degen und rief: „Herr, wer erlaubt Ihnen, so tölpelhaft auf mich zuzustoßen?“
„Sind Sie's, Medina?“ rief der andere, den Lorenzo bald an der Stimme für Don Christoval'n erkannte. „Seien Sie froh, daß Sie die Kirche noch nicht verlassen haben! Sie kommen, und wir werden sie sehen können.“
„Wen denn?“
„Die Gluckhenne und ihre Jungen, alles ist auf dem Wege. Kommen Sie nur wieder zurück! ich will's Ihnen hernach schon erklären.“
Sie gingen zurück, und verbargen sich geflissentlich hinter der Bildsäule des heiligen Dominicus.
„Darf man jetzt fragen“, fing Lorenzo an, „was Ihre Eilfertigkeit und Ihre Freude zu bedeuten haben?“
„Ein allerliebstes Abenteuer. Die Äbtissin von Sankt Clara ist mit ihrer ganzen Schar auf dem Wege hierher. Ich wurde noch zeitig genug von der Pförtnerin, bei der ich etwas gelte, davon benachrichtigt. Sie wissen, daß der Pater Ambrosio, dem Himmel sei dafür gedankt, ein Gelübde getan hat, nie aus dem Kloster zu gehen. Indessen wollen ihn alle Nonnen von Stande gern zum Beichtvater haben. Ist's ihnen aber um die Befriedigung dieses frommen Eigensinns zu tun, so müssen sie selbst hierher zu ihm kommen; denn will der Berg sich nicht dem Muhamet nähern, so muß Muhamet sich dem Berge nähern. Um aber den unbescheidenen Blicken der Neugierigen, wie ich und Sie sind, auszuweichen, so führt die Äbtissin von Sankt Clara ihre Schäfchen immer gegen die Nachtzeit hierher zur Beichte. Sie werden zu einer besonderen kleinen Pforte hereingelassen, die, uns gegenüber, in die Mutter-Gottes-Kapelle führt: von da gehen sie in eine andere Kapelle, worin Pater Ambrosios Beichtstuhl steht; und so können wir die schönsten Gesichtchen von Madrid bei ihrem Vorbeigehen betrachten.“
„Ich denke immer, wir werden nichts sehen, Christoval! Die Clarisserinnen sind ja immer verschleiert.“
„Aber doch nicht, wenn sie in die Kirche kommen, wo sie aus Ehrfurcht wegen der Heiligkeit des Orts den Schleier wegziehen müssen! Und die Kirche ist jetzt helle genug, um sie genau betrachten zu können. Sehen Sie, daß ich besser unterrichtet bin, als Sie! Stille, da sind sie! Nun können Sie sich selbst überzeugen.“
Lorenzo freute sich, daß er bei dieser Gelegenheit vielleicht entdecken könne, welches der Gegenstand der Wünsche des geheimnisvollen Fremden sei. Schon sah er die Äbtissin, welche beim Eintritte, nachdem sie ihren Schleier zurückgeworfen hatte, die Hände kreuzweise über die Brust schlug, auf die Bildsäule des heiligen Dominicus zugehen: ihr folgte eine lange Reihe von Nonnen, die ihrem Beispiele folgten. Beim Vorübergehen vor der Bildsäule machte sie eine tiefe Verbeugung, und ging dann der anderen Kapelle zu. Die Nonnen taten ein Gleiches. Schon waren die meisten vorbei, und Lorenzo glaubte seine Neugierde nicht befriedigt zu sehen, als eine junge Nonne, die sich in den letzteren Reihen befand, bei ihrer Verbeugung sich stellte, als ob ihr der Rosenkranz wider Willen auf die Erde fiele; und während sie ihn aufhob, zog sie mit vieler Behendigkeit den unter das Piedestal niedergelegten Brief mit in die Höhe, verbarg ihn in ihren Busen, und trat wieder in ihr voriges Glied.
„Ein herrliches Gesicht!“ zischelte Christoval: „aber ich wollte wetten, daß eine Liebesintrige hinter dem Fallen des Rosenkranzes stak.“
„Beim Himmel, das ist Agnes!“ rief Lorenzo.
„Wie? Ihre Schwester? Beim Teufel, die Sache wird wichtiger, als ich dachte!“
„Eine geheime Intrige mit meiner Schwester? Ich hoffe aber, es soll mir jetzt ein jemand auf der Stelle Rechenschaft darüber geben.“
Das Ehrgefühl der Spanier hat für eine Beleidigung dieser Art keine Nachsicht. Die Prozession war jetzt ganz in die Beicht-Kapelle gegangen, und der Unbekannte schlich sich aus seinem Winkel hervor, und eilte der Haupttüre zu: aber ehe er sie noch erreichte, fühlte er sich schon von Medina aufgehalten, der ihm auf den Fuß gefolgt war: er machte einen Tritt rückwärts, und drückte sich den Hut in die Augen.
„Ihre Mühe, mir zu entkommen, ist umsonst“, rief Lorenzo. „Ich muß wissen, wer Sie sind, und was in Ihrem Briefe enthalten war.“
„Mit welchem Recht machen Sie diese Fragen an mich?“ erwiderte der Unbekannte.
„Darüber sollen Sie ein anderesmal Rechenschaft erhalten. Jetzt beantworten Sie meine Fragen, oder machen Sie sich gefaßt - -“
„Das letzte, Señor! ich bin gefaßt.“
Beide hatten wirklich die Degen schon in der Hand, und Lorenzo ging auf den Unbekannten wütend los: aber Christoval, der kälteren Blutes war, stürzte sich zwischen beide, trennte sie voneinander, und rief: „Halten Sie ein, Medina! halten Sie ein! Wo denken Sie hin? Ist dies der Ort, einen Handel zu schlichten? Wollen Sie sich in einer Kirche duellieren?“
Der Unbekannte steckte seinen Degen wieder in die Scheide.
„Medina?“ sagte er mit einem Tone der Überraschung. „Großer Gott! ist's möglich? Haben Sie Raymund de las Cisternas ganz vergessen?“
Lorenzo war nicht weniger überrascht, und als er seinen Freund erkannt hatte, verweigerte er ihm noch den Handschlag. „Wie, Marquis?“ sprach er; „Sie in Madrid? Was soll das alles bedeuten? Und wie sind Sie in eine geheime Korrespondenz mit meiner Schwester verwikkelt, deren Zuneigung -?“
„Sich längst für mich erklärt hat“, unterbrach ihn Raymund. „Doch dieser Ort taugt nicht zu einer Behelligung. Kommen Sie mit, Lorenzo! Begleiten Sie mich in meine Wohnung: dort will ich Ihnen meine Abenteuer erzählen. Doch, wer ist der, welcher Sie begleitet?“
„Jemand, den Sie sich wohl anderwärts, als in der Kirche, gesehen zu haben erinnern werden“, antwortete Christoval.
„Sind Sie nicht der Graf Ossorio?“
„Ich bin's!“
„So können Sie uns begleiten, Don Christoval! Männern von solcher Verschwiegenheit nehme ich nicht Anstand mein Vertrauen zu schenken.“
„So günstig Ihre Meinung von mir auch ist, so mag ich mich doch nicht mit der Last Ihrer Geheimnisse beschweren. Gehen Sie mit Lorenzo'n ohne Anstand, wohin Sie wollen! ich werde ein Gleiches tun. Nur, sagen Sie mir vorher Ihre Wohnung.“
„Wie gewöhnlich, im Cisternas'schen Palast. Sie finden mich dort unter dem Namen Alphonse d' Alvarada, weil ich mich hier inkognito aufhalte.“
„Gut! Leben Sie wohl, Señors!“ - Christoval entfernte sich.
„Alphonso d' Alvarada?“ erwiderte Lorenzo erstaunt „Wie, Marquis? Sie haben diesen Namen angenommen?“
„Ja, Lorenzo! mit Recht mag Sie dies befremden, da Ihnen Ihre Schwester nichts von ihren und meinen Schicksalen vertraut zu haben scheint. Ich habe Ihnen also viel zu erzählen, das Sie noch mehr befremden wird. Lassen Sie uns gehen!“
Da die Nonnen wieder durch die kleine Pforte aus der Kirche gehen mußten, so schickte sich der Dominicaner-Pförtner an, die übrigen Kirchtüren zuzuschließen; Raymund und Lorenzo mußten also wohl die Kirche verlassen, und sie machten sich auf den Weg nach Cisternas Wohnung.
* * *
Zweiter Abschnitt
ALS Pater Ambrosio nach der Predigt zur Klosterpforte eingetreten war, begleiteten ihn die übrigen Geistlichen des Klosters, die ihn erwartet hatten, um ihm einige Komplimente wegen des erhaltenen Beifalls zu machen, bis an seine Zelle. Hier letzte er sich von ihnen mit dem Anstande eines Mannes, der sein Übergewicht fühlt; das ist: er gab sich den möglichsten Schein der Demut, durch die sein wesentlicher Hochmut lebhaft durchstach.
Kaum war er allein, so überließ er sich demselben ohne allen Rückhalt. Der Gedanke an das Entzücken, welches seine Predigt erregt hätte, schwellte seinen Busen, und seine Einbildungskraft malte ihm die glänzendsten Aussichten. Mit dem Blicke eines Siegers sah er um sich herum: seine Eitelkeit sagte ihm laut, daß er weit aber seine Mitbrüder und alle Menschen erhaben sei. „Welcher andere“, sprach er zu sich, „hat sich in seiner Jugend, wie ich, so einer strengen Probe unterworfen? Welcher andere hat sich so, wie ich, rein und unbefleckt erhalten? Welcher andere hat so, wie ich, über die mächtigsten Leidenschaften, über fast unwiderstehliche Triebe eines hitzigen und ungestümen Temperaments gesiegt? Welcher andere hat so, wie ich, den Mut gehabt, der Welt zu entsagen, und sich auf immer von ihr zu trennen? Ich konnte es, aber ich bin auch der einzige, der alles dies mit sich immer gleicher Entschlossenheit erreichte. Nein, noch kann sich die Kirche keines Ambrosio rühmen. Welchen tiefen Eindruck machte nicht heute meine Predigt auf die Anwesenden! Wie umzingelten sie mich, als ich die Kirche verließ! Wie überschütteten sie mich mit Lobeserhebung und Segnungen, indem sie mich die Hauptstütze, den Eckstein der Kirche nannten! Was bleibt mir nun noch übrig? Nichts, außer denn, ebenso gewissenhaft über andere, wie über mich selbst, zu wachen. - Sollte es aber nicht möglich sein, daß irgendeine mächtige Lockung mich von dem rechten Wege ableitete? Bin ich nicht ein Mensch, und als Mensch Fehlern und Schwachheiten unterworfen? - Nein, ich fühle mich stark, und kühn darf ich mich der Gefahr bloßgeben. Schon sehe ich die schönsten Frauenzimmer von Madrid zu meinem Beichtstuhle kommen: ich will meine Augen an ihren Anblick gewöhnen. Keine von ihnen hat so viele Reize für mich, als meine liebenswürdige Madonna.“
Während er dies sagte, warf er seine Blicke auf ein ihm gegenüber aufgehängtes, überaus schönes Marien-Bild, dessen Besitzer er seit zwei Jahren war, und welches den Gegenstand seiner täglichen andächtigen Verehrungen abgab. Er verweilte mit seinem Blick auf demselben, und betrachtete es mit süßer Rührung.
„Welche reizende Gesichtszüge!“ rief er; „Welche angenehme, unerreichbare Rundung in diesem Kopfe! Welche Sanftheit, aber auch welche Majestät in diesen göttlichen Augen! Wie diese niedliche Wange so weich auf ihrer Hand ruht! So frisch ist die Rose nicht. Ja, ihr Inkarnat ist weniger lebhaft, und die Weiße der Lilie kommt dieser schönen Hand nicht gleich. Freilich, Ambrosio, existierte das Original dieses Gemäldes in der Welt; existierte es für dich, dich allein, dürftest du mit deinen Fingern an diesen Goldlocken spielen, an deine Lippen diesen Schneebusen drücken - o wer könnte dann der Versuchung widerstehen? Ein einziger Kuß von diesem holdseligen Munde würde dreißig Jahre Höllenpein reichlich ersetzen; entreißen würdest du dich auf einmal - - Aber bin ich nicht wahnsinnig? Wohin reißt mich die andächtige Bewunderung dieses Gemäldes? Fort, fort, unreiner Gedanke! Ich habe auf zeitlebens dem weiblichen Geschlechte entsagt. - Und gab es wohl je eine Sterbliche, die diesem göttlichen Bildnisse glich? - O gäbe es auch eine, die Versuchung würde für eine Alltags-Tugend zu stark sein: aber Ambrosio fürchtet, sie nicht; seine Tugend würde Widerstand leisten. Versuchung? O auch diese hätte ich nicht zu fürchten. Nein, dieses Bildnis, das mich jetzt reizt, wenn ich es als ein idealisches, als ein übernatürliches Wesen betrachte, würde Ekel in mir erwecken, wenn ich seine Reize auf eine schwache Sünderin übergetragen sähe. Nicht weibliche Schönheit ist's, die mich in solches Entzücken versetzt, sondern die Geschicklichkeit des Malers, die ich bewundere; oder es ist vielmehr ein Engel, es ist die Gottheit selbst, die ich anbete. - Ist nicht alle Leidenschaft in meinem Busen erstorben? Habe ich mich nicht schon über alle menschliche Gebrechlichkeit hinausgesetzt? - Fürchte nichts, Ambrosio, und fasse Vertrauen auf die Stärke deiner Tugend! Mit mutigem Auge darfst du jedem, der sich dir nähert, ins Gesicht sehen. Frei von allen Schwächen und Lastern der Menschlichkeit kannst du selbst den Feinheiten der Geister der Finsternis Trotz bieten, und sie werden nichts wider dich vermögen.“
Eben pochte jemand leise an die Tür der Zelle, Ambrosio war zu tief mit seinen Ideen beschäftigt, als daß er hätte unterbrochen werden wollen: er antwortete nicht. Man klopfte noch einmal.
„Wer ist da?“ fragte er endlich.
„Rosario“, antwortete eine sanfte Stimme.
„Ach, sind Sie's? Herein, mein Sohn!“
Die Tür öffnete sich, und Rosario trat mit einem Körbchen in der Hand herein.
Rosario war ein junger Novize, welcher in drei Monaten Profeß machen sollte. Die Herkunft dieses jungen Mannes war in eine Art von Dunkelheit verwickelt, welche das Interesse für ihn erregte, aber auch die Neugier reizte. Sein Geschmack für das anschauliche Leben, seine tiefe Melancholie, seine Gewissenhaftigkeit in Erfüllung der Pflichten seines Standes, das freiwillige Opfer, welches er Gott mit seiner Freiheit und dem Anspruch auf eine ausgezeichnete Stelle in der Welt machte - alles trug dazu bei, ihm die Achtung und Zuneigung aller Klosterbrüder zu erwerben. Rosario schien zu befürchten, daß er vor Ablegung seines Gelübdes erkannt werden möchte; darum hüllte er stets seinen Kopf in die Kapuze, und ließ nur einen Teil seines Gesichts sehen: doch ließ sich von dem wenigen, was man sah, abnehmen, daß er von einer angenehmen Bildung sei. Rosario war der einzige Name, unter dem er im Kloster bekannt war. Niemand wußte etwas Gewisses von seinen Schicksalen vor dem Eintritte ins Kloster; und fragte man ihn darum, so beobachtete er ein tiefes Stillschweigen. Ein unbekannter Fremder, von dessen prächtiger Equipage man auf seinen hohen Stand geraten hatte, hatte ihn im Kloster vorgestellt, und die Mönche durch eine große Summe verpflichtet, ihn als Novizen anzunehmen; seitdem hatte man aber denselben nicht wieder gesehen.
Rosario mischte sich nicht in die Gesellschaft der übrigen Geistlichen: er beantwortete zwar ihre Fragen, aber mit Rückhalt, und zeigte, einen entschiedenen Hang zur Einsamkeit. Die Geistlichen, welche glaubten, daß irgend geheime Ursachen oder ein Familieninteresse den jungen Mann zur Wahl des Klosterlebens bestimmt haben, ließen ihm völlige Freiheit in seinem Geschmacke. Indessen schien es doch, als ob der Prior bei ihm eine Ausnahme machte. Stets nahte er sich Ambrosio'n mit der größten Ehrerbietung: er suchte sogar seine Gesellschaft, und verabsäumte nichts, wodurch er seine Zuneigung zu gewinnen glaubte. Ging er mit ihm um, so schien sich sein Herz zu erweitern, und über sein ganzes Wesen verbreitete sich eine sonst unbemerkte Heiterkeit. Auch Ambrosio fühlte sich zur Zuneigung für diesen liebenswürdigen jungen Mann hingezogen. Nur gegen ihn entäußerte er sich seiner gewöhnlichen Strenge, und er sprach mit ihm viel sanftmütiger, als mit den übrigen: manchmal machte er sich sogar ein Vergnügen daraus, sein Lehrer zu sein. Der junge Novize hörte seinem weisen Unterricht mit viel Gelehrigkeit zu, und jeden Tag fand Ambrosio mehr Vergnügen an der Lebhaftigkeit seines Geistes, an der edlen Einfalt in seinem Betragen und an seiner Aufrichtigkeit, so, daß er ihn endlich wie ein Vater seinen Sohn liebte.