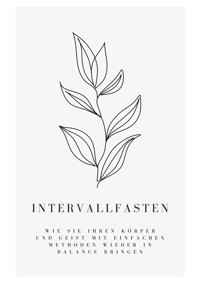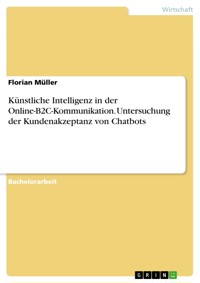19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: National Geographic Deutschland
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was als Backpacking-Trip in Istanbul beginnt, wandelt sich zur Abenteuerreise durch den Orient: Vier Monate lang reiste Florian Müller durch den Nahen und Mittleren Osten, schlich sich in den Iran ein und erlebte als einer der ersten Touristen Saudi-Arabiens Lebensfreude und Gastfreundschaft. Er trank Tee mit den Taliban in der gefährlichsten Stadt der Welt und lernte, dass das Glück nicht immer dort ist, wo man es vermutet. Weil das Beste am Reisen die intensiven Begegnungen mit den Menschen vor Ort sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ehrfürchtig vor der märchenhaften Fassade der Masdsched-e Emãm Moschee in Isfahan. Nur ein Beispiel der eindrucksvollen Architektur im Iran.
Inhalt
Prolog
Türkei
Ankunft im Orient
Istanbul. Das Tor in den Osten
Auf den Spuren von Mohammed in Selçuk
Kappadokien und türkischer Fußball
Tinder auf Muslimisch
Iran
Eminem, Joints und das verbotene Silvester in Teheran
Tarof, Falafel und die USA
Kriegsangst in Isfahan
Ein Treffen von fremden Freunden in Shiraz
Zwischenstopp mit Sorge in Bandar Abbas
Für Frauen, Freiheit und das Recht
Kerman und einer der gefährlichsten Männer der Welt
Saudi-Arabien
Mit Kamera im Wüstenstaat
Dschidda und der Bachelor
Ein Fußballstar auf Abwegen in Medina
Ein Trip in die Wüste
»Model für Anfänger« in Riad
Hochzeit wider Willen
Pakistan
Islamabad: Hauptstadt nach Plan
Tee trinken bei den Taliban
Zu Besuch bei einer pakistanischen Familie in Peshawar
Stadttour mit einem Einheimischen
Abhängen mit Adam
Islamabad und der Weg nach Hause
Epilog
Karte
Prolog
Prolog
Mein Herz pumpt, als uns die Soldaten plötzlich mit erhobenen Waffen befehlen, aus dem Auto zu steigen. Wir stellen uns in eine Reihe mit anderen Reisenden, die kontrolliert werden.
»Siehst du andere Touristen?«, frage ich Jacob, der sich daraufhin zu unserem Nachbarn beugt. »Pakistan?«, fragt er, woraufhin dieser den Kopf schüttelt. Unter den grimmigen Blicken der pakistanischen Soldaten traut sich niemand, aufzublicken, um nicht verdächtig zu wirken. Jacob hingegen lächelt seinen Nachbarn aufmunternd an, bis dieser schließlich vorsichtig antwortet.
»Afghanistan«, erwidert der junge Mann. Mein Mitreisender beugt sich jetzt verschwörerisch zu ihm. »Ah, Afghanistan«, sagt er interessiert. »Taliban?«
Mein Herz rutscht mir in die Hose. Ich sehe, wie sich einer der Soldaten zu einem Kameraden beugt und auf uns deutet. Mir wird übel. »Oh Mann, Jacob«, stöhne ich leise, »wehe wir kommen deswegen in den Knast.« Unser Nebenmann scheint ebenfalls Sorgen zu haben. Entgeistert reißt er die Augen auf und beginnt panisch mit den Armen zu rudern. »No, no, no, no Taliban«, sagt er hektisch im Flüsterton und auch unser Fahrer, der unbehelligt in Sichtweite im Auto sitzt, blickt sorgenvoll in Richtung des Soldaten, der jetzt in unsere Richtung marschiert. »Der hat das sicher nicht gehört«, erwidert Jacob betont locker, aber sein demonstratives Lächeln erscheint plötzlich nicht mehr so überzeugend.
»Passports«, adressiert uns der Soldat, als er uns erreicht hat. Etwas zittrig und käseweiß reicht ihm unser Nebenmann einen ausgeblichenen Lappen, den er kurz darauf wieder zurückbekommt und von dannen zieht. Jacob formt noch »sorry« mit den Lippen, aber der Mann ist einfach nur froh, dass er unbehelligt weiterfahren darf. Wir dagegen haben offenbar die Aufmerksamkeit des Militärs errungen. »You, journalists?«, fragt er mit Blick auf Jacobs Kameras.
»Touristen«, erwidern wir, woraufhin er einen ungläubigen Laut ausstößt.
»Tourists?«, presst er hervor und mustert uns von oben bis unten. »Tourists?!«, stößt er noch mal ungläubig hervor und blickt dann verwirrt in Richtung der Straßenabsperrung.
»Wait«, sagt er und geht schnellen Schrittes zu einem anderen Soldaten am Grenzposten, der offenbar sein Vorgesetzter ist. Die beiden Männer diskutieren kurz und heftig, blicken mit verschlossenen Mienen in unsere Richtung, ehe sie auf uns zukommen. Der zweite Soldat, ein Offizier mit beeindruckender Bandschnalle, hält sein Gewehr fest im Anschlag, als er sich vor uns aufbaut.
»You are journalists?«, fragt er ruppig, ohne uns zu begrüßen. Wir schütteln beide den Kopf.
»Tourists«, sagen wir einstimmig und ich setze meinen besten ›braver-Junge‹-Gesichtsausdruck auf, den ich aufbieten kann.
»Touristen, das kann nicht sein. Habt ihr ID?«, fragt der Offizier weiter auf Englisch. Wir reichen ihm unseren Pass, aber er schüttelt heftig den Kopf. »Nein, ID vom Hotel«, sagt er und klopft ungeduldig mit dem Fuß. Ich merke, wie ich allmählich etwas unruhig werde. Es scheint offenbar ein ernsthaftes Problem mit Touristen zu geben. Auch Jacob, der eigentlich in jeder Situation die Ruhe weg hat, zieht eine tiefe Sorgenfalte auf der Stirn.
»Haben wir irgendwas?«, frage ich Jacob, der ebenfalls ratlos mit den Schultern zuckt. Sein Blick streift die bewaffneten Soldaten, die uns argwöhnisch fixieren, und er beugt sich verschwörerisch zu mir. »Flo, du bist doch gegen Entführungen versichert, oder?«, fragt er dann leise. Als ich schockiert den Kopf schüttele, klopft er mir aufbauend auf die Schulter.
Wenn das ein Scherz war, denke ich, dann hat er ein ganzes Büschel grauer Haare gekostet. Hätte mir jemand vor ein paar Monaten gesagt, eine Versicherung gegen Entführungen wäre auf meiner Reise nötig, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber was wusste ich damals schon. Als ich in der Türkei losgereist bin, war alles noch in Ordnung. Damals hatte ich noch einen Plan, wohin es gehen sollte. Heute dagegen ist jeder Tag aufs Neue ein Abenteuer.
Türkei
Kebab und traditionelles Gemüse. Bei diesem leckeren Abendessen darf eines nicht fehlen: der berühmte türkische Schnaps Raki.
Ankunft im Orient
November 2018
»Leute, ich habe mich verliebt. Sie ist die Frau meines Lebens und ich werde sie heiraten.«
Zum dritten Mal betrachte ich nun den Chatverlauf und brüte darüber, was eigentlich schiefgelaufen ist. Vor exakt zwei Jahren ist das gewesen, als ich ziemlich euphorisch in den Gruppenchat meiner Freunde geschrieben habe. Dem ewigen Gedächtnis des Messengers sei Dank durfte ich zufällig auf der Suche nach alten Fotos über die Nachricht stolpern. Und seitdem verbringe ich den Flug in mein neues Leben damit, über mein altes Leben nachzudenken. Es ist viel passiert im vergangenen Jahr. Aber wenn alles so gelaufen wäre, wie ich es in dem Chat prophezeit habe, dann würde ich jetzt neben einer hübschen blonden Frau mit strahlend blauen Augen, mystischer Aura und mit einem bezaubernden Namen sitzen. Außerdem hätte ich einen Job, der mich glücklich machen würde und ein Leben, das ich gerne leben würde. Wir würden gemeinsam in die Türkei fliegen, Urlaub oder Flitterwochen machen, Reisen und Dinge unternehmen, die uns beiden Spaß machen. Aber daraus ist nichts geworden. Meinen Job habe ich gekündigt, meine Freundin hat mich verlassen und statt einer schönen Frau sitzt neben mir ein übergewichtiger Araber, mit dem ich mir seit eineinhalb Stunden meinen Sitz teile. Auch bin ich nicht auf dem Weg in den Urlaub oder zu einem neuen Job – sondern ich wage den verzweifelten Versuch, meinem bisherigen Leben zu entkommen.
»Please fasten your seatbelts, we will shortly arrive at Istanbul Airport.«
Die monoton freundliche Stimme des Stewards im Lautsprecher des kleinen Fliegers der Turkish Airlines reißt mich aus meinen Gedanken. Ich blicke aus dem Fenster und unter mir breitet sich das Tor in den Osten aus, durch das ich in Kürze gehen werde. Ich fühle mich plötzlich wie eine Ameise, die vom Weg ihrer Artgenossen abgekommen ist und sich alleine in der gigantischen Welt zurechtfinden muss. Die Ausmaße Istanbuls schüchtern mich von oben derartig ein, dass ich tiefer in meine Selbstzweifel sinke. Noch könnte ich zwei Wochen Urlaub machen und mir dann einen neuen Job suchen.
Es ist nicht so, dass mein Leben besonders tragisch verlaufen wäre. Meine Eltern haben mich wohlbehütet aufgezogen und mir alles gegeben, was ich brauchte und wollte. Sie würden alles tun, um mich vor den Übeln der Welt zu beschützen. Egal, wie alt ich bin. Es ist also kein Familienclan hinter mir her, der mich zwingt auszuwandern – im Gegenteil, meine Eltern hätten mich am liebsten in Deutschland behalten. Auch bin ich nicht auf der Flucht vor meinen Gläubigern oder habe jüngst den Staat um Milliarden betrogen, indem ich mir für meinen insolventen Zahlungsdienst haushohe Investitionszuschüsse erschlichen habe. Nein, mein Leben ist nicht das eines Geheimagenten, der durch die Welt reist und aufregende Sachen erlebt, über die man Filme drehen und Bücher schreiben kann. Ich bin ein ziemlich normaler Typ, den man wie tausend andere auf der Straße trifft und sich nichts dabei denkt. Ich bin dafür gemacht worden, meine Tage zwischen 9 und 17 Uhr in einem Großraumbüro zu verbringen, mit den Kollegen über Fußball zu quatschen und über den Chef zu scherzen, am Abend mit der Freundin Netflix zu gucken, irgendwann zu heiraten, zwei Kinder zu bekommen und auf die nächste Beförderung zu hoffen. Zwischenzeitlich würde ich den Arbeitgeber wechseln, aber im Grunde bliebe alles gleich. Ohne Risiko und mit einer gesunden Balance an Beständigkeit und Abwechslung könnte ich durch das Leben gehen. Bislang lief alles, was ich getan habe, auf dieses Szenario raus. Ich habe sämtliche Stationen auf dem Weg dorthin abgehakt: Abitur – Studium – Arbeit – Frau. Naja, das mit der Frau hat noch nicht geklappt. Im Grunde ist alles optimal in meinem Leben. Aber jetzt, kurz vor meinem dreißigsten Geburtstag, stellt sich mir erstmals die Frage: Ist es das, was mich wirklich glücklich macht?
Das Deprimierende daran ist nicht, dass ich mir diese Fragen stelle. Sondern, dass ich sie mir nach dreißig Jahren meines Lebens immer noch nicht beantworten kann.
Die Landebahn unter mir kommt unaufhaltsam näher und es fühlt sich für einen Moment so an, als würde ich nicht nur auf festem Untergrund landen, sondern auch auf dem Boden der Tatsachen. Ich hole den kleinen Rucksack unter meinem Sitz hervor und sortiere all meine Sachen. Smartphone, Handstativ, Mikrofon, Laptop, Ladegeräte – alles da, was ich für mein Vorhaben brauche. Ich verdränge all die Gedanken, die mich in die Vergangenheit zurückreißen und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Denn sie wird kein leichtes Unterfangen, diese Reise. Aber wenn alles gut geht, dann bin ich danach dort, wo ich hinmöchte – bei mir selbst.
Istanbul. Das Tor in den Osten
Das ungewöhnlich warme Novemberwetter lässt sommerliche Gefühle in mir aufkommen und ich spüre, wie das aufkeimende Abenteuer den Tatendrang in mir weckt. Sightseeing in Istanbul ist angesagt: Vor mir kündigt der Aufgang zu einer riesigen Brücke den gigantischen Bosporus an und dahinter erahne ich die größte der Sehenswürdigkeiten Istanbuls: die Hagia Sophia im Ensemble mit der Blauen Moschee. Auf halbem Weg über die riesige Brücke, die die gigantische Meerenge überquert, fasse ich mir ein Herz. »Entschuldigung«, sage ich auf Türkisch zu einem vorbeigehenden älteren Mann und gestikuliere zu meiner Kamera. »Könnten Sie ein Foto machen? «, frage ich dann auf Englisch. Auch wenn er nicht so wirkt, als ob er ein Wort verstehen würde, weiß er, was zu tun ist. »Mit dem Bosporus im Hintergrund bitte«.
Irritiert blickt er mich an. »Junger Mann, das ist nicht der Bosporus«, erklärt er mit leichtem Akzent und zeigt mir dann freundlich lächelnd die eigentliche Meerenge. Er drückt mir meine Kamera in die Hand und klopft mir aufbauend die Schulter, während ich vor Scham im Boden versinke. Was ich fälschlicherweise für einen Hafen gehalten habe, stellt sich als die trennende Meerenge zwischen dem europäischen und dem asiatischen Kontinent heraus. Vor mir erstreckt sich eine Wasserstraße, die mehr an eine Autobahn erinnert, als an ein beschauliches Stück Meer, nur mit Booten statt mit Autos. Unzählige Schiffe, Segelboote, Frachter und Fähren kreuzen und queren das Gewässer und es gleicht einem Wunder, dass keines der Boote kollidiert. Unsicher lächelnd blicke ich meinem Aufklärer hinterher und nehme mir fest vor, weniger selbstgefällig zu sein. Das hier ist ein fremdes Land und auch wenn die Türkei nicht weit weg zu sein scheint, so habe ich doch keine Ahnung von ihr. Ich lasse am besten alles unvoreingenommen auf mich zukommen.
Reumütig krame ich mein Smartphone mit der Lonely Planet-App hervor und scrolle diesmal dahin, wo man als Neuling beginnen sollte: an den Anfang.
Es stellt sich heraus, dass ich mich auf der Galatabrücke befinde, die den hippen Stadtteil Karaköy mit dem historischen Stadtteil Eminönü verbindet. Beide sind noch Teil des europäischen Kontinents, wie ich der Stadtkarte in meinem Reiseführer entnehmen darf. Auf der Brücke überquert man das Goldene Horn, das nicht etwa ein Gasthaus aus einem Fantasyroman, sondern ein gigantischer Nebenarm des Bosporus ist. Der Bosporus trennt Europa von Asien und verbindet das mir bis dahin völlig unbekannte Marmarameer mit dem Schwarzen Meer. Die Meerenge, die Istanbul umschließt, gestaltet sich damit als eine der wichtigsten Wasserstraßen im gesamten eurasischen Raum. Als verkappter Betriebswirt brauche ich nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu begreifen, welche geo-wirtschaftliche Bedeutung dem vor mir liegenden Verbindungskanal zukommt: Sämtliche Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres lassen große Teile ihres globalen Schiffshandels durch das Nadelöhr bei Istanbul laufen, darunter auch Russland und die Ukraine. Ganz abgesehen von dem Handelsvolumen, das tagtäglich diese Wasserstraße bewältigt, dämmert mir allmählich die politische Bedeutung, die der Stadt Istanbul damit zukommt – und in ihrer Geschichte schon immer zukam. Auch heute noch macht der Bosporus einen Teil von Istanbuls Anziehungskraft als Weltstadt aus.
Es dauert einige Zeit, bis ich mein Ziel erreiche. Auf dem Weg durch die Altstadt wird mir immer deutlicher bewusst, welche immensen Ausmaße die Stadt einnimmt. Allein der Weg vom Goldenen Horn bis zum Gülhane-Park dauert fast fünfzehn Minuten zu Fuß und nimmt nicht einmal einen Fingerbreit auf der Stadtkarte ein. Ohne öffentliche Verkehrsmittel werde ich sicherlich nicht auskommen, wenn ich die Stadt bis ins letzte Detail erkunden möchte. In deutscher Manier habe ich mir für die Zeit in Istanbul einen Plan gemacht, den es abzuarbeiten gilt: Museen, Moscheen, berühmte Plätze und Gebäude warten nur darauf, sich meiner Neugier zu beugen.
Die Hagia Sophia ist der Champion unter den Sightseeing-Spots: Museum, Moschee und Kirche zugleich. In der Touristenbibel ist das die heilige Dreifaltigkeit in Gebäudeform. Dementsprechend wenig überrascht bin ich, als schon auf dem Weg zu der Moschee zahlreiche Reisebusse Ströme an Touristen ausspucken, die mir den Weg planieren. Ich möchte gar nicht wissen, welche Massen hier im Sommer unterwegs sind, denke ich, während ich einer aufgeregten Gruppe asiatischer Touristen ausweiche.
Der große Basar Istanbul macht seinem Namen alle Ehre: Gleich mehrfach muss ich nach dem Weg fragen. Unten: Auf dem Gewürzbasar erfahre ich Gerüche wie nie zuvor. Der verkaufstüchtige Standinhaber gibt mir zudem einen Geschmackseindruck seiner eigenen Çay-Mischung.
Der Galataturm, einer der vielen Klassiker unter den Sehenswürdigkeiten von Istanbul
Nach ein paar weiteren Minuten Fußweg baut sich das gigantische Gebäude mit seinen vier Minaretten und den ineinander verschlungenen Kuppeln vor mir auf. Ich begreife sofort, weshalb die einstige Kirche die Touristenattraktion schlechthin ist. Die Hagia Sophia ist 1500 Jahre alt und gehört zu den frühesten Symbolen des christlichen Kaisertums. Sie übersteigt die Ausmaße jedes christlichen Doms, den ich bislang besucht habe und als ich nachlese, dass sie in nur fünf Jahren gebaut wurde, bin ich vollends überwältigt. Es dauerte über 650 Jahre, bis der Kölner Dom fertiggestellt war, und für diese Riesenanlange vor mir brauchte man nur fünf?
Die Hagia Sophia kann ich auf meiner To-do-Liste abhaken und mich der nächsten Sehenswürdigkeit zuwenden – die glücklicherweise nicht weit weg ist. Die Blaue Moschee befindet sich nämlich direkt gegenüber, keine fünfhundert Meter entfernt. Das Ensemble prägt damit das Antlitz der europäischen Bosporusseite. Gespannt auf die Unterschiede zwischen Moschee und Moschee-Kirche-Museum gehe ich quer über den Platz und staune bei dem Anblick: Die beiden Gebäude sind sich so ähnlich, dass ich keinen Unterschied erkenne.
Irritiert blicke ich mich um. In der Nähe steht eine Gruppe Reisender, die aufgeregt erst die Hagia Sophia und dann die Blaue Moschee knipsen, während der Guide in gelangweiltem Englisch ein paar Fakten über die Gebäude von sich gibt.
»… ist die Sultan-Ahmed-Moschee die Hauptmoschee von Istanbul. Ihr Erscheinungsbild ist angelehnt an die Architektur der Ayasofya, die das Bild unserer Gotteshäuser mit der Eroberung Konstantinopels stark geprägt hat. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, sind die sechs Minarette außergewöhnlich viele, einzigartig in der Türkei …«
Stolz, wieder etwas gelernt zu haben, halte ich inne und lasse mich auf einer der Sitzbänke neben mir nieder. Eine richtige Brotzeit habe ich zwar nicht, aber ein paar Kleinigkeiten nehme ich immer für den Hunger zwischendurch mit.
»Wuff«, höre ich neben mir, als ich in meinen Müsliriegel beißen möchte.
»Na sowas, hast du Hunger? «, frage ich den Streuner, der langsam in meine Richtung schlendert. Interessiert schnuppert der Mischling an mir und entscheidet dann, dass ich zwar nicht essbar bin, aber scheinbar als angemessene Gesellschaft tauge. Gemächlich lässt er sich auf der Sitzbank nieder zum Nickerchen.
Eigentlich hat er recht, denke ich mir. Das Ziel meiner Reise sollte es sein, die Orte »zwischendrin« zu finden. Jene Plätze, an denen ich nicht ständig etwas suchen und erleben muss, sondern einfach den Moment genießen kann. Der Streuner neben mir hat das besser begriffen als ich. Innerlich gehe ich die Liste an Sehenswürdigkeiten durch – die, die ich noch vor mir habe, und die, die ich schon gesehen habe – und merke, dass ich bisher nur gehetzt war und keinen Moment Ruhe hatte. Ich war auf der Suche nach etwas Besonderem – und ja, ich habe auch Besonderes gefunden. Die Moscheen, die Museen, die Brücken – all das ist sehr beeindruckend und ohne Frage lohnt es sich, nur deshalb hierher zu fahren. Aber ist es das, was ich will?
Aus der Entfernung sehe ich, wie die Reisegruppe wieder in ihren Bus hetzt, um zur nächsten Station zu fahren. Einer der Mitreisenden fängt an, heftig mit dem Guide zu diskutieren und wedelt ständig in Richtung Hagia Sophia. Anscheinend war ihm der Besuch zu kurz. Die Übrigen verschwinden jedoch schnell im Bus wie in einer Höhle und schließlich zuckt der Guide nur mit den Schultern und lässt den Mann stehen. Ich könnte es ja machen wie die, denke ich. Jemandem Geld geben, dass er mir die großen Kulturschauplätze der Türkei zeigt, mir ein paar Sachen dazu erzählt und am Abend ein Essen und einen Platz zu schlafen organisiert. Oder ich versuche mich von meinen Zwängen loszureißen, einfach weniger Deutsch zu sein. Keine Liste, kein Plan, kein Zeitdruck. »Ich bin Reisender«, sage ich zu mir und in diesem Moment werfe ich meinen kompletten Plan über den Haufen. Ab jetzt fahre ich an die Orte, auf die ich Lust habe. Vielleicht finde ich ja ein paar Einheimische, die mir Tipps geben können.
Die Lonely Planet-App stecke ich weg und nehme mir vor, die Stadt noch mal neu zu erkunden – und zwar aus meinem ganz eigenen Blickwinkel. Ich mache es so, wie mein neuer Freund, der Streuner. Als ich aufstehe, lässt er sich über den Kopf streicheln und weint mir keine Träne hinterher: Ich war für einen Moment in seinem Leben, im nächsten bin ich wieder weg. Wie ein Wanderer, der die Dinge so nimmt, wie sie kommen. Mal sehen, was mich noch alles erwartet.
Auf den Spuren von Mohammed in Selçuk
Ehe ich aufbrach, hatte ich mir das Reisen in der Türkei etwa so vorgestellt: Ein klappriger alter Van würde mich bis vor die Grenzen der Stadt Istanbul bringen. »Von hier an musst du allein weiterkommen«, hätte der junge Mann in weißen Roben gesagt, während die Türen knallen und sein Motor aufheult. Verzweifelt hätte ich mich umgesehen und mir wäre nichts anderes übrig geblieben, als den holprigen Feldweg, auf dem ich abgeladen wurde, weiter entlangzulaufen.
»Selçuk?«, frage ich vorsichtig am Schalter des Busbahnhofs und der Herr hinter dem Tresen lächelt mich freundlich an. »Morgen früh fährt ein Bus, den können Sie nehmen. Die Fahrt dauert etwa sieben Stunden mit Zwischenstopp«, erwidert er und druckt mir das Ticket aus. »Wo genau fährt der Bus ab?«, frage ich und der Servicemitarbeiter deutet auf die entsprechende Nummer am Ticket. »Sie fahren mit so einem«, fügt er an und nickt zu einem weißen Reisebus, der gerade abfährt.
Ich bin immer wieder davon überrascht, wie sehr Vorurteile in meiner Fantasie Gestalt annehmen – die Türkei ist ein hochmodernes Land mit einer ähnlichen Infrastruktur wie Deutschland. Dementsprechend modern ist auch der Bus, in dem ich fahren darf. Polstersessel mit viel Platz und einer absolut luxuriösen Ausstattung sind praktisch Standard. Trotzdem war ich bis zuletzt davon überzeugt, dass ich über rumplige Wege trampen müsse – natürlich völliger Blödsinn. Selbst die Plätze im Bus sind für jeden einzelnen Passagier reserviert, sodass es zu keinem Gezanke kommen kann.
»Was für ein komischer Zufall, dass alle Frauen auf einer und die Männer auf der anderen Seite sitzen oder nicht?«, adressiere ich naiv lächelnd an meinen Sitznachbarn, kurz nachdem wir losgefahren sind. Der junge Mann, sicherlich nicht älter als zwanzig Jahre, blickt mich mit seinen scheuen Rehaugen an und schüttelt ängstlich den Kopf. »Englisch?«, frage ich, woraufhin er erneut fast schon traurig mit dem Kopf schüttelt. Okay, alles klar, denke ich. Für die nächste halbe Stunde versuchen wir es mit Zeichensprache, wobei das einzig verwertbare, das ich aus ihm herausbekomme, ist, dass er auf dem Weg nach Hause ist. Ich merke schnell, dass mein Sitznachbar nicht der Einzige ist, der kein Englisch spricht. Je mehr sich die Landschaft verändert und wir weiter ins Landesinnere vordringen, mit seinen Hügeln und Tälern, desto mehr wird mir klar, dass Istanbul eine internationale Metropole ist. Die ländliche Gegend erscheint mir deutlich weiter weg von der westlich geprägten Wirklichkeit der Stadt am Bosporus. Vor dem Busfenster zieht die Landschaft vorbei, die sich allmählich vom saftigen Grün mittlerer Breiten zum mediterranen Oliv wandelt.
Ephesus, nahe der heutigen Stadt Selçuk: Die Celsus-Bibliothek ist eine der besterhaltenen Bibliotheken der Antike.
Bei Ankunft in meinem Hostel kann ich zwei Dinge kaum erwarten: erstens, mich ins WLAN einzuloggen, zweitens, neue Leute kennenzulernen. Am besten Einheimische, aber zumindest ein paar Reisende.
»Hier ist das Passwort«, sagt der Rezeptionist und drückt mir eine kleine Karte in die Hand. »Teşekkür ederim«, erwidere ich und deute auf das leere Foyer. »Gibt es keine anderen Gäste als mich?«
Der Mann mittleren Alters schüttelt den Kopf. »Nichts los, momentan. Sie sind unser einziger Gast.«
»Oh, okay«. Klar, ich hatte ja schon gehört, dass Selçuk etwas verschlafen ist. Aber so? Am selben Abend entschließe ich mich, etwas durch die Straßen zu ziehen und herauszufinden, ob der Eindruck aus dem Hostel für die ganze Stadt gilt. Jetzt könnte ich natürlich die großen Straßenzüge suchen und die vielen Sehenswürdigkeiten. Aber ehrlich gesagt … Nein.
Ich finde einen Imbiss in der Ortsmitte. Bemerkenswert ist, dass ich den ganzen Abend keine Menschenseele treffe. Niemanden. Schade, eigentlich. Ich hole mir ein Börek und setze mich auf eine der Bänke im Central Park Selçuk. Im Grunde nur eine begrünte Straßenkreuzung, denke ich, und kann meine Enttäuschung nicht verbergen. Es kann hart sein, wenn man alleine unterwegs ist, denn gelegentlich wäre etwas Ablenkung von mir selbst ganz angenehm. Nicht, dass ich nicht gerne alleine bin. Aber manchmal fühlt man sich eben doch etwas einsam, wenn man auf Reisen ist.
Aus meinem kleinen Tagesrucksack krame ich mein Reisetagebuch, in das ich immer dann reinschreibe, wenn ich unterwegs einen freien Moment habe, und ich beginne darin zu blättern. Seit meiner Ankunft in Istanbul ist kaum mehr eine Seite entstanden und mich packt gleich ein schlechtes Gewissen. »Selçuk« schreibe ich schwungvoll als Überschrift und überlege mir, was ich von meinen Gedanken festhalten möchte.
»Selâmün aleyküm, Freund«, höre ich jemanden neben mir sprechen. Zwei junge Männer, etwa in meinem Alter, sind unbemerkt neben mir aufgetaucht. Einer von ihnen, der ein Buch unter seinem Arm geklemmt hat, deutet auf die Sitzbank und sagt etwas auf Türkisch.
»Sorry«, erwidere ich, »nur Englisch.«
»Ah«, sagt er. »American?«
»German«.
Der Zweite der beiden fängt plötzlich an zu lachen. »Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im November mitten in Selçuk einen Deutschen trifft?«, fragt er und ich verstehe jedes Wort – er spricht nämlich fließend Deutsch.